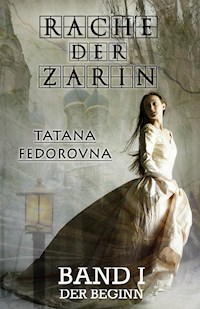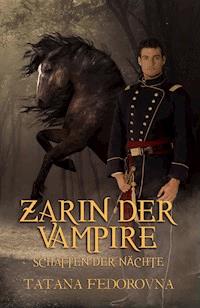Zarin der Vampire - Die Gesamtausgabe: Russland und selbst der Zar können fallen, doch das Haus Romanow ist unsterblich E-Book
Tatana Fedorovna
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Neuauflage 2017: +++ erstmals als Gesamtausgabe +++ Sehnsucht + Rache + wahre Geschichte + sündige Begierde + bisher unveröffentlichte Szenen +++ Oberst Tarpen von Radewitz beschützt und umwirbt Olga, die Lieblingstochter des letzten Zaren. Er kennt weder ihre wahre Herkunft noch ihr dunkles Geheimnis. Diese dürstet vor allem nach bitterer Rache für den Mord an ihrer Familie. Sie kommt dabei ihrem Hauptfeind immer näher, doch auch der versucht ihrer habhaft zu werden. Hat Liebe inmitten vom Blut des russischen Bürgerkrieges eine Chance? Im heutigen Berlin will der Hauptkommissar Graf Gordon von Mirbach das Verschwinden von jungen Mädchen aufklären, doch dabei stehen ihm seine erotischen Gefühle für die mysteriöse Ermittlerin im Weg. Wie hängen Vergangenheit und Gegenwart zusammen? Der große Stoff, die besondere Perspektive und das Agieren bedeutender Persönlichkeiten machen diese Reihe einzigartig. Sie treffen auf Liebe und heroisches Handeln. In dieser farbig illustrierten Version verschmelzen Spannung und Kunst zu einem ganz besonderen Genuss. ---Lesermeinungen: -Spannend und abwechslungsreich ist der Stil der Autorin, die mit Worten zu faszinieren versteht. Kein Vampir-Mainstream, keine billige Lovestory, keine glitzernden Hipster-Vampire. - Die Geschichte über die junge Zarentochter ist spannend geschrieben, schaurig und bietet auch jede Menge Hintergrundwissen über das Russland der Vergangenheit -unbedingt lesen, Geheimtipp, schauerlich schön und anders
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Tatana Fedorovna
Zarin der Vampire - Die Gesamtausgabe: Russland und selbst der Zar können fallen, doch das Haus Romanow ist unsterblich
Nach wahren Begebenheiten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Band: Blut der Sünde
Prolog
Petrograd am 31. Dezember 1916
Das Geheimnis der Fabergé-Eier
Zarskoje Selo am 14. März 1917
Der Abend des 16. Juli 1918
Zarenmord im Ipatjew Haus
Bergwerksschacht Ganina Jama
Berlin 2016 - Totes Mädchen
Berliner Nächte
Böses Spiel
Der Auftrag
Lebe weiter!
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Jagdbeginn
Band: Böse Spiele
Prolog
Plünderer im Koptyaki-Wald
Wieder in Jekaterinburg
Pawel Medwedew
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Teepause
Gesetz des Zufalls
Marc
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Die Pathologie
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Die Spur
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Freiheit
Aufzeichnungen des Kommissars Gordon von Mirbach
Band: Schatten der Nächte
Prolog
Pläne und Versprechen
Blutnächte
Die Rache muss warten
Medwedews Tod
Die Reise nach Omsk
Admiral Koltschak
Goldene Tage in Ufa
Bittere Niederlagen
Berlin 2016 – Der Schuss
Aufzeichnung des Hauptkommissars Gordon von Mirbach – Jonas’ Verhör
Teepause 2
Die Freunde Satans
Das Ritual
Band: Fluch der Liebe
Prolog
Die Sokolows
Frohe Botschaft
Die Flucht
Liebe und Tod
Tarpens Cousin
Das Wiedersehen
Verrat in Irkutsk
Das Sonderkommando
Mitjas Rettung
Wladiwostok
Berlin 2016 - Jurowski
Aufzeichnungen des Hauptkommissars Gordon von Mirbach: Die Befreiung der Mädchen
Der Pakt
Der Plan
Das Fabergé-Ei
Die Übergabe
Letzte Aufzeichnung des ehemaligen Hauptkommissars Graf Gordon von Mirbach
Bonus: Historische Fotos
Weitere Bücher
Hexen Kuss - Leseprobe
Impressum neobooks
Vorwort
Die Prinzessin Olga Nikolajewna Romanowa erblickte im düsteren November 1895 als erstes Kind der Zarenfamilie das Licht der Welt. Ganz Russland und der Hochadel in der Welt feierten ihre Geburt. Anstelle zu schreien, lächelte sie bei der Geburt. Die Prinzessin war ein wunderschönes Kind. Die orthodoxe Kirche bezeichnete sie als ein Geschenk Gottes, geboren um Besonderes zu tun. Ihre Mutter war eine deutsche Adlige, ihr Vater stammte aus dem Geschlecht der Romanows. Die Ehe der beiden war gegen den Widerstand ihrer Familien geschlossen worden. Tiefe Liebe verband den mächtigen Regenten mit seiner gottesfürchtigen Gemahlin. Das Paar wurde mit fünf Kindern gesegnet: Olga, Tatjana, Maria, Anastasija und Alexej. Russland versinkt bald darauf im Chaos und die Zarenfamilie wird auf bestialische Art ermordet. Olga kann auf wundersame Weise überleben, schwört Rache und Gott ab. Ihr neuer Beschützer -Tarpen von Radewitz- kennt ihre wahre Herkunft nicht und entwickelt mehr und mehr Gefühle für die geheimnisvolle Schönheit. Haben die beiden inmitten von Blut und Gewalt eine Zukunft? Die mitreißende Geschichte beruht auf wahren Geschehnissen. Diese Neuauflage wurde um weitere Szenen ergänzt und zudem hervorragend illustriert.
Band: Blut der Sünde
Prolog
Nichts geschieht ohne Ursachen.
Diese hast du selbst geschaffen.
Immer erfährst du deren Folgen.
O, wie köstlich schmeckt böses Blut!
Papa, verzeih mir!
Petrograd am 31. Dezember 1916
Mama schien nicht mehr bei Sinnen zu sein. Sie zuckte sprachlos, als rang sie um Worte. War uns Geschwistern das Leben am Morgen trotz des andauernden Krieges noch warm, licht und wundervoll vorgekommen, drang nun die Düsternis der Vergänglichkeit unbarmherzig durch jede Ritze. Das eisige Grauen lauerte um uns herum und streckte seine scharfen Krallen aus. Die Bestie Tod war auf dem Sprung und wollte unsere Kehlen zerfetzen und unseren Lebenssaft trinken.
Ljoschka, mein jüngerer Bruder, wirkte besonders verstört. In Russland nennt man den Thronfolger liebevoll Zarewitsch. Für uns Geschwister war er jedoch - seit er das erste Mal vom Löffelchen aß - Ljoschka. Er hatte sich angstvoll an unsere Mutter gepresst. Ihre Weinattacken wurden von heftigen Krämpfen begleitet. Sein Haar war ganz nass von ihren Tränen. Sogar auf seiner blauen Matrosenuniform, die er am liebsten trug, zeigten sich dunkle Flecken.
Wir drei Mädchen saßen auf Hockern um unsere Mutter. Keines wagte ein Wort zu sagen – gleich Kaninchen beim Anblick des Fuchses – und warteten gebannt und voller Schrecken auf das Kommende. Eine Standuhr schlug im Nebenraum. Der tiefe Gong drang dumpf durch die geschlossene Tür und erinnerte mich an die Glocken eines Friedhofs. Meine feinen Haare auf den Armen standen zu Berge. So musste es sich anfühlen, wenn der eigene Tod tatsächlich nahte.
Ich war verwirrt, verängstigt und ausgesprochen wütend. Da ich, Olga, mit einundzwanzig Jahren die Älteste von uns Geschwistern war, musste ich mich aber zusammennehmen. Auch ich wollte eigentlich weinen und mich so erleichtern, doch meine Rolle in der Familie forderte äußerliche Disziplin. Ich durfte kein Kind mehr sein. Der Krieg und die Staatsräson machten mich Romanowprinzessin erwachsener, als ich es vom Alter her eigentlich war. Was konnte ich nur unternehmen, um zu helfen? Wer sollte den anderen Halt geben, wo schon Mama uns alle so erschreckte? Ihr hysterischer Zusammenbruch ließ uns die Unsicherheit der gesamten Welt, die Verletzlichkeit unserer kleinen Familie erkennen. Alle Vorstellungen waren letztlich nur Konstrukte – wie Häuser, die aus Klötzen errichtet wurden. Entfernte man ein tragendes Teil, brach gleich das ganze Gebäude zusammen und verdeutlichte seine innewohnende Zerbrechlichkeit.
„Sein Segen wird mich auf dem schmerzvollen Weg begleiten, den ich hienieden noch zu wandeln habe“, flüsterte Mama mysteriös.
Mich fröstelte. Was war der Sinn dieser gehauchten Worte? In diesem Moment war uns noch nicht klar, dass nur zehn Wochen später eine Revolution deren verborgene Bedeutung offenlegen würde.
Endlich vernahmen wir die lange erwarteten Schritte. Es waren seine. Wir alle wandten unsere Köpfe und sahen zu der großen, mit Intarsien verzierten Doppeltür. Nur unsere Mutter vergrub das Gesicht weiterhin im Haar von Ljoschka.
Die großen hölzernen Flügel öffneten sich knarrend.
Papa war extra aus dem Kriegsquartier herbeigeeilt, um uns zu trösten. Er warf uns besorgte Blicke zu, stürzte aber sofort zu Mama. Der Anblick seiner Gemahlin entsetzte ihn am meisten. Unser Vater, der Zar von Russland, rang um Fassung, versuchte dem Chaos aber einen Rest an Stärke und Normalität entgegenzustellen, genau wie ich. Er war schließlich das Rückgrat Russlands, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der Armee, des Staates, der Romanows und unserer kleinen Familie. Ich konnte mir eine Welt ohne ihn nicht vorstellen. Er war mein Held, der unbesiegbare Ritter, das Beste was das Geschlecht der Romanows je hervor gebracht hatte.
„Was kann ich tun?“
Er wusste, dass jede andere Frage in diesem Moment unpassend wäre. Papa war äußerst klug und weitsichtig. Mama war mehr deutsch im Charakter und hatte seit der Begegnung mit Rasputin einen starken Hang zum Mystizismus. Das verbindet Deutsche und Russen. Die letzten Jahren hatten erwiesen, dass dieser sogar dem rationalen Handeln oftmals überlegen war.
Ohne Mutters Glauben an den Wunderheiler Rasputin wäre Ljoschka längst gestorben. Mein geliebter Bruder litt an der in vielen Adelshäusern verbreiteten Bluterkrankheit. Als die Ärzte ihn aufgaben und die Popen die letzte Salbung empfahlen, heilte Rasputin ihn vor unseren Augen. Gegen den Widerstand von Papa, seinen Beratern, den Ärzten und sogar mir hatte Mama allein dessen Wunderkräften vertraut. Sie hatte Recht gehabt und dadurch dem Zarewitsch wiederholt das Leben gerettet. Deswegen hassten die Ärzte und auch die höfische Kurie den einfachen Wunderheiler. Er führte ihnen und allen aufgeklärten Zweiflern ihre Unfähigkeit sowie Dummheit vor Augen. Nicht Rasputin, den wir auch Vater Grigorij nannten, irrte, sondern sie. Wieso wählte Gott einen versoffenen Popen aus dem Ural, um seine Wunder zu vollbringen? Das verstand niemand, wozu auch.
Es gab in Russland keinen Mann wie ihn. Gott hatte dem sibirischen Priester eine ganz besondere Fähigkeit geschenkt, aber leider auch ein abscheuliches Benehmen. Dieses stellte er jedoch bei Mama so weit wie möglich zurück. In ihrer Gegenwart benahm Rasputin sich besser. So wie ein Vater, der sich mit ganzem Einsatz um seine Tochter und deren Sorgen kümmert. Sie hatte das beste Bild von ihm, denn er war schließlich der Retter des Thronfolgers, ihres einzigen Sohnes. Alle anderen hatten versagt. Das hatte Rasputin Einfluss gegeben, den andere ihm neideten.
Ganz zaghaft hob Mama ihren Kopf. Unendlich langsam kehrte ihr Blick aus einer anderen Welt in diese zurück und färbte sich sofort mit grenzenlosem Hass.
„Töte diese widerlichen Bestien!“, brach es aus ihr heraus.
Papa versteinerte und auch wir waren entsetzt. War das unsere warmherzige Mutter? Mama hatte nie Todesurteile akzeptiert. Manch ruchloser Bösewicht verdankte ihr eine Begnadigung. Stets war sie selbst für die Abschaffung solcher Strafen in Russland eingetreten. Nun forderte sie diese?
Wir alle wussten, wen die Zürnende meinte. Es ging um unsere eigenen Verwandten und deren Freunde, um das sakrosankte Blut von Romanows.
Unser Vater rang um Fassung. Er sprach niemals unbedacht. Wie ein Schriftsteller und Philosoph wählte er seine Worte genau, wog sie ab.
„Wage nicht, diese sündigen Bestien zu verteidigen!“, schrie sie zornerfüllt.
„Dein Lieblingsneffe Großfürst Dimitrij und sein Liebhaber Fürst Jussupow haben ihn ermordet. Sie waren es.“ Sie spuckte sogar aus. „Dr. Lasawert hatte für sie Rattengift in Rasputins Wein gemischt. Nur geschwitzt hat unser Vater Grigorij davon. So leicht bringt man einen von Gott Geliebten nicht um.“
Für einen kurzen Moment hielt sie inne und verdrehte die Augen nach oben, so als sähe sie direkt zum heiligen Vater. „Dann hat Purischkewitsch ihn an den Hoden gefoltert und Jussupow, der widerliche schwule Bückling deines Neffen, hat ihn kaltblütig erschossen. Doch Gott ließ unseren Beschützer nicht sterben.“ Erneut drehte sie ihre geröteten Augen gen Himmel, um die Heiligkeit Rasputins zu untermalen.
„Gerade wollte er fliehen, da kamen die Monster zurück. Dimitrij, dieser böswillige Hund, schoss abermals auf den Geschundenen und schlug ihm mit seinem Stock sogar ein Auge aus.“
Sie machte eine ahnungsvolle Pause und sah Vater nun fest in die Augen. „Das alles geschah in Jussupows Palais durch die Hand eines Romanow! Selbst als die Bestien Vater Grigorij gefesselt und verstümmelt in die Newa warfen, versuchte er noch, sich zu befreien.“
Niemand unterbrach sie, als sie abermals in ihrer Anklage einhielt. Jedem Wort durch Langsamkeit Gewicht verleihend, schloss sie die lange Rede ab: „Sie wussten, dass der Zarewitsch nur durch seinen Segen überleben kann!“
Papa sagte nichts. Es waren seine nächsten Verwandten, die Rasputin getötet hatten. Es waren Romanows, um die es hier ging. Das machte selbst ihn sprachlos, da Mama zu Recht ihren Tod forderte.
Nicht einmal die Polizei hatte in Russland Zutritt zu den Häusern von Familienmitgliedern des Zaren. Obwohl Nachbarn diese über die Schüsse im Palast alarmierte, mussten die gerufenen Beamten den Mord an Rasputin untätig geschehen lassen und durfte sich nicht einmischen.
„Er war ein Priester und von Gott gesandt!“, stieß meine Mutter nochmals keuchend hervor.
„Sie wollen uns vernichten und den Thronfolger töten! Seine Prophezeiung wird nun eintreten“, erklärte Mama mit von Paranoia geweiteten Augen.
„Welche Prophezeiung?“, wagte Tatjana furchtsam zu fragen.
„Rasputin hat einen Brief hinterlassen“, klärte ich flüsternd meiner Schwester auf.
„Wenn er durch die Hand eines Mitglieds unserer Familie stirbt, werden wenige Monate später das Zarenreich und die Romanows untergehen. Vater Grigorij hat den Mord an ihm vorausgesagt.“
Daraufhin hielt Tatjana verblüfft die Hände vor den Mund.
„Nun bin ich verloren!“, stöhnte Vater, worauf unsere Blicke noch angstvoller wurden. Die Worte waren ihm entglitten und eigentlich für niemanden gedacht.
Er versuchte hilflos die Hand unserer Mutter zu nehmen, diese stieß seine aber erbost weg.
„Rette wenigstens deine Kinder, nicht mich! Rette Ljoschka, deinen Sohn, den Zarewitsch! Töte diese Brut aus dem Hause Romanow! Töte alle diese Verräter, verschone niemanden!“ Mama war außer Rand und Band.
„Warum haben unsere Cousins das getan?“, fragte Anastasija. „Vater Grigorij war doch unser Beschützer, zudem ein einfacher Mönch.“
„Werden wir wirklich alle sterben?“, flüsterte mein kleiner Bruder. Er war gerade erst zwölf Jahre alt.
„Das werde ich nicht zulassen!“, erwiderte Papa und nahm alle Kraft zusammen.
„Ich beschütze euch, ich bin noch immer der Zar!“
Mama gab ein irrsinniges Kichern von sich. Ich bekam Gänsehaut.
„Sie arbeiten bereits an deinem Sturz! Sie nehmen dich nicht ernst! Bist du noch von dieser Welt?“, spottete sie.
Unserem Vater entglitt die Beherrschung über seine Gesichtszüge. Tiefste Sorgen spiegelten sich in ihnen.
Mama forderte erneut: „Töte sie sofort, nur so kannst du uns beschützen! Wenn du mich und deine Kinder wirklich liebst, dann zerfetze sie! Sei ein russischer Wolf. Wir wollen ohnehin nicht länger Romanows sein. Der Name ist für immer besudelt. Lasst uns die Sachen packen und aus dem Land fliehen, solange überhaupt noch jemand auf dich hört. Sie hassen uns. Ich verabscheue dieses bösartige Volk!“
„Wer hasst uns?“, fragte der kleine Zarewitsch verängstigt. „Ich denke, alle lieben mich?“
Mama lachte abermals ihr neues hysterisches Lachen. Sie war eine wütende Hyäne, die ihre Jungen verteidigte. Papa rannen nun Tränen aus den Augen. Ich hatte ihn noch nie weinen sehen. Die Räson verbot das, so schwer die Situation auch war. Er war immer der Fels gewesen, an dem sich alle festhalten konnten.
Wir alle fühlten instinktiv, dass Mama Recht hatte. So gern ich Papa glauben wollte. Die eisige Vorahnung unseres Todes zog durch unsere Gemächer und vertrieb die letzte Illusion von Beständigkeit vollständig. Wie Schmetterlinge hatten wir das schöne Licht eines Sonnentages genossen, doch die Nacht und unser Ende rückten mit jedem Augenblick näher. Das wurde mir bitter klar.
Papa kniete sich auf den Boden und versuchte erneut die Hand seiner geliebten Frau zu nehmen. Diese gewährte ihm diese Intimität nicht mehr.
„Wenn dir das Leben unserer Familie etwas wert ist, wenn dir der Zarewitsch etwas bedeutet, dann töte deinen Neffen und seine Helfer! Beweise, dass du uns wirklich liebst und es nicht nur leere Worte sind. Zeig, dass du wirklich ein Zar und kein gutmütiger Narr bist! Kämpfe endlich!“, beschwor sie ihn erneut.
Sie zuckte in Krämpfen und weinte erbittert, weil sie ahnte, dass Papa vor dieser letzten Konsequenz zurückschreckte. Es waren nun einmal Söhne aus dem Geschlecht der Romanows, die Rasputin gemeuchelt hatten. Sein Charakter war ausgleichend, mehr der eines Künstlers, als der eines Soldaten.
„Du hast schon immer auf die Falschen gehört! Ich hätte dich niemals heiraten sollen. Alle wollten das verhindern, selbst deine Mutter. Sie wusste, warum. Jetzt führst du sogar Krieg gegen die Deutschen. Deine Frau und Kinder sind aber Deutsche!“
„Warum sind wir Deutsche?“, fragte der Zarewitsch erneut.
„Mama will damit sagen, dass wir auch solche Wurzeln haben, da sie in Deutschland geboren wurde“, erklärte ich.
„Dann sollten wir vielleicht auf Mama hören und fliehen“, versuchte der kleine Zarewitsch im Streit zwischen seinen Eltern auf seine kindliche Weise zu vermitteln. In seinen Augen stand Hoffnung. Die Flucht erschien ihm als wunderbarer Ausweg.
Unser Vater sah ihn traurig an.
„Ihr seid hier geboren und somit Russen!“, widersprach er Mama. Da er sich aber mit Mama keinesfalls noch mehr anlegen wollte, beschwichtigte er jedoch. „Natürlich habt ihr auch das Blut euer Mutter.“ Das Wort deutsch vermied er dabei. Russland führte ja Krieg mit dem deutschen Kaiser, der auch noch sein Cousin war.
„Und ich bin nicht so verdorben wie diejenigen, die Rasputin töteten. Alles muss nach Gesetz und Ordnung erfolgen.“
„Glaubst du diesen Unsinn noch?“, schrie Mutter abermals die Beherrschung verlierend.
„Die Gesetze machen Menschen. Du bist der Zar! Mach ein Gesetz, das uns beschützt! Rasputin war ihnen egal. Wer ist der Nächste? Sie wollten in Wirklichkeit deinen Sohn, den Thronfolger meucheln! Ihn wollten sie töten und dein Zarentum zerstören! Wer soll jetzt den Zarewitsch heilen, Doktor Botkin etwa? Bist du denn blind? Sie weihen unseren Sohn dem Tod. Töte sie, schnell oder ich fliehe mit den Kindern allein!“ Sie sah ihrem Gemahl direkt in die Augen. „Und wir sind keine Russen, sondern Deutsche! Alle sehen das so!“
Entsetzt schauten wir uns an. Die Sorgen trennten Mama und Papa. Sie wirkten in diesem Moment wie Rivalen. In ihren Appellen erahnten wir das ganze Ausmaß der Gefahr.
„Ich werde den Arzt rufen lassen“, schlug Vater vor.
Mama verlor vor Wut jede Zurückhaltung und spuckte in Raserei auf das Parkett des Bodens.
„Damit der mir Laudanum gibt oder mich wegen des Aussprechen der Wahrheit für irre erklärt? Das wollen sie doch nur! Ich glaube hier keinem mehr! Warum vertraust du deinen Beratern immer mehr als uns. O, Nicky! Warum ist es so weit gekommen? Wo ist deine Liebe geblieben? Dieser Krieg hat dich verändert. Du trägst ebenso Schuld daran, dass unser Beschützer ermordet wurde. Diese Schlangen haben erkannt, dass Rasputin sie enttarnt hatte. Der Name Romanow wird für immer mit dieser Bluttat besudelt sein! Wir werden alle sterben, wenn du sie nicht bestrafst!“
„Ich werde es tun!“
„Dann lass sie sofort hinrichten!“
„Das kann ich nicht.“
Mama winkte konsterniert ab.
„Ich wusste es! So bist du eben. Sie werden dich bald heiligsprechen, aber nicht wegen des Glaubens, sondern wegen Scheinheiligkeit. Die ist aber nichts als deine Schwäche zu handeln. Sogar die Kommunisten wissen das inzwischen!“
So würdelos hatte ich Mama noch nie mit ihm sprechen gehört. Sie verhöhnte ihn regelrecht.
„Das Blut klebt nun auch an deinen Händen“, flüsterte sie und blickte uns schaurig verschwörerisch an. „Das Leid ist nicht mehr aufzuhalten.“
Sie klang, als verabschiedete sie sich schon jetzt von ihren Kindern – für immer.
Wir waren noch mehr verängstigt. Panik erfüllte endgültig unsere Herzen. Dieser Tag gehörte zu den Schlimmsten.
„Ich will nicht sterben!“, bat der Zarewitsch ängstlich.
Ich strich ihm über sein tropfnasses Haar und konnte die eigenen Tränen nicht länger zurückhalten.
„Olga?“ Ljoschka sah mich fragend und um Hilfe bittend an. Die Situation überforderte ihn, obwohl er durch seine Hämophilie schon oft an der Schwelle des Todes gestanden hatte.
„Ich passe auf dich auf“, flüsterte ich und benetzte ihn nun auch noch mit meiner Trauer.
„Niemand soll dir jemals Leid zufügen. Dann bekommt er es mit mir zu tun!“
Ljoschka lächelte dankbar und drückte meine Hand.
Auch aus Vaters unermesslich traurigen Augen ergossen sich in einem dünnen Rinnsal Tränen in seinen Bart. Er war sich seiner eigenen Unfähigkeit bewusst, fand jedoch keinen Ausweg.
In der Tür erschien ein Staatssekretär.
„Majestät, Sie werden erwartet!“
Meine Mutter winkte meinen Vater ab.
„Geh nur zu den Verrätern, berate dich mit ihnen! Du hast mich enttäuscht! Lecke dem Gesindel den Arsch!“
Wir schauten sie pikiert über die ungewöhnlich deftige Wortwahl an. Die Welt war wirklich aus den Fugen geraten.
Papa wischte sich mit dem Uniformärmel die Tränen ab und erhob sich schwerfällig. Einige seiner Orden schepperten dabei traurig. Das Geschehen wirkte unwahr, verloren, wie hinter einem Schleier.
Unser Vater schien um Jahre gealtert. Sein Gang war nicht mehr der eines russischen Zaren. Ein erschöpfter alter Mann zog ein letztes Mal in eine nicht zu gewinnende Schlacht. Sein Schwert war aus Holz, das seiner Gegner aus Stahl. Er hatte jedoch keine Wahl. Sein aufgesetztes Lächeln, das uns Kinder ermutigen sollte, war eine offensichtliche Lüge. Angst schnürte mir die Kehle zu. Papa würde uns nicht mehr beschützen können. Das wurde mit klar.
Mama sah mir in die Augen und musterte dann meine Erscheinung. Sie hatte offensichtlich einen Entschluss gefasst. Ein eigenwilliger Funke leuchtete in der Trübnis ihres Blickes auf.
„Geht jetzt bitte!“, forderte sie uns Mädchen auf. Nur den Zarewitsch drückte sie noch fester an sich.
Was sollten wir tun? Wir erhoben uns.
Mama wandte sich unerwartet an mich direkt: „Olga, halte dich bereit. Komm allein in zwei Stunden zu mir. Ich muss noch etwas mit dir zusammen erledigen. Sei pünktlich!“ ...
Als ich nach exakt zwei Stunden zurückkehrte, war sie ganz allein. Auch der Zarewitsch war fort. Im Vorraum standen zehn schwer bewaffnete Kosaken unserer Leibwache mit entschlossenen Gesichtern. Niemand wagte ein Geräusch zu machen. Die Stille war gespenstisch.
Was bedeutete das? Normalerweise hielten sie sich nicht in diesem Teil des Palastes auf.
Ohne ein Wort zu sagen und alle Willenskraft zusammennehmend, erhob Mama sich entschlossen von dem samtenen Sofa, auf dem sie geruht hatte. Ich folgte ihr wortlos. Was sollte ich auch sagen? Die Kosaken eskortierten uns schweigend. Tür für Tür öffnete sich. Wir stiegen tiefer und tiefer. Wohin gingen wir? Noch nie war ich in diesem Teil des Palastes gewesen. Unser Palais war eine der größten Residenzen der Welt.
Zuweilen versuchte eine der dortigen Wachen uns sogar den Weg zu verweigern.
Mama drohte dann: „Ich bin die Zarin! Tritt zur Seite oder du stirbst sofort!“ Unsere Leibwache fasste dann jedes Mal die Gewehre fester. Die Kosaken würden schießen. Man konnte sich auf sie verlassen. Ich stand selbst einem Reiterregiment seit meinem sechzehnten Lebensjahr als Hauptmann vor. Das bereitet mir große Freude und war ein Privileg, welches ich Vater abgetrotzt hatte, nachdem die Besetzung durch die Erkrankung des Zarewitsch vakant war. Zarensöhne erhielten stets ein eigenes Kosakenregiment, um sich als Befehlshaber zu üben. Meine Ernennung war ein Bruch mit der Konvention und zeigte, wie aufgeschlossen mein Vater war. Ich ritt verdammt gern und konnte es inzwischen mit jedem männlichen Rekruten aufnehmen. Einer der Feldwebel trainierte mich sogar in asiatischer Kampfkunst, die er in China erlernt hatte. Vater nahm meine Fortschritte mit Erstaunen zur Kenntnis. Mutter hatte meine militärischen Avancen zuerst abgelehnt, aber bei Ausbruch des Krieges gebilligt. Zumindest kritisierte sie mich nicht mehr.
So drangen wir im Laufe einer Stunde bis in die Gänge unterhalb der sogenannten Schatzkammern vor. Auch hier gab es noch Wachen. Wir kamen zu einem Tunnel, von dessen Existenz wohl nur ganz wenige wussten. Er verlief recht steil nach unten. Wir waren inzwischen so tief, dass ich Furcht hatte, dass die Erdmassen über uns herunterbrechen und uns begraben könnten.
Mama hielt inne und wendete sich der Eskorte zu. „Wenn ihr jemals erzählt, dass ihr hier wart, werden eure Familien sterben!“ So rigoros hatte ich sie nie zuvor erlebt. Für mich war sie immer meine Mama, jetzt war sie die Zarin und zeigte, dass in ihr auch das kämpferische blaue Blut ihrer germanischen Vorfahren pulsierte. Es übernahm in dieser Krisensituation die Regentschaft. Ich musste davon etwas abbekommen haben, gestand ich mir spöttisch ein.
Die Leibwachen zuckten mit keiner Wimper.
Wir kamen nun zu einem Raum, der mit großen Schlössern und einer eisernen Tür verriegelt war. Dort standen erneut zwei bewaffnete Posten.
„Tretet beiseite!“, befahl meine Mutter herrisch und zog einen Schlüssel aus ihrer Tasche.
„Das dürfen wir nicht!“, beharrte einer der beiden.
„Erschießt sie!“ Die Kosaken senkten die Gewehre, um dem Befehl nachzukommen.
„Nein, wir gehorchen!“, bat der arme Kerl entsetzt mit erschrocken aufgerissenen Augen.
Mama blickte kurz auf unsere Begleiter: „Nehmt ihnen die Waffen, aber verschont sie noch einmal!“
„Widersprich niemals wieder deiner Zarin!“, forderte sie nebenbei.
Der Mann versuchte die Erde zu küssen, die ihre Füße berührt hatten.
„Bitte verzeiht uns!“
Die beiden wurden von unserer Eskorte ihrer Pistolen beraubt. Meine Mutter öffnete den Eingang. Wir traten ein. Alle anderen blieben draußen. Mama schloss sorgsam die Tür hinter uns zu. Was wollten wir hier?
In dem Raum standen vor allem religiöse Utensilien, Ikonen, Leuchter und verstaubte Geschenke von fremden Herrschern aus vergangenen Zeiten. Meine Mutter sah sich um und ging zielstrebig zu einem der Schränke. Sie öffnete diesen, warf die darin enthaltenen Gegenstände achtlos auf den Boden und zog ein geheimes Fach heraus.
„Nur noch zwei! Wo sind die anderen?“ Ihre Stirn kräuselte sich nachdenklich.
„Mama, was ist das?“, fragte ich erschauernd.
Meine Mutter sah mich an.
„Olga, wir werden alle ermordet. Es ist nur eine Frage der Zeit. Rasputin hat sich niemals geirrt. Seine Prophezeiung wird eintreten. Sei bereit! Wenn ich dir dieses Mittel gebe, ist alles verloren. Beiß mit aller Kraft auf diese Kapsel. Sie ist so dünn, dass sie dem Biss nicht standhält.“
Ich verstand gar nichts.
„Mama, du machst mir fürchterliche Angst. Das ist doch alles nur ein böser Traum. Was ist das? Gift?“
„Nein, das Gegenteil davon. Es ist deine einzige Hoffnung auf ein Leben.“
Sie winkte mich ganz dicht heran. Niemand sollte uns hören können. Ihr Mund flüsterte nun in mein Ohr: „Ich sah mit eigenen Augen, dass ein zum Tode Verurteilter, nachdem er erhängt wurde, am nächsten Tag durch diese Medizin erwachte. Man hatte sie ihm zuvor verabreicht. Der Henker musste ihm darauf den Kopf abtrennen und ihn verbrennen, um das Urteil zu vollstrecken.“
„Was ist das für ein Mittel? Was sind das für unglaubliche Geschichten?“
„Sie sind wahr, Olga. Es gibt eben mehr zwischen Himmel und Erde, als wir sehen. Du hast es bei Rasputin und der Heilung des Zarewitsch selbst beobachten können.“
Sie beugte ihren Mund erneut zu meinem Ohr herab und flüsterte so leise, als könnte uns jemand belauschen.
„Es ist das Blut des einzig bekannten russischen Vampirs. Er wurde vor mehreren Hundert Jahren gefangen, hingerichtet und sein Blut aufbewahrt. Da man im Laufe der Zeit immer wieder an der Geschichte zweifelte, testete man es zuweilen an zum Tode verurteilten Verbrechern. Dieses Staatsgeheimnis wurde bis heute bewahrt und von Zar zu Zar weitergegeben. Zuletzt hat man den Rest des verbliebenen Blutes in sieben gläsernen Ampullen versiegelt. Fünf wurden scheinbar schon gestohlen. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen.“
„Mama, was verlangst du von mir?“
„Wenn ich dir diese gebe, dann ist alles verloren und wir werden sterben. Zögere in diesem Moment nicht. Vertrau mir! Ich will, dass du lebst. Nimm Rache, dein Vater ist zu schwach dazu! Du bist stark und klug!“
Mama war wohl verrückt geworden. Ich zitterte.
„Was wird Gott dazu sagen?“
„Der?“ Mama lachte blasphemisch. „Er wird es schon verstehen! Der Vampir war doch auch ein Teil seiner Welt!“
Diese neuartige Auslegung unseres Glaubens aus dem Mund meiner Mutter war zutiefst ungewöhnlich. Sie legte ihren Finger auf den Mund – als Zeichen, dass ich schweigen sollte. Die zwei kleinen Kapseln steckte Mama in eine eigens mitgebrachte kleine Tasche. Dann öffnete die Zarin von Russland die Tür.
„Sofern ihr irgendjemanden erzählt, dass ich hier war, sterbt ihr!“, ermahnte sie die verängstigten Wächter. Beide hatten mit ihrem Tod gerechnet.
Wir gingen von den Kosaken eskortiert zurück.
Das Geheimnis der Fabergé-Eier
Was sollte ich schon gegen einen Besuch bei dem berühmten Fabergé einwenden? Ich freute mich sogar über diese Abwechslung. Welches Mädchen liebte nicht den Anblick von Juwelen und Gold? Bei Fabergé gab es immer etwas zu bestaunen. Peter Carl Fabergé gehörte fast schon zu unserer Familie. Er war für mich einfach schon immer da gewesen. Unzählige Schmuckstücke hatte er zusammen mit seinen vielen Mitarbeitern in den letzten Jahrzehnten in der Eremitage restauriert. Das war der Louvre Russlands. Dort gab es immer etwas zu tun. Seine Berühmtheit hatte er bereits vor meiner Geburt 1882 bei der Allrussischen Ausstellung durch zahlreiche extravagante und einmalig fantasievolle Schmuckstücke erlangt. Seit dem war allein der Name Fabergé bereits eine Marke. Sein persönliches Auftragsbuch war so voll, dass er auf Jahre ausgebucht war. Sein Geschick war weltweit unvergleichlich. Jeder Monarch in dieser Welt wollte inzwischen unbedingt eines seiner verspielten Meisterwerke ergattern. Daran hatte auch der Krieg nichts geändert. Unsere Familie bevorzugte er natürlich. Denn Peter Carl Fabergéwar inzwischen zum Hofjuwelier aufgestiegen und durfte diesen Namen auch als Titel in der Firmenanschrift verwenden. Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass Mama mich zum Abholen von zwei kürzlich bestellten Werken in seinem Geschäft einlud.
Wir fuhren mit einem amerikanischen Automobil zu unserem Ziel. Es war ein Geschenk des dortigen Präsidenten und recht bequem. Selbst bei der kurzen Fahrt stellte ich fest, dass sich die Stimmung in der Stadt noch mehr zum Schlechten gewandelt hatte. Das quicklebendige Petrograd wirkte inzwischen bedrückend und bedrohlich auf mich. Nur einige wenige Getreue trauten sich noch, ihre Verbundenheit mit dem Zarenhaus öffentlich auf der Straße zu zeigen. Winkten die Menschen vor einigen Monaten noch unserem mit den russischen Reichswimpeln geschmückten Auto begeistert zu, so ernteten wir heute fast nur noch böse Blicke. Die Zarenfamilie war in Ungnade gefallen. Der Mord an Rasputin schien die Ereignisse nur zu beschleunigen. Seine Mörder waren davongekommen. Papa hatte sich gegenüber den Tätern aus seiner eigenen Familie als zahnlos erwiesen. Mama verzieh ihm das nicht. Zwischen beiden war so etwas wie eine kleine Eiszeit. Trotzdem verließ Mama ihren Gemahl nicht. Sie war eben die russische Zarin, auch wenn sie immer stärker ihre deutschen Wurzeln betonte. Sicher wollte sie uns Kindern damit ein wenig Hoffnung spenden und andeuten, dass es auch eine Zukunft für uns außerhalb Russlands gab. Aber es machte uns nur um so mehr Furcht.
Unter den Gaffern sah ich einen Mann auf Krücken durch die Straße humpeln. Wahrscheinlich hatte er ein Bein im Krieg verloren. Er spuckte beim Anblick unseres Autos auffällig aus. Ein lauter Schlag ertönte vom Blech unseres Wagens. Jemand hatte tatsächlich mit einem Stein auf ihn geworfen. Unser Sicherheitsdienst feuerte zur Sicherheit und Abschreckung einen Schuss in die Luft. Das Leben in der Hauptstadt war für uns gefährlich geworden. Vater Grigorij schien mit seiner düsteren Prophezeiung Recht zu behalten. Angst erfüllte mich.
Mama zog beherzt die Gardine vor die Scheibe.
„Schau am besten gar nicht hin!“, ermahnte sie mich.
„Sie sehen in uns eben Deutsche. Du musst auf alles gefasst sein. Wir werden nächste Woche die Stadt verlassen und früher nach Zarskoje Selo reisen. Hier wird es zu gefährlich.“
„Mama, du übertreibst immer so sehr. Es ist halt Krieg. Viele hungern und sind deswegen unzufrieden. Bald wird alles besser!“, widersprach ich. „Irgendwann endet auch dieser Krieg.“ Die Wahrheit erschien mir zu bitter. Ich redete sie schön.
Mama verzog keine Mine. So reagierte sie immer, wenn sie anderer Meinung war. Sie versuchte jedoch nicht, mich zu überzeugen und brauchte sicher nicht meinen pubertären Optimismus.
Der Wagen hielt bald darauf und unser Beifahrer öffnete eifrig die Tür. Vor und hinter uns parkten die Autos unserer Leibwächter. Ohne diese konnten wir keine Fahrt mehr unternehmen.
Peter Carl Fabergé ließ es sich trotz seines hohen Alters nicht nehmen, seinen hohen Besuch vor der Eingangstür zu empfangen. Sein Haupthaar war noch dünner und grauer geworden. Sein Bart schien dagegen immer voller zu werden. Genau so stellte ich mir in meinem Inneren einen wahren Künstler vor. Nicht mit äußerlicher Exaltiertheit oder Auffälligkeit, wie bei den unzähligen un- oder halbbegabte Adepten, glänzte ein Meister dieser Zunft, sondern allein mit seinen grandiosen Werken. Sie entsprangen dem Geist der göttlichen Musen und nicht menschlicher Beschränktheit. Der berühmte Goldschmied hatte es nicht nötig, irgendjemandem Bedeutung oder Individualität vorzugaukeln, denn er besaß diese ganz natürlich. Jeder Besucher spürte sofort, dass er es mit einem ganz besonderen Menschen zu tun hatte. Der alte Fabergé stand mit seinen beiden Beinen fest auf dem russischen Boden. Aus seinem intelligenten Gesicht blickten uns warme und neugierige Augen an. Seine von vielen Falten gestaltete Stirn spiegelte vielfältige Emotionen, durchlebte Gefühle und Erfahrungen wider. Mit fünfzig Jahren hat schließlich jeder Mensch das Gesicht, welches er sich durch sein Leben verdient hat. Fabergé war zu diesem Zeitpunkt bereits über siebzig Jahre alt. Er trug einen gut geschneiderten, jedoch nicht unbedingt auffälligen dunklen Anzug, eine dazu passende Krawatte und ein weißes Hemd. Er glich in diesem für ihn typischen Aufzug mehr einem Gelehrten, denn einem Feinschmied. Auch er hatte wie wir zur Hälfte deutsches Blut. Vielleicht verband uns diese Gemeinsamkeit zusätzlich.
„Meine Zarin, Sie glänzen mit ihrem Besuch mehr als meine gelungensten Schmuckstücke!“, schmeichelte er galant und vertraut zugleich. „Wie schön, dass Sie mir hier die Ehre Ihres Besuches geben. Ich wäre selbstverständlich auch im Palast vorbeigekommen.“
„Ach gönnen Sie uns doch diese kleine Abwechslung!“, wiegelte Mama ab. Sie wirkte plötzlich so natürlich und ungezwungen in der Nähe dieses Da Vinci des Goldes. Die steife Monarchin fiel wie ein Mantel von ihr ab. So mochte ich sie am liebsten.
„Prinzessin Olga!“ Faberge küsste ungezwungen meine Hand. „Mein Gott, Sie sind noch schöner als bei unserer letzten Begegnung!“ Er hatte keinerlei Berührungsängste in Bezug auf den höchsten Adel dieser Welt, denn seine Kunst adelte ihn gleichfalls und machte ihn zu einem der ihren.
Ich klopfte ihm vertraut mit meinem Fächer auf den Oberarm. Der Juwelier erschien mir fast wie mein Großvater. Hoffentlich lebte er noch lange, denn ich mochte ihn gar zu gern und natürlich seinen Schmuck, der mich schon aus den Fenstervitrinen anfunkelte: Kauf mich!
Ein Angestellter hielt die Tür auf. Wir traten ein.
Mein Gott, was war das für eine schöne Welt. Kein Wunder, dass der alte Mann so zufrieden wirkte. Er hatte sich sein eigenes goldenes Königreich geschaffen. Hier gab es keinen Krieg und kein Leid.
Mama und ich gingen ein wenig im Geschäft umher und nahmen einmal dieses und einmal jenes Stück neugierig in die Hand.
„Sie sind ein Genie!“, bewunderte Mama in einem fort.
„Nun ja!“, erwiderte der Besitzer, „die Zeit bringt Erfahrung!“ Er war stolz auf sein Werk, aber keineswegs überheblich. So ist es eben, wenn ein Genie genau weiß, was es kann und dies ein Fakt ist. Falsche Bescheidenheit wirkt dann erst recht deplaziert.
„Ihr Auftrag war etwas ungewöhnlich!“, kam er zur Sache. „Ansonsten bestellen Sie die Eier doch nur zu Ostern und über ihren Mann, den Zaren selbst!“
Mama sah sich um und winkte unserer Begleitung, sich aus dem Geschäft zu entfernen, bevor sie antwortete. Niemand sollte sie hören. Das machte mich neugierig. Um was ging es denn genau?
„Es ist diesmal anders! Die guten Stücke sind fertig?“, fragte sie, als wir allein waren.
„Ich habe sie hinten in meiner eigenen Werkstatt, damit ich sie dort endgültig verschließen kann.“
Er ging vor, wir folgten ihm. Ich war etwas irritiert.
„Mama?“, fragte ich leise.
„Dies bleibt unter uns!“, ermahnte sie mich nur. Sie wusste aus Erfahrung, dass ich kein Geheimnis verriet. Wir hatten inzwischen viele Monate gemeinsam in Lazaretten gearbeitet, um dort Verwundeten zu helfen. Das verband uns. Wir waren durch diese schwere Arbeit nicht nur miteinander vertraut, sondern vertrauten uns. Auch dort hatten wir so manches erlebt, was meine jüngeren Geschwister lieber nicht wissen sollten. Es würde ihnen den Rest ihrer kindlichen Unschuld rauben.
Auf einer Werkbank standen zwei absolut gleich aussehende Schmuckeier, wie Vater sie stets zu Ostern anfertigen ließ und zumeist verschenkte. In diesem Zimmer arbeitete Fabergé allein. Niemand außer ihm durfte es betreten. Man hörte seine vielen Mitarbeiter woanders werken. Er beschäftigte über 500 allein in dieser Stadt und hatte weitere Niederlassungen in Moskau, Odessa, Kiew, London und anderen Städten.
„Ich nenne sie die Zwillinge!“, erklärte der Meister zu ihrer Ähnlichkeit.
Er wies auf eine Öffnung inmitten der Goldeinfassung.
„Ich habe das Geheimfach in der beschriebenen Größe eingearbeitet.“
Mama holte aus ihrer Tasche zwei der wertvollen Ampullen, die sie in meinem Beisein aus der Schatzkammer entnommen hatte. Dabei blickte sie mich einen Moment bedeutungsvoll an. Ich wusste was dies bedeutete und prägte mir das Geschehen gut ein.
Dann deponierte sie diese in den dafür vorgesehenen Öffnungen. Fabergé erhitzte eigenständig Silber und verfugte mit diesem jeweils ein ziseliertes Silberblümchen so, dass man keinesfalls dahinter einen verborgenen Schatz vermutete. Alles war gut vorbereitet und passte.
„Ich muss die Stelle noch ein wenig polieren!“ Die Arbeit ging ihm so geschickt von der Hand, als wäre sie von unbeschreiblicher Leichtigkeit. Er fragte nicht nach, was und wozu Mutter etwas in den beiden Eiern verbarg. Sicher war er solche Sonderwünsche seiner reichen Kundschaft gewohnt. So manches Geheimnis steckte sicherlich in seinen Werken.
Nach getaner Arbeit deponierte er die beiden relativ kleinen Schmuckeier in eigens bereitstehenden Schutzkisten.
„Fällt es ihnen eigentlich schwer, sich von ihren Kunstwerken zu trennen?“, fragte ich nun doch neugierig nach.
Er lachte. War die Frage zu naiv?
„In unserem Leben trennen wir uns pausenlos von Dingen, die uns am Herzen liegen. Ich sehe das als Übung an. Dann fällt es mir vielleicht leichter, mich irgendwann von dem Bedeutendsten zu trennen, das ich besitze!“
„Das wäre?“, mischte sich nun sogar meine Mutter ein.
Er lachte abermals.
„Na was schon, das eigene Leben!“
Er blickte mich an. Seine Augen wirkten etwas traurig. „Pass nur immer gut darauf auf!“
Zarskoje Selo am 14. März 1917
Die erste Bahn Russlands wurde zwischen Petrograd und Zarskoje Selo gebaut. Oh, ich liebte Zarskoje Selo. Schon immer! Es war hier ganz anders als in Petrograd. Nirgendwo gab es einen besseren Platz für Freigeister. Sogar Puschkin hatte hier gewirkt und seine Spuren hinterlassen. Es gab sogar ein Museum über den großen russischen Dichter. Das kleine Feodorowski-Städtchen war einfach entzückend zum Bummeln und Einkaufen. Die Symbiose von Parks und Schlössern war unvergleichlich in ganz Europa. Wo gab es noch so ein erhabenes und zugleich behagliches Ensemble? Von den unzähligen Kunstwerken im Schloss muss man gar nicht sprechen.
Wie wunderbar war es, durch die schönen barocken oder englischen Parks zu laufen und am Ufer der dortigen Seen die Schwäne zu füttern. Der Schönste von ihnen war für mich der Alexandrowski-Park. Jetzt im März steckten dort bereits die ersten Blumenblüten ihr Haupt der erstarkenden Sonne entgegen. Man sah auch schon erste Bienchen summend fliegen und den frühen Honig sammeln. Bei schönem Wetter beobachtete ich von der prächtigen Paladin Brücke das Treiben der Vögel auf dem See oder den Kampf der Enten um zugeworfene Brotkrumen. Danach trank ich gern einen Tee im Pavillon „Grotte“.
Wir wohnten wie immer im Katharinenpalast und waren in diesem Jahr früher als sonst hierher gekommen. Papa hatte seine Verwandten, die unseren Vater Grigorij ermordet hatten, verschont. Diese waren nur aus Petrograd verbannt worden. Was war das für eine milde Strafe für dieses große Verbrechen! Mama verzieh ihm diese Milde nicht und sorgte sich um unser Leben. Der Vorwurf, wir wären Deutsche, wurde immer lauter geäußert. Zuweilen sprach Mama sogar davon, nach Schweden zu fliehen. Doch sie liebte natürlich unseren Vater viel zu sehr, um diese Drohung wahr zu machen.
Die Lage in Petrograd spitzte sich insgesamt zu. Seit einigen Tagen war die Bahnverbindung dorthin unterbrochen. Es gab immer wieder gefährliche Unruhen in der Metropole. Einige machtverliebte Aristokraten nutzten die Abwesenheit des Zaren für sich aus und verfolgten ihre eigenen Pläne. Sie schürten das Chaos und verdienten an der Lebensmittelknappheit. Unser Vater war gerade im Hauptquartier der Armee in Mogilew in der Nähe von Minsk. Wir sahen ihn kaum noch. Er verbrachte die meiste Zeit als Oberbefehlshaber im Generalstab an der Front. Früher hatte er manchmal unseren kleinen Bruder gegen den Protest von Mama mitgenommen. Doch seit Rasputin tot war, erschien ihm das Risiko dafür zu hoch. Eine kleine Verletzung konnte unseren Bruder, der an Hämophilie litt, töten. Zudem stießen die Deutschen Kilometer um Kilometer vor. Selbst der russische Winter hatte sie nicht aufhalten können. Es sah fast so aus, als würden sie den Krieg gewinnen. Das wäre schrecklich. Im ganzen Land herrschte Hunger, da die Felder durch den Krieg nicht ausreichend bebaut worden waren. Die Männer waren ja Soldaten. In den Städten und Fabriken gab es immer wieder Streiks. Dazu gab es noch Gerüchte von einem geplanten Umsturz. Aus allen diesen Gründen waren wir froh, hier zu sein.
Rasputin schien recht zu behalten. Mütterchen Russland versank im Chaos. Das wollte ich aber an dem heutigen Tag vergessen. Nur für einen Augenblick sollten die Sorgen verblassen. die Jugend ist doch dazu da, um sie zu genießen. Es war der 14.03.2017 nach gregorianischem Kalender, wie wir ihn in Russland verwendeten. Der Rest Europas benutzt die julianische Zeitrechnung. Hiernach war der 01.03.2017. Mama war mit Anastasija zu einem bedeutsamen Generalsbegräbnis gefahren. Davon gab es jetzt viele. Alexej bastelte gerade mit seinem Englischlehrer, Charles Sydney Gibbes, Modellhäuser. Am Vormittag hatte ich mit ihm vorsichtig Ball gespielt.
Wir drei Mädchen waren also unbeobachtet und konnten endlich einmal das machen, was wir wollten. Und was war das?
Natürlich ein Tanztee! Solche Vergnügungen waren in Kriegszeiten aus Respekt vor den Soldaten und den Toten verboten. Doch welches junge Mädchen will nicht tanzen?
„Was ist, wenn Mama herausbekommt, was wir machen?“, fragte ich Tatjana besorgt, die die eigentliche Organisatorin war.
Diese lachte und warf ihr offenes Haar kess von links nach rechts.
„Dann ist es ohnehin zu spät. Olga, willst du denn niemals einen Jungen küssen?“, stellte sie in den Raum.
„Was weißt du schon“, erwiderte ich lachend. „Ich habe schon viele geküsst.“
„Papa und deinen Bruder Alexej! Das war es dann auch schon“, spottete Maria. Sie war die Jüngste von uns Dreien.
Es klopfte. Wir kicherten. Da waren sie, unsere stolzen Kadetten, die wir zu uns gerufen hatten. Sie wussten natürlich nicht, was sie hier erwartete. Alle unsere Kammerdienerinnen und Bediensteten hatten den strengen Befehl erhalten, keineswegs zu stören. Sicher waren sie froh, auch ein wenig Freizeit zu erhalten.
„Herein doch!“, befahl ich mit tiefer, verstellter Stimme. Maria und Tatjana lachten leise.
Etwas verdutzt traten die drei jungen Offiziersanwärter ein. Sie erröteten und wussten nicht so recht, wie sie sich verhalten sollten und traten unsicher steif ein. Die Burschen waren erst vor zwei Tagen aus Petrograd hierher versetzt worden und gehörten zum Wolhynischen Garderegiment. Die schwierige Situation dort gefährdete ihre Ausbildung, die sie gerade begonnen hatten.
Der Mutigste von ihnen nahm militärische Haltung an und salutierte, als wären wir seine Befehlshaber. Die beiden anderen kopierten seinen Gruß etwas verzögert.
Wir kicherten erneut. Das führte bei den jungen Männern zu noch mehr Röte in ihren Gesichtern.
„Man hat uns befohlen, hier zu erscheinen“, stotterte der selbst ernannte Anführer erklärend.
Da ich die Älteste war und auch militärisch ja gewisse Erfahrungen besaß, übernahm ich die Rede.
„Jawohl, meine Herren Offiziersanwärter! Ein wichtiger Auftrag, streng geheim!“, tat ich wichtig.
Maria prustete heraus und konnte ihr kindisches Lachen nicht zurückhalten. „Mein Gott!“, keuchte sie.
„Ein bisschen Haltung!“, ermahnte ich sie scheinbar streng. „Was sollen die Herren Offiziersanwärter denken?“
Die drei glotzten mich an und verstanden rein gar nichts. Sie sahen durchaus gut aus. Der Jüngste war etwa siebzehn, der Älteste um die zwanzig Jahre alt.
„Nun ja, darf ich vorstellen? Das sind meine Schwestern die Prinzessinnen Tatjana und Maria.“
Beide machten dazu jeweils einen höfischen Knicks. Es war ein Theaterstück und machte wirklich Vergnügen. Die jungen Männer knallten gehorsam die Hacken zusammen.
„Und ich bin Olga, im Moment die Herrin des Hauses Romanow, da die Zarin auswärtig beschäftigt ist.“
„Sehr wohl!“, fand der Mutigste unter ihnen seine Stimme wieder. Das war zwar unpassend, aber lustig.
Tatjana ging nun zu einer der in den Kühlern bereit gestellten Flaschen Sekt und goss daraus sechs Gläser voll.
Nervös sah sich der Anführer um.
„Soll ich Ihnen helfen, verehrte …“ Der flotte Bursche stotterte etwas, da er nicht wusste, auf welche Weise ein Offiziersanwärter meine Schwester anreden sollte.
„Nennen Sie mich einfach Tatjana, wir sind ganz unter uns!“
Sie trat an den Burschen heran und reichte ihm ein Glas. Ungläubig sah dieser auf das prickelnde Getränk. „Nur zu!“, ermunterte sie die anderen und wies auf die Gläser. „Oder soll ich euch wirklich bedienen.“
Die beiden jüngeren Offiziere trauten sich trotzdem nicht ihren sicheren Stehplatz zu verlassen.
Maria brachte ihnen darum ihre Gläser.
„Wir wollten heute alle Neuankömmlinge begrüßen!“, stellte ich fest. „Zudem kommt ihr aus Petrograd. Da viel gemunkelt wird, wollten wir aus erster Hand erfahren, wie es da im Moment so ist.“
Die drei machten große Augen und waren vor Schock stumm. Man musste ihnen die Angst nehmen. Verdammt, waren die verkrampft.
„Auf Russland!“, rief ich patriotisch, trank das Glas aus und warf es in bäuerlicher Sitte in weitem Bogen über meinen Rücken. Es zerbrach klirrend. Das sollte Glück bringen.
„Na los!“, befahl ich.
Etwas verlegen grinsend taten sie es ebenso. Jedoch trauten sie sich nicht, die Gläser zu zerschmettern.
Tatjana holte eine neue Flasche als Nachschub für alle und drückte diese, dem Schönsten von den Dreien in die Hand. Er war wohl der Mittlere vom Alter und tat etwas unbeholfen seinen Dienst.
„Zieht doch erst einmal eure Mäntel aus!“, regte ich an, da die Drei trotz der Kälte zu schwitzen begannen. Seit Tagen funktionierte im Palast weder Heizung noch Wasser. Die Wasserwerke streikten und scheinbar auch die Heizer.
Die Kadetten folgten der Aufforderung. Ich sah, wie sie sich fragende Blicke zuwarfen und auch ein erstes verschmitztes Lächeln bei Zweien von ihnen. Nur der vom Alter Mittlere behielt eine eisige Mine. Er war anscheinend besonders schüchtern und brauchte mehr Sekt.
„Auf den Sieg!“, befahl ich das nächste Glas.
„Auf Zarsko Selo!“, regte Tatjana an.
„Auf den Zaren!“, schloss sich Maria an.
Tatjana lief etwas watschelnd zum Grammofon. Die Schuhe waren für ihre Spreizfüße etwas zu eng. Sie ging darum am liebsten barfuß. Doch das passte hier natürlich nicht.
„Könnt ihr tanzen?“ Sie winkte mit der Hand ab. „Ach was! Das ist ein Befehl, ihr müsst tanzen!“
Sie legte Walzer auf. Die beschwingten Klänge erfüllten den kleinen Saal.
Der Älteste der Drei ließ sich nicht lange bitten, machte vor mir eine galante Verbeugung. „Darf ich bitten!“
„Ja gern!“ Wie lustig war das. Und er konnte tatsächlich gut tanzen und gefiel mir vom Typ ausgesprochen gut. Irgendetwas war an ihm witzig und ich mochte Witzvögel. Zudem war er sportlich und durchaus auch hübsch anzusehen. Er gehörte zu denen, die einem nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten auffallen und die sich durch ihre offene Art, dann auf den ersten Platz schieben. Ein echter russischer Prachtkerl eben. Das Leben war ernst genug, da war ich für jede Ablenkung dankbar.
Die anderen folgten uns, bildeten aber bei weitem nicht so gute Tanzpaare.
Maria beschwerte sich sogar über ihren tollpatschigen Partner. „Du tanzt wie ein Bauer!“
Tatjana lachte. „So etwas sagt eine Prinzessin nicht.“
Maria grummelte und war unzufrieden. Etwas neidvoll beobachtete sie, wie ich mit meinem Begleiter durch den Saal huschte. Die Welt drehte sich um mich. Das war das wahre Leben.
„Woher kommst du?“, fragte ich beschwingt.
„Aus Minsk!“
„Gefällt dir die Stadt?“
„Oh ja! Sie ist nicht so groß wie Petrograd, aber schon bedeutsam. Nun ist sogar das Oberkommando dort.“
Die anderen beiden Paare hatten nach zwei Walzern das Tanzen eingestellt und sahen uns zu. Tatjana schenkte weiter Sekt nach. Sie schien unzufrieden mit ihrer Wahl. Der Kerl schien stumm wie ein Fisch und wirkte dabei fast grimmig. Obwohl er der Hübscheste von unseren Besuchern war, erschienen mir seine Blicke, mit denen er uns heimlich musterte, etwas verlogen.
Mein Begleiter war dagegen ein typischer Russe. Der aufsteigende Alkohol machte ihn immer mutiger. Ich spürte, wie er sogar kess mit seinen Fingern zärtlichen Druck auf meine Hand und Taille ausübte und sie rein zufällig mal da, mal dorthin verrückte. Er war genau der Richtige für einen solchen Tag.
Wir setzten uns nach zwei weiteren Walzern zu den anderen. Natürlich gab mir Petja, so hieß mein Kadett, einen Handkuss zum Dank. Seine Lippen verweilten etwas zu lang. Nun ja, das gefiel mir. Tatjana nahm es etwas neidvoll zur Kenntnis. Sie hatte den Stockfisch abbekommen. Maria kicherte und hielt ihrem Tanzpartner auch die ihre Hand hin, der sie eifrig mit einem kleinen Küsschen bedachte. Seine Ohren glühten dabei wie Schmiedeeisen. Er hieß Oleg. Die nächste Flasche wurde geöffnet.
„Wie ist es so als Soldat“, fragte Maria recht naiv in die Runde.
Die drei sahen sich an.
„Es geht so“, hörte ich Oleg zum ersten Mal sprechen. „Ich bin froh hier zu sein!“, schüttete er sein junges unschuldiges Herz aus. Der Alkohol lockerte ihm die Stimme.
„In Petrograd weiß man nicht, wo man steht.“
Die beiden anderen warfen ihm bedeutungsvolle Blicke zu. Er sollte schweigen.
„Was heißt das?“, hakte ich gerade deswegen nach.
„Ach nichts!“, lenkte mein Tanzpartner ab. Ihm war das Thema unangenehm. „Wozu muss man sich an einem so schönen Tag Sorgen machen? Wollen die Damen vielleicht abermals tanzen?“
Schon war er aufgesprungen und machte uns zur Belustigung einen wilden russischen Kosakentanz vor. Seine Beine wirbelten, während er kniend hoch und runter sprang.
Ich mochte ihn.
„Ihr tanzt zu schlecht“, wehrte Tatjana ab. „Nein, lasst uns lieber würfeln!“, schlug sie schnippisch vor.
„Was ist der Einsatz?“, fragte Petja frech.
„Na, was wohl!“ Tatjana ließ eine Pause vergehen. „Ein Kuss! Die Gewinner dürfen sich küssen.“
Erstaunt sahen wir uns an. Petjas Gesicht leuchtete auf. Die Wendung war ganz nach seinem Geschmack. Er träumte sich wohl schon in den Armen einer Prinzessin.
„Ist das denn erlaubt?“, fragte er zur Sicherheit dumm nach.
Ich hatte nichts dagegen. Ein Kuss mit ihm könnte mir gefallen. Ein merkwürdig warmes Summen erfasste nicht nur mein Gesicht vor Aufregung.
„Erlaubt?“, spottete ich. „Das ist ein Befehl! Ihr habt den Befehl uns ordentlich zu unterhalten!“
Er salutierte: „Sehr wohl!“
Wir lachten. Nur einer nicht.
„Ich spiele nicht mit!“, druckste er herum und machte eine eiserne Mine. Es war Tatjanas mürrischer Tanzpartner.
Maria verstand nicht, warum er diese Chance nicht nutzen wollte.
„Wieso? Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir erzählen auch niemandem davon. Sei nicht so ein miesepetriger Stockfisch.“
„Ich habe keine Angst vor euch!“, schoss es aus ihm heraus. Der Alkohol lockerte auch seine Zunge.
Plötzlich lag eine ganz andere Stimmung, etwas Ernstes in der Luft.
„Was dann?“, hakte ich neugierig aus.
„Ich küsse keine Deutsche!“
Das schlug ein! Stille breitete sich aus. Die Stimmung war dahin. Dieser unverfrorene Kerl. Was erlaubte er sich?
Im gleichen Moment ertönte lautes Glockengeläut. Es war ein Achtungszeichen.
Verdutzt hörten wir alle auf den Klang.
Die Tür wurde aufgerissen. Ein Kadett stürmte in den Raum.
„Kommt sofort mit, man sucht euch schon!“, rief er diesen zu. „Wir werden neu vereidigt!“
Erst jetzt gewahrte er uns drei Romanow-Prinzessinnen.
Er nahm Haltung an.
„Der Zar hat abgedankt!“
Der Abend des 16. Juli 1918
Seit April wohnten wir bereits im Haus des Militäringenieurs Ipatjew in Jekaterinburg. Die Bolschewiken hatten es extra beschlagnahmt, um uns hier unterzubringen. Die Villa war relativ geräumig, weiß, von klassizistischem Stil und befand sich am Rande der Stadt. Ihre eigentliche Schönheit wurde jedoch durch einen riesigen Bretterzaun und drei bedrohliche Maschinengewehre auf dem Dach verschandelt. Die Fenster hatten die Rotgardisten zudem mit weißer Farbe getüncht, damit niemand uns, die unglücklichen Gefangenen, sah. So verlieh man dem wundervollen Bau äußerlich den Charme einer Baracke.
Sie war somit zu unserem Gefängnis umgestaltet worden. Da sowohl dreißig Bewacher als auch die Dienstboten darin ebenfalls untergebracht waren, standen meiner Familie nur sehr wenige Zimmer zur Verfügung. Das ließ alle Mitglieder noch enger zusammenrücken. Wir waren eine kleine Insel inmitten eines feindlichen Meeres.
Eine Einheit feindseliger Rotgardisten hatte uns von Tobolsk aus hierher gebracht, nachdem die aufständischen Kosaken die Roten aus Sibirien zu vertreiben drohten. Die aufkeimende Hoffnung auf Befreiung zerschlug sich so für uns. Wir waren unseren Bewachern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. 78 Tagen lebten wir nun hier. Angst und heimliches Hoffen bestimmten unseren Alltag. Jeden Einzelnen davon hatte ich gezählt.
Rasputins Voraussagen erwiesen sich als richtig. Seit seinem Tod hatte sich unsere Lebenssituation kontinuierlich verschlechtert. Papa hatte Rasputin nicht gerächt und dessen Mörder lediglich aus Petersburg verbannt. Die Deutschen schlugen unsere Armeen und in Russland brach die Revolution aus. Wir Romanows waren zu Gefangenen im eigenen Land geworden und Papa hatte abgedankt. Anstelle einen Prinzen zu heiraten, flickte ich die Socken oder Fußlappen unserer Bewacher. Fast alle unsere Verwandten waren ebenfalls inhaftiert oder sogar ermordet worden. Russland hatte inzwischen unter den Bolschewiki den Krieg ganz verloren und einen erniedrigenden Friedensvertrag mit den Deutschen geschlossen, der diesen große Teile Russlands und die gesamte Ukraine überließ.
Lenin und seinen roten Kumpanen hatte der Krieg aber trotzdem viel gebracht. Die Deutschen bezahlten ihn und er festigte mit dem deutschen Gold seine eigene Macht in Zentralrussland. Er war diesen ohnehin dafür dankbar, dass sie ihn 1917 über Finnland nach Russland eingeschleust hatten. Nur so hatte er zum Führer der proletarischen Revolution aufsteigen können.
Papa hatte, obwohl er gar nicht mehr Zar war, den Friedensvertrag von Brest-Litowsk mit unterzeichnen müssen. Das Deutsche Reich hatte darauf bestanden. Mama meinte, dass sich der deutsche Kaiser, unser Großonkel, dadurch nur versichern wollte, dass wir überhaupt noch lebten. Unser Leben war eine der deutschen Bedingungen für diesen schandvollen Vertrag gewesen. Die Verwandtschaft mit dem deutschen Kaiser hatte uns bisher offenbar gerettet.
Durch eine geheime Nachricht des kaiserlichen Botschafters, des Grafen von Mirbach-Harff, erhielten wir vor einiger Zeit die Mitteilung, dass der deutsche Kaiser bereit war, wirklich alles für unsere Befreiung zu tun und ein Sonderkommando beauftragen wollte. Leider weigerte Papa sich, diese Hilfe zu akzeptieren. Wilhelm der II. tat es ohnehin wohl mehr für Mama als für seinen Cousin. Man munkelte, dass der Kaiser noch immer unsere Mutter liebte. Auch er hatte einst um die Hand meiner Mutter angehalten. Diese hatte sich jedoch für unseren Vater entschieden, obwohl alle Seiten dagegen waren.
Zu groß war bis heute Papas Enttäuschung über den Verrat des deutschen Kaisers. Dieser hatte Russland 1914 den Krieg erklärt. Vater wollte lieber sterben, als sich von Wilhelm dem II. helfen zu lassen.
Mamas eindringliche Bitten, hier an die Kinder zu denken, nutzten nichts. Sein Stolz stand ihm leider im Wege. Mama wiederum vermochte ihren Gemahl nicht zu verlassen und schlug eine von Lenin in Aussicht gestellte eigene Ausreise mit allen Kindern ebenfalls aus. Sie liebte ihren Mann. Lenin hatte dem Berliner Kaiser angeboten, alle deutschen Familienmitglieder ins Reich zu schaffen. Nur unseren Vater wollte er richten. Dieser war für ihn an allen Problemen Russlands schuld. So waren wir Gefangenen in unserem Schicksal fest aneinander gebunden.
Erst die Nachricht von der Erschießung unsers Onkels Michail vor einem Monat ließ Papa seine Haltung ändern. Zuvor hatte er offensichtlich nicht wirklich geglaubt, dass man ihn und auch uns ermorden wollte. Er kannte sein Russland nicht.
Leider wurde der für uns agierende Graf von Mirbach-Harff am 07. Juli durch ein Attentat in Moskau ermordet. Dadurch schien ein gutes Ende nun nicht mehr möglich. Mama rechnete durch Rasputins Prophezeiung mit dem Schlimmsten und versuchte uns mit religiösen Gesprächen Mut zu machen.
Papa und ich wussten, dass sie dem Glauben zum Trotz die Kapseln dabei hatte. Das angeblich wunderschöne Himmelreich stand also doch hinter dem Leben hier zurück. Sie trug sie an ihrer Brust, sodass es selbst Papa nicht gelang, ihr diese zu entwenden. Er war der Meinung, das Blut wäre die größte aller Sünden. Der Tod wiege dagegen leicht.
Was gab es da noch zu sagen?
Seit Rasputins Ermordung und der gemeinsamen Fahrt in die geheime Schatzkammer hatte Mama nicht mehr mit mir über die Ampullen gesprochen. Für wen sie die zweite bestimmte, wusste ich nicht. Das blieb bis jetzt ihr Geheimnis. Ich verstand jedoch, wenn sie mir das Mittel gab, war unser Tod nah.
Unser Bruder würde wohl nie ein Zar werden. Vielleicht war das auch besser so. Das böse, hinterhältige und grausame Russland verdiente einen so guten Menschen wie ihn ohnehin nicht.
Wir bekamen inzwischen nur noch das gleiche Essen wie die Bewacher. Diese Gleichmacherei gehörte zu unserer Erniedrigung. Das Abendessen war zwar auch heute karg und einfach, jedoch hatte der freundliche Koch den Wunsch meiner jüngeren Schwester, Maria, erfüllt und zusätzlich russische Plinsen mit Apfelstückchen in der Pfanne gebraten. Solche Abwechslungen waren selten geworden. Er konnte sich dadurch schnell den Ärger des neuen Kommandanten zuziehen.
Ljoschka und ich hatten die Plinsen bisher noch nicht angerührt. Mein Bruder mochte sie gar nicht und ich hatte mir die Leckerei für den Schluss aufgespart.
Pawel Medwedew, der die Außenwachen befehligte, trat in den Raum, der uns als Esszimmer und Wohnzimmer gleichzeitig diente. Seine Augen musterten unseren Tisch. Interessiert schaute er auf die Küchlein und strich nachdenklich über sein stoppeliges Kinn. Sein Gesichtsausdruck wurde gierig, er sagte jedoch nichts. Man ahnte aber, dass er selbst gern ein solches Küchlein gegessen hätte.
„Herr Kommandant, dürfen wir Ihnen eine Plinse anbieten?“, fragte ich diesen direkt.
Papa nickte anerkennend und Mama lächelte mir zu. Zwar mochten wir unsere Bewacher nicht, bemühten uns aber ihnen gegenüber um Höflichkeit. Vater Grigorij hatte uns gelehrt, dass alle Wesen von Gott kämen, und so müssten wir sie respektieren, auch wenn sie uns im Moment negativ gegenüberstanden.
Man sah, dass der Rotgardist mit sich rang. Medwedew wollte wohl keine Geschenke der „Ausbeuter“ annehmen, andererseits war die Lust auf den seltenen, köstlich duftenden Leckerbissen groß.
Er trat zum Tisch und griff sich mit seinen schmutzigen Fingern – so als gehörte sie ihm ohnehin – die vor mir liegende Plinse.
Ein Ungar, der sich auf jüdische Art an der Seite zwei längere Zöpfe hatten wachsen lassen, trat ebenfalls ein. Da die Ungarn zumeist kein Russisch sprachen, redeten wir sie auf Deutsch an. Das beherrschten die meisten von ihnen, da es zudem die erste Amtssprache in ihrem Land war. Ungarn war ein Teil Österreichs.
Wir alle beherrschten recht gut Deutsch und auch Französisch. Mama gab sich sehr viel Mühe, uns ihre Muttersprache beizubringen. Wir sollten auf diese Weise nicht vergessen, dass wir solche Wurzeln hatten. Seit Papas Abdankung hatte sie die freie Zeit für weiteren Sprachunterricht genutzt. Scheinbar hoffte sie innerlich doch auf ein dortiges Exil.
„Möchten Sie vielleicht auch ein Küchlein?“, wagte ich den Ungarn trotz Medwedews Unverfrorenheit zu fragen.
„Aber gern, Madam!“, antwortete der Mann in korrektem Deutsch.
„Was tuschelt ihr da?“, fuhr der Kommandant der Außenwache uns auf Russisch an. Es war ihm suspekt, dass er unsere Unterhaltung nicht verstand.
„Wir haben ihm nur ebenfalls eine Plinse angeboten“, versuchte Mama die Situation zu erklären.
Der Aufgebrachte knurrte unzufrieden, schritt aber nicht ein, als ich dem Ungarn die Plinse von Alexej reichte. Dieser verspeiste sie dankbar.
„Schmeckt sehr gut!“ Er ließ es sich für den Moment nicht nehmen, höflich zu sein.
Medwedew brummelte so etwas wie: „Verfluchtes deutsches Gesindel!“
Dann wandte er sich an den jüdischen Ungarn:
„Habe ich dir das erlaubt?“, fuhr er ihn an.
Doch der verstand scheinbar kein Russisch oder tat listigerweise zumindest so. Er aß unbeeindruckt weiter. Wir mussten unwillkürlich schmunzeln.
Die Ungarn waren Kriegsgefangene, die die Bolschewiken gegen das Geschenk der Freiheit in ihre Garden gepresst hatten. Einige hatten zuvor gegen das gleiche Versprechen in der früheren Zarenarmee gedient. Unter den Bewachern waren etwa zehn Ungarn. So wollte man sicherstellen, dass nicht etwa russische Bewacher die Seiten wechselten und uns bei der Flucht halfen. Der neue Kommandant nahm an, dass wir den Ungarn egal und sie deswegen besser für die Bewachung geeignet wären. Dabei hatte Jurowski aber übersehen, dass die Ungarn meist Deutsch sprachen.
Er selbst unterhielt sich mit den ungarischen Wächtern auf Jiddisch, da die meisten von diesen und auch er es aufgrund ihrer Herkunft beherrschten. Da viele Bolschewiki wie Lenin, Trotzki und auch Swerdlow durch solche Wurzeln miteinander verbunden waren, glaubten viele unserer Adeligen in der Revolution eine jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung zu erkennen.
Der Ungar und sein Hauptmann verließen das Zimmer wieder. Sie hatten nur nach uns sehen wollen. Wir atmeten befreit auf.
„Lasst uns ein wenig lesen!“, schlug Mama vor.
Wir erwiderten nichts. Andere Ablenkungen gab es im Moment nicht. Etwas Trost war immer gut.
„Außenkommandant Medwedew hat heute besonders böse geschaut“, stellte Alexej nachdenklich fest.
Mein Bruder wirkte noch sehr mitgenommen von den Entbehrungen der letzten Monate. In Tobolsk war er beim Schlittern auf dem Eis gestürzt und musste seitdem im Rollstuhl sitzen. Ohne Rasputin war die Gefahr, dass er an einem Hämatom aufgrund seiner Bluterkrankung starb, zu groß.
Die Angst, seine kürzlich Erkrankung in Tobolsk und die Belastungen der letzen Monate erschwerten seine Genesung zusätzlich. Wie sollte ein Vierzehnjähriger diese Bedrohungen alle verarbeiten?
„Das bildest du dir nur ein“, lenkte Papa ihn ab.
„Er ist immer etwas übellaunig!“
„Ich lese heute freiwillig“, bot Tatjana sich an.
Sie wollte sich immer etwas vor Mama hervortun. Ich hatte mich damit abgefunden. Es gab heutzutage wahrlich Wichtigeres als die Rangordnung unter Geschwistern.
Papa hatte mich als Älteste ohnehin immer etwas bevorzugt. Da brauchte ich nicht eifersüchtig sein. Außerdem gab es zwischen mir und ihm ein ganz besonderes Band. Wir waren so etwas wie Seelenverwandte und verstanden uns auch ohne Worte. Mama hielt mir deswegen manchmal vor, ich liebe ihn mehr. Das war aber nicht so. Es war eine andere Liebe.
Die Not und die Ängste der Verbannung hatten uns beide tatsächlich noch mehr zusammengeführt. Papa ließ das Tatjana aber nicht merken. Oft schauten er und ich uns nur an und wir sahen alle Gedanken im Gesicht des anderen. Das bedurfte keiner Worte mehr. Die Tränen in unsere Augen verbargen wir jedoch vor den anderen. Auch diese Räson verband uns.
Tatjana ging in ihr Zimmer, um die Bücher zu holen. Unsere kleine Gruppe saß wortlos und wartete.
Plötzlich hörten wir dumpfen Kanonendonner. Die Scheiben klirrten, als versuchten sie ein Lied zu singen. Erschrockene Blicke wanderten zu den weiß getünchten Fenstern. Allerdings konnte man durch diese nicht hinaussehen.
Mama wirkte aufgeregt, ein Hoffnungsschimmer belebte ihr Antlitz. In Papas Gesicht spiegelten sich dagegen Sorgen wider.
„Was bedeutet das?“, wagte Anastasija zu fragen. Sie war meine jüngste und auch aufgeweckteste Schwester.
„Die Front rückt näher“, erklärte Papa. „Still!“