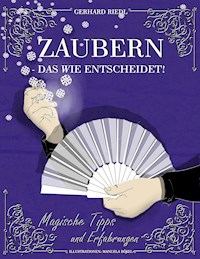
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wieso bewirkt der gleiche Trick beim einen Zauberkünstler kaum Applaus, während der andere dafür bejubelt wird? Gerhard Riedls Antwort: Weil das „Wie“, also die Art der Präsentation, entscheidet. Die Persönlichkeit des Vorführenden bewirkt spannende Unterhaltung, nicht seine Requisiten – der Star sind Sie! Zur Gestaltung einer überzeugenden Rolle muss man viele Aspekte in Einklang bringen: Kleidung, Bühnenbild, verbale Darstellung, Körpersprache, Tempo und Rhythmus des Ablaufs, Publikumskontakt und vor allem die Auslösung von Emotionen, um die Zuseher von der Suche nach Erklärungen abzubringen. Anhand von Beispielen aus beinahe dreißig Jahren eigener Zauberei zeigt Ihnen der Autor, wie man Effektfolgen so gestalten kann, dass nicht der „Trick“ im Vordergrund steht, sondern dessen Erlebniswert. Ein großes Kapitel ist einer ganz eigenen Welt, der Zauberei für Kinder, gewidmet. Gerade hierbei sind die schauspielerischen und psychologischen Gesichtspunkte weit wichtiger als die Auswahl der Kunststücke! Wie kommt man zu Engagements und gestaltet den Kundenkontakt? Auch für das oft unterschätzte „Drumherum“ von Werbung über Vertragsgestaltung bis Vorführbedingungen erhalten Sie eine Fülle realistischer Tipps aus der Erfahrung von fast tausend Auftritten. Führen Sie in Zukunft keine Rätsel vor, sondern erfüllen Sie die Träume Ihrer Zuschauer!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Gleich mal zu Beginn
Die Zauberei in meinem Leben
Damit Sie dieses Buch nicht vergeblich kaufen
Der Star sind Sie!
Die Persönlichkeit entscheidet
Ihre Rolle als Magier
Kleidung und Erscheinungsbild
Ihre Körpersprache
Die verbale Darstellung
Zaubern mit Worten: Piano-Trick
Der passende Vortrag
Ihre Requisiten
Kontakt mit dem Publikum
Vom Trick zum Zauberprogramm
Hauptsache unerklärlich?
Reicht die Vorführung von Rätseln?
Ten Card Poker Deal
Der Zauberhandel verkauft Illusionen
Die Routine: paralleler Lauf der einzelnen Spuren
Beispiel: meine Schwammballroutine
Der Zuschauer als Helfer
Das Spiel mit dem Zuschauer: Knotenroutine
Zaubern zur Musik
Musik schafft Emotionen: Wintertime in China
An das glauben, was man tut
Opening: Damit steht und fällt Ihr Auftritt!
Beispiele: So könnte es beginnen
Ihre Schlussnummer: Das sollte hängen bleiben!
Aufsitzer: Sackgasse für Besserwisser?
Ein klassischer Aufsitzer: die Hasenwanderung
Die Abenteuer des Geistes: Mentalmagie
Meine Lieblingseffekte mit den Gedanken
Auswahl der Zaubernummern: Was geht überhaupt?
Weniger ist mehr: Zeitpunkt und Dauer des Auftritts
„Variatio delectat“: die Zusammenstellung des Programms
Kinderzauberei – eine andere Welt
„Es ist ja nur für die Kleinen“
Die verschiedenen Altersstufen
„Die Kinder können sich ja auf den Boden setzen“:die äußeren Bedingungen
Die Steuerung der Inszenierung:So behalten Sie das Ruder in der Hand!
Der Weg zur Erlebniswelt der Kinder – wichtige Strategien
Tricks speziell für Kinder? Meine persönliche Auswahl
Das Drum und Dran
Der erste Kontakt – meist telefonisch
Die Vereinbarung mit dem Kunden – Vertrag oder Vertrauen?
Zauberauftritte – die verschiedenen Formate
Und was kostet das?
„Was brauchen Sie jetzt alles?“ – Stress vor Ort
Wichtiger als die Requisiten: Ihre sonstige Ausstattung
Das bleibt hängen: Ihr Bühnenbild
Wer nicht wirbt, stirbt: Ihre Außendarstellung
„Den Trick kenn’ ich schon!“ – die lieben Kollegen
„Neuartig“ und „professionell“ – Kampfparolen einer Geisterdebatte
Bonusroutine: Sonne und Mond
Was noch zu sagen ist
Angaben zu den im Buch erwähnten Zauberkünstlern
Liste ausgewählter Zauberhändler
Verwendete Literatur
Zum Autor
GLEICH MAL ZU BEGINN
Die Zauberei in meinem Leben
So weit ich noch zurückdenken kann, war es gar nicht die Zauberei speziell, die mich als Kind besonders interessierte. Vage erinnere ich mich an den Auftritt eines Magiers in der zweiten oder dritten Klasse der Grundschule: Stumm und zu Begleitmusik spulte der eine Vielzahl von eher manipulativen Effekten ab, was mich mehr verstörte denn unterhielt. Jahrzehnte später lernte ich einen Satz unseres großen Lehrmeisters Dai Vernon kennen: „Verwirrung ist keine Zauberei!“ Daran muss es wohl gelegen haben…
Was mich jedoch schon Wochen vorher in Atem hielt, war das jährliche Volksfest. Dort zogen mich allerdings wegen einer veritablen Höhenangst weniger die Fahrgeschäfte an, vielmehr die ganze Atmosphäre: Musik, bunte Lichter, exotische Gerüche, Zuckerwatte – und als Höhepunkt das Feuerwerk, für das ich mir bereits eine Stunde zuvor den besten Zuschauerplatz suchte. Das alles stand in einem solchen Kontrast zu meinem ziemlich glamourfreien, kleinbürgerlichen Elternhaus, dass ich dieses manchmal gerne gegen den Wohnwagen eines Schaustellers getauscht hätte!
Ein Weg aus der recht farblosen Spießigkeit meiner alltäglichen Umgebung war die Erkenntnis, dass Pyrotechnik ziemlich viel mit Chemie zu tun hat, was über einen Experimentierkasten und ein Heimlabor später zu meinem Chemiestudium führte. Niemals aber hätte es mir gereicht, in diesem Fach am Schreib- oder Experimentiertisch einer Firma oder Forschungsstätte zu arbeiten. Nein, ich wollte anderen etwas vorführen, was mich zum Lehrberuf zog. Viele chemische Effekte muten ja wie Zauberei an, und diese Faszination wollte ich weitergeben.
Der Startschuss zur magischen Kunst fiel, als ich im Alter von dreizehn Jahren von einem Freund erfuhr, dass er einen Zauberkasten besitze. Da mein Kumpel schon einige Jahre älter und daher zunehmend an anderen Dingen interessiert war, schenkte er mir diesen. Obwohl das Angebot bescheiden war, studierte ich mit Feuereifer die beschriebenen Effekte ein und las alles, was mir zum Thema Zauberei in die Finger kam (damals ein eher begrenztes Unterfangen – das Internet hieß ja in meiner Jugendzeit noch „Stadtbücherei“…).
Natürlich präsentierte ich das Gelernte umgehend anderen , was mich zur Verletzung einer der wichtigsten Grundregeln unseres Faches trieb: Niemals Prophet im eigenen Lande sein wollen! So blieben die Auftritte vor Eltern und Verwandten weitgehend folgenlos. Das für Protagonisten der Zauberkunst so wichtige dicke Fell hatte ich mir noch nicht zugelegt – folglich geriet ich ganz schön ins Schlingern, wenn meine Mutter kurz vor dem entscheidenden magischen Effekt Sätze brachte wie „Jetzt muss ich aber nach dem Nudelwasser gucken!“ Da ich ebenfalls nicht wusste, wie schwierig es ist, vor Kindern und Jugendlichen zu bestehen, warfen mich die obligatorischen Sprüche gleichaltriger Freunde völlig aus der Bahn: „Den Trick kenn’ ich, ich weiß, wie das geht.“
Warum ich nicht (wie die meisten) das Fuchteln mit dem schwarzweißen Stab umgehend wieder einstellte, lag wohl an einer speziellen Charaktereigenschaft von mir: Wenn ich etwas wirklich will, raste und ruhe ich nicht, bis ich es erreicht habe. So versuchte ich, derartige Erfahrungen positiv umzusetzen, nämlich als wichtige Information darüber, was an meiner Präsentation noch nicht stimmte. Zudem war ich in den nächsten Jahren in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv und leistete meinen Zivildienst bei geistig behinderten Kindern ab: In beiden Bereichen war es gelegentlich günstig, Unterhaltungsbeiträge liefern zu können. (Highlight war sicherlich eine Vorstellung bei einem Zeltlager, wo nicht nur die Teilnehmer, sondern praktisch die gesamte Einwohnerschaft des benachbarten Dorfes anwesend war und ich vor dem Lagerfeuer, beleuchtet von zwei Autoscheinwerfern, meine mehr als bescheidenen Künste darbot. Wieso ich dennoch rauschenden Beifall erhielt, sollte mir erst Jahrzehnte später klar werden…)
Zunehmend trat dann aber eine weitere Leidenschaft auf den Plan: das Tanzen. Wieder ging es darum, eine Faszination auf andere zu übertragen, freilich hier eins zu eins und mit ganz anderen Tricks… Schließlich nahm das Studium (noch dazu weit vom Heimatort entfernt) meine zeitlichen und mentalen Kapazitäten voll in Beschlag. Der Zauberkasten lag derweil bei meinen Eltern im Keller…
Auf Seite Eins meines dicken Albums mit Erinnerungen klebt ein Kassenzettel der Universitätsbuchhandlung meines Studienorts vom 20.12.1975. Als Weihnachtsgeschenk erstand ich dort nämlich ein Kochbuch für meine Mutter (wie originell…), und da sich dieses in der Abteilung „Hobby“ fand, geriet ich zufällig auch an eines der besseren Zauberbücher: „Zaubertricks – Das große Buch der Magie“ von Jochen Zmeck. (Weder wusste ich damals, dass es sich um einen Berufskollegen – Lehrer für Chemie – noch gar einen der berühmtesten Vertreter der magischen Zunft handelte.) Für stolze 12,80 DM erstand ich das Werk und stellte bald fest, dass die dort beschriebenen Kunststücke schon ein anderes Kaliber darstellten als die mir bislang bekannten!
Dennoch hielten mich bis 1979 noch Staatsexamina und Referendarzeit weitgehend davon ab, die Effekte ernsthaft einzustudieren und vor Publikum zu erproben. Erst als ich beruflich in etwas „ruhigerem“ Fahrwasser landete, unternahm ich derlei Versuche – freilich einschließlich des oben schon beschriebenen Fehlers: Ich zauberte vor Bekannten und Kollegen. Der Zuspruch war zwar nun deutlich größer, ging jedoch trotzdem nicht über „recht nett“ hinaus. Inzwischen wusste ich auch schon, dass man Requisiten bei einschlägigen Händlern kaufen konnte – und dass es da Tricks gab, welche meine Kartentricks oder den „springenden Gummiring“ in den Schatten stellten. Die Preise lagen deutlich jenseits dessen, was meine damalige Partnerin unter „vernünftigen Anschaffungen“ verstand. Überhaupt war für sie eine solche Beschäftigung „Kinderkram“ und daher eines erwachsenen, gebildeten Mannes nicht würdig – schon gar nicht, wenn sie Geld kostete.
Nachdem wir uns getrennt hatten, blieb mir zwar weit weniger als die Hälfte des Geldes, dafür musste ich niemand mehr fragen, wofür ich es ausgeben durfte. In meiner einstweiligen Unterkunft existierte zwar kein Kleiderschrank, aber dafür traf von Zeit zu Zeit ein dickes Packet eines Zauberhändlers ein. Nie werde ich den Moment vergessen, an dem ich meiner neuen Partnerin (und jetzigen Frau) zum ersten Mal klopfenden Herzens eine kleine „Zaubershow“ darbot. Sie war begeistert – und auch, als wir keine getrennten Kassen mehr hatten, war ihre Antwort auf die Schilderung eines neu angebotenen Zaubereffekts stets: „Na, dann kauf ihn dir doch!“ Mehr noch: Wann immer es ihre Termine zulassen, begleitet sie mich bis heute als Assistentin – fährt mich also zu Auftritten, schleppt Requisiten, verhandelt mit dem Veranstalter, kümmert sich um Licht und Ton, hält vorwitzige Zuschauer vom Untersuchen meiner Utensilien ab, bügelt während der Darbietung meine Patzer aus und pflegt die empfindsame Künstlerseele….
Nachdem ich nun mehr Zeit auf mein magisches Hobby verwenden durfte und auch die Requisiten professioneller wirkten, wurden wir zunehmend im Bekanntenkreis „herumgereicht“ – und auf Grund von Empfehlungen landeten wir gelegentlich schon bei Leuten, die wir überhaupt nicht mehr kannten. Warum also die Zauberei nicht gleich öffentlich anbieten? Ende 1985 platzierte ich einige Inserate in diversen Anzeigenblättern. Der erste Anruf wird mir immer im Gedächtnis bleiben: Ein Herr erkundigte sich, ob wir bei einer „kleinen Gesellschaft“ mit zirka zwei Dutzend Personen eine halbe Stunde auftreten würden. Ja, aber gerne! Als er mir Namen und Anschrift gab, wurden mir allerdings die Knie weich – ein echter Baron in einem veritablen Schloss!
Stets sehe ich noch vor mir, wie wir nach Passieren der Zugbrücke von diskreten Bediensteten in ein Vorzimmer gebeten wurden, wo wir unseren Auftritt vorbereiten konnten, um dann vor dem Dessert an eine fein gedeckte Tafel mit illustren Gästen in Abendkleidung geleitet zu werden. Ich hatte mich zwar in einen schwarzen Anzug mit silbergrauer Krawatte geworfen, aber ansonsten boten wir mit unserem Teewägelchen als Abstellfläche und einem schwarzen Pappkoffer wohl eher einen bescheidenen Eindruck. Doch die „Show“ kam sehr gut an, wir erhielten das Vierfache des vereinbarten Honorars und in der Folge noch zwei Reengagements. (Wiederum überlegte ich damals nicht, warum dies so war, siehe oben!)
In jenem Jahr (1986) gab ich insgesamt 35 Vorstellungen – einige davon an meiner Schule; dort kommt es speziell vor den Ferien sehr gut an, wenn man noch etwas anderes kann als unterrichten. Zudem lernte ich in dieser Zeit zwei Zauberkünstler kennen, die mich bis heute geprägt haben: Punx und Marvelli jr. (Letzteren sogar live bei einigen Auftritten). Ich wusste sofort: Diese feinsinnigen Darbietungen mit geistvollpoetischen Texten passten zu mir, so wollte ich zaubern! Weiterhin entdeckte ich die Dai Vernon-Routine des Chinesischen Ringspiels, die ich in Rekordzeit einstudierte und stets als Schlussnummer zeigte.
Zu einer Schulvorstellung erschien dann ein Lehrerkollege, der ein sehr erfahrener, ja preisgekrönter Zauberkünstler war. Seine kritische Frage hinterher: Warum ich eigentlich die Nummern, ja sogar den Vortragsstil großer Magier „abkupfere“, anstatt mir neue, eigenständige Effekte zu überlegen? Insbesondere die „ausgeleierten Ringe“ zeige doch jeder – ich solle mir etwas Originelleres einfallen lassen! Diese Sichtweise stürzte mich damals in eine ziemliche Krise: Bot ich „Plagiate“, anstatt eine individuelle Bühnenpersönlichkeit zu entwickeln? Andererseits kamen gerade Klassiker wie das Ringspiel bei meinem Publikum sehr gut an!
Zum Glück blieb ich damals meiner Linie treu. 1987 meldete ich mich zu einem regionalen Zauberwettbewerb an – und gewann ihn trotz einer Darbietung, die nach meiner heutigen Einschätzung bescheiden und alles andere als perfekt war! Ein Jahr später nahm ich wieder teil, konnte mich nun aber nicht einmal unter den ersten Drei platzieren. Der Unterschied? Beim ersten Mal ließ man das Publikum abstimmen, beim nächsten Mal eine Fachjury. Seitdem lautet meine Devise: Ich führe meine Kunststücke Laien vor, nicht Zauberkollegen! Daher blieben meine Kontakte zu magischen Vereinigungen auch sehr gering.
1995 wurde ich an ein anderes Gymnasium versetzt. Zum Abschied gab ich meinen Kollegen bei einem Sommerfest eine Vorstellung – wie meistens mit dem Ringspiel als Schlussnummer. Mein Kritiker von einst war wieder dabei, und im Anschluss rief er mir begeistert zu: „Du hättest sehen sollen, wie die Ringe im blauen Scheinwerferlicht glänzten – einfach magisch!“
Inzwischen ist der tausendste Auftritt in Sicht, und ich bin bei meinem Stil der klassischen Salonmagie mit poetisch-kabarettistischen Texten geblieben. Um den professionellen Bereich mit Agenturen und großen Gagen habe ich mich nie bemüht, schon da mein Hauptberuf eine Vierzigstundenwoche als Zauberkünstler nicht zuließ. Außerdem ist die Kammerspielform, die mir besonders liegt, sowieso nichts für die große Bühne. Zwar besitze ich genügend Requisiten, mit denen ich schon einmal auf einem Ball oder einer Kongressveranstaltung vor 300 Gästen bestehen kann, aber meist ist es doch eher das Nebenzimmer einer Gaststätte bei einer Familienfeier oder das Wohnzimmer anlässlich eines Kindergeburtstags.
Der nahe Kontakt mit den Zuschauern gibt mir sehr viel, und es ist eine große Aufgabe, ohne Vorhang, Lichttechnik, Bodennebel und Bühnenpersonal dennoch eine überzeugende Inszenierung zu bieten. Jedes Mal, wenn wir unsere Ausstattung ins Auto packen und zu einem Auftritt fahren, spüre ich den Reiz dieser Herausforderung. Und so lange es Alter und Gesundheit zulassen, wird es weitergehen – und ich genieße ja den Vorteil, nur selten Bühnentreppen bezwingen zu müssen…
„Als Zauberkünstler kannst du, egal in welchem Alter, zu den Kindern an den Strand gehen und Sandburgen bauen.“ (Hank Moorehouse)
Damit Sie dieses Buch nicht vergeblich kaufen
… denn umsonst ist es eh nicht. (Haha, alter Moderatoren-Gag!)
Bücher mit Beschreibungen von Kunststücken gibt es wie Sand am Meer. Schon deshalb wollte ich kein weiteres verfassen. Bezeichnenderweise eint Laien und Insider das heftige Bemühen, hinter den „Trick“ zu kommen. Das Großhirn ist halt erst beruhigt, wenn „Übernatürliches“ ausgeschlossen werden und man sich mit der rationalen Erklärung wichtig machen kann! Sollten Sie also keine Ruhe finden, bis Sie herausgekriegt haben, welche Täuschungsmanöver beispielsweise beim Chinesischen Ringspiel zur Anwendung kommen, dann nichts wie ran an den Computer! Googeln Sie einfach die Angebotslisten diverser Zauberhändler (Adressen finden Sie im Anhang). In spätestens fünfzehn Minuten können Sie Ihre Online-Bestellung aufgeben und erhalten drei Tage später die Beschreibung (am besten gleich mit einem Satz Ringe). „Geheimes Wissen“ gibt es in unserer digitalen, vernetzten Welt kaum noch.
In meinem Buch werden Sie Ihre Neugier jedoch nur punktuell stillen können. Dai Vernon (wohl der größte magische Theoretiker des 20. Jahrhunderts), dessen Handhabung des Ringspiels ich schon an die 700 Mal vorgeführt habe, sagte dazu:
„Eine Straße weiter gibt es ein Musikgeschäft, wo Sie sich vielleicht eine Violine kaufen. Einige Häuser daneben finden Sie eventuell ein Zaubergeschäft, wo Sie diese Ringe erwerben können. Aber in beiden Fällen müssen Sie dann nach Hause gehen und lernen, wie man spielt.“
Wenn Sie also eine Möglichkeit suchen, bei der nächsten Geburtstagsfeier mit einem „tollen Kartentrick“ zu glänzen oder ihre Stammtischbrüder mit einem „lustigen Requisit“ so richtig foppen wollen, bietet sich Ihnen eine riesige Auswahl diverser Artikel und Veröffentlichungen. Mein Buch dagegen würde Sie sicher enttäuschen! Für mich ist das „Gewusst wie“, der technische Hintergrund, nur eine notwendige Grundlage, ab der es erst spannend wird: Zwischen dem „Modus operandi“ und der wirklich magischen Wirkung liegen Lichtjahre – eine Reise, auf die ich Sie gerne mitnehmen möchte.
Meine Warnung aber: Das kann dauern...
Als Beispiel schlage ich Ihnen vor, sich einmal auf YouTube die Vorführung des „Gläsernen Herzens“ von Punx anzusehen:www.youtube.com/watch?v=rvgBCgmgAfE
Sollte das Video irgendwann nicht mehr im Internet zu finden oder Ihr Computer gerade abgestürzt sein, hier eine kleine Inhaltsangabe: Punx tritt als Ehrengast in der „Marvelli-Show“ auf. In der Kulisse einer altertümlichen Bibliothek erzählt er (frei nach Wilhelm Hauff) im Märchen vom Gläsernen Herzen von einem unermesslich reichen Mann: Durch die Freude an seinem Geld wurde dessen Herz immer härter, und als er eines Abends eine Bettlerin verjagte, erstarrte sein Herz zu Glas – er konnte sich über nichts mehr freuen, nicht einmal über seinen Reichtum. Seine Versuche, wieder ein lebendiges Menschenherz zu bekommen, führen ihn nach vielen Irrwegen zu einer Hexe, die dafür aber sein ganzes Geld verlangt. Ein Glasrahmen mit Herzornament wird beiderseits von „zwei lebendigen Menschenherzen“ (aus rotem Papier) bedeckt und alles mit einem Stilett durchbohrt. Wird der „Pfeil des Gottes Amor“ wieder herausgezogen, sind zwar die Papierherzen perforiert, nicht aber das Glas, denn der reiche Mann hatte im entscheidenden Moment „an etwas Böses gedacht: Geld! Und daher ist es das Schicksal der Geizigen, dass sie ein Herz haben – kalt und freudlos – ein Herz aus… Glas!“
Ludwig Hanemann alias Punx hat diesen Effekt über 40 Jahre, auch in großen Sälen und Theatern, vorgeführt – er wurde sein Markenzeichen. In seinem Buch „Setzt Euch zu meinen Füßen…“ beschreibt er ihn mit dem Hinweis, er wolle aufzeigen, „wie man durch einen Vortrag aus einem simplen Durchdringungstrick ein Kunststück mit künstlerischer Aussage machen kann.“ Tatsächlich wird es Ihnen schnell gelingen, auf dem magischen Markt ein Requisit zu finden, bei dem solides Glas (meist nach Bedeckung) folgenlos durchbohrt wird. Das können Sie dann stumm zur Musik vorführen oder einen beschreibenden Text bringen in der Art von „Hier habe ich eine ganz normale Glasscheibe…“
Fig. 1
Fig. 2
Damit haben Sie etwas gezeigt, was den Naturgesetzen widerspricht; das Großhirn des Zuschauers wird dagegen rebellieren und nach einer Erklärung suchen – und wenn Sie Pech haben, diese auch finden. Mit der Botschaft „Geld macht nicht glücklich“ dagegen, eingebettet in eine märchenhafte Geschichte, appellieren Sie an das Herz des Publikums – statt Irritation bekommen Sie Sympathie. In seinem oben zitierten Buch schreibt Punx, er habe es noch nie erlebt, dass jemand auf das Trickgeheimnis neugierig war. Kein Wunder!
Wenn Sie nun schon am Computer sitzen, könnten Sie sich noch die Vorführung des „Gläsernen Herzens“ von einem anderen Zauberer, mit exakt den gleichen Requisiten, ansehen:www.youtube.com/watch?v=--oTqBSZonY
Überlegen Sie einmal, was die beiden Vorführweisen unterscheidet!
Im Gegensatz zu den meisten Büchern über Zauberei werden Sie in meinem keine vorwiegende Sammlung von Trickbeschreibungen finden! Ich gehe davon aus, dass Sie schon etliche magische Effekte so weit beherrschen, dass Ihnen eine Vorführung ohne Enthüllung des Geheimnisses gelingt (oder Sie dies nun ernsthaft in Angriff nehmen). Wie Sie dann aus dem Trick ein Kunststück machen können, möchte ich Ihnen – an Beispielen aus meinem Repertoire – nahebringen.
Nicht das Was entscheidet, sondern das Wie – und davon handelt mein Buch!
Daher werde ich den technischen Hintergrund und den Ablauf von Zaubereffekten immer nur als Beispiel für ein Thema wählen, welches mir allgemein am Herzen liegt. Wenn Sie die gleiche Wirkung mit anderen Manövern hinbekommen – umso besser! Zudem würde ich mit der Beschreibung genauer Texte und Trickfolgen eventuell auch Urheberrechte verletzen, nämlich wenn ein Kollege oder Zauberhändler eine solche Beschreibung bereits genauso vorführt bzw. verkauft. Eifersucht und Futterneid sind in unserem Gewerbe (natürlich nur hinter dem Vorhang) weit verbreitet – und ich habe keine Lust, mich mit diversen Unterlassungsklagen der „lieben Konkurrenz“ herumzuschlagen. Glücklicherweise sind jedoch viele Prinzipien der Täuschung längst Allgemeingut, so dass ich Ihnen guten Gewissens einige davon anvertrauen kann. Und etliche Ideen habe ich ja auch selber entwickelt und darf sie daher unbesorgt weitergeben…
So, nun wissen Sie zumindest, was der Kauf meines Buches Ihnen nicht bringt!
(aus der „Marvelli-Show“)
DER STAR SIND SIE!
“People will forget what you said, and what you did, but they will never forget the way you made them feel.”
(Maya Angelou)
Die Persönlichkeit entscheidet
Den Teilnehmern meiner Zauberkurse habe ich öfters die folgende Aufgabe gestellt:
Erinnern Sie sich an die letzte Zaubervorstellung, die Sie gesehen haben!
Wie war der Name des Künstlers?
Beschreiben Sie den Eindruck, den er auf Sie gemacht hat!
Können Sie kurz den Ablauf eines seiner Kunststücke wiedergeben?
Das übliche Ergebnis: An den Namen des Kollegen erinnerte man sich nur selten („irgendwas mit–ini“), ebenso erhielt ich kaum jemals eine halbwegs genaue Darstellung eines gezeigten Effekts (lediglich manchmal Aussagen wie „etwas mit Karten“, „ein Seiltrick“, „kleine Bällchen sind gewandert“, „er hatte eine Waschbär-Handpuppe“ etc.). Der persönliche Eindruck des Zauberers, der „Typ“ hingegen war den Angesprochenen noch recht präsent, also ob man ihn beispielsweise routiniert, freundlich, witzig, charmant oder aber distanziert, dilettantisch, albern bzw. langweilig fand.
Was ich Ihnen damit klarmachen will: Das Publikum bewertet in erster Linie Sie und nicht die von Ihnen gezeigten Zaubereffekte!
Die Wahrheit ist sogar noch extremer: Ab Beginn Ihres Auftritts haben Sie maximal eine Minute Zeit, sich von den Zuschauern einschätzen zu lassen. Das ist nicht anders als beim Gespräch mit einem neuen Kunden oder einem Arzt, der Sie zum ersten Mal untersucht. Auch hierbei etabliert sich bei Ihnen schnellstens das Gefühl, ob Sie Ihr Gegenüber sympathisch, interessiert und kompetent finden oder nicht.
Ihre Rolle als Magier
Merke:
Männer möchten gerne Zauberer sein – so wie Frauen Prinzessinnen!
Zunächst sollten Sie sich entscheiden: Wollen Sie sich dem „Mainstream“ stellen? Vor einem Rockerclub beispielsweise kommt eine martialische Figur in Lederkluft, die sich aus Stahlketten befreit, bestimmt bestens an, und gewisse Kreise finden es sicher herrlich „schräg“, falls Sie sich als durchgeknallter Psychopath gleich einmal einen 5 Zoll-Nagel durch die Zunge treiben. Oma und Opa (und auch die meisten anderen Zuschauer) werden es bei der Feier ihrer Goldenen Hochzeit aber attraktiver finden, wenn Sie höflich und nett, also „normal“ daherkommen. Studieren Sie einmal den Typus von Moderatoren, die in den Medien hohe Einschaltquoten erzielen, dann wissen Sie, was man unter „Massengeschmack“ versteht!
„Ein Zauberkünstlerist ein Schauspieler, der einen Zauberer darstellt.“
(Jean EugèneRobert-Houdin)
Wenn Sie kein professioneller Mime sind, sollten Sie Ihre Bühnenrolle nicht allzu weit von Ihrer tatsächlichen Persönlichkeit ansiedeln. Aber beachten Sie den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung! Möglicherweise bemerken die Zuschauer bei Ihnen andere Eigenschaften als diejenigen, welche Sie sich selber zubilligen. (Persönlich sehe ich mich beispielsweise eher als zurückhaltend und sensibel, während Beobachtern meiner Auftritte vorwiegend Begriffe wie „überlegen“ und „selbstsicher“ einfallen.) Auf jeden Fall gilt stets die Außenansicht – und aus der müssen Sie Ihre Rolle entwickeln! Das Gegenteil sieht man leider nicht selten: Künstler, die den Typ verkörpern möchten, der sie gerne wären – und denen das Publikum genau das nicht abnimmt…
„People pay for background“ – „Die Leute zahlen für Niveau“
(Harlan Tarbell)
Als Zauberer sind Sie nicht der „Herr Müller von nebenan“, sondern ein Mensch mit ganz besonderen, herausragenden Fähigkeiten. Daher muss Ihr Auftreten stets eine Klasse besser (oder zumindest „anders“) sein als das der übrigen Gäste. Dies gilt für die Gepflegtheit Ihrer Erscheinung, Ihre Kleidung, Ihre Sprache, Ihre Bewegungsweise, das Aussehen der Requisiten und vor allem die Kommunikation mit dem Publikum.
Daraus erklärt sich die Problematik von Darbietungen vor nahe stehenden Menschen. Diese kennen Sie in Ihrer alltäglichen Rolle und nehmen Ihnen daher den Wechsel zum „Zauberer“ nur schwer ab. Ein Großteil der magischen Wirkung ergibt sich aber genau aus dieser persönlichen Ausstrahlung! Aus dem gleichen Grund vermeide ich es, mich vor meiner Darbietung schon im Publikum sehen zu lassen. („Kommen Sie doch eine Stunde früher, dann können Sie noch mit uns essen!“) Ich möchte die Schauspieler einer Theateraufführung auch nicht vor Beginn im Kostüm an der Bar stehen sehen – meine Illusion wäre dann beeinträchtigt.
„Magier“ ist ein Archetyp, der bei den meisten schon ab dem Kleinkindalter geprägt wird. Ich habe immer wieder festgestellt, dass dieses Bild durchaus noch bei Erwachsenen aktiv ist. „Alltägliche“ Schwierigkeiten wie die Suche nach einem Parkplatz, den Transport sperriger Utensilien über enge Treppen oder den Krieg mit Stromanschluss und Verlängerungskabel vermutet man bei Ihnen eher nicht. Auch volljährige Veranstalter sehen Sie irgendwie als einen, der auf dem Besen einfliegt, sich vor das Publikum stellt, die Requisiten aus der Luft greift und – einfach zaubert. Dass Sie jedoch für ein Dreiviertelstunden-Programm eine dreistellige Zahl von Einzelteilen ein- und auspacken, platzieren und eventuell noch präparieren, sich um Licht und Beschallung kümmern müssen, sollten Sie sehr diskret handhaben. Wenn die Zuschauer Sie vorher schon beim Zusammenschrauben irgendwelcher Geräte oder dem Kampf mit Musikanlage plus Mikrofon bewundern dürfen, nimmt man Ihnen hernach nicht mehr ab, dass Sie über den Naturgesetzen stehen!
Sie sind das Alphatier – nehmen Sie diese Rolle an!
Wegen Ihrer vermuteten Fähigkeiten steht diese Funktion sowieso für Sie bereit (falls Sie diese nicht schon im Vorfeld durch Ihr Verhalten ruiniert haben). Ab Beginn des Auftritts sind Sie mit Abstand die wichtigste Person im Raum – das müssen Sie aber voll akzeptieren und umsetzen! Leider sieht man das Gegenteil recht häufig: Kollegen, die sich vorab dafür entschuldigen, dass sie jetzt zaubern, wo es doch echte Zauberei gar nicht gäbe (am besten noch begleitet von diversen Übersprungs- und Verlegenheitsgesten, inklusive hängenden Schultern sowie gesenktem Kopf). Wundert es Sie dann, wenn denen (vor allem bei Kindervorstellungen) die Inszenierung ganz schnell entgleitet, Sie sich der Zwischenrufe und anderer Störungen kaum noch erwehren können – und das bei mäßigem Beifall? Ergehen Sie sich am Anfang nicht in Reflexionen der Situation, sondern kommen Sie (wie jedes andere Alphatier auch) herein und ganz schnell zur Sache – nämlich zur Zauberei!
Haben Sie im Zirkus schon einmal Raubkatzen vor Beginn der Dressurdarbietung dabei beobachtet, wie begierig die sich vor dem Laufgitter drängen, weil sie unbedingt in die Manege wollen? Und Sie? Treibt es Sie unverzüglich und dringend auf die Bühne, um den Zuschauern endlich Ihre Fähigkeiten zu beweisen? Wirklich sofort und ohne Einschränkungen wie „vielleicht“, „einerseits“ und „eigentlich“? Sorry, aber wenn dieses „Rampensau-Gen“ in Ihrem Erbgut fehlt, wird es schwierig – lernen kann man das nur sehr begrenzt! Zum Trost bleibt Ihnen dann immer noch die Beschäftigung, welcher die Mehrzahl der Hobbymagier nachgeht: Zaubertricks sammeln und zu Hause am Schreibtisch ausprobieren.
Fazit:
Das Maximum an persönlicher Überzeugungskraft haben Sie erzielt, wenn Sie dem Publikum nicht mehr zeigen müssen, dass beispielsweise eine Kiste leer ist, sondern es reicht, wenn Sie dies glaubhaft versichern...
Kleidung und Erscheinungsbild
(Weibliche Magier dürfen dieses Kapitel überlesen!)
Eine wichtige Grundregel vorweg: Wenn die Gäste bei einer Veranstaltung wissen, dass ein Zauberkünstler auftreten wird, und Sie dann auftauchen, muss jeder sicher sein: Der ist es!
Ein gepflegtes, bühnentaugliches Aussehen ist selbstverständlich – oder möchten Sie sich während der Darbietung alle zehn Sekunden die Haare, welche Ihnen ständig in die Stirn fallen, nach hinten wischen? Besonders genau werden Ihnen die Zuschauer auf die Finger sehen – eine gründliche Maniküre ist Voraussetzung! Spätestens im Scheinwerferlicht wirkt Ihr Gesicht mit einem leichten Makeup nicht mehr blass und glänzend. Lassen Sie sich hierbei von Fachleuten (oder zumindest Ihrer Partnerin) beraten und helfen, es lohnt sich! (In jedem Fernsehstudio gibt es Maskenbildnerinnen, an denen kein Talkshow-Gast vorbeikommt.)
Ihre Kleidung hängt natürlich von der Rolle ab, die Sie spielen. Wenn diese Abstimmung passt, haben Sie ein weites Feld von Möglichkeiten. Generell halte ich es aber für eine schlechte Idee, im 21. Jahrhundert auf die Abbildungen in alten Märchenbüchern zurückzugreifen und sich aus der „Rapunzelkiste“ zu bedienen. Das heutige Image der Zauberkunst ist angestaubt genug – wir müssen dies nicht noch verstärken! Ebenso wenig angemessen fände ich es, wenn Sie bei einer Hochzeit oder einem ähnlich formellen Anlass mit abgewetzter Jeans, kariertem Flanellhemd und Weste aufkreuzen würden. Eine Klasse höher als die Gäste, wie bereits angesprochen, wäre da sicherlich eher ein Smoking. Fantasievoller (nicht: geschmackloser) darf Ihr Kostüm bei Kindervorstellungen sein. (Dennoch wären für mich Spitzhut plus Sternchenumhang entsetzlich – aber bitte, es ist Ihre Show…)
Denken Sie daran, was ich schon zum Thema „Mainstream“ erklärt habe: Entscheidend ist, was die Mehrheit des Publikums als modern, schick und elegant ansieht – und da ist halt bei Männern der Anzug (oder Kombination aus Jackett und Hose) schwer zu übertreffen (siehe Showmaster und Nachrichtensprecher). Als Magier dürfen Sie, was Farbe und Machart betrifft, natürlich etwas mutiger sein und gerade in jungen Jahren zu Extravaganterem greifen (aber bitte keine Papageienfarben und schon gar nicht die gefürchtete Glitzerjacke von Jahrmarktsansagern)! Hier lohnt sich eine professionelle Farb- und Stilberatung (z.B. in einem sehr guten Modehaus) allemal.
Bei einem erwachsenen Zuschauerkreis entscheiden stets zunächst die Frauen, ob eine Darbietung goutiert wird. Glauben Sie mir: Die Mehrzahl der weiblichen Gäste sieht ganz genau, ob Ihr Outfit hochklassig ist oder vom Grabbeltisch stammt! Dazu kommt, dass wertvolle Kleidungsstücke – von Material und Schnitt her – auch in der Bewegung gut aussehen. Und, zumindest für die Männer, ein Trost: „Teure“ Textilien sind oft durchaus preiswert, da sie über die Jahre kaum an Qualität verlieren. Trotzdem sollten Sie über eine Neuanschaffung nachdenken, wenn Modestil bzw. Kleidergröße sich nach ein, zwei Jahrzehnten geändert haben! Genau das Gleiche gilt für Ihr Schuhwerk. (Nebenbei: Zu Frack, Gehrock oder Smoking sind Lackschuhe ein Muss!)
Zudem verfügen Sie mit einem Sakko über mindestens fünf Taschen mehr als ohne dieses Kleidungsstück. Bei beengten Platzverhältnissen werden Sie dankbar dafür sein, einige Utensilien „am Mann“ verstauen zu können. Für manche Trickabläufe müssen Sie in einem bestimmten Moment etwas aus der Kleidung hervorholen bzw. einstecken. Etliche Effekte verlangen auch geheime Halterungen („Holdouts“) unter der Jacke. Persönlich bevorzuge ich zusätzlich eine Weste, in der ich mich dann – wenn es gar nicht anders geht, schon vorher im Publikum zeigen kann. Mit Jackett erblicken mich die Zuschauer erst beim Auftritt, also in meiner Bühnenrolle. Zudem kann ich so das Sakko offen lassen, was die „Zugänglichkeit“ der Taschen fördert.
Noch ein Tipp: Man sieht Ihnen an, ob Sie öfters feine Garderobe tragen oder nicht. Erinnern Sie sich an die zahlreichen Missgeschicke von Brautleuten in den einschlägigen „Hoppala-Sendungen“?
Solche Unfälle kommen meist daher, dass sich diese Menschen in ungewohnter Kleidung bewegen und deshalb von den High-Heels kippen oder sich mit dem Schleier in der Tür verfangen. Tragen Sie also Ihr Bühnenkostüm zeitweise auch beim Proben, dann wirken Aktionen in dieser Kleidung „selbstverständlicher“!
Merke: Manche Zauberprogramme scheitern schon, bevor sie beginnen – nicht selten an der optischen Erscheinung des Künstlers!
Ihre Körpersprache
Jeder Mensch hat ein individuelles Bewegungsmuster. Dies ist größtenteils genetisch festgelegt, Korrekturen sind nur begrenzt und mit großem Aufwand möglich. Daher werden Sie von mir (im Gegensatz zu vielen einschlägigen Veröffentlichungen) auch keine allzu detaillierten Handlungsanweisungen lesen. („Biegen Sie mit dem linken Kleinfinger die rechte hintere Ecke der untersten Karte um!“) Lieber schildere ich Ihnen das Ergebnis einer Aktion, und Sie versuchen dann, es mit Ihren Möglichkeiten zu erreichen. Dies gilt ebenso für Ihre Bühnenrolle: Wenn Sie eher grobmotorisch veranlagt sind, sollten Sie nicht im Frack den eleganten Manipulator geben!
Vor allem muss Ihr körperlicher Ausdruck der schon erwähnten Rolle des Alpha-Tiers entsprechen. Das heißt nun aber nicht, dass Sie sich „aufpumpen“ und die Muskeln anspannen müssen! Da Sie gar nicht mit einem Angriff zu rechnen brauchen, dürfen Sie sich locker und entspannt geben. (Studieren Sie einmal Auftritte von Spitzenpolitikern, Kirchenfürsten oder sonstigen „Promis“ vor deren Fans!) Allerdings darf Ihre Haltung keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass ein Angreifer keine Chance hätte: Aufrechte Haltung, also Kopf hoch (vermeidet auch, dass Sie zu sehr „nach unten“ sprechen), Brustbein nach vorne und oben heben, Schultern entspannt sinken lassen!
„Benatural!“ (DaiVernon)
Gerade am Anfang des Zaubererdaseins ist die Angst groß, dass die Zuschauer etwas mitbekommen, was sie nicht sehen sollten, mithin das Trickgeheimnis verraten ist. Dies führt häufig zu einer „Verbergehaltung“: der Rücken nach vorne gekrümmt, die Arme stark zum Körper hin angewinkelt, die Hände direkt vor der Brust. Einerseits ist das eine Unterwerfungsgeste, welche schlecht zu Ihrer Ranghöhe passt. Zum anderen löst sie gerade die Suche nach dem Geheimen aus, das man anscheinend nicht mitbekommen soll.
Wenn Sie dem Publikum ein Requisit zeigen, so halten Sie es hoch genug und deutlich vor dem Körper. Damit dies locker und entspannt geschieht, vergegenwärtigen Sie sich das Gewicht Ihres Utensils: Ein Kartenspiel wiegt weniger als ein Ziegelstein, und ein Stück Seil ist keine Schlange, die Sie erwürgen müssen. Grundsatz: Zwei Finger reichen!
Unsicherheit zeigt sich auch durch diverse Nebenbewegungen wie Übersprungshandlungen (am Kopf kratzen, über den Mund wischen), dauerndes Getrippel mit den Beinen oder gar unnötiges Hin- und Herlaufen (Pendeln zwischen „Angriff“ und „Flucht“). Diese Unruhe überträgt sich auf die Zuschauer, welche stets „spiegelbildlich“ reagieren, und lenkt von den gewünschten Ausdrucksbewegungen ab, die Sie zur Unterstützung Ihrer Vorführung brauchen. Ebenso nervig ist das ständige magische Gefuchtel mit den Vorderextremitäten („Hände waschen“). Bleiben Sie also ruhig und tun Sie nur das, was nötig ist – so erreichen Sie eine souveräne Ausstrahlung!
Prunken Sie nicht mit „Fingerfertigkeit“!
Dieses Pendant zur Unsicherheit sieht man gerade bei jungen, „technokratisch“ orientierten Kollegen: Die beherrschen oft schwierigste manipulative Kunstgriffe, welche mir schon beim Lesen der Beschreibung Verschlingungen im Gehirn bescheren. Schön, wenn man so etwas kann! Leider machen solche Zauberer nicht selten diesen Vorzug dadurch zunichte, dass sie ihn zu deutlich „heraushängen lassen“: Da zeigt man gerne „Ziergriffe“ wie das Rotieren einer Münze im Slalom durch die Finger. So zementiert man das sowieso bestehende Vorurteil, dass magische Effekte nur eine Frage der „Fingerfertigkeit“ seien. Doch Kunstfertigkeit ist das Gegenteil von Kunst! Ein Tipp: Auf „YouTube“ kann man sich etliche Auftritte von Tony Slydini, des wohl größten Manipulators aller Zeiten, betrachten: Er bewegt sich völlig natürlich und sparsam – und wenn dann Zauberhaftes geschieht, ist es eben ein „Wunder“ und nicht eine Geschicklichkeitsübung!
„Geschwindigkeit ist keine Hexerei“, daher: Rennen Sie nicht, wenn niemand Sie jagt!
Die Angst vor der Entdeckung des Zaubergeheimnisses bewirkt oft ein generell zu hohes Tempo. Man will es möglichst schnell „hinter sich haben“, bevor etwas Unerwünschtes dazwischenkommt. Irgendwann hat man dann die Zuschauer „abgehängt“ und lässt sie ratlos zurück. Wenn Sie aber zum Beispiel Münzen vermehren, muss deren vorherige Anzahl glasklar bewusst werden – sonst ist es kein Wunder! Ein anderes Problem ist, dass ja irgendwann im „normalen“ Ablauf eine „Trickbewegung“ kommt, welche man hundertmal geübt hat. Diese fällt daher optisch aus dem natürlichen Ablauf heraus, ist häufig zu schnell bzw. „perfekt“. Die Zuschauer sehen vielleicht nicht, WAS Sie da verborgenerweise getrieben, wohl aber, DASS Sie irgendwie getrickst haben.
Mein Tipp: Üben Sie mehr den gesamten Ablauf als eine einzelne Passage, dann bekommen Sie ein zusammenhängendes Aktionsmuster!
Die verbale Darstellung
Nichts offenbart den sozialen Status eines Menschen zuverlässiger als seine sprachliche Gestaltungsfähigkeit. Achten Sie auf folgende allgemeine Merkmale:
komplexere (nicht: komplizierte) Satzkonstruktionen statt nur kurzer Hauptsätze
grammatikalische Richtigkeit
abwechslungsreiche, anschauliche Ausdrucksweise, keine ständige Wiederholung von „Allerweltsvokabeln“ wie
„haben“
,
„machen“
etc. oder floskelhaften Ausdrücken (
„okay“/„gell“
…)
richtige Verwendung und Aussprache von Fremdwörtern
„druckreife“ Formulierungen anstatt Korrektur und Neubeginn von Sätzen
geringer „Stoiber-Faktor“, d.h. wenig stammelnde Wortwiederholungen (
„die… die… die… äh, äh“
)
Deutlichkeit der Artikulation (kein Genuschel oder Verschlucken von Silben)
kein niedriges Sprachniveau (
„tun Sie das Tuch da rein“
)
Umgangssprache und Dialekt nur als bewusste Stilmittel
Klarheit geht vor Schnelligkeit
Modulation von Sprechtempo, Lautstärke und Klangfarbe der Stimme
richtig gesetzte Pausen
keine Unterforderung des Publikums durch platte Witze oder grobe Zweideutigkeiten
Falls Sie Ihre Vorführung mit einem Text versehen wollen (Alternative ist eine Begleitmusik, in besonderen Fällen auch beides kombiniert): Verlassen Sie sich keinesfalls darauf, dass Ihnen spontan schon die passenden Worte einfallen werden – dazu müssten Sie zur seltenen Spezies rhetorisch Hochbegabter gehören! Gemeinhin kommen weitgehend beschreibende Texte heraus wie „nun nehme ich dieses rote Tuch und gebe es in die Röhre“. Punktuell mag es einmal nötig sein, die optischen Informationen verbal zu verstärken, aber über weitere Strecken wirkt ein solch parallel laufender Text ziemlich fad. Versuchen Sie daher besser, das Gezeigte zu interpretieren! (Vielleicht bedeutet ein rotes Tuch ja Liebe, ein grünes Neid etc.?) Auf diese Weise verleihen Sie Gegenständen eine emotionale Wirkung!
Mit Ihrem Vortrag haben Sie die wunderbare Möglichkeit, dem Publikum eine Betrachtungsweise nahezubringen, die weit von der Trickerklärung wegführt! Als Beispiel möchte ich Ihnen eines meiner Lieblingskunststücke mit Karten vorstellen, das ich dem Buch von Leo Behnke („Professionelle Close-up-Zauberkunst“) gefunden habe:
Zaubern mit Worten: Piano-Trick
Vorbereitung: keine
Fragen Sie, ob jemand im Publikum Klavier oder Orgel spielt (oder wenigstens schon mal einen Pianisten beobachtet hat…). Bitten Sie diese Person, die Hände so zu halten, als ob er ein solches Instrument bediene. Und der Unterschied zwischen Klavier- und Orgelspiel? „Organisten krümmen die Finger stärker ein, da es in Kirchen stets saukalt ist. Ein Theologe hat mir einmal erklärt, man wolle sich damit von der Hölle unterscheiden, die ist ja ganz gut temperiert…“
Demonstrieren Sie diese Handhaltung und nehmen Sie zwei Karten vom Spiel: „Ich stecke Ihnen nun zwei Karten zwischen die beiden Finger.“ Das Kartenpaar kommt in einen Fingerzwischenraum (z.B. zwischen Daumen und Zeigefinger). Diese Handlung wiederholen Sie, bis die Lücken beider Hände (bis auf eine) mit je zwei Karten bestückt sind. Betonen Sie fortlaufend: „wieder zwei Karten“, „wieder ein Paar“ usw. „Zum Schluss nur noch eine Karte!“ Geben Sie die in die letzte Fingerlücke und betonen Sie diesen Umstand nochmals: „Als Letztes eine einzelne Karte!“ (Endposition siehe Skizze!)
Holen Sie nun die Kartenpaare nacheinander wieder zurück und legen Sie sie jeweils getrennt ab, so dass zwei Stapel entstehen. Betonen Sie auch dabei wieder: „zwei Karten“, „ein Kartenpaar“, „schon wieder zwei“ etc. Bei der letzten Karte fragen Sie den Zuschauer: „Auf welches Päckchen soll die einzelne Karte?“ Legen Sie sie dort ab, dann greifen Sie aus diesem Stapel eine imaginäre Karte und platzieren sie auf dem anderen: „Dann nehme ich unsichtbar diese Karte und lege sie auf die gegenüber liegende Seite.“ Zählen Sie nun die Karten beider Päckchen paarweise ab: „Sehen Sie, da, wo vorhin die einzelne Karte lag, sind nur noch Paare, und hier drüben auch Paare – und eine einzelne Karte!“
Am besten, Sie greifen sich umgehend ein Kartenspiel sowie ein „Opfer“ und probieren die Sache aus. Wetten, dass weder Ihr Partner noch Sie eine Ahnung haben, wie das möglich ist? Mir ist es jedenfalls bei Dutzenden von Vorführungen noch nie passiert, dass die richtige Lösung präsentiert wurde. Dabei ist sie recht einfach: Es gibt acht Fingerzwischenräume; wenn Sie in sieben davon Kartenpaare geben, liegt nachher auf jedem Stapel eben diese Zahl von Karten. Kommt dazu noch eine einzelne, haben wir dort eine gerade Zahl, auf der Gegenseite eine ungerade!
Das Geheimnis wird durch den Text geschützt, in dem immer nur von zwei Karten oder einer die Rede ist, niemals von deren Gesamtzahl. Wenn Sie dies durchhalten und gut „verkaufen“, haben Sie einen Knüller – wenn nicht, wird der Absturz ziemlich senkrecht… Eine weitere Strategie ist natürlich, dass Sie (wie bei jedem Zaubereffekt) niemals den Schluss vorher ankündigen! In diesem Fall würden die Zuschauer ebenfalls dazu motiviert, weiter als bis zwei zu zählen…
Leo Behnke sagt dazu: „Es ist ein Wörtertrick, kein Kartentrick. Aber das sind bekanntlich die meisten.“ (Nochmal: „die meisten“! Es lohnt sich, über diese Behauptung etwas länger nachzudenken…)
Die Spannweite von passenden Vorträgen ist riesig und hängt vom Kunststück sowie natürlich auch vom Typ ab, den Sie verkörpern. Sie reicht von opulenten Märchen und Geschichten (siehe Punx) bis zu eher knappen, gezielten Worten wie beim „Piano-Trick“. In beiden Fällen aber führt der Text von der Trickerklärung weg, indem er beim Publikum Bilder etabliert (hier der freudlose, reiche Mann bzw. die Handhaltung eines Pianisten). Dass später ein Durchdringungseffekt bzw. eine Kartenwanderung zu entschlüsseln wäre, ist nicht absehbar. Die Eröffnung mit dem Satz „Ziehen Sie eine Karte und merken Sie sich deren Wert“ (für mich einer der schrecklichsten magischen Texte überhaupt) lässt dagegen sofort die Vermutung entstehen, dass der Vorführende diese erraten bzw. finden wird. Den Zuschauern bleibt genügend Zeit, den weiteren Ablauf unter jenem Gesichtspunkt zu analysieren und auf eine Vermutung zu kommen, wie das Ganze funktioniert (und selbst, wenn sie nicht zuträfe, wäre der Glanz des Effekts verflogen).
Der passende Vortrag
Wie kommt man an gute Texte? Mein Tipp: Schauen Sie sich so viele Vorstellungen wie möglich an (auch dank „YouTube“ heute kein Problem mehr). Überlegen Sie, welche Vorträge Sie interessant und witzig finden – und die Publikumsreaktionen kriegen Sie ebenfalls mit! Auf die Gefahr hin, von meinen Kollegen gesteinigt zu werden: Kupfern Sie gute Sprüche und Geschichten ruhig ab, so hat sich nämlich die Zauberkunst seit Jahrtausenden gehalten! Sehr bald werden Sie merken, ob Ihnen die Sätze vom Publikum abgenommen werden und wie sie zu Ihrer Bühnenfigur passen. Im Laufe der Zeit wird sich dann Ihre Wortwahl immer mehr verändern – und so ist letztlich doch etwas Neues entstanden.
„Der unsägliche Comedyzwang, der in letzter Zeit herrscht, tut der Zauberei nicht gut (…), und ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Kollegen denken, wenn der Trick nicht überzeugt, dann lachen die Zuschauer wenigstens, Hauptsache Applaus.“ (Alexander de Cova: „Secrets N° 1“)
Moderatoren, die sich lediglich von Witz zu Witz hangeln, sind schon schlimm genug – als Magier sollten Sie vor allem das tun, wofür man Sie engagiert hat: zaubern. Gags müssen sich aus der spezifischen Vorführsituation ergeben, sonst wirken sie künstlich und aufgesetzt. Vor allem aber: Vermeiden Sie die im Unterhaltungssektor grassierende Unterforderung der Zuschauer – im Klartext: Diese sind nicht halb so primitiv, wie man im „Showbiz“ heute offenbar annimmt!
Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn einmal nur zehn Prozent des Publikums ein ziemlich sophistisches Wortspiel kapieren? Einige werden sich köstlich amüsieren, und der Rest ahnt zumindest, dass er gerade - auf hohem Niveau – etwas verpasst hat. Sollten Sie aber einen unsäglichen Schwiegermutterwitz (oder gar einen mit Bezug auf mittlere Körperregionen) gerissen haben, grölt vielleicht ein Drittel los, der Rest aber geniert sich – und eventuell finden auch die Schenkelklopfer später, dass Ihre Sprüche schon recht flach waren…
„Ich hoffe, Sie gehen heute mit dem Gefühl nach Hause, niemals unter Ihrem Niveau gelacht zu haben.“ (Marvelli)
Persönlich probiere ich zu Anfang meines Programms diverse „Testgags“, dann weiß ich sehr bald, was ich dem Auditorium zumuten kann. Wenn die Reaktionen eher schwach sind, „verschlanke“ ich meinen Vortrag auf die unbedingt für ein Kunststück erforderlichen Passagen – ansonsten bekommen meine Gäste die eine oder andere Pointe extra. Machen Sie sich nicht zu abhängig von häufigen Lachern! Nach meiner Erfahrung gibt es eine Sorte von Publikum, welches die lustigen Stellen eher still genießt, ohne dass es deshalb weniger Spaß hat. Manche Entertainer versuchen in einem solchen Fall, die Leute mit Gewalt „in Stimmung zu bringen“: siehe diverse „Applausübungen“, immer ärgere Sprüche oder das beliebte Herauspicken eines Zuschauers, der im weiteren Verlauf ständig wieder mit dummen Bemerkungen bedacht wird. Ich empfinde solch ein Vorgehen als Belästigung, denn es ist mein gutes Recht, einen Auftritt entspannt zu verfolgen, ohne einem ständigen „Mitwirkungszwang“ ausgesetzt zu sein oder mit dämlichen Pointen traktiert zu werden.
Wie fixiert man seinen Text?
Am sichersten ist es natürlich, wenn Sie ihn aufschreiben und von einer sprachlich versierten Person korrigieren lassen. Das Problem ist allerdings, dass er dann in einem „Schreibstil“ gehalten ist, beim Sprechen werden Sie merken, dass er sich allmählich verändert – und das ist gut so! Der umgekehrte Weg ist, sich zunächst nur Stichpunkte und „Schlüsselsätze“ zu notieren und den Vortrag bei einer Testvorführung aufzuzeichnen. Beim Abhören merken Sie nebenbei, was sich an Tempo, Aussprache, Modulation etc. noch verbessern lässt. Wenn Sie diese Version dann aufschreiben, ist sie von vornherein im Sprechstil formuliert!
Falls Sie ein Kunststück länger nicht zeigen, werden Sie froh sein, eine schriftliche Dokumentation des Wortlauts zu haben. Allerdings halte ich nichts davon, das Ganze nun Wort für Wort auswendig zu lernen – das Risiko ist groß, dass es beim Auftritt dann auch so klingt. Sie werden bald merken, welche Sätze Sie unverändert lassen müssen, und wo Sie etwas variieren können. Zudem wird es gelegentlich nötig sein, auf Zwischenrufe und andere unerwartete Vorfälle zu reagieren. Gerade dabei glücken Ihnen manchmal Passagen, die toll ankommen und daher Bestandteil Ihres Textes werden, der so im Laufe vieler Vorführungen immer mehr „reift“. Schon deshalb ist es unsinnig, ständig nur auf der Suche nach „neuen Tricks“ zu sein!
Merke:
Den wahren Wert eines Zaubereffekts können Sie erst abschätzen, wenn Sie ihn einige Dutzend Male vor Laien präsentiert haben!





























