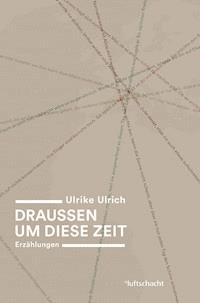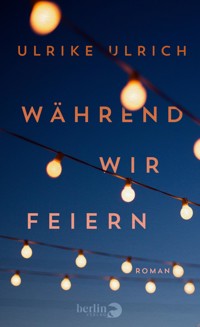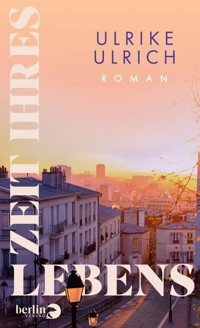
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine literarische Liebeserklärung an die Stadt Paris »So, also hierher kommen die Menschen, um zu leben ...« Im Frühsommer 2021 schreibt die 60-jährige Schriftstellerin Liane Steffen am Montmartre Briefe an ihre verstorbene Freundin Jana, mit der sie so oft in der Seine-Metropole war. Sie versucht ihr die Pandemie zu erklären und wie sich die Welt seit Janas Tod vor 8 Jahren für sie verändert hat. Immer wichtiger werden Liane dabei die Menschen der Pariser Gegenwart – und die vergessene Autorin Louise Crombach, die 1845 einer Frau zur Flucht aus dem Gefängnis verhalf. Lianes Briefe werden ihr neues Buch:ein anspielungsreicher Parisroman und ein bewegendes Plädoyer für eine solidarische Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Text bei Büchern ohne inhaltsrelevante Abbildungen:
Mehr über unsere Autor*innen und Bücher:
www.berlinverlag.de
Die Arbeit an diesem Roman wurde gefördert mit einem Arbeitsbeitrag Literatur der Stadt Zürich 2024.
© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Martial Colomb / Photodisc / Getty Images und FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
Literaturliste
Nachbemerkung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Widmung
Für meine Eltern
1
Ich bin da. Endlich. Im dritten Anlauf habe ich es geschafft. Im vierten, wenn ich mitzähle, dass ich diese Reise erstmals im Jahr nach deinem Tod geplant habe. Bevor meine Diagnose kam und Paris auf die lange Bank geschoben hat. Sechs Jahre und siebzehn Tage ohne Rezidiv. Ich wollte die 5-Jahres-Etappe hier feiern. Das hat mir die Pandemie verdorben. Aber jetzt bin ich da. Ich habe Glück gehabt, Jana.
Glück auch, dass mir Zoltan diese Wohnung vermittelt hat, die Stéphane Leduc gehört, einem Autor aus Lausanne. Sie liegt am Fuß des Montmartre, nur zwei Straßen entfernt von dem Hotel, in dem wir beide bei unserer ersten Parisreise übernachtet haben, nein, bei der zweiten war das, bei der ersten hatten wir nur einen Tag zwischen zwei Nachtzügen. Ich habe geahnt, dass du hier herumgeistern wirst. Es vielleicht sogar gehofft. Im letzten Jahr hast du mir gefehlt, als wärst du gerade noch da gewesen.
Dabei gibt es jetzt Carmine. Carmine Jarosz aus Essen. Seit bald zwei Jahren bin ich wieder in einer Beziehung. Dass dich das freuen wird, dachte ich gerade. Dabei warst du in deinen letzten Jahren mindestens so überzeugt wie ich, dass wir am besten schreiben, wenn die einzigen Männer in unseren Leben unsere Lektoren sind.
Und meinem verdanke ich nun also diese Wohnung, er hat mir den seltsamen Schlüssel zugeschickt, der aussieht, als solle man damit eine sehr große Spieluhr aufziehen. Und so hat es sich auch angefühlt, als ich vorgestern die schmale Eingangstür öffnete, hinter der sich eine aufwendige Schließanlage befindet. Zuerst bin ich zu den Fenstern gegangen, habe die bodentiefen Flügeltüren aufgezogen. Mich an das geschwungene schmiedeeiserne Geländer gelehnt und auf die gegenüberliegenden, nur wenige Meter entfernten Häuser geschaut. Mit ihren ähnlichen Fenstern, Brüstungen, ihren wehenden Vorhängen.
In der vier Stockwerke unter mir liegenden Straße gibt es ein Friseurgeschäft, das Afrokiki heißt, einen Tabac, eine Boulangerie, einen Installateur und links an der Kreuzung, die ich sehen konnte, als ich mich ein bisschen weiter hinauslehnte, ein Bistro, vor dem einzelne Menschen an eng nebeneinanderstehenden Tischen saßen, alle mit Blick auf die Straße, als würde dort etwas aufgeführt. Paris natürlich.
Vorgestern, als ich in dieser sehr schönen Wohnung ankam, als ich aus dem Fenster auf die Kreuzung schaute, hatte ich plötzlich eine Zuversicht wie nicht mehr seit der Zeit, als ich mit Kraftakt begonnen habe. 2013. Als du noch gelebt hast.
Ich habe sofort den Computer ausgepackt, ihn auf den hellen, schlichten Art-déco-Tisch im Wohnzimmer gestellt. Beinah die gesamte Einrichtung ist alt, sieht ererbt aus, als stünde sie schon seit den 1920ern hier, einzig der Schreibtischstuhl und das Bettsofa stammen aus einem Schweizer Möbelhaus. Die Wohnung ist perfekt. Sie hat (abgesehen von einer Kaffeemaschine) alles, was ich brauche, eine vollständige Küchenausstattung, gute Stühle, eine rückenfreundliche Matratze. Es fehlt, was mich stören würde: WLAN, ein Fernseher, jegliche Art Nippes oder Dekoration, alles Persönliche. Bloß im Schlafzimmer drei wandbreite Regalbretter mit französischsprachigen Büchern, der Höhe nach von links nach rechts geordnet, vorne bündig mit dem Bord. Ich mag sehr, dass diese Wohnung beinahe so leer ist wie ein Hotelzimmer, dass sie mich quasi bei null anfangen lässt.
Vor mir liegen zwei Monate ohne Termine, ohne Verpflichtungen. Ich kenne in dieser riesigen Stadt vielleicht zehn Menschen, von meinem Hiersein wissen sie nichts. Merci, Monsieur Leduc! Ich verzeihe Ihnen sogar, dass Sie diese Wohnung das ganze Jahr leer stehen lassen. 2018 ist er offenbar das letzte Mal hier gewesen, der alte Herr (dreizehn Jahre älter als ich), er könne die Reise, die Treppen nicht mehr bewältigen, sagt Zoltan. Vermieten will er nicht. Während des Salon du Livre überlässt er die Wohnung für drei Nächte seinem Verleger und dessen Frau. Die restlichen 362 Tage wird sie nur von den Möbeln bewohnt. Und ich profitiere davon. Ich konnte problemlos zwei Mal verschieben. Ich könnte verlängern, bis zum Frühling oder darüber hinaus, falls auch 2022 wieder die Buchmessen ausfallen.
Was ich nicht hoffe. Wegen Zoltan und seinem Frühlingsprogramm, wegen Carmine und seinem neuen Roman. Und am meisten, weil es bedeuten würde, dass sich die Pandemie-Situation nicht wesentlich verbessert hätte. Die Messen selbst sind mir gerade so gleichgültig wie die Veranstaltungen. Ich will einfach in Ruhe schreiben.
Apropos Ruhe: Ich hatte vergessen, wie laut diese Stadt ist. Auch in den Nächten. Es ist lauter als bei mir in der Flingerstraße, lauter als damals im East-End. Ähnlich laut, würde ich sagen, wie am Bilker Bahnhof, wo wir uns während des Studiums für ein paar Wochen das Zimmer geteilt haben – und uns nicht wegen des Fensters einigen konnten. Für mich gilt immer noch: lieber Lärm und Luft als stickige Stille. Schließlich bin ich an der Einfallstraße zum Krankenhaus aufgewachsen, habe nachts die ein- und ausrückenden Wagen gezählt. Stadtgeräusche, wenn sie nicht vollkommen fremd und unerklärlich sind, machen mir zum Glück noch immer nichts aus (und die Sirenen hier gleichen den nordrhein-westfälischen Martinshörnern, die kann ich überschlafen).
Heute Nacht bin ich allerdings kurz nach drei aufgewacht, weil ich eine Frau habe schreien hören. Ich konnte sie aus dem Fenster sehen: zwei Frauen, eine hat geschrien, beide haben gelacht. Trotzdem habe ich mir, bevor ich mich wieder hinlegte, im Internet noch die Notrufnummern rausgesucht. Eine zulässige Ausnahme der Regel. Grundsätzlich gehe ich nur am Nachmittag für eine Stunde online, das habe ich mir für Paris auferlegt, aus verschiedenen Gründen. Sonst lasse ich das Telefon im Flugmodus, die meiste Zeit. Mit Carmine telefoniere ich freitags und dienstags. So haben wir es abgemacht. Damit wir uns beide an das Alleinsein gewöhnen können.
Was nur ich will. Carmine hat gelacht, als ich ihn um eine Telefonbeschränkung bat. Nicht weil er es für einen Witz hielt. Er wollte nicht, dass ich merke, dass es ihm etwas ausmacht. Das ist seine Methode, er versucht erst mal über das, was ihn verletzt oder verärgert, hinwegzulachen. Nicht mehr so oft wie am Anfang. Ich merke es ja doch meistens.
2
Seit dem zweiten Tag schon habe ich meinen Ablauf. Meine Regelmäßigkeit. Wie sehr ich noch immer Regeln brauche, auch für mich allein. Hauptsache, sie sind selbstgesetzt. Die Regel habe ich als zu mir gehörig empfunden, meine eigene Regel. Hier in Paris ist sie mir abhandengekommen. Du warst dabei, als die ersten Wallungen kamen. Und ich empfinde diesen Verlust noch immer als Zumutung, vermisse die Struktur, das verlässlich getaktete Bluten. Jetzt sind meine Hormone ohne Plan. Was vermutlich nicht stimmt. Ihr Plan erschließt sich mir einfach nicht mehr.
Aber zurück zum Plan meiner Pariser Freiheit, lach nicht, Jana, er sieht so aus: Um sieben Uhr breche ich auf zum Joggen, suche ein Leihrad und fahre damit zum Stade Jesse Owens, zehn Minuten von hier (den Sportplatz hatte ich schon vorab gefunden, genau wie die Fahrrad-App). Dann laufe ich meine Runden bis um acht, wenn die Schulklassen kommen, suche mir wieder ein Rad, und wenn ich zurück bin, dusche ich, mach mich bereit, geh ins Café. Ja, ich gehe zum Schreiben ins Café, für zwei Stunden, es ist möglich hier, weil mein Französisch so schlecht ist, dass mich die Gespräche nicht stören. Und ich schreibe dort mit der Hand, mit dem Füller, den du mir zum Fünfzigsten geschenkt hast. All die Jahre habe ich ihn nur zum Signieren benutzt. Von elf bis dreizehn Uhr tippe ich ab, was ich geschrieben habe, selbst wenn es nur Notizen sind, Beobachtungen, selbst wenn es nur ein Plan ist, ein Tagesplan, oder eben diese Briefe an dich, die keine Briefe sind, sondern eine Hilfskonstruktion. Weil ich Ich sagen will. Und weil du immer diejenige warst, der gegenüber ich am leichtesten Ich sagen konnte. Nach Kraftakt habe ich begonnen, Ich zu sagen, habe ich ein Projekt begonnen, in dem ich vorkomme. Und komme nicht weiter damit.
Mittags esse ich einen Salat. Mit Baguette. Pariser Brot hieß das in Düsseldorf. Wirklich dunkles Brot gibt es in der Boulangerie ohnehin nicht. Wusstest du, dass die Menschen in Paris dunkles Brot mit der Belagerung durch die Preußen verbinden? Weil 1870/71, als die Stadt eingekesselt war und es kaum noch Weizen gab, alle ein fürchterlich schmeckendes dunkles Brot essen mussten: Pain du siège. Ich esse Baguette. Zu jedem Mittagessen. Und dann geh ich spazieren.
Wir waren nicht am Montmartre letztes Mal, oder? Als du mich besucht hast vor neun Jahren, deine letzte Reise überhaupt. Nein. Ich glaube, ich war 2010 zuletzt hier, auf dem Hügel, den sie nach Mars benannt haben. Wie die Marsfelder. All diese Orte, die dem Kriegsgott geweiht wurden, all die Plätze, Metro-Stationen, die Namen von Schlachtfeldern tragen. Aber es wird doch immer mehr Venushügel geben.
Tatsächlich sind auch einige Straßen und Plätze nach Frauen benannt, mehr als in Düsseldorf, scheint mir. Suzanne Denglos, Dalida, Dora Bruder, Eva Kotchever. Ich lese ja immer noch, gehe durch die Straßen mit meinem Leseblick, Straßenschilder, die Erklärungen dazu, Warnschilder, Graffiti, kleine Aufkleber (an der Ampel vor meinem Haus: Où sont les poètes?). Was ich nicht verstehe, fotografiere ich, um es nachzuschauen, ich laufe lesend durch die Straßen, aber ich sehe auch mehr, wenn ich gehe, wenn ich sitze, bin aufmerksamer als zuletzt zu Hause, ich nehme mehr auf und mit.
Die Straßen von Montmartre! Diese schmalen, verwinkelten Gassen, von denen manche in Treppen münden, überhaupt die verschiedenen Treppen, Treppen für große Auftritte, Treppen für heimliche Abgänge und die Häuser, die schmal sind, schmale Fassaden haben, gerade mal zwei Fenster nebeneinander, fünf oder sechs Stockwerke hoch, dann wieder welche, die nach zwei Etagen schon aufhören und zwischen ihren Nachbarn stehen, wie ein Kind zwischen Eltern. Und die Häuser wie meines, die dreieckig sind, auf eine Ecke hin zulaufen, wie das Flatiron Building in Manhattan, bloß viel schmaler, man geht von der einen Straße hinein und schaut auf der anderen raus. Ihre spitzen Winkel sind den sternförmigen Kreuzungen geschuldet, an denen es immer mindestens noch eine Möglichkeit mehr gibt als rechts, links, geradeaus oder zurück. Ich sitze an einer solchen Kreuzung, ich sitze in dem Café, das ich von meiner Wohnung aus sehen kann.
Schräg gegenüber die Apotheke. Ihre grüne, ständig wechselnde Lichtreklame macht mich ein bisschen nervös. Wie sie mir Uhrzeit und Temperatur aufdrängt. Selbst wenn sie geschlossen ist, verhält sie sich wie ein Club oder ein Kino. Davor steht ein Zelt. Die Zelte sind neu. Einerseits die vor den Apotheken, in denen getestet wird. Darin meist eine stehende Person in grüner Schutzkleidung mit Maske, eine sitzende Person, den Kopf in den Nacken gelegt. Es sind offene Zelte, wie sie bei Hochzeiten in weitläufigen Gärten zum Einsatz kommen. Groß und weiß. Die anderen sind farbig, sind niedrig, sind Ein-Personen-Zelte. Zwei davon auf der kleinen Fußgängerinsel unterhalb der Station Marcadet-Poissonniers, vor dem grünen steht eine Vase mit Blumen, vor dem orangefarbenen ein Campingkocher. In diesen Zelten lässt sich nicht aufrecht stehen.
So ein Zelt gibt es auch ein paar Straßen weiter am Fuß einer Treppe. Es ist mir schon am ersten Abend aufgefallen, auf dem Rückweg vom Seven Eleven. Zwischen dem Treppenaufgang und der Wand des Nachbarhauses (darin ein Geldautomat). Die Treppe ist theatral, mündet in bepflanzte Emporen, die sich aufteilen und wieder verbinden. Und zwischen dem ersten gerade nach oben führenden Aufgang und dem Haus mit dem Geldautomaten sind vielleicht fünf Quadratmeter Platz. Dort steht das Zelt. Und davor: Topfpflanzen, Hometrainer, ein Regal, Putzmittel, Schaufel und Besen. Gestern, als ich tagsüber vorbeikam, habe ich auch noch ein Paar Hanteln gesehen. Aber nicht die Person, die dort lebt.
Es hat ganz und gar nichts Kurzfristiges, dieses Zelt mit seinem durch eine Bank und die Pflanzen vom Trottoir abgetrennten Vorplatz. Und ich frage mich, wie die Stadt umgeht mit den Wohnungslosen, die inmitten von Tourist*innen-Routen, Banken, teuren Cafés und Delikatessengeschäften ihre Zelte aufschlagen. Ob es da eine Praxis gibt. Ob diese Zelte geduldet sind. Und das Wort sagt es ja schon. Duldung. Wie der Status, den jemand bekommen kann, der geflüchtet ist. Abhängig von der Geduld, der Duldsamkeit der Behörden. Die vielleicht irgendwann die Geduld verlieren. Da ist keine Rechtssicherheit. Da ist Willkür.
3
Ich bin ausgegangen. Am Abend. Habe das Spiel Schweiz gegen Spanien vor meinem Café geschaut. Zum ersten Mal in meinem Leben so etwas wie Public Viewing. Es war insofern erträglich, als ich sowohl von den selbsterklärten Kommentatoren (außer mir nur vier Frauen dort) als auch von den über das Spiel hinwegredenden Desinteressierten nur Fetzen verstand. Was ich trotzdem und schon vor der Roten Karte für Freuler erkennen konnte: dass die meisten der Schweiz die Daumen hielten. Dass die französischen Fans der Schweizer Nationalmannschaft offenbar nicht nachtragen, dass sie Les Bleus so spektakulär aus dem Turnier geworfen hat. Und die Schweiz hat wirklich eindrucksvoll gespielt letzten Samstag, das hättest sogar du gefunden, Jana. Zoltan jedenfalls, der Fußball im Allgemeinen auch nichts abgewinnen kann, hat sich nachher als neuer Fan meiner Gladbacher bezeichnet.
Das gestrige Spiel war dagegen eine Plackerei. Und Sommer und Zakaria sind sich schon wieder in die Quere gekommen. Es hat sich dennoch gelohnt, dass ich rausgegangen bin, in der Halbzeitpause hatte ich eine interessante Unterhaltung mit einem jungen Lehrer aus Pantin, einem Vorort im Département Seine-Saint-Denis, der sehr gut Englisch sprach. Zu Beginn war ich allerdings irritiert, weil er meinte, die Schweizer Mannschaft sei deshalb so gut, weil so wenige echte Schweizer dabei seien (»real Swiss«, hat er gesagt). Was er denn meine, mit real Swiss, hab ich gefragt. Und als er »like Freuler and Stocker« sagte, habe ich eingewandt, dass das doch auch in der Abwertung eine problematische Formulierung sei.
Ich hatte schon mit Zoltan eine kleine Diskussion, weil er fand, es mache die Mannschaft sympathisch, dass sie so unschweizerisch sei, so viele Doppelbürger dabei seien. Nicht dass mir der Gedanke vollkommen fremd wäre. Aber er ist doch entlarvend. Wir hätten gern, dass das etwas bedeutet. Für etwas steht. Darum verfolge ich ja internationale Wettbewerbe nur selten, wegen dieser Implikationen, der Symbolik, der Vermischung mit dem Politischen.
Der junge Mann, der Khader heißt, erklärte, er würde von sich selbst auch nicht als »real French« denken, obwohl er die französische Staatsbürgerschaft habe, in Pantin geboren wurde. Ob er denn nicht glaube, dass er damit den Leuten in die Hände spiele, die Le Pen wählen. Er hat nur gelacht. »We don’t do this in Seine-Saint-Denis«, hat er gesagt. Er kenne niemanden, der Front National wählen würde, aber er kenne genug Menschen, die sich nicht als echte Franzosen sähen. Eben gerade, weil der Begriff von den Rechten so besetzt sei. Das sei nicht, was er sein wolle, nicht mehr. Ich habe es loslassen können. Das kann ich besser als früher. Ich habe ihm nicht erklärt, wie er sich fühlen soll.
Khader hat mir dann, bevor das Spiel weiterging, noch von Pantin vorgeschwärmt, das einen viel zu schlechten Ruf habe, es sei nicht weit, ich solle unbedingt mal hinfahren. Und nach dem Spiel, als ich aufstand, um zu gehen, kam er nochmals zu mir und drückte mir einen Zettel mit seiner Nummer in die Hand, wenn ich Fragen hätte oder einen Guide für Seine-Saint-Denis brauche. Einen Namen hatte er draufgeschrieben, den ich recherchieren solle, bezüglich Nation und Fußball: Rachid Mekhloufi.
Carmine, mit dem ich nach dem Spiel telefoniert habe, meinte leicht vorwurfsvoll: »Eine neue Fußballbekanntschaft?« Er ist nicht eifersüchtig. Hat auch gar keinen Grund dazu. Aber ich glaube, es stört ihn, wenn ich mich von anderen Leuten aus dem Alleinsein herausreißen lasse, nachdem ich ihm diese Telefondiät aufgedrängt habe. Nachdem ich auch seinem Vorschlag, mich wenigstens für ein paar Tage zu besuchen, er würde meine Routine nicht stören, selbst schreiben, sich alleine die Stadt ansehen, erst einmal abwehrend begegnet bin.
Meine andere Fußballbekanntschaft ist er selbst. Wir haben uns bei einem österreichischen Literaturfestival im Fernsehzimmer des Hotels kennengelernt, wo er Premier League schaute, und als ich mich dazusetzte, fragte, ob ich zufällig wisse, warum sie David Silva Merlin nennen. Ob es eine Geschichte gebe dazu. Dann hat er sich vorgestellt: Carmine, mit Betonung auf der ersten Silbe wie Karneval.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder behaupten würde, ich hätte mich verliebt. Und an diesem Wochenende in Krems war ich auch noch weit davon entfernt. Obwohl ich Carmine attraktiv fand, er mir schon aufgefallen war, bevor wir zusammen vor dem Fernseher das Abschlussbuffet geschwänzt hatten. Wer ist dieser große Mann, der ein bisschen aussieht wie Petr Čech ohne Helm, zuerst dachte ich, er würde zum Organisationsteam gehören. Er stand mit den Techniker*innen, der Fotografin zusammen, hat oft gelacht, viel getrunken.
Als ich begriff, dass er Autor ist, dachte ich: Das kann sich auch nur ein Mann leisten und wird trotzdem ernst genommen. Inzwischen weiß ich, dass er glaubt, sein Gender-Vorteil würde dadurch aufgehoben, dass seine Bücher dem Science-Fiction-Genre zugeordnet werden. Das ist natürlich Unsinn. Es gibt diese Genre-Abwertung, aber auch da sind die männlich konnotierten im Vorteil. Und die Männer darin. Seine Vorbilder sind allerdings Ursula Le Guin und Octavia Butler. Was mich beeindruckt hat. Dass er meine Bücher kannte und kluge Fragen dazu stellte, hat (ich sehe dich lachen) auch nicht geschadet.
Übrigens hatte ich heute schon Post von ihm. Einen kurzen Brief, den er vor meiner Abreise geschrieben hat. Vielleicht ist man erst richtig da, wenn man Post bekommt. Wenn man einen Brief in der Hand hält, mit Namen und Adresse. Und nicht mal c/o, denn ich habe einen Zettel an den Briefkasten geklebt. Ich lebe jetzt hier.
4
Es ist Sonntag. Sonntage unterscheiden sich kaum von den anderen Wochentagen, nicht bei mir, draußen auch nicht. Die meisten Läden haben geöffnet, die Cafés sowieso. Das Stadion allerdings hat geschlossen, weshalb ich heute im kleinen Park an der Rue Marcadet gelaufen bin, auch wenn ich mir etwas albern dabei vorkam, kleine Runden um immer dieselben Blumenbeete zu drehen – und Menschen mit Hunden auszuweichen. Dafür liegt über dem ganzen Park Lavendelgeruch, der tatsächlich eine besänftigende Wirkung auf mich ausübt.
Am Nachmittag habe ich den Hügel umrundet, La Butte, für einmal keine einzige Treppenstufe genommen, bin die Rue de Clignancourt hinab, vorbei an dem großen Bild von Louise Michel auf dem heruntergelassenen Rollladen des lokalen Gewerkschaftsbüros. Wäre ich im Frühling schon da gewesen, hätte ich die (wegen der Pandemie sicher sehr reduzierte) 150-Jahr-Feier erlebt. Montmartre war ja Zentrum der Pariser Kommune, sie regierten vom hiesigen Rathaus aus. Und hier fanden auch die meisten Kämpfe statt. Akropolis des Aufstands haben sie den Hügel genannt, Zitadelle der Freiheit. Tausende Kommunard*innen sollen hier gestorben sein. Aber Louise Michel hat überlebt, war eine der Letzten, die noch die Barrikaden hielten. Ich habe mir vorhin ihr Buch gekauft, Die Pariser Commune, 2020 wurde es endlich auf Deutsch übersetzt. Ich habe es auf den E-Reader geladen, ja, ich habe jetzt eins dieser Lesegeräte, über die ich früher so geschimpft habe.
Auch heute Nachmittag hatte ich es dabei, aber gelesen habe ich nicht. Stattdessen bei einem Pétanque-Turnier zugeschaut, das auf der Promenade am Boulevard Marguerite-de-Rochechouart stattfand. Etwa zwanzig Zweierteams und keine einzige Frau. Junge und alte Männer, einer mit Kippa, einer im Burnus. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und zugesehen. Zuerst bei den beiden Teams gleich vor mir, aber dann ist mir zwei Felder weiter ein Spieler mit asiatischem Hintergrund aufgefallen. Er war – wie sein Partner – um die siebzig, gekleidet wie die meisten älteren Männer dort, kurzärmliges Hemd, lange Hose, Turnschuhe, die Haare kurz und grau. Wenn er in die Knie gegangen ist, geworfen hat, hatten seine Bewegungen eine besondere, schwungvolle Präzision, ich habe an Tai-Chi gedacht, was mit Sicherheit ein Zusammenhang war, den ich nicht unabhängig vom Aussehen der Person hergestellt hätte. Von den beiden Zweierteams hat diese Person am besten gespielt. Und ich habe begonnen zu hoffen, dass sie eine Frau ist. Vielleicht bin ich aber auch erst auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Spielerin handeln könnte, durch die Art, wie sich ihr Kollege verhielt, wie er ihr Tipps gab, wie er die Lage der Kugeln begutachtete, um dann zu ihr zurückzukehren und Erklärungen abzugeben. Er hat diese Person belehrt, die im selben Alter war wie er, eine Person mit asiatischem Hintergrund, weshalb ich kurz dachte, die Herablassung, das Paternalistische könnte auch damit zu tun haben. Und Chauvinismus: ja ein Wort aus dem Französischen. Das für beides gilt. Das Verhalten gegenüber Frauen. Und anderen Nationen. Dass jemand ein Chauvi sei, habe ich lange niemanden mehr sagen hören.
Übrigens dachte ich, als ich dem Mann dabei zusah, wie er der Person zuredete, ihr Lob aussprach, wenn etwas gelang (und ihr ist ja eben fast alles gelungen), an die Zeit, als wir im Grünen Mond Billard gespielt haben, meistens wir beide als Team, wir haben oft gespielt, weißt du noch, wie gut wir waren. Und trotzdem kam fast immer ein Mann, besonders zu dir, der zeigen wollte, wie man das Queue hält, wie man der Kugel einen Drall geben kann, wie man sich verhält, wenn die weiße Kugel so liegt, dass man sich strecken muss oder auf einem Bein balancieren. Manchmal haben wir das zugelassen, damals, haben wir uns das gefallen lassen, wenn uns der Mann gefallen hat. Und mir gefielen ja eigentlich immer nur die, die besser spielen konnten als ich.
Die Person, von der ich hoffte, sie wäre eine Frau, hat mit großer Geduld, stoisch würde ich sagen, auf die Tipps ihres Partners reagiert, ihm nie selbst welche gegeben. Es hat ihr sicher nicht gefallen. Dass sie die Absurdität der Situation nie aufgedeckt hat, auch das habe ich, in meinen Stereotypen verfangen, ihrer Herkunft zugeordnet, ihre Höflichkeit, dass sie den Mann nicht dazu gebracht hat, sein Gesicht zu verlieren. Wir haben uns damals durchaus lustig gemacht, wenn einer so besserwisserisch daherkam und dann schlechter spielte als wir. Weißt du noch, der Abend, an dem wir zwei Stunden am Tisch geblieben sind, einen Besserwisser nach dem anderen düpierten, bis die beiden mit den Profi-Queues kamen, der eine aus dieser Düsseldorfer Band, die nur einen Hit hatte, ein Frauenname, glaube ich, kann ich rausfinden. »Wer verliert, schmeißt ’ne Lokalrunde«, hast du gesagt, so laut, dass es alle hören konnten. Und das waren dann wir.
Beim Pétanque hat mein Team gewonnen, sie haben einander gratuliert, indem sie die Fäuste aneinanderhielten, der Mann klopfte der asiatisch aussehenden Person auf den Rücken. Als sie dann ihre Kugeln nahmen, um das Spielfeld zu wechseln, bin ich aufgestanden und ihnen zu dem Platz gefolgt, auf dem ihre nächsten Gegner warteten. Ich habe ihnen aus der Nähe zugeschaut und konnte die Person, die ein seltenes Lächeln und sehr viele Falten hatte, zum ersten Mal sprechen hören, mit einer tiefen, rauchigen Stimme. Und ihren Partner rufen: »Bravo, Juliette!«
Diese Fixierung auf Geschlecht. Herkunft. Das ewige Zählen. Wann wird das mal obsolet sein? Nicht mehr, solange ich lebe, Jana, obwohl sich so vieles so schnell verändert. Aber das, nein, es gibt zu viel Widerstand, es gibt, immer noch, viel zu viel Chauvinismus.
5
Carmine hat mir von einem Traum geschrieben, in dem wir Sex hatten. Es sei schön gewesen, aber auch schräg, denn ich hätte zwischendurch Gedichte von Patti Smith rezitiert. Carmine liebt seine Träume, er liebt es, sie zu erzählen, manche beunruhigen mich.
Ich träume nicht von Sex, Jana, aber ich denke ab und zu daran. Vor dieser Beziehung dachte ich, dass ich für den Rest meines Lebens sehr gut mit der Befriedigung auskommen würde, die ich mir selbst geben kann.
Und es gab ja auch immer die Zeiten, in denen ich nicht mal dazu ein Bedürfnis verspürt habe. Oder in denen ich die Art der Überreizung, als die ich die Stimulierung empfunden habe, meiden wollte, weil ich davon überzeugt war, für meine Arbeit eine Art Nüchternheit zu benötigen, die sogar durch eine alkoholfrei durchtanzte Nacht gefährdet werden konnte. Weißt du noch, als ich dir meine Theorie dargelegt habe, dass es Texte gebe, die ich nur vollkommen asketisch schreiben könne? Und du mich entsetzt unterbrochen hast. Das sei ja schön und gut mit dem Leben für die Kunst. Aber es gebe auch Grenzen, hast du gesagt. Und dennoch: Ich konnte Richtwert nur schreiben, weil ich in der Zeit nicht getrunken habe. Gar keinen Alkohol.
Quellenangabe hingegen habe ich nur schreiben können, weil ich trank. Das vorletzte Kapitel ist sogar under the influence entstanden. Die anderen habe ich zwar nüchtern geschrieben. Aber ich brauchte damals die Aussicht auf Betäubung. Die Orte verlassen zu können, an die der Text mich brachte.
Carmine würde manchmal gern mit mir schlafen, wenn wir beide etwas getrunken haben, aber ich will das nicht mehr. Ich will ganz da sein. Gar nichts verpassen. Wenn ich mit Carmine schlafe, geht es nicht um meine oder seine Befriedigung, obwohl sie dazugehört, es geht um Berührung, Elektrisierung, Energetisierung auch. Früher hatte ich manchmal das Gefühl, beim Sex etwas abzugeben von mir, weniger zu sein danach. Mit René sicher. Aber nicht mit Carmine. Der sich mir zuweilen entzieht. Wenn wir Streit hatten, wenn ich schon wieder ein Wochenende abgesagt habe, an dem wir uns sehen wollten, dann ist er bei unserem nächsten Treffen distanziert, dann berührt er mich zwar, aber nicht lange, dann umarmt er mich zwar, aber nicht eng. Und wenn ich seinen Po anfasse, den ich sehr mag, dann entzieht er sich. Ich mag diese Rolle nicht. Aber ich mag sie lieber als das ständige Neinsagen bei René, der immer wollte, für den das eine Art Grundbedürfnis zu sein schien. Bei dem ich gar nicht dazu kam, von mir aus Lust zu haben.
Aber ja, auch deshalb möchte ich nicht, dass Carmine mich besuchen kommt, denn dann werde ich in eine andere Energie kommen. Und nachher, wenn er weg ist, wird nicht nur er mir fehlen, sondern auch der Sex.
6
Es ist erst mein sechster Morgen in diesem Café, und ich kenne schon die Hälfte der Gäste. Kennen ist übertrieben. Aber heute wurde ich bereits von dem alten Herrn mit dem zerfledderten Taschenbuch und dem ebenso zerfleddert aussehenden Rauhaardackel gegrüßt und von der Dame, die Sirop Violette trinkt und ihre Stoffmaske hier draußen immer wie einen geblümten Bart unter dem Kinn trägt. Auch die beiden Männer im Sport-Outfit, die offenbar mehrmals in der Woche miteinander Tennis spielen und danach hier Kaffee trinken, nickten mir zu. Der Kellner mit der dicken Brille, der eine Orthese ums rechte Knie trägt und der gestern noch »Comme d’habitude?« gefragt hat, hat mir heute von der Tür aus gewunken und ist dann verschwunden, um den Café allongé zu machen. Ich sitze, wenn es geht, immer auf demselben (dem linken) Stuhl, am selben kleinen Tisch, von dem aus ich die Kreuzung überblicken kann und der nur rechts einen Nachbartisch hat. Dort sitzt heute ein schlafender Mann, vor ihm stehen eine Karaffe mit einem Rest Weißwein und ein leeres Glas. Einer der älteren Kellner, dessen Nase über die Maske ragt, hat schon zwei Mal versucht, den Mann neben mir zu wecken. Hat ihn an seinem Jackett gezogen, hat ihm gesagt, er solle gehen, worauf der Mann unwillig die Augen öffnete – und einen Wein bestellt hat, den er aber nicht bekommt. Ich kenne auch diesen schlafenden Mann schon. Er trägt meist einen Nadelstreifenanzug, mit Weste und weißem Hemd. Nicht gebügelt, aber doch elegant. Heute allerdings trägt er das nicht mehr so weiße Hemd über einer grauen Jogginghose, die einen großen Fleck hat. Und schnarcht.
Apropos Fleck: Gestern Nachmittag war ich im Waschsalon. Das war ein kleines Ereignis. Erst stand ich eine Weile vor den sehr ausführlichen, französischsprachigen Anweisungen, dann eine Weile vor einer Art Zigarettenautomat, aus dem das Waschmittel zu ziehen war, der jedoch keinen Schlitz für Geld oder Kreditkarte hatte. Plötzlich sprang eine Schublade auf. Ich dachte schon: Telekinese. Dachte, nun würden sich endlich auch bei mir die den Frauen in meiner Familie zugesprochenen übersinnlichen Kräfte äußern. Da kam ein Mann aus der hinteren Ecke des Salons auf mich zu und nahm sich das Waschmittelpäckchen. Er erinnerte mich an Tom, war auch in Toms Alter (stell dir vor, dein Patenkind wird dieses Jahr dreiunddreißig und ist schon fünf Jahre verheiratet). Und ich habe ihm, also dem Mann im Salon, zugeschaut, wie er zwei Maschinen befüllte, in eine stopfte er noch die Jacke, die er angehabt hatte, dann verschwand er wieder in der Ecke, und kurz darauf begannen seine Maschinen zu laufen. In der Ecke habe ich dann die zentrale Zahlstation gefunden, von der sämtliche Geräte ihm Raum zu bedienen waren. Von wegen Übersinnlichkeit!
Was ich dir aber eigentlich schreiben wollte: dass ich, als er die Jacke auszog, sofort diese alte Jeanswerbung vor Augen hatte, die, abgesehen vom Stephen-Frears-Film, meine Hauptreferenz zu Waschsalons ist. Eine große Sache damals. The Female Gaze. Der Mann als Sexobjekt. Und immer noch undenkbar, dass eine Frau das in einer Fernsehwerbung tun könnte! Einfach mal das T-Shirt ausziehen. Du hast es getan. In Düsseldorf auf den Rheinwiesen, sogar hier auf dem Bateau Mouche, überall, wo es die Männer getan haben. Aus Prinzip, hast du gesagt und auch nach der Mastektomie nicht damit aufgehört. Wenn es um den Körper ging, warst du immer freier als ich. Inzwischen denke ich, dass du auch freier warst, wenn es ums Schreiben ging.
Den Mann aus dem Waschsalon habe ich nachher im Café wiedergesehen, von dem aus ich meiner Wäsche beim Waschen und Trocknen zuschauen konnte. Ohne die Maske sah er Tom nicht mehr ähnlich. Um den Mund hatte er einen zynischen Zug. Wie oft mir das jetzt schon passiert ist, dass ich eine Person mit der Maske attraktiver fand als ohne. Augen sind meistens schön. Aber all die verbitterten Münder. Die hinabgesunkenen Mundwinkel, abhandengekommenen Kinnlinien, es ist dieser untere Teil des Gesichts, in dem sich das Alter (auch das Leid) niederschlägt, in dem sich die Enttäuschungen manifestieren. Zumutungen. Zurichtungen. Auch bei mir. Mit der Maske sehe ich zehn Jahre jünger aus. Bestimmt hat sich schon jemand erschrocken, als ich sie abgenommen habe, weil er oder sie mit einem völlig anderen Gesicht gerechnet hat.
Meine Mutter hatte nie ein altes Gesicht. Wie gern ich ihr geglichen hätte, ihre Augen gehabt, ihre staunenden Augen, die, wenn sie krank war, noch größer wurden. Und das Staunen darin zum Schluss, vielleicht über die Ironie des Schicksals. Dass sie all ihre schweren Krankheiten überlebt hat, um dann von einer Lappalie erwischt zu werden. Du hast mich damals gefragt, ob ihr bewusst war, dass sie sterben würde. In diesen letzten Stunden. Ich bin immer davon ausgegangen. Auch wenn sie mit uns nicht darüber gesprochen hat. Seit ich meinen Vater erlebt habe, in den Tagen vor seinem Tod (er ist 2019 gestorben), bin ich nicht mehr sicher. Er wusste es nicht.
Grundsätzlich hat meine Mutter mit dem Tod gerechnet, sie hatte mit dreißig schon ein Testament, das hat sie vor der Eileiter-OP aufgesetzt. Schon vier Jahre vor ihrem Tod hat sie festgelegt, dass ich ihre Bücher bekommen solle (1221 waren es zum Schluss). Als ob sie gewusst hätte, was passieren würde. Dass mein Vater eine Frau heiraten würde, die Lesen für Luxus hielt, Bücher für Staubfänger, Regale für Platzverschwendung, eine Frau, die, und das habe ich erst viel später begriffen, eine Leseschwäche hatte. Tom habe ich übrigens zuletzt bei der Beerdigung meines Vaters gesehen.
Jetzt habe ich mich unterbrochen, weil ein alter Mann in einer giftgrünen Jacke quer über die sechsarmige Kreuzung gelaufen ist, nein, nicht gelaufen, ganz langsam ist er über die Kreuzung geschlurft, hat mit jedem Schritt eine halbe Fußlänge Fortschritt gemacht. Und alle sind für ihn stehen geblieben, der kleine und der große Bus, die Lastwagen, die Taxis und andere Pkw, das weiße, fast leere Tourist*innen-Bähnlein, das immer so aufdringlich klingelt, sogar die Mopeds und Fahrräder. Einzig zwei junge Frauen auf einem Scooter fuhren direkt hinter ihm durch, viel zu nah. Er hob schimpfend die Faust und schlurfte im selben Tempo weiter. Zwei Ampelphasen auf jeder Seite hat es gedauert. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden, bis er auf der anderen Seite angekommen war, wo er sich am Ampelmast festhielt.
Dann brachte ihm der Mann mit den sehr weißen Haaren und dem sehr weißen Bart einen Einkaufswagen, mit dem er in den Carrefour rollen konnte. Der weißhaarige Mann sitzt fast jeden Tag mit seinem jungen Schäferhund beim Trafokasten neben dem Supermarkt, er sitzt auf einem Stück Pappkarton, oft hat er einen Kaffee vor sich, manchmal steht er auf und wäscht sich die Hände mit dem Wasser, das aus einem Loch im Rinnstein rinnt. Sein Platz ist vor Regen geschützt. Zum ersten Mal steht heute eine Frau neben ihm, zwei Meter weiter. Sie hat keinen Becher vor sich. Keinen Hut. Sie steht da auf zwei Krücken gestützt, an die Wand gelehnt, hinter sich einen Rucksack, sie trägt eine orangefarbene Mütze und nichts an den Füßen. Ich habe noch niemanden gesehen, der ihr Geld gegeben hat. Dem Mann schon. Dem Mann werfen Leute Geld in den Becher. Aber der Frau, die wahrscheinlich so alt ist wie ich, hat in der Stunde, in der sie da steht, niemand eine Münze in ihre geöffnete Hand gedrückt.
7
Es ist drei Uhr in der Nacht. Und ich habe fast eine Stunde wach gelegen, mit Schmerzen und Angst. Schmerzen bin ich nun wirklich gewohnt. Die vielen Tage des Krankseins, wie oft ich als Kind im Bett lag mit Bauchweh, Krämpfen, all die Tage, an denen ich die Schule verpasst habe. Und später dann die Migränekopfschmerzen. Ich hatte Schmerzen, aber Angst vor dem Tod hatte ich nicht. Wenn ich jetzt in der Nacht aufwache und mein Bauch sich zusammenkrampft, denke ich manchmal: Er ist wieder da. Diese Stunde zwischen zwei und drei am Morgen, the wee small hours, ich mochte den Ausdruck immer, die winzig kleinen Stunden, wenn man wach liegt, allein, und Schmerzen hat, dann können les petites heures auch in Paris gefährlich werden. Und eben noch lag ich wach und habe auf die Stuckatur an der Decke gestarrt, das Licht ist immer im Raum, das gelbe Licht der Straßenlaternen, das durch die Vorhänge dringt, die Schatten der schmiedeeisernen Geländer an der Wand, ich lag da mit dem Stuck und den Verzierungen und habe Geschwüre gesehen.
Dass ich noch immer Angst vor dem Krebs habe. Oder wieder. Fast anderthalb Jahre war sie von der Angst vor der Infektion verdeckt. Stand in der zweiten Reihe und hat das Schild Vorbelastung hochgehalten. Ich bin sechzig, Jana, bald werde ich einundsechzig. Das Beste daran (abgesehen vom Ida-Dehmel-Preis fürs Gesamtwerk): dass ich in eine bessere (schlechtere) Impfkategorie gerutscht bin. Und seit ich nun endlich beide Dosen intus habe, fühle ich mich, was das Virus angeht, plötzlich erstaunlich sicher, als wäre ich in einen Zaubertrank gefallen. Es ist nicht rational. Bei mindestens 5 von 100 wirkt der Schutz nicht. Nur etwa 0.03 von 100 haben nach sechs Jahren ein Rezidiv. Und trotzdem lag ich vorhin im Bett, mit dem Blick auf den Stuck, und hab mich wie die Frau aus The Yellow Wallpaper gefühlt, die immer panischer wird, je länger sie auf die verschlungenen Muster der gelben Tapete starrt.
Dann ist etwas Seltsames passiert. Ich hörte jemanden die Treppe hochkommen. Daran ist noch nichts Ungewöhnliches. Das Haus ist alt, schlecht isoliert. Ich bekomme mit, wenn in der Nachbarwohnung der Anrufbeantworter anspringt, morgens höre ich über mir ein Handy vibrieren, das offenbar auf dem Boden liegt, ich höre Stimmen über den winzigen Innenhof, der eher ein Schacht ist, und oft höre ich Menschen die Holztreppe hoch- und runterrennen, insbesondere nachts, zu zweit, zu dritt, zu viert, sehr schnell und so nah an meinem Kopf, dass die Dielen unter meinem Bett knarren. Manchmal rennen sie nachts um drei oder vier runter. Und ich frage mich, ob sie dann erst ausgehen. Auf jeden Fall sind im obersten Stock Airbnb-Wohnungen (illegal vielleicht), auf den Klingelschildern steht PAIRS und SIRAP. Zwei Mal schon habe ich junge Menschen getroffen, die ihre Koffer an meiner Wohnung vorbei in den obersten Stock geschleppt haben.
Die Person vorhin stieg ganz langsam, schnaufend und mit schwerem Schritt, die Treppe hoch (vielleicht die mit dem Anrufbeantworter, habe ich gedacht). Und blieb dann auf dem Absatz vor meiner Tür stehen. Ging einfach nicht weiter. Kein Schritt war zu hören, kein Schnaufen mehr. Auch die Tür gegenüber auf dem Stock wurde nicht geöffnet. Ich dachte, dass die Person im besten Fall eingeschlafen ist, im schlechtesten aber kollabiert sein könnte. Also bin ich aufgestanden und habe nachgesehen. Es war niemand da. Und ich bin ganz sicher nicht eingeschlafen zwischendurch. Ich war wach. Meine Schmerzen waren weg.
Tante Laura hätte gesagt, dass mich jemand besucht habe, um mir zu helfen. Und wenn ich wie Tante Laura denken würde, dann würde ich denken, dass sie es war. Sicher nicht du. Du hast immer darauf bestanden, dass tot tot ist. Dass ich dir dein Nichtsein nicht lasse, vielleicht ist dir das gar nicht recht.
Jetzt habe ich also zum ersten Mal in der Nacht geschrieben, direkt in den Computer. Es ist vier Uhr, und ich gehe wieder ins Bett. Was ich aber doch gern wüsste, wie es diese Person geschafft hat, so leise zu verschwinden.
8
Eben hat sich ein deutsches Paar an den Nebentisch gesetzt. Und jetzt weiß ich wieder genau, warum ich in Düsseldorf nicht im Café schreibe. Sie sprechen sehr laut. Es ist mir unmöglich, nicht zuzuhören. Noch dazu führen sie ein Corona-Gespräch. Ich könnte in Flingern ins Durbun gehen, da wird ausschließlich Türkisch gesprochen. Ich könnte dort zwischen den Männern sitzen (es sind vor allem Männer) und schreiben.
Im Corona-Gespräch neben mir geht es um die Frage, ob es sicherer ist, mit der U-Bahn zu fahren oder mit dem Bus. Sie meint, im Bus seien weniger Menschen, die Türen würden immer wieder an der frischen Luft geöffnet. Man könne aussteigen und wäre sofort draußen im Freien. Darauf er: Das sei irrational. Im Bus sei man viel länger unterwegs, ausgesetzt, mit anderen Menschen zusammengepfercht. In der Metro verbringe man eine deutlich kürzere Zeit mit denselben Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand durch die Maske Aerosole verbreite und jemanden anstecke, sei in der Metro geringer. Er habe sich informiert. Daraufhin sie: »Das sagst du immer.« Als ob sie sich nicht informieren würde.
Jetzt sind die beiden weg. Während ihrer Diskussion, die wie ein Kapitel aus einem seit vielen Jahren geführten Beziehungsstreit klang, habe ich mich immer mehr verspannt, habe ihnen übel genommen, dass ich ihre Klischeesätze verstehen konnte. Weshalb ich dann interveniert habe, ihnen vorgeschlagen, Fahrräder zu leihen. Und ihnen erklärt, wie das geht. Natürlich waren sie erschrocken, dass ich Deutsch sprach, ihr Gespräch verfolgt hatte. Für einen Moment schien es sie zu verbünden, dass sich eine fremde Frau in ihr Gespräch einmischte. Aber dann wandte der Mann sich zu mir. Bedankte sich für den Hinweis. Leider aber komme das nicht infrage, sie hätten ja keine Helme. Daraufhin sie: »Du trägst doch sonst auch keinen.« Dann wieder er: »Aber du.« Und es sei zu gefährlich. Zum Glück ist die Frau dann aufgestanden. »Bus oder Fahrrad«, hat sie gesagt, hat ihre Maske angelegt und ist reingegangen, um zu bezahlen. Ihm war das unangenehm. »Mal schauen, wie heute die Zahlen sind«, hat er gemurmelt und sich in sein Handy versenkt.
Die Zahlen. Die Leute fragen: Hast du die Zahlen schon gesehen? Wie sind heute die Zahlen? Sie kommen als Trias: Infektionen, Hospitalisationen, Verstorbene. Ich lese sie von links nach rechts, obwohl die Zahl rechts (Todesfälle) mit der links (Neuinfektionen) nichts mehr zu tun hat. Aber auch das lese ich mit, kann die Zahl links in die Zukunft projizieren. Der Mann hat die französischen Zahlen nachgeschaut. Sie sind wieder gestiegen. Jedes Land zählt seine eigenen Toten.
Ich stelle mir vor, dass das alles erst annähernd fassbar, begriffen wird, wenn wir vom Zählen zum Erzählen übergehen können. Zu einem Erzählen kommen, das keine Agenda hat. Was es wohl nie gegeben hat. Trotzdem hoffe ich immer noch, immer wieder auf die Literatur. Auf Romane. Filme und Serien auch. Erinnerst du dich an Holocaust, die Serie mit Meryl Streep, die im Dritten Programm lief, welchen Einfluss diese Fiktion hatte? The Story of the Family Weiss. Wie darüber diskutiert wurde. Wie die Stimmung in Deutschland durch diese amerikanische Mini-Serie umschlug. Das war kurz vor dem Abi, und wir diskutierten über nichts anderes in der Schule. Erst recht, nachdem dieser Rechtsradikale in Nottuln den Sendemast in die Luft gejagt hat.
Und jetzt habe ich es selbst getan. Dabei hatte ich, als der Begriff Corona-Leugner aufkam, große Mühe mit der Analogie. Ich habe sogar in einer Kolumne darauf hingewiesen, wie diese Ungenauigkeit zur Relativierung des Holocaust führen könne, zu einer Verharmlosung der antisemitischen Behauptung, die Ermordung sechs Millionen jüdischer Menschen sei eine Erfindung. Und gleichzeitig zu einer unzulässigen Zusammenfassung aller Protestierenden unter einen mit dem Holocaust verbundenen Begriff. Ein Nebengleis, sicher, aber ich habe darüber geschrieben. Und bekam einen Dankesbrief von einer Frau, die sich mit Sophie Scholl verglich, weil sie Flugblätter verteilte und darin aufforderte, auf den Demos gegen die Maßnahmen keine Maske zu tragen. Ich sehe dich die Stirn runzeln. Ungläubig. Ich verstehe kein Wort, Liane. Maßnahmen. Masken. Sophie Scholl? Und mir fällt ein, wie wir uns 2003, während der SARS-Epidemie, ein bisschen mokiert haben über die chinesischen Messebesucher*innen, die Masken trugen. Es kam uns übertrieben vor. What happens in China, stays in China. Etwa so … Das war damals.
Jetzt haben wir eine Pandemie, und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen treiben mich um. Ich bereue die Kolumne nicht, genaue Begriffe sind wichtig, aber ich würde diesem Aspekt nicht mehr so viel Raum geben. Dafür ist die Präsenz antisemitischer Narrative bei den Protesten gegen die Pandemiebekämpfungspolitik zu groß.
Ich werde nicht so bald in der Lage sein, einen Roman über die Pandemie zu schreiben. Und ich bin froh, dass ich ein Sabbatical bei der Kolumne nehmen konnte. Zoltan, auf dessen Adresse meine offizielle Mail umgeleitet ist, habe ich gebeten, mir während meiner Zeit in Paris wirklich nur ganz wichtige Anfragen zu schicken.
Natürlich will ich hier keine Ferien von der Gegenwart nehmen, aber ich habe beschlossen, mich in den kommenden zwei Monaten nicht zu Covid zu äußern. Nicht weil es nichts mehr darüber zu schreiben gäbe, sondern weil es immer noch auch alles andere zu schreiben gibt und nichts davon sich erledigt hat.
Gestern, als ich nach der wach gelegenen Nacht recherchiert habe, wie groß die Rezidiv-Wahrscheinlichkeit bei meinem Krebs ist, bin ich auf ein Tortendiagramm zu den Todesursachen von 2020 gestoßen. 4 % Covid. 23,5 % Krebs. Und daneben ein Balkendiagramm zu den verlorenen Lebensjahren. 318 000 durch Covid. 4 Millionen durch Krebs. Und es wird natürlich auch hier mit der Lebenserwartung pro Land gerechnet. Wenn ich jetzt stürbe, würde ich als sechzigjährige Frau aus Deutschland nur zwanzig Jahre weniger zu erwartende Lebenszeit verlieren als ein Junge, der in Lesotho kurz nach der Geburt stirbt.
Ich habe damals in Büchern gerechnet. 2015. Ich habe gedacht: Wenn ich jetzt sterbe, wie viele Bücher kann ich dann nicht mehr schreiben? Damals hatte ich noch einen Output von drei bis vier pro Jahrzehnt. Und du, Jana! Du hast gesagt, du hättest deiner Prognose genau die zwei Jahre abgerungen, die du gebraucht hast, um Die lichteren Jahre fertigzubringen. Dein erfolgreichstes Buch. Du hast nicht bloß alle möglichen Preise damit gewonnen, die posthum verliehen werden können. Es ist inzwischen in der 7. Auflage. Als die erste in den Druck ging, bist du gestorben. Wie ich das Lesen hinausgeschoben habe, nicht weil ich Angst hatte, es könnte nicht gut sein. Weil ich wusste, wie schwer es sein würde, zum letzten Mal einen Text von dir zum ersten Mal zu lesen. Er ist großartig. Fast alle deine Texte sind großartig, und inzwischen haben das deutlich mehr Menschen begriffen.
Wofür ich dich nicht genug bewundern kann: wie es dir gelungen ist, für die Not eine Form zu finden. Das Zerrissene, Fragmentarische, das die Kritik so hervorgehoben hat, wie Intervalltraining, diese unterschiedlichen Tempi hat die Süddeutsche geschrieben, du hast, als du mir von deinem Text erzählt hast, selbst gesagt, das sei der Krankheit geschuldet. Ich habe später am eigenen Leib erfahren, wie sich diese Chemo-Struktur auf das Schreiben auswirkt. An den wenigen guten Tagen habe ich beinahe obsessiv geschrieben. Aber viel häufiger waren die Tage, an denen ich keine Kraft hatte, mich nicht konzentrieren konnte. Als mir die täglichen Verrichtungen schon zu viel waren, als ich nicht daran denken konnte, spazieren zu gehen, geschweige denn zu laufen, als mich schon der Gang zum Briefkasten so überanstrengte, dass ich danach eine Stunde liegen musste. Und am schlimmsten die Unfähigkeit, einen Gedanken zu Ende zu denken.
Du hast das zum Prinzip erklärt. Und hättest es auch nicht geändert, wenn dir noch mehr Zeit geblieben wäre. Ich habe Kraftakt nach dem Krebs nochmals komplett umgeschrieben, und die Laudatorin für den Fallada-Preis hat gesagt, dieser Roman sei noch konsequenter, konziser als der letzte, er sei so sehr aus einem Guss, als wäre er in vier Wochen entstanden. Ich habe das richtiggestellt, ich habe den Prozess offengelegt, aber mein Text tut es nicht.
Seitdem habe ich keinen Roman mehr geschrieben. Ein Essayband ist erschienen. Ich habe mit Die Bücher der Mutter begonnen, essayistisch auch, aber vor allem autobiografisch, dieses Buch, in dem ich nun also Ich sage. Und mich meine. Ich hänge fest darin. Es ist, als wäre ein Teil vom Band gefallen, und die ganze Produktion kommt durcheinander. Dass ich in dieser kapitalistischen Produktionslogik denke, ist Teil des Problems. Anders als früher habe ich das Gefühl, es müsse produziert werden. Das ist etwas Extrinsisches. Es hat auch mit Geld zu tun. Der Vorschuss für den Essayband hat kaum für ein halbes Jahr Miete gereicht.