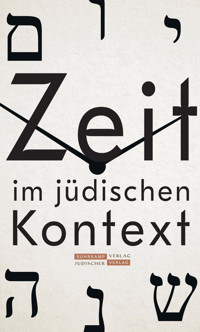
Zeit im jüdischen Kontext E-Book
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Jüdischer Almanach
- Sprache: Deutsch
Im jüdischen Kalender beginnt die Zählung der Zeit mit der Erschaffung der Welt. Laut der Tora geschah dies 3761 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Gott schuf die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebten. Dieser Ruhetag ist der Sabbat, eine heilige Zeit. Während heilige Orte in vielen Religionen zu finden sind, ist die heilige Zeit ein einzigartiges jüdisches Konzept.
In diesem Almanach geht es um jüdische Zeit und Zeitlichkeit. Die Zeitlichkeit, also das Sein in der Zeit, wird bestimmt durch das Wissen um die Vergangenheit, das Bewusstsein der Gegenwart und die Erwartung dessen, was kommt. Die Autorinnen und Autoren beschäftigen sich mit den Ursprüngen des jüdischen Kalenders, aber auch mit der Endzeit: Haolam Habah, die kommende Welt. Es geht darum, wie Gott wohl seine Tage einteilen mag, aber auch um Zeiten der Verfolgung, um Warte- und Überbrückungszeiten in der Emigration, ebenso wie um Zukunftsvorstellungen und die Frage, ob sich verlorene Zeit wieder gut machen lasse.
Und in Israel stellt sich die Frage, inwiefern die Zeit – Warten, Zurückhaltung – uns helfen kann, mit den aktuellen Konflikten umzugehen.
Mit Beiträgen von Alfred Bodenheimer, Etgar Keret, Philipp Lenhard, Tamara Or, Natan Sznaider u.a.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
JÜDISCHERALMANACH
der Leo Baeck Institute
Zeit im jüdischen Kontext
Herausgegeben von Gisela Dachs im Auftrag des Leo Baeck Instituts Jerusalem
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Gefördert durch: Stiftung Irene Bollag-Herzheimer, BaselIm Dialog. Evangelischer Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und NassauRedaktionelle Beratung: Irene Aue-Ben-David, Sharon Livne und Oded SteinbergDas Leo Baeck Institut (LBI) ist benannt nach der Symbolfigur der deutschen Judenheit im 20. Jahrhundert und besitzt Zentren in New York, London und Jerusalem sowie eine WissenschaftlicheArbeitsgemeinschaft in Deutschland. Es wurde 1955 in Jerusalem gegründet, um die Geschichte und Kultur des deutschen und zentraleuropäischen Judentums zu erforschen und zu dokumentieren.Seit 1993 gibt das Leo Baeck Institut Jerusalem den Jüdischen Almanach heraus. Dies knüpft an eine alte Tradition an, die durch denNationalsozialismus gewaltsam abgeschnitten wurde. Erstmals erschien ein Jüdischer Almanach im Jahre 1902.Leo Baeck Institute:Jerusalem: 33 Bustenai Street, Jerusalem 9322928, Israel; www.leobaeck.orgLondon: 2nd Floor, Arts Two Building, Queen Mary University of London, Mile End Road, London E14NS, UK; www.leobaeck.co.ukNew York: 15 West 16th Street, New York, NY 10011, USA; www.lbi.orgFreunde und Förderer des LBI: Liebigstr. 34, 60323 Frankfurt am Main
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2025.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
eISBN 978-3-633-78428-8
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Zu diesem Almanach
Sylvie Anne Goldberg
:
Zeitlichkeit
Zeitfragen
Gebrauch der Zeit
Elisheva Carlebach
:
Wann beginnt die Moderne des jüdischen Kalenders?
Sarit Kattan Gribetz
:
»Was tut Gott den lieben langen Tag (und die Nacht) über?«
Lynn Kaye
:
Mazze und Madeleines: Verbindende Zeit im Babylonischen Talmud
Parallele Daten und Zeiten
Der Mund als Tor zu fernen Ereignissen (Erzählung, Gesang und Essen)
Sara Soussan
:
»Im Angesicht des Todes« – Das Ende der Zeit?
Zeit der Lebenden und Zeit der Toten
Jüdische Nachwelten: Das Ende der Zeit?
Das biblische Fundament: Scheol und Auferstehung
Die rabbinische Tradition: Olam HaBa und Gehinnom
Mittelalterliche Debatten
Kabbalistische und mystische Konzepte
Moderne jüdische Perspektiven
Und am Ende?
Philipp Lenhard
:
Die kommende Zukunft und der falsche Messias
Etgar Keret
:
Ein Wiegenlied für die Zeit
Guy Miron
:
Der Jahreskreis der deutschen Juden unter der Nazi-Herrschaft
Joachim Schlör
:
»Sie haben den Blick auf die Türe geheftet«: Zur Bedeutung der Zeit vor und während der Emigration
Pini Ifergan
:
Hans Blumenberg: Wie verlorene Zeit aufzuholen ist
Avi Shilon
:
Die Rolle der Zeit und der israelisch-palästinensische Konflikt
Alfred Bodenheimer
:
Endzeit jetzt! Eschatologie, Prophetie und Politik in Israel
Tamara Or
:
Alles hat seine Zeit – Von der Gleichzeitigkeit im Judentum
Sanduhr
Stoppuhr
Trauma
Heiligung
Erinnerung
Parallelität
Zionismus
Zukunft
Natan Sznaider
:
Jetzt!
Wladimir Struminski
:
Zäsur und Warnzeichen – Was der 7. Oktober für Israels Zukunft bedeutet
Andrew Steiman
:
Der Tanz der Zeit. We will dance again – oder haben wir schon?
Epilog
Kleines Glossar
Eldad Stobezki
:
Du liebe Zeit
Michael Dak
:
Schlafstunde
Zu den Autorinnen und Autoren
Informationen zum Buch
Zu diesem Almanach
Die Zählung der Zeit beginnt im jüdischen Kalender mit der Schöpfung der Welt. Nach Berechnungen, die auf der Thora basieren, fand diese 3761 Jahre vor der Zeitrechnung statt. Damals schuf Gott die Welt in sechs Tagen und ruhte am siebten Tag. Deshalb soll auch am Schabbat Ruhe gehalten werden. Dieser Tag ist auch Teil der Zehn Gebote, eine heilige Zeit. Während heilige Orte in vielen Religionen zu finden ist, ist heilige Zeit ein einzigartiges jüdisches Konzept. Orte lassen sich zerstören, nicht aber der Schabbat.
In Kohelet (3; 1-8) heißt es:
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen, eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz.
Dieser Almanach erscheint also im neu begonnenen Jahr 5786. Der jüdische Kalender, der das Jahr in zwölf Mondmonate aufteilt und die Feiertage jedes Mal erneut festlegt, existierte für die jüdischen Gemeinden in der Welt stets zusätzlich zum westlichen Bürgerkalender. Keine modernisierende Ideologie forderte die Abschaffung des jüdischen Kalenders zugunsten des westlichen Bürgerkalenders.
In diesem Band soll es um jüdische Zeit und Zeitlichkeit gehen. Die Zeitlichkeit, also das Sein in der Zeit, wird bestimmt durch das Wissen um die Vergangenheit, das Bewusstsein der Gegenwart und die Erwartung auf das, was kommt. In den Beiträgen geht es um multiple Zugänge: In ihrem Eröffnungsessay über den Gebrauch und die Erfahrung der Zeitlichkeit beschreibt Sylvie Anne Goldberg wie diese Zeitlichkeit eine besondere Form der Einschreibung in die Zeit offenbart. Die Beziehung prägt auch die Vorstellungswelt und die Haltung der Juden zur Geschichte. Mit der Besonderheit und den Ursprüngen des kalendarischen Systems, das sich bis heute hartnäckig gehalten hat, beschäftigt sich Elisheva Carlebach. Sie verweist darauf, dass keine modernisierende jüdische Ideologie je die Abschaffung des jüdischen Kalenders zugunsten des westlichen Bürgerkalenders forderte. Damit gibt es kein jüdisches Äquivalent zu einem der großen neuzeitlichen Experimente, mit denen der westliche Kalender sich von seiner religiösen Verankerung befreite.
Auf die Frage, wie Gott wohl seine Tage einteilt und nutzt und auch was er alle Nächte tut, versucht anschließend Sarit Kattan Gribetz eine Antwort zu geben, indem sie sich auf die klassische rabbinische Literatur bezieht. Zur Tagesplanung gehören demnach neben Thorastudium und Weltgericht auch die Ehevermittlung. In ihrem Text »Mazze und Madeleines. Konjunktive Zeit im Bablyonischen Talmud« zieht Lynn Kaye Parallelen zwischen Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und manchen jüdischen Ritualen, etwa am Sederabend, an dem ebenfalls zwei Zeiten gefühlt zusammenfließen, die der Vergangenheit und die der Gegenwart. Auch der Talmud nennt bestimmte Nahrungsmittel, die einen im gegenwärtigen Moment eine andere Zeit erleben lassen können. Anders als in Prousts Roman handelt es sich dabei nicht um zwei Augenblicke im Leben eines Individuums, sondern um die Verbindung eines Einzelnen mit einer kollektiven Vergangenheit aus den heiligen Texten.
Das Ende der eigenen Zeit wird vom Tod besiegelt. Vorstellungen vom Leben danach haben im Judentum im Laufe der Jahrhunderte eine lange und facettenreiche Entwicklung durchlaufen. Die zeitlose Ewigkeitsvorstellung bleibt dem Judentum fremd. Es gibt auch kein Wort für Ewigkeit in der hebräischen Bibel. Sara Soussan beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem Sterben und der Endzeit, der Olam HaBa, der »kommenden Welt«, ein weitgehend unübersichtliches Konzept.
Obwohl die Annahme einer Olam HaBa in den Diskussionen der Rabbinen durchaus eine wichtige Rolle einnimmt, liegt der Fokus der religiösen Praxis vielmehr auf der Befolgung der Halacha im Hier und Jetzt, schreibt Philipp Lenhard. In seinem Beitrag geht es um Zukunftsvorstellungen in der jüdischen Geistesgeschichte und die Erwartung auf das Kommen des Messias.
In seiner Kurzgeschichte »Ein Wiegenlied für die Zeit« erzählt Etgar Keret von dem Schlaflied seiner Mutter, das ihm – bis heute – eine Ruhepause verschafft.
Der Größenwahn der Nazis ging so weit, dass sie auch die Zeit beherrschen wollten. Der neue Jahreskreis, den sie einführten, sollte den flachen und gleichförmigen Zeitenstrom, den sie der bürgerlichen Welt zurechneten, durch einen intensiven und eng getakteten Jahreskreis voller bedeutsamer Höhepunkte ersetzen. Guy Miron beschreibt, wie viele der davon ausgeschlossenen Juden, einschließlich jener, die ihrer Herkunft entfremdet waren wie z. B. Victor Klemperer, sich damals stattdessen auf ihre Tradition zurückbesannen, um in der jüdischen Erinnerung einen alternativen Zeitenstrom zu finden. Joachim Schlör widmet sich den Warte- und Überbrückungszeiten in den verschiedenen Etappen der Emigration. Auf der einen Seite verursachte das Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem zunehmenden Antisemitismus den Eindruck einer »ins Stocken geratenen Zeit«, auf der anderen Seite verursachte das emigration fever – die Dringlichkeit, einen Ausweg zu finden – das Gefühl einer »bis hin zum Kontrollverlust beschleunigten Zeit«. Pini Ifergans Beitrag ist dem Nachkriegsphilosophen Hans Blumenberg und dessen Konzept der »Verlorenen Zeit« gewidmet. Ihn beschäftigte die Frage, ob sich die Jahre, die ihm als Sohn einer jüdischen Mutter von den Nazis gestohlen worden waren, aufholen ließen. Deshalb soll er nur an sechs Tagen in der Woche geschlafen haben.
In Israel stellt sich wiederum die Frage, inwiefern die Zeit dabei helfen kann, den Konflikt mit den Palästinensern zu lösen oder ihn wenigstens zu verstehen? Avi Shilon versucht darauf eine Antwort zu geben, indem er auf die Geschichte des Zionismus zurückblickt. Auf die Entwicklung des religiösen Zionismus der Siedlerbewegung in Erwartung der Erlösung, geht Alfred Bodenheimer ein. Er weist darauf hin, dass lange Zeit von jüdischer Seite übersehen oder verdrängt wurde, wie eng die in diesen Kreisen vertretene Behauptung, dem Vollzug einer biblischen Verheißung beizuwohnen und dieser zugleich durch den eigenen Lebenswandel verpflichtet zu sein, mit evangelikalen Theorien in den USA und nicht zuletzt mit dem Denken der dort sich ausbildenden Popkultur verzahnt war.
Mit der Bedeutung des Zeitbegriffs, für den es im Hebräischen gleich mehrere Ausdrücke gibt, beschäftigt sich Tamara Or. Ihr Essay kreist um die Sanduhr, die seit dem 7. Oktober auf dem Geiselplatz steht. Für die Familien der Geiseln hat die Zeit seither zwei Tempi: Sie steht still und läuft gleichzeitig ab. Ebenfalls auf das Schicksal der (im Mai 2025 immer noch verbliebenen) Geiseln in Gaza verweisend, hält Natan Sznaider ein Plädoyer für die Gegenwart, die zu einem Deal zwingt und nicht ausgespielt werden darf gegen eine potentiell gefährdete Zukunft, in der freigelassene palästinensische Terroristen erneut morden, die wir aber nicht kennen. Diejenigen, die gegen einen Geiseldeal sind, so sein Fazit, glauben nicht an das Jetzt, sondern nur an die Vergangenheit und Zukunft.
Um Letztere macht sich Wladimir Struminski große Sorgen. Er beschreibt die Herausforderungen, denen sich Israel stellen muss, um – nach der Zäsur des 7. Oktobers, die er zugleich als ein Warnzeichen sieht – zu einer konsensfähigen Zukunftsstrategie zu gelangen. Über das viel zu frühe Sterben, sei es im Jahr der Staatsgründung 1948 oder im Herbst 2023, denkt Andrew Steiman in seinem Essay nach, in dem es um transgenerationelle Traumata geht. In der Erzählung »Zeitfragmente« sinniert Eldad Stobezki über seine israelische Kindheit und sein Erwachsensein in Deutschland, das mittlerweile den größten Teil seines Lebens ausmacht.
Und last, but not least, schreibt Michael Dak eine Hommage an die »Schlafstunde« in Israel, den sogenannten »Schnatz«, für den es mittlerweile sogar einen eigenen Eintrag im hebräischen Wikipedia gibt.
Gisela Dachs
Tel Aviv/Jerusalem, Mai 2025
Sylvie Anne Goldberg
Zeitlichkeit
Saras Leben: Gebrauch und Erfahrung von Zeitlichkeit
Geboren in der Woche von Saras Leben,
im Jahr 390 des Kleinen Kompendiums.
Dies geschah zur Zeit des Wochenfestes,
vor vierzig Jahren.
Stirbt am siebten Tag in dem Monat, der tröstet,
aus dem Jahr 550…
Der Neugierige, der diese Kalenderangaben, die in den charakteristischen Formen von (imaginären) Sprechern der traditionellen jüdischen Gesellschaft angegeben sind, in »Weltzeit« übersetzen möchte, ohne über eine entsprechende Tabelle zu verfügen, muss einige grundlegende Rechenoperationen durchführen. Im ersten Fall genügt es, 5000 zu 390 zu addieren und 3760 von der Summe abzuziehen, was einen in das Jahr 1630 versetzt. Man kann ganz einfach 240 zu 390 addieren und erhält so 630, zu dem man 1000 addiert, um sich zurechtzufinden. Da der Tag nicht angegeben ist, muss man auf eine Wochendatierung zurückgreifen: Sie findet sich in der Erwähnung der Wochenperikope Hayei Sara (Das Leben Saras). Diese steht an fünfter Stelle nach der Eröffnung von Bereschit, die den Neubeginn der jährlichen und vollständigen Lesung des Pentateuchs markiert, nachdem die großen Herbstfeste gefeiert wurden, die den jährlichen Zahlenwechsel einleiten. In diesem Jahr, 1630, fiel der erste Tischri, der Tag des jüdischen Neujahrs, auf den 18. September; die Lesung der Perikope mit dem Titel »Leben der Sara« fand daher am Samstag der Woche statt, die am 4. November begann: Unser Sprecher wurde also zwischen dem 4. und dem 10. November 1629 geboren, da der gregorianische Kalender das Jahr nur am 1. Januar wechselt.1 Für den Sprecher, der uns von einem Ereignis berichtet, das zur Zeit des Wochenfestes vor vierzig Jahren (ausgehend von 2025) stattfand, muss unser Neugieriger lediglich das Datum des Schawuot-Festes vom 6. bis 7. Sivan des Jahres 5745 suchen, was einen auf den 25. und 27. Mai des Jahres 1985 zurückführt. Ein Verstorbener, der am 7. Aw (dessen traditioneller Spitzname der »Monat, der tröstet2« ist) des Jahres 5550 starb, wird aufgrund der oben beschriebenen Berechnungen zum 18. Juli 1789 gelangen.
Diese Formen der Datierung führen uns in das Herz eines Systems mit zahlreichen Zeitbezügen, das in den heutigen Normen, die die Zeit zu einem Begriff machen wollen, der in allen Gesellschaften gleich ist, nicht sehr verbreitet ist. Die jüdische Zeitrechnung beginnt mit dem jüdischen Zeitalter, le-beriat olam, das vom angeblichen Datum der Erschaffung der Welt an gerechnet wird. Zwischen diesem und dem allgemeinen Zeitalter liegt also eine zusätzliche Zeitspanne von dreitausendsiebenhundertsechzig Jahren nach christlich-abendländischem Maßstab. In der Welt der jüdischen Observanz, die in der heutigen Gesellschaft eine Möglichkeit unter vielen darstellt, läuft das Jahr im Rhythmus des liturgischen Zyklus ab, der durch eine jahrhundertealte Tradition überliefert wird und dessen Zeitgebrauch an die Normen der alten Gesellschaft erinnert. Diese heute vereinbarten Unterscheidungen zwischen Religion und bürgerlichen Gesetzen zeichnen die Konturen der Räume nach, die dem Öffentlichen und dem Privaten, der Konfession und der Staatsbürgerschaft vorbehalten sind, aber sie führen auch ein dauerhaftes Prinzip der doppelten Zeitreferenz ein.
Zeitfragen
Als liturgische Zeit im Alltag des Erlebens fließt die jüdische Zeit in der Vielfalt der täglichen, wöchentlichen und jährlich wiederkehrenden Rhythmen. Ein Zyklus, der durch die Lesungen der Perikopen aus der Bibel wiederholt wird, aber in der immer wieder erneuerten Langsamkeit der Ewigkeit der Schöpfung des ersten Tages angesiedelt ist, die das Aufkommen der beweglichen, gezählten Zeit markiert. Die Tradition situiert die Erschaffung der Welt im Herbst eines Jahres, das zwischen 3762 und 3758 Jahren vor unserer Zeitrechnung stattfand. Das Jahr der Schöpfung, der einzigartige Kalender und die doppelte Einbettung in Zeit und Geschichte haben im Laufe der Jahrhunderte das Gefühl der Einzigartigkeit der Juden gefördert, die jedoch in die Gesellschaft der Welten eingebunden sind, in denen sich ihr Leben abspielt. Könnte es als bloße Bequemlichkeit ohne weitere Auswirkungen angesehen werden, wenn die Tage wie die der anderen vergehen, aber dennoch nicht im selben Zeitrahmen?
Der jüdische Kalender ist ein Erbe der antiken Zivilisationen, insbesondere der chaldäischen, und funktioniert nach dem Lunisolarprinzip. Er unterscheidet sich vom westlichen Sonnensystem, das auf die ägyptische Zivilisation zurückgeht und durch den julianischen und später den gregorianischen Kalender überarbeitet wurde. Der jüdische Kalender beruht wie sein christliches Gegenstück auf dem Zusammenwirken sowohl religiöser als auch ziviler Prinzipien im Jahresablauf. Die zyklische Anordnung des Jahres umfasst verschiedene Monatsabläufe: Das neue spirituelle Jahr beginnt im Herbst mit dem Neujahrsfest »der Jahre«, während das bürgerliche Jahr im Frühjahr mit dem Neujahrsfest »der Könige« beginnt.3 Die Kalendereinteilung stellt die Eschatologie neben die Gesetzgebung, die sowohl aus biblischen Anweisungen als auch aus rabbinischen Interpretationen hervorgegangen ist. Die Bibel ordnet die Zeit in regelmäßigen Zyklen an, die von der wöchentlichen Pünktlichkeit, die die Woche in sieben Tagen regelt, über die Jubeljahre, die Zyklen von 19 und sieben Jahren regeln, bis hin zu außergewöhnlichen neunundvierzig Jahren reichen.4 Diese zeitlichen Normen bestimmten das Leben einer landwirtschaftlichen Bevölkerung im Rhythmus der Jahreszeiten aus einer Zeit vor der Zerstreuung Palästinas. Sie wurden jedoch kaum verändert an die »Reste Israels« weitergegeben, die über die Welt in den verschiedensten Klimazonen verstreut waren. Dieser Lebenszyklus ermöglichte die Fortführung der Gruppe unter anderen Völkern, obwohl die Hebräer und später die Juden die allgemeinen äußeren, persischen oder seleukidischen Datierungsnormen akzeptierten, die zur Zählung der Regierungsjahre der damals herrschenden Monarchien verwendet wurden. Die Datierungskonventionen scheinen also unabhängig von den Verfahren zu sein, die die rituellen Formen rechtfertigen, die den Ablauf des täglichen Lebens regeln. Der Gebrauch des Weltalters, Annus mundi oder beriat olam drang erst um das 11. oder 12. Jahrhundert herum vollständig in die jüdische Welt ein. Das rituelle Leben verlief im zyklischen Rhythmus der Bibellesungen.5
Lebenszyklus und Datierung verbinden sich zu einer besonderen Zeitordnung, die sich im Mittelalter durchsetzt, während sich die Formen der »traditionellen«, auf rabbinischen Normen basierenden Gesellschaft herausbilden, die die Jahrhunderte überdauern werden. Während sich die Juden von den umliegenden Gesellschaften abwenden, die zunehmend feindseliger werden, nutzen sie die Privilegien, die ihnen von den Fürsten und Herrschern gewährt werden.6 Sie durchlaufen einen solchen Prozess der Singularisierung, dass sie innerhalb weniger Jahrhunderte eine autonome Mikrogesellschaft innerhalb der Staaten bilden, während sich ein mentales Universum herausbildet und etabliert, in dem die Wahrnehmung und der Zeitgebrauch nur ein Spiegelbild sind. Indem sie die allgemeine Zeitrechnung vernachlässigten und sich für chronologische Operationen entschieden, die eher auf Spekulation als auf objektiver Berechnung beruhten, behaupteten die Juden im Mittelalter, sie befänden sich in einer Zeitlichkeit, die sie außerhalb der sozialen Normen der Länder, in denen sie lebten, stellte. Diese Haltung hat sich im Laufe der Jahrhunderte gefestigt und ist in den modernen und zeitgenössischen Gesellschaften zu einem der charakteristischen Elemente der Einzigartigkeit der jüdischen Identität geworden. Ob man diese zeitliche Einbettung nun auf den Wunsch zurückführt, sich nicht den umliegenden Konventionen der Geschichte zu beugen, die das Datierungssystem bestimmen, oder – aus einer ganz anderen Perspektive – sie als Ausdruck einer Form nationaler und politischer Unabhängigkeit betrachtet, diese Zeitlichkeit offenbart dennoch eine besondere Form der Einschreibung in die Zeit.
Der Begriff der Zeit ist ein soziales Konstrukt, das die Kultur einer sozialen Gruppe in einer bestimmten Erfahrung der Zeit, die in der Dauer erfasst wird, verankert. Die Entwicklung der Zeitvorstellungen von archaischen Gesellschaften bis zu ihrer Fixierung in einem astronomischen und arithmetischen System veranschaulicht dies durch die Systeme der Monatsintervalle und die Kombination von Mond- und Sonnenkalender.7 Die Zeitskala, die innerhalb einer bestimmten Gruppe errichtet wurde, gibt also Aufschluss über den Grad der Kommunikation und des Handelns mit ihrer Umwelt.
Gebrauch der Zeit
Die Messung der Zeit ist jedoch nur ein Aspekt ihrer Wahrnehmung und Nutzung. Die Quantifizierung der Zeit ermöglicht messianische Vermutungen durch die Berechnung biblischer Chronologien und rabbinischer Interpretationen sowie die Bestimmung von Jubiläumszyklen. Die Zeit ist eines der wichtigsten Kennzeichen von Gesellschaften: Sie verteilt menschliche Lasten, passt die Rhythmen der Gesellschaft und der Natur an den Einzelnen und die Gruppe an. Sie ordnet eine Art und Weise an, das Menschliche vom Übermenschlichen, die irdische von der himmlischen Welt zu unterscheiden und das Göttliche zu denken. Denn unabhängig davon, ob man die Zeit als abstrakte Entität betrachtet, sie in ein System von Kategorien einordnet oder als variables Konzept analysiert, bleibt es dabei, dass die Zeit seit der Wiederentdeckung der augustinischen Meditationen über die Ewigkeit oft in die Reihe der undefinierbaren Wahrnehmungen verbannt wird. In Gesellschaften, in denen die Tradition vorherrscht, wird die menschliche Existenz von einer als heilig empfundenen zeitlichen Organisation eingerahmt, in der jede Phase von der Geburt bis zum Tod durch eine Aufteilung in heilige und profane Bereiche gekennzeichnet ist. Diese Auffassung verkörpert sich in einem spezifischen Kalender, der eine jüdische »Raum-Zeit« formt. Diese Organisation ist um einen bestimmten topographischen Ort herum aufgebaut, an dem die Juden leben und wo die Tradition einen Rahmen für den Ablauf ihres täglichen Lebens schafft. Die jüdische Zeitrechnung unterscheidet sich somit von der ihrer christlichen oder muslimischen Umgebung. Diese unterschiedlichen und doch miteinander verflochtenen Rhythmen existieren nebeneinander, ohne sich zu vermischen, und spiegeln eine Koexistenz trotz der Unterschiede wider, die sie in ein und dasselbe kulturelle Schema einordnen. Davon zeugen die Synagogenuhren, die die Zeiten der Sabbate und Feiertage anzeigen, ebenso wie die illustrierten Almanache, die christliche Feiertage und Messetermine angeben,8 oder die Register und Chroniken, die auf die implizite Verwendung jüdischer und christlicher Datierungen hinweisen, wie das Werk von David Gans aus dem 16.Jahrhundert zeigt.9 Während der Westen den Beginn eines Zeitalters als Konvention ansieht, die das Jahr der Geburt des christlichen Erlösers, das Annus Domini, als Maßstab nimmt und das Zeitalter der Barbaren als veraltet abtut, setzen die Juden den Ursprung der Zeit dagegen: das Datum der Erschaffung der Welt.
Diese beiden Zeitskalen eröffnen einen Bereich der Gesellschaftlichkeit, der durch die Konfrontation von zwei Glaubenssystemen und zwei religiösen Systemen gekennzeichnet ist. In diesem Rahmen kommen ihre Arten der Koexistenz und ihre Beziehungen zum Ausdruck. Wenn man davon ausgeht, dass die Weltanschauung den Zeitbegriff prägt, beeinflusst die Beziehung zur Zeit die Art und Weise, wie der Einzelne in das Universum eingebettet ist und wie er es begreift. Die Wahrnehmung der Zeit, ob zyklisch, mit einem ewigen, sich wiederholenden Charakter, oder linear, mit einem stetigen Fortschreiten in Richtung Zukunft oder Ziel, beeinflusst das Verhältnis zum Alltag maßgeblich. Und während die Gewissheit eines Fortschritts in Richtung eines ultimativen Ziels einen eschatologischen Prozess in Gang setzt, ist die historische Zeit im Gegensatz dazu ein Kontinuum ständiger Veränderungen.10
Die Umwälzungen in den jüdischen Gesellschaften in der Vormoderne und Moderne haben die Vorstellungen der Juden hinsichtlich ihrer Weltanschauung und des Judentums grundlegend verändert. Ihr Verhältnis zur Zeit wurde durch die Konfrontation innerhalb des Judentums verändert, das zwischen den gegensätzlichen Bestrebungen, die traditionelle Gesellschaft zu erhalten und zu verändern, hin und her gerissen war. Die Beobachtung jüdischer Zeitkonzepte erweist sich daher als bevorzugter Rahmen, um die Interaktionen der Juden mit ihrem sozialen Umfeld zu verstehen und die Art und Weise ihrer Integration in die umliegenden Gesellschaften zu ermitteln. Insbesondere die Verwendung des Kalenders ist ein relevanter Indikator, um die Dynamik dieser Eingliederung zu messen. Der Ansatz des Zeitbegriffs, der durch die Kommentare zu den kanonischen Texten beleuchtet wird, lässt sich weder von diesen Dynamiken noch von diesen Interaktionen täuschen. Der Midrasch Rabba erklärt in der Tat, dass die Zeit der Menschheit am vierten Tag der Schöpfung geschenkt wurde, zwar mit einigen himmlischen Orientierungspunkten, aber sie (die Menschheit) hat die Kontrolle über sie.11
Die Epigraphik zeugt davon. Sie zeigt, wie in der jüdischen Welt die Grabsteine die Datierungsgewohnheiten einer Epoche oder einer Gemeinschaft widerspiegeln: Es ist oft einfacher, die Todesdaten auf den Grabsteinen zu finden, als die Geburtsdaten der Individuen in der damaligen jüdischen Gesellschaft zu kennen. Über einen längeren Zeitraum hinweg, während das annus mundi vorherrscht, deuten die Datierungspraktiken auf wenig signifikante Abweichungen bei der Datierung der Ära hin. Das Zeitalter der Tempelzerstörung (70 v. Chr.) taucht kurzzeitig, wenn auch häufig, in palästinensischen Inschriften oder in den italienischen Katakomben auf. Auch die republikanische Zeitrechnung wurde erst viel später auf jüdischen Friedhöfen im Frankreich der Revolutionszeit eingeführt. Die gemeinsame Verwendung des Jahres der Erschaffung der Welt und der gemeinsamen Ära oder allein der gemeinsamen Ära in der Praxis der Grabdatierung macht deutlich, dass es einen Raum für die Darstellung von Zeitlichkeit gibt, sowohl im »jüdischen« als auch im »universellen« Modus.12
Neben der Verwendung der Zeit, die als eines der Mittel des jüdischen Singularismus angesehen wird, prägt die Beziehung zur Zeit und zur Zeitlichkeit die Vorstellungswelt und die Haltung der Juden zur Geschichte. Die Geschichte mit ihrer Kohorte von Akzeptanz und Ablehnung, sowohl eines ausschließlich irdischen als auch eines weltlichen Verlaufs, bleibt das Privileg der menschlichen Person. Die Begriffe Zeit und Geschichtlichkeit bestimmen gemeinsam durch ihre Objektivierung im täglichen Leben eine Art und Weise, wie das Individuum in das Universum eingebunden wird. Sie ermöglichen es, die Verankerungen in einem Glaubenssystem zu erkennen, das wiederum auf eine Vorstellungswelt und eine soziale Realität verweist, die sich in Haltungen äußern, deren Entwicklung man verfolgen kann.
Die Beziehung der Juden zur Zeitlichkeit kann jedoch nicht auf Dauer oder Chronologie reduziert werden. Es ist möglich, eine Zeitsaga zu erstellen, die sich auf den Übergang von der biblischen Ära bis zu einer bestimmten Periode beschränkt, indem man die in der Liturgie, den Riten und den Responsa erkennbaren Zeitmarken zu einer Zeitchronik verarbeitet. Darüber hinaus zeugt das jüdische »kulturelle Gepäck« bzw. das kulturelle und religiöse Erbe von einer jahrhundertelangen Vermischung von Bräuchen, Überzeugungen, Integration und Ablehnung. Dieser kulturelle Reichtum zeichnet das Bild einer jüdischen Gesellschaft, die um ihre Einzigartigkeit herum zusammengeschweißt ist und sich in einer Umgebung bewegt, die manchmal fremd, manchmal feindselig und noch gefährlicher für ihre Erhaltung ist, wenn sie tolerant oder sogar wohlwollend wird.
Während die jüdische Gesellschaft die Aussagen ihrer Gründungstexte fortschreibt, fügt sie diese immer wieder neu in ihre Entwicklungen ein und beweist damit ihre Fähigkeit, sich den Umwälzungen in ihrer Umgebung anzupassen und sich zu verändern. Diese Dynamik, die durch eine ständige Interaktion zwischen Vergangenheit und Gegenwart gekennzeichnet ist, führt eine paradoxe Spannung zwischen Perpetuierung und Wandel ein, was relevante Fragen bezüglich ihrer Beziehung zur Zeitlichkeit aufwirft. Diese Dynamik könnte als eines der Merkmale der sogenannten »traditionellen« Gesellschaften interpretiert werden, wie sie von Mircea Eliade und Aaron Gurjewitsch13 definiert wurden. Sie ist jedoch mit einer ganz anderen Komplexität verbunden. Ein kulturalistischer Ansatz, wie er von Efraim Shmueli vertreten wird, ermöglicht es, die jüdische Geschichte neu zu betrachten und sich dabei von den monolithischen Formen zu entfernen, die durch die Idee einer linearen Geschichte etabliert wurden.14 Denn das zyklische Modell der Antike koexistiert scheinbar konfliktfrei mit dem linearen Modell der Moderne in einer Zeitlichkeit, die sich vereinfachenden Kategorien widersetzt. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, auf die geometrische Ellipse zurückzugreifen, um das Hin und Her der Zirkulationen der Zeitfigur angemessener darzustellen. So sind alle Denkbewegungen der Perioden der jüdischen Geschichte, selbst die am offensichtlichsten vergangenen, wie die, die die biblischen und talmudischen Epochen durchzogen, dennoch immer noch in den bestehenden Modellen am Werk, die die rabbinischen, philosophischen, mystischen oder rationalen Systeme der modernen oder zeitgenössischen Epochen präsentieren. Diese Elemente verbinden oder trennen sich zeitweilig, um dann in den Modalitäten einer Gegenwart zu verschmelzen, die eine Vielzahl von spezifischen Modellen zur Erfassung der Idee der Zeit aufruft. Versucht man, diese in die stereotypen Normen der linearen und kreisförmigen Unterscheidungen einzuordnen, die angeblich die traditionellen oder theologischen Modelle der westlichen christlichen Gesellschaften bestimmen, würde man leicht zu einer Auflistung heterogener Systeme kommen. Diese oft unvollständigen Systeme stehen miteinander in Konflikt und offenbaren einen undurchsichtigen Wettbewerb zwischen Auffassungen, die trotz ihrer Unterschiede dennoch durch ihre ständigen Interdependenzen miteinander verwickelt sind.
Nichtsdestotrotz entfaltet sich eine jüdische Sicht der Zeit durch die Dialektik, die sich zwischen den Begriffen olam ha-zeh (»diese Welt«) und olam ha-ba (»die kommende Welt«) abspielt. Sie hat ihren Ursprung in der Vorstellung von der Erwartung der Erlösung, einem Konzept, das vom Judentum im Laufe seiner Geschichte entwickelt und aufrechterhalten wurde. Die jüdischen Begriffe be-atid lavo (»in der kommenden Zukunft«) oder ba-olam ha-zeh (»in dieser Welt«) sind Ausdrücke, die in jüdischen Gesellschaften zirkulieren und ihnen in verschiedenen Welten und Epochen charakteristische Aspekte verleihen. Diese Formeln, die von den wesentlichen Prinzipien der jüdischen Eschatologie abgeleitet sind, tragen zu einem besseren Verständnis des Zeitbegriffs und seiner Anwendungen bei. Sie legen die Existenz einer Zeit nahe, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft erstreckt, einer Zeitlichkeit, die ständig in Bewegung und im Wandel begriffen ist und die oft als Verdichtung des Augenblicks in rückwärts gerichteten oder sich entwickelnden Projektionen wahrgenommen wird.
In der jüdischen Interpretation der Begriffe »diesseitiger Welt« und »kommender Welt« wird innerhalb der Tradition eine Unterscheidung getroffen, die sich auf die Idee der Auferstehung bezieht.15 Die »kommende Welt« wird als der Höhepunkt der Menschheit verstanden, der ihren Austritt aus der Geschichte markiert. Da diese kommende Welt die gesamte Menschheit betrifft und somit ihrem Wesen nach universell ist, gehört sie zum gemeinsamen Fundus der monotheistischen Glaubensvorstellungen. Die Auferstehung hingegen bleibt in ihrem Wesen ungewiss, da nur Gott den Schlüssel dazu besitzt. Dieser Begriff hat im Laufe der jüdischen Geschichte intensive Debatten ausgelöst und wird als offene Perspektive betrachtet, die entweder als nationales Ereignis oder als universelles Phänomen interpretiert werden kann und stets aus mystischen und philosophischen Blickwinkeln betrachtet wird. Die Frage hat im jüdischen Denken heftige Debatten ausgelöst, insbesondere mit dem Philosophen Maimonides (1135/1138-1204), der die Auferstehung als Metapher für die Unsterblichkeit der Seele betrachtete.16 Heutzutage, während man zwischen einer digitalen oder analogen Zeit wählen kann, bleibt die Frage nach dem Gebrauch der Zeit ein unvermindertes Anliegen, das auch von Dystopien nicht ausgeschlossen wird. Und in diesem Kontext der Ungewissheit hinsichtlich der Zukunft bietet die jüdische Tradition eine wertvolle Perspektive darauf, wie die zukünftige Welt aussehen könnte, denn sie besagt, dass der Sabbat, der Tag, an dem das Individuum mit einer zusätzlichen Seele ausgestattet wird und das Privileg eines Tages genießen kann, der sich von der menschlichen Zeitlichkeit befreit, ein Vorgeschmack auf diese Welt ist.17
Dieser Text ist eine Bearbeitung der Einleitung von





























