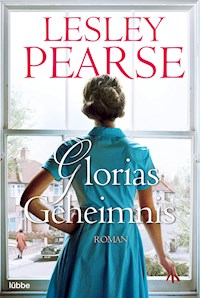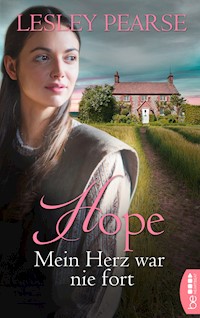9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London, 1935: Durch einen Zufall lernen sich die beiden Mädchen Verity und Ruby kennen. Verity stammt aus gutem Hause, Ruby aus ärmlichen Verhältnissen, doch gerade wegen ihrer Unterschiede sind die beiden von der jeweils anderen sehr beeindruckt und freunden sich miteinander an. Trotz aller Widerstände schaffen sie es, ihre Freundschaft bis ins Erwachsenenalter zu bewahren, aber dann entzweit ein schreckliches Unglück die beiden Freundinnen. Werden sie je wieder zueinander finden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 703
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
Über das Buch
London, 1935: Durch einen Zufall lernen sich die beiden Mädchen Verity und Ruby kennen. Verity stammt aus gutem Hause, Ruby aus ärmlichen Verhältnissen, doch gerade wegen ihrer Unterschiede sind die beiden von der jeweils anderen sehr beeindruckt und freunden sich miteinander an. Trotz aller Widerstände schaffen sie es, ihre Freundschaft bis ins Erwachsenenalter zu bewahren, aber dann entzweit ein schreckliches Unglück die beiden Freundinnen. Werden sie je wieder zueinander finden?
Über die Autorin
Lesley Pearse wurde in Rochester, Kent, geboren und lebt mit ihrer Familie in Bristol. Ihre Romane belegen in England regelmäßig die ersten Plätze der Bestsellerlisten. Neben dem Schreiben engagiert sie sich intensiv für die Bedürfnisse von Frauen und Kindern und ist Präsidentin für den Bereich Bath und West Wiltshire des Britischen Kinderschutzbundes.
LESLEY PEARSE
Zeiten voller Hoffnung
Roman
Aus dem Englischen von Britta und Tessa Evert
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:Copyright © 2016 by Lesley PearseTitel der Originalausgabe: »Dead to me«Originalverlag: Michael Joseph, Penguin Books Ltd.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, KölnTitelillustration: © Joana Kruse/ArcangelUmschlaggestaltung: Manuela Städele-MonverdeE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5584-0
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
KAPITEL 1
1935
»Guck dir das an!«, rief Ruby dem Mädchen zu, das neben ihr stand und wie sie selbst mit offenem Mund auf den Mann starrte, der gerade aus dem Badeteich in Hampstead gezogen wurde.
»Ist er tot?«, fragte das andere Mädchen mit bebender Stimme.
»Wahrscheinlich. Die versuchen ja nicht mal, ihn wiederzubeleben.«
Es war Anfang April, kurz nach Ostern, und obwohl die Sonne schien, war es kalt. Abgesehen von den beiden Mädchen gab es nur wenige Leute, die den Vorfall beobachteten, hauptsächlich Erwachsene, die mit ihren Hunden Gassi gingen.
Schweigend schauten die Mädchen zu, wie zwei kräftige Polizisten den triefend nassen Körper auf den Weg neben dem Teich und dann auf eine von zwei Sanitätern gehaltene Trage hievten.
In dem weitläufigen Park von Hampstead Heath gab es drei Badeteiche, jeweils einen für Männer und einen für Frauen und einen für Badegäste beiderlei Geschlechts. Alle drei waren eingezäunt und von Sträuchern und Bäumen umgeben. Der Teich für Damen war kaum zu sehen, so dicht war das Buschwerk, hinter dem er sich verbarg. Aber der Ertrunkene hatte in dem Teich für gemischtes Publikum gebadet, und da wegen Reparaturarbeiten am Zaun ein Teil der Hecke gestutzt worden war, hatten die Mädchen freie Sicht.
Ruby versetzte es einen leichten Stich, als sie sah, wie ein Sanitäter das Gesicht des Ertrunkenen zudeckte. Es war der erste Tote, den sie je gesehen hatte, und obwohl sie gut zehn Meter entfernt stand und den Mann nicht gekannt hatte, empfand sie Trauer.
»Wer mag das sein?«, fragte das andere Mädchen. »Ob er Frau und Kinder hat? Wir müssen wohl abwarten, bis darüber etwas in der Zeitung steht«, fügte sie bekümmert hinzu.
Ruby hatte das Gefühl, dass die andere genauso betroffen war wie sie selbst, und drehte sich zu ihr um. Sie war vermutlich ein bisschen jünger als Ruby, vielleicht zwölf oder dreizehn, und hatte langes blondes Haar, das von einem blauen Samtband gehalten wurde. Ihre Stimme klang kultiviert, ihre Kleidung wirkte teuer. Normalerweise war Ruby für solche Mädchen unsichtbar.
»Darüber schreiben die nur, wenn er reich oder berühmt war. Warum arme Leute sterben, interessiert doch keinen«, sagte sie im Brustton der Überzeugung. »Wohnst du hier in der Gegend? Ich hab dich noch nie gesehen.«
»Ich wohne auf der anderen Seite von Hampstead Village, in der Nähe von Swiss Cottage«, sagte die Blonde. »Normalerweise gehe ich nicht allein auf die Heide; Mutter glaubt, dass hier oben Mörder herumlungern.«
Es gefiel Ruby, wie sie das sagte – als fände sie die Ansichten ihrer Mutter albern. »Liegen Mörder denn auf der Lauer nach Leuten, die sie abmurksen können?«, fragte sie und musste unwillkürlich grinsen, weil sie die Vorstellung komisch fand. »Bringen die nicht meistens jemanden um, den sie schon kennen? Na, ist ja auch egal. Wie heißt du, und wie alt bist du?«, wollte sie wissen.
»Ich heiße Verity Wood und bin dreizehn Jahre alt. Und du?«
»Ruby Taylor, vierzehn. Ich wohne in Kentish Town, und da ist es längst nicht so schön wie hier. Deine Mutter würde bestimmt in Ohnmacht fallen, wenn sie wüsste, dass du mit einer wie mir redest!«
»Es kümmert mich nicht wirklich, was sie denkt.« Verity warf den Kopf zurück, sodass ihr das schimmernde Haar in den Nacken fiel. »Was meinst du, wo bringen sie den Toten wohl hin? Wird die Polizei herausfinden, woher er kommt?«
Es gefiel Ruby, dass diese Verity, die offenbar aus gutem Haus kam, es nicht für unter ihrer Würde hielt, mit einer zu sprechen, die von den meisten Leuten als »Kind der Gosse« bezeichnet worden wäre.
»Der kommt ins Leichenschauhaus, wo man Tote aufschneidet, um zu sehen, woran sie gestorben sind. Wenn einer irgendwelches Zeug in den Taschen hat, an dem man sieht, wer er ist und wo er wohnt, geht die Polizei hin und sagt es der Familie und bringt einen Verwandten ins Leichenschauhaus, damit er den Toten identifiziert.«
»Was du alles weißt!«, rief Verity.
Ruby zuckte die Achseln. »Mrs. Briggs, die unter uns wohnt, die hatte mal die Polizei im Haus, als sie ihr gesagt haben, dass ihr Alter in Camden Town mit eingeschlagenem Schädel tot aufgefunden worden ist. Meine Ma ist mit ihr hingegangen, um ihn zu identifizieren. Beiden ist total schlecht geworden, weil er so übel zugerichtet war. Aber als der Doktor ihn aufgeschnitten hat, kam raus, dass er gar nicht an der Kopfwunde gestorben ist. Er hatte einen Scheißherzinfarkt und ist hingeknallt und hat sich den Schädel am Randstein aufgeschlagen.«
»Mann«, sagte Verity beeindruckt und sah Ruby bewundernd an. »Du weißt aber wirklich eine Menge!«
Sie verstummten, als der Krankenwagen mit dem Ertrunkenen abfuhr, und beobachteten, wie vier Polizeibeamte ausschwärmten, um das Gelände rund um den Teich abzusuchen.
»Die gucken, ob sie irgendwas finden, weil sie dann wissen, ob der Mann freiwillig ins Wasser gegangen oder einfach gefallen ist. Wenn sie noch andere Fußspuren oder so finden, denken sie vielleicht, jemand hat ihn reingestoßen oder überhaupt zuerst umgebracht und dann die Leiche ins Wasser geworfen«, stellte Ruby sachkundig fest. »Ich schätze mal, der ist zuerst ermordet und dann ins Wasser geworfen worden, nachdem der Badeteich geschlossen wurde.«
Ruby interessierte sich sehr für Detektivarbeit. Sie stammte aus dem rauen, heruntergekommenen Kentish Town und hatte gelegentlich beobachtet, wie sich Polizeibeamte nach einem Verbrechen auf die Suche nach Beweisen machten. Sie war auch schon einige Male befragt worden, ob sie nicht diese oder jene Person gesehen habe, und genauso oft hatte sie die jungen Konstabler mit Fragen zu den Fällen gelöchert, in denen sie ermittelten. Seit sie reden konnte, war ihr eingebläut worden, nie jemanden zu »verpfeifen«, und das würde sie auch nie tun, aber gegen das Einsammeln von Informationen, um ihre eigene Neugier zu befriedigen, gab es kein Gesetz, ob geschrieben oder ungeschrieben.
Die Mädchen blieben noch eine Weile stehen, aber da es nichts Interessantes mehr zu sehen gab, schlenderten sie schließlich in Richtung Whitestone Pond und Hampstead Village weiter.
»Hast du Geschwister?«, fragte Ruby, der sehr viel daran lag, das Interesse dieses vornehmen Mädchens so lange wie möglich zu fesseln.
»Nein, leider nicht. Es kann ziemlich einsam sein, ein Einzelkind zu sein«, antwortete Verity.
Ruby konnte mit dem Begriff »einsam« nicht viel anfangen. Da sie zusammen mit ihrer Mutter in einem Zimmer lebte und jeder andere der sechs Räume im Haus von ganzen Familien bewohnt wurde, gab es in ihrer Nähe ständig Menschen und Lärm. Genau deshalb war sie heute in den Park von Hampstead Heath gegangen: um Ruhe und Frieden zu haben.
»Ich bin gern allein«, sagte sie achselzuckend. »Na ja, jedenfalls hab ich’s gern ruhig – das ist es bei mir zu Haus nämlich nie. Aber ich finde es schön, mit dir zu reden. Du bist richtig nett und außerdem wahnsinnig hübsch.«
»Oh, danke schön«, sagte Verity und wandte ihr Gesicht Ruby zu. Das Mädchen hatte rote Locken, die förmlich nach einer Bürste schrien, aber die Haarfarbe war schön und wurde durch die grünen Augen noch betont. »Du bist auch hübsch. Deine Haare gefallen mir, und es macht Spaß, mit dir zusammen zu sein, weil du so viel weißt. Die Mädchen von meiner Schule sind alle so langweilig und brav. Alles, was sie können, ist kichern und über Kleider reden.«
»Über Kleider kann ich nicht reden, weil ich bloß das hier habe«, sagte Ruby. Ihr Kleid war aus grober brauner Baumwolle, viel zu weit und noch dazu recht schmuddelig. Darüber trug Ruby eine Jungenjacke aus Tweed, die ihre Mutter eines Abends auf dem Heimweg vom Pub gefunden hatte. Sie hätte die Jacke selber getragen, wenn sie ihr nicht zu klein gewesen wäre. »Freut mich, dass dir mein Haar gefällt. Die meisten Leute nennen es karottenrot.«
»Karottenrot ist es überhaupt nicht, eher wie Kupfer, und wirklich schön«, sagte Verity. »Obwohl ich finde, du solltest versuchen, es hin und wieder zu kämmen.«
Ruby wusste nicht recht, was sie darauf sagen sollte. Verity kam ganz offensichtlich aus jener Art von Zuhause, die Ruby nur flüchtig aus dem Kino kannte. Ein Haus, wo Bürsten und Kämme auf einem Frisiertisch lagen, wo man sich jederzeit ein heißes Bad einlassen konnte und jemand die schmutzige Kleidung einsammelte und für einen wusch und bügelte.
Ruby war klar, dass Verity keine Ahnung hatte, wie es war, eine Mutter zu haben, die meistens betrunken war, in einem kleinen Zimmer zu hausen, wo man eimerweise Wasser zu schleppen hatte, wenn man sich selbst oder seine Sachen waschen wollte, oder das Ganze am gemeinsamen Wasserhahn draußen im Hof erledigen musste. Wenn Ruby ihr Kleid wusch, musste sie, während es trocknete, gut aufpassen, dass es nicht von jemandem geklaut wurde, der noch schlechter dran war als sie selbst. Während dieser Zeit trug sie nur ihren Unterrock und dazu einen Sack um die Schultern. Selbst ihr Kamm ging ständig verloren.
Aber sie nahm Verity die Bemerkung nicht übel. »Würd ich machen, wenn ich einen Kamm hätte«, erwiderte sie und betrachtete verstohlen den dicken marineblauen Mantel mit braunem Pelzbesatz an Kragen und Manschetten, den die andere trug. Was hätte sie nicht gegeben, um so einen Mantel zu besitzen! Sie konnte auch sehen, dass Veritys Kleid, das unter dem Mantel hervorlugte, aus rosa Wollstoff war. Sie trug sogar dicke Strümpfe an den Beinen, um nicht zu frieren. »Ich würde mich auch über einen schönen warmen Mantel wie deinen freuen und über eine warme Mahlzeit am Tag, aber wie meine Oma immer gesagt hat: ›Wenn Wünsche Pferde wären, würden Bettler reiten.‹«
Verity machte ein verlegenes Gesicht. »Das war unhöflich von mir, nicht wahr? Tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht.«
»Muss dir nicht leidtun«, meinte Ruby leichthin. »Du weißt eben nix von armen Leuten. Ich wette, du kommst normalerweise nicht mal so richtig aus deiner eigenen Straße raus, oder? Solltest du ruhig mal probieren, London ist echt ’ne tolle Stadt.«
In Veritys Augen blitzte Interesse auf, und sie sah Ruby fragend an. »Würdest du es mir zeigen?«, fragte sie.
Ruby zuckte mit den Schultern. In Wirklichkeit war sie begeistert, dass ein Mädchen wie Verity mit ihr nicht nur über die Heide bummelte, sondern noch mehr Zeit mit ihr verbringen wollte. »Wenn du willst«, sagte sie so lässig, wie sie nur konnte. »Ich hab diese Woche schulfrei. Du auch? Sollen wir morgen was unternehmen?«
»Ja, ja!« Verity strahlte übers ganze Gesicht und hüpfte aufgeregt von einem Bein aufs andere. »Das wäre fabelhaft!«
Ruby lachte. Angesichts einer so großen Freude vergaß sie, wie kalt ihr war und dass sie Hunger hatte. »Du brauchst ein bisschen Geld für die U-Bahn oder den Bus oder wenn du irgendwo was essen willst. Ich hab keins.« Sie wollte nicht wie ein Bettelkind klingen, aber sie musste ihre Situation unmissverständlich klarmachen.
»Kein Problem, ich habe Geld.« Verity strahlte. »Sollen wir nicht jetzt gleich irgendwo etwas essen und trinken gehen und uns darüber unterhalten, was wir morgen unternehmen?«
Ruby erstarrte kurz. Sie hätte liebend gern etwas gegessen und getrunken, aber sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie in der Art Lokal, die Verity vermutlich aufsuchte, gern gesehen wäre. »Das wäre toll, aber …« Sie brach ab, weil sie es einfach nicht über die Lippen brachte.
Verity runzelte die Stirn. Plötzlich schien ihr ein Licht aufzugehen, und sie grinste. »Ich glaube, ich weiß, wo wir hinkönnen. Komm!« Sie nahm Ruby an die Hand.
Die Mädchen liefen Hand in Hand die Heath Street hinunter und lachten, weil sich die Leute nach ihnen umdrehten. Bei der U-Bahn-Station ging Verity mit Ruby in Richtung Belsize Park und bog ungefähr fünfhundert Meter weiter in eine schmale Gasse. Hier befanden sich mehrere kleine Geschäfte – ein Flickschuster, ein Kurzwarenladen und ein Hutsalon –, die alle ein bisschen schäbig wirkten, und dahinter ein Laden, in dem frische Pasteten verkauft wurden. Ein köstlicher Duft wehte ihnen entgegen; Rubys Magen zog sich vor Hunger schmerzhaft zusammen.
»Ein Dienstmädchen, das eine Weile bei uns gearbeitet hat, war einmal mit mir hier«, erzählte Verity. »Sie hat gesagt, hier gäbe es die besten Pasteten in London. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil unsere Haushälterin auch sehr gute macht, aber die von hier waren wirklich lecker.«
Ruby konnte sehen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Laden handelte, weil die große Theke fehlte, auf der die Pasteten normalerweise warmgehalten wurden. Wahrscheinlich wurden die Pasteten an andere Geschäfte und Restaurants verkauft, dachte sie sich. Aber es gab zwei kleine Tische für Kunden, die gleich hier essen wollten.
»Wenn du findest, ich kann da reingehen, würd ich gern eine verdrücken«, sagte Ruby, die Mühe hatte, die Worte zu formen, so sehr lief ihr das Wasser im Mund zusammen. »Ich bin am Verhungern«, fügte sie hinzu.
Da sie seit zwei Tagen nichts in den Magen bekommen hatte, war diese Bemerkung keine Übertreibung. Unter anderem war sie heute auch deshalb nach Hampstead gekommen, weil sie hoffte, irgendwo etwas Essbares klauen zu können. Sie hatte festgestellt, dass die Leute dort täglich Milch, Brot und andere Lebensmittel geliefert bekamen und die Lieferanten die Sachen häufig vor der Haustür stehen ließen, wenn die Bewohner nicht da waren. Aber auf dem Weg durch den Park war sie von den Ereignissen am Badeteich abgelenkt worden und hatte ihren Hunger und den Zweck ihres Kommens vorübergehend vergessen.
Verity bestellte zwei Pasteten und zwei Tassen Tee, und innerhalb weniger Minuten standen die Sachen vor ihnen auf dem Tisch.
»Oh Mann!«, rief Ruby, als ihr der Duft der Steak- und Nierenpastete mit der goldbraunen Teighülle in die Nase stieg. »Hab ich einen Kohldampf! Bestimmt blamier ich dich, wenn ich gleich reinhaue!«
»Unsere Haushälterin fasst es als Kompliment auf, wenn ich mich heißhungrig auf die Sachen stürze, die sie gekocht hat, und ich bin sicher, die Leute hier sehen es genauso.« Das war gelogen. Miss Parsons würde es nie gutheißen, wenn jemand sein Essen hinunterschlang, egal, wie köstlich es schmecken mochte. Sie hielt große Stücke auf gute Manieren. Aber Verity wollte, dass Ruby sich wohlfühlte.
Ruby witterte den Schwindel, entschied aber, dass er gut gemeint war. Ob es der Frau, die ihnen die Pasteten gebracht hatte, Freude bereiten würde, ihr beim Essen zuzuschauen, bezweifelte sie. Wahrscheinlich zerbrach die Verkäuferin sich gerade den Kopf, wie sie das gutmütige reiche Mädchen von diesem Gassenkind loseisen sollte, das womöglich vorhatte, es auszurauben. Aber im Moment interessierte sich Ruby nicht dafür, was irgendjemand von ihr hielt. Sie dachte nur daran, sich den Bauch vollzuschlagen.
Sie ignorierte Messer und Gabel, packte die Pastete mit beiden Händen und biss hinein. Das war ohne Zweifel die beste Pastete, die sie je gekostet hatte, gehaltvoll und saftig, das Fleisch so zart, dass es auf der Zunge zerging. Und die Teighülle war locker und luftig wie ein Schmetterlingsflügel. Ruby schloss die Augen, um den Geschmack und das köstliche Aroma noch mehr zu genießen.
Die Pastete war im Handumdrehen verschwunden, und als sie die Augen wieder aufmachte, sah sie, dass Verity ihre eigene zierlich mit Messer und Gabel zerteilte. »Das war toll«, stieß sie atemlos hervor, während sie sich die Finger ableckte und ihren Mund am Jackenärmel abwischte.
Dann wurde ihr bewusst, wie ungehobelt sie auf Verity wirken musste. Sie hatte sich die Pastete mit ihren schmutzigen Fingern einfach in den Mund gestopft, und obwohl Ruby noch nie feine Leute beim Essen beobachtet hatte, wusste sie, dass man so etwas nicht tat. Sie verging fast vor Scham und wäre am liebsten aus dem Laden hinaus und zurück nach Kentish Town gelaufen.
Aber sie war zu dankbar für das Essen, um Veritys Gefühle noch mehr zu verletzen.
»Tut mir leid«, entschuldigte sie sich mit niedergeschlagenen Augen. »Ich hab gefressen wie ein Schwein, was? Ich konnte einfach nicht anders, weil ich so einen Hunger hatte. Ich hab dich echt blamiert, und dabei isst du so fein.«
Verity lächelte bloß, ein Lächeln, das von Herzen kam und ihre blauen Augen leuchten ließ. »Wenn du wirklich solchen Hunger hattest, konntest du natürlich nicht anders. Nimm ruhig den Rest von meiner Pastete, ich habe genug. Aber iss lieber nicht zu schnell, sonst bekommst du eine Magenverstimmung. Das sagt Miss Parsons jedenfalls immer.« Sie schob ihren Teller, auf dem noch mehr als die Hälfte der Pastete lag, zu Ruby hinüber.
Das ließ Ruby sich nicht zweimal sagen. Diesmal griff sie jedoch nach dem Besteck und versuchte genauso zu essen wie Verity.
Als sie zehn Minuten später draußen vor dem Laden standen, fasste Verity Ruby am Arm. »Bist du oft hungrig?«, fragte sie. »Hat dein Vater keine Arbeit?«
»Keine Ahnung, wer mein Vater ist«, sagte Ruby mürrisch. »Der hat sich schon vom Acker gemacht, noch bevor ich auf der Welt war. Und Hunger zu haben ist für mich normal. Ich bin heute hergekommen, um mir was zu essen zu klauen. Das ist für mich auch normal.«
Veritys Augen weiteten sich vor Bestürzung. »Das ist ja furchtbar!«, sagte sie. »Dass du so etwas machen musst, meine ich natürlich. Ich wünschte, ich könnte dich mit nach Hause nehmen, damit du es besser hast, aber das geht leider nicht.«
»Nee, das geht echt nicht«, lachte Ruby. »Mit mir zu reden und mir eine Pastete zu spendieren, das war schon mehr als genug. Wenn deine Leute dich mit mir sehen würden, würden sie Anfälle kriegen.«
»Aber wir können trotzdem Freundinnen sein, nicht wahr?«, fragte Verity. »Ich mag dich nämlich.«
Ein Gefühl von Wärme erfüllte Ruby, und es lag nicht nur daran, dass sie etwas gegessen und Tee getrunken hatte. »Ich mag dich auch«, sagte sie. »Aber wenn wir Kumpel sein wollen, musst du mir ein paar Manieren beibringen.«
»Das mache ich gern, und dafür zeigst du mir London«, erwiderte Verity. »Morgen fangen wir an!«
Verity huschte so leise wie möglich durch die Tür im Souterrain in ihr Haus in Daleham Gardens, in der Hoffnung, unbemerkt die Treppe hinauf und in ihr Zimmer zu gelangen. Aber ihr Glück ließ sie im Stich, und sie lief Miss Parsons, der Haushälterin, direkt in die Arme, als diese aus der Waschküche kam.
»Wo bist du gewesen, Kind?«, fragte sie in dem für sie typischen scharfen Ton.
Verity sank der Mut. Die Haushälterin meldete stets pflichtgetreu jedes Fehlverhalten ihren Eltern. »Ich habe nur einen Spaziergang ins Dorf gemacht. Tut mir leid. Wollte Mutter mich sehen?«
Miss Parsons war eine kleine, knochige Frau in mittleren Jahren, die bei den Woods arbeitete, seit sie dieses Haus gekauft hatten. Damals war Verity ungefähr drei Jahre alt gewesen. Dass Miss Parsons aus Cambridge stammte, war alles, was Verity über sie wusste; sie sprach nie über sich selbst.
Sogar ihre Mutter fand die Frau reichlich unterkühlt. Verity hatte einmal zufällig mitangehört, wie sie einer Freundin von Miss Parsons erzählte. Sie sagte, ihrer Meinung nach sollte eine Haushälterin, die schon so lange für eine Familie arbeitete, fast so etwas wie eine Tante oder Kusine werden, insbesondere für ein Kind, das sie von klein auf kannte. Sie hatte rasch hinzugefügt, dass Miss Parsons den Haushalt vorbildlich führte und sie ohne sie gar nicht zurechtkommen würden; sie wünschte nur, sie wäre nicht ganz so streng und dafür ein wenig geselliger.
Verity hatte sich manchmal, wenn sie wusste, dass die Haushälterin nicht da war, in Miss Parsons’ Zimmer auf dem Dachboden vorgewagt, um ein bisschen mehr über sie zu erfahren, war aber stets enttäuscht worden. Der Raum war genauso sauber und ordentlich wie die Haushälterin selbst, die weiße Tagesdecke auf dem Bett so glatt, als wäre sie frisch gebügelt. An einem Haken hinter der Tür hing ihr marineblaues Dienstkleid, und unter der Kommode standen ihre soliden, auf Hochglanz polierten schwarzen Schnürschuhe. Neben dem schmalen Eisenbett fanden sich einige wenige Bücher aus der Bücherei und ein Wecker. Verity war nicht unverfroren genug gewesen, Schubladen zu öffnen oder in den Schrank zu spähen, aber sie hatte gehofft, Fotos oder irgendetwas anderes zu sehen, irgendeinen Hinweis darauf, dass die Frau Freunde und Verwandte hatte.
»Ja, allerdings. Deine Mutter wollte, dass du sie zu Selfridges begleitest. Sie war nicht gerade erfreut, Verity«, sagte Miss Parsons und verzog missbilligend die Lippen.
Verity war klar, dass eine Gardinenpredigt auf sie wartete, aber das war einfach nicht fair. Wenn ihre Mutter das Kaufhaus Selfridges aufsuchte, dann nur, um Kleider zu begutachten oder Hüte anzuprobieren, während sich Veritys Rolle darauf beschränkte, danebenzustehen und sie zu bewundern. Jeder Versuch, Miss Parsons auf ihre Seite zu ziehen, wäre vergeblich; die Haushälterin schien es geradezu zu genießen, wenn Verity Ärger bekam.
»Ich gehe nach oben in mein Zimmer und lese ein bisschen«, sagte sie und eilte rasch die Treppe hinauf.
Die Begegnung mit Ruby hatte tiefen Eindruck auf Verity gemacht. Es lag nicht nur daran, dass das Mädchen aus einer ganz anderen Welt kam, so faszinierend das auch sein mochte, sondern an dem Gefühl, es wäre ihr aus irgendeinem Grund, der ihr jetzt noch unbekannt war, bestimmt gewesen, Ruby kennenzulernen.
Verity blieb in der Diele stehen und versuchte, ihr Haus mit Rubys Augen zu sehen. Bestimmt wäre ihre neue Freundin von dem großen dreistöckigen Reihenhaus mit Souterrain schwer beeindruckt gewesen. Schon vom Eingangstor aus wirkte es mit der gepflegten Rasenfläche vor dem Haus und den Steinlöwen links und rechts der breiten Stufen, die zur Haustür führten, sehr imposant.
Drinnen im Haus fand sich der Besucher in einer geräumigen Diele mit Bodenkacheln in schwarzweißem Schachbrettmuster wieder. Eine Glastür führte auf die vordere Veranda, an die das Studierzimmer ihres Vaters anschloss. Nach hinten hinaus, mit Blick auf den Garten, befanden sich Salon und Speisezimmer. Die Treppe war breit, das Geländer aus blank poliertem Holz, und auf halbem Weg nach oben, auf dem Absatz, zierte ein schönes Buntglasfenster die Wand.
Jedes Jahr zu Weihnachten ließ ihr Vater einen großen Tannenbaum in der Diele aufstellen, und ihre Mutter schmückte das Treppengeländer mit Girlanden aus Stechpalmenzweigen und rotem Band. Sämtliche Geschenke, auch die für die Leute, die am ersten Weihnachtsfeiertag zum Lunch zu ihnen kamen, wurden rund um den Baum arrangiert. Bis zum letzten Jahr war Weihnachten für Verity eine märchenhafte Zeit gewesen, und sie hatte immer gefunden, sie könne sich glücklich schätzen, ein so schönes Zuhause zu haben.
Aber an jenem Heiligabend war etwas geschehen, das diese Überzeugung für immer zerstören sollte. Verity hatte versucht, es aus ihrem Denken zu streichen, aber es war ihr nicht gelungen, und nun lebte sie in der ständigen Furcht, es könnte wieder geschehen. Früher hätte sie nicht einmal im Traum daran gedacht, allein auszugehen, aber jetzt schien es draußen sehr viel sicherer zu sein als daheim, selbst wenn sie ohne Erlaubnis das Haus verließ und sich dadurch den Zorn ihrer Mutter zuzog.
Sie wandte sich um und lief die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Wie der Rest des Hauses war auch dieser Raum sehr schön, mit Blick auf den Garten und in sanften Creme- und Pfirsichtönen eingerichtet. Verity besaß einen Schrank voller Kleider, ein riesiges Puppenhaus mitsamt einer ganzen Puppenfamilie, die darin lebte, Hunderte Bücher, Puzzles, Spiele, Puppen und Stofftiere, die alle hübsch ordentlich in den Regalen saßen, aber sie rührte kaum noch etwas davon an. Etwas Dunkles, Schlimmes war zu Weihnachten in dieses Zimmer eingedrungen, und sie konnte es immer noch spüren, sogar bei strahlendem Sonnenschein.
Aber heute, nach ihrer Begegnung mit Ruby, schien es nicht mehr so gegenwärtig. Sie wusste, wie entsetzt ihre Eltern wären, wenn sie wüssten, dass sie sich mit einem Mädchen angefreundet hatte, das sie als »Gassenkind« bezeichnen würden, aber Verity hatte sie auf Anhieb gerngehabt und war trotz der Ansichten ihrer Eltern fest entschlossen, Ruby am nächsten Tag wiederzusehen.
Cynthia Wood nippte an ihrem Gin Tonic, den sie stets vor dem Dinner trank, und starrte nachdenklich in den Garten hinaus, während sie sich fragte, was sie mit Verity machen sollte. Es dämmerte bereits, Miss Parsons würde bald das Abendessen servieren, und wenn Cynthia ihre Tochter mit Stubenarrest bestrafen wollte, musste sie jetzt handeln.
Sie hielt im Grunde nichts von dieser Art Konfrontation, aber höchstwahrscheinlich würde Miss Parsons Archie berichten, was passiert war, wenn er nach Hause kam. Und er würde sich ärgern, weil seine Frau keine Konsequenz gezeigt hatte.
Archie schien zurzeit ständig verärgert zu sein, und sie verbrachte sehr viel Zeit mit dem Versuch, ihn zu beschwichtigen. Früher hätte sie jede Frau, die sich so verhielt, spöttisch belächelt, aber tatsächlich hatte sie begonnen, sich vor ihm zu fürchten. Wenn er jetzt einen Wutanfall bekam, war es, als hätte man seinen gemeingefährlichen Zwillingsbruder vor sich, der normalerweise eingesperrt war.
Cynthia erhob sich aus ihrem Lehnstuhl am Fenster und betrachtete sich in dem Spiegel, der über dem Kamin hing. Sie war ein bildhübsches Kind gewesen – klein, blond und blauäugig –, aber nun, als Frau von zweiundvierzig Jahren, konnte sie erkennen, dass ihre Züge zu scharf und vogelartig geworden waren, um noch als hübsch zu gelten. Ihr ehemals weißer und rosiger Teint war fahl geworden, und allzu viele dünne Fältchen hatten sich um ihre Augen eingegraben. Andere Frauen beneideten sie um ihre schlanke Gestalt und ihr Gespür für Mode. Dabei wäre sie viel lieber um Charme oder Intelligenz beneidet worden statt wegen einer Figur, die sie lediglich dem Umstand verdankte, zu nervös zu sein, um viel zu essen. Und jede Frau konnte lernen, sich gut zu kleiden, wenn sie so oft Modejournale studierte und bei Selfridges stöberte wie sie.
Mit einem tiefen Seufzer verließ Cynthia in dem Moment das Esszimmer, als Miss Parsons von unten aus der Küche kam.
»Ich gehe nach oben, um Verity zu sagen, dass sie heute Abend nichts zu essen bekommt und in ihrem Zimmer bleiben muss«, teilte Cynthia der Haushälterin mit. »Ich denke, ich selbst werde mein Dinner auf einem Tablett im Salon einnehmen, da mein Mann heute Abend nicht nach Hause kommt.«
»Sehr wohl, Mrs. Wood«, sagte Miss Parsons. »Freut mich, dass Sie ihr gegenüber eine feste Hand zeigen. Mädchen in Veritys Alter neigen dazu, eigensinnig zu sein und den elterlichen Rat zu missachten.«
Cynthia war versucht, die Frau daran zu erinnern, dass sie die Haushälterin war, mehr nicht, und ihre Meinung, wie man mit unternehmungslustigen jungen Mädchen umzugehen hatte, gefälligst für sich behalten sollte, unterließ es aber. Falls Miss Parsons beschloss, zu kündigen oder Archie zu erzählen, was seine Frau zu ihr gesagt hatte, wäre das Ergebnis für alle Beteiligten unerfreulich. Und Cynthia brauchte eine Haushälterin. Jeder in Hampstead oder Swiss Cottage hatte eine, und sie würde nie mehr mit hocherhobenem Kopf zu ihren Bridgerunden gehen können, wenn sie selbst keine mehr beschäftigte. Was Archie anging, so würde er sie bestimmt ohrfeigen, weil er Miss Parsons’ Kochkünste liebte und behauptete, seine Frau könne nicht einmal ein Ei kochen, ohne es anbrennen zu lassen.
Ohne anzuklopfen, betrat Cynthia Veritys Zimmer und fand ihre Tochter auf dem Bett liegend und lesend vor.
»Kein Essen für dich heute Abend«, sagte sie scharf. »Wenn du Hunger hast, bereust du es vielleicht, ignoriert zu haben, dass ich gesagt hatte, wir würden heute Nachmittag zusammen ausgehen.«
»Es tut mir leid, Mutter«, sagte Verity und setzte sich auf. »Ich war bloß ein bisschen spazieren und habe die Zeit vergessen. Ich wollte dich nicht ärgern.«
»Wie du weißt, mag es dein Vater nicht, wenn du allein herumstromerst«, sagte Cynthia gereizt. »Da draußen lauern alle möglichen Gefahren auf ein junges Mädchen. Wir wollen nur verhindern, dass dir etwas passiert. Versprichst du mir, es nie wieder zu tun?«
»Das kann ich nicht, Mutter«, gab Verity zurück. »Manchmal entstehen einfach besondere Situationen, und alles ändert sich. Aber ich verspreche dir, in Zukunft da zu sein, wenn du mit mir ausgehen willst.«
Cynthia war sich durchaus bewusst, dass ihre Tochter ihr nicht die Art Zusicherung gegeben hatte, die sie sich wünschte, aber einstweilen gab sie sich damit zufrieden.
»Das will ich stark hoffen«, sagte sie und ging.
Verity atmete erleichtert auf, als die Tür ins Schloss fiel. Offenbar kam ihr Vater heute Abend nicht nach Hause, da sich ihre Mutter nicht zum Dinner umgezogen hatte.
Dass sie kein Abendessen bekam, war ihr völlig egal. Sie hatte keinen Hunger, und für den Notfall hatte sie eine Dose Kekse.
Sie war ungeschoren davongekommen.
KAPITEL 2
Verity fühlte sich relativ entspannt, als sie am nächsten Morgen das Haus verließ. Ihre Mutter hatte ihr gegenüber nicht erwähnt, dass sie irgendwo zusammen hinwollten; ganz im Gegenteil, beim Frühstück hatte sie gemeint, sie wolle ihre Sommerkleidung durchgehen. Verity hatte ihr vorgeschwindelt, dass sie zur Bücherei wollte, und angeboten, ein paar Briefe mitzunehmen und unterwegs einzuwerfen. Wahrscheinlich würde es Ärger geben, wenn sie erst Stunden später wieder nach Hause kam, aber Verity hatte sich eingeredet, eigentlich würde sie gar kein Versprechen brechen. Und vielleicht hatte Ruby ja schon nach ein, zwei Stunden genug von ihr und sie wäre noch vor dem Mittagessen wieder daheim.
Sie hatte ihre Kleidung mit Bedacht gewählt, damit der Unterschied zwischen Ruby und ihr nicht allzu sehr ins Auge stach. Der marineblaue Mantel vom Vorjahr war abgetragen und zu kurz und von ihrer Mutter schon für den nächsten Kirchenbasar vorgesehen, und das Kleid, das sie darunter trug, war von einem stumpfen Dunkelgrün und hatte ihr noch nie richtig gefallen. Die dunkelblaue, bis über die Ohren gezogene Baskenmütze vervollständigte das Bild eines ganz gewöhnlichen Mädchens, und obwohl Miss Parsons über ihre Erscheinung ein wenig überrascht schien, äußerte sie sich nicht dazu.
An der U-Bahn-Station Hampstead musste sie nur ein, zwei Minuten warten, ehe Ruby um die Ecke gerannt kam.
»Ich dachte, du kommst nicht!«, schrie sie atemlos, als sie noch gut fünfzig Meter entfernt war. »Aber ich wollte sicherheitshalber auf jeden Fall hier sein.«
»Warum hast du gedacht, ich würde nicht kommen?«, fragte Verity, sobald ihre neue Freundin bei ihr war.
»Feine Tussis wie du reden normalerweise nich’ mit mir«, sagte Ruby.
Verity überlegte, was »Tussis« bedeuten mochte, freute sich aber so sehr, Ruby vor Begeisterung strahlen zu sehen, dass sie nicht danach fragte. »Ich versuche, meine Versprechen zu halten«, sagte sie. »Gestern hatte ich daheim Ärger, weil ich nicht da war und meine Mutter mit mir ausgehen wollte. Ich habe kein Abendessen bekommen.«
»Du kannst doch von Glück reden, dass es deiner Ma nicht wurscht ist, wo du bist. Ich könnte eine Woche weg sein, und meine würde es nicht mal merken.«
»Warum würde ihr das nicht auffallen?«
»Weil sie dauernd betrunken ist«, sagte Ruby mit einem resignierten Schulterzucken.
Verity hatte in ihrem ganzen Leben nur zwei betrunkene Leute gesehen: einmal ihren Onkel Charles zu Weihnachten vor zwei Jahren und dann das Dienstmädchen der Nachbarn. Das Mädchen war an einem Spätnachmittag durch die Kellertür getaumelt gekommen, weil sie irrtümlich das Haus der Woods für das gehalten hatte, in dem sie arbeitete. Verity hatte gerade Miss Parsons geholfen, Wäsche zusammenzulegen, und geglaubt, das Mädchen wäre krank. Sie hatte nicht gewusst, das starkes Trinken einen Menschen dazu brachte, zu schwanken und zu nuscheln.
Miss Parsons hatte die Frau energisch hinausbefördert und ihr dabei gehörig die Meinung gesagt – wie schlimm Trunksucht wäre und welche Folgen sie für junge Frauen haben könnte. Verity hatte mit offenem Mund zugeschaut und gelauscht, und der Auftritt hatte bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Als die beiden Mädchen jetzt den Weg Richtung Chalk Farm einschlugen, fragte Verity ihre Freundin, was ihr Vater von der Trinkerei ihrer Mutter hielt.
Ruby lachte. »Ich hab dir doch schon gestern gesagt, dass ich keinen Dad habe. Vielleicht macht das meine Ma so fertig. Sie hat mir mal erzählt, dass sie sein Schatz war, bis sie ihm erzählt hat, dass was in der Röhre ist, und dann isser abgeschwirrt.«
»In der Röhre?«, wiederholte Verity verwirrt.
»Schwanger«, erklärte Ruby.
Verity war klar, was dieses Wort bedeutete, aber sie hatte nicht gewusst, dass ein Paar Kinder kriegen konnte, wenn es nicht verheiratet war. Bis letzte Weihnachten hatte sie nicht einmal die leiseste Ahnung gehabt, wie man überhaupt ein Baby bekam – oder sich diese Frage auch nur gestellt –, aber wegen der Sache, die damals passiert war, glaubte sie jetzt ziemlich genau zu wissen, was es damit auf sich hatte.
»Verglichen mit mir scheinst du unheimlich viel zu wissen«, sagte Verity, die zu dem Schluss gekommen war, dass sie nie etwas dazulernen würde, wenn sie ihr Unwissen nicht eingestand.
»Ich wette, du weißt jede Menge Zeug, von dem ich keine Ahnung hab«, erwiderte Ruby grinsend. »Alles Mögliche über andere Länder und die Könige und Königinnen von England und wie man sich benimmt, um eine echte Dame zu sein.«
»Ja, wahrscheinlich«, gab Verity zu. Sie hatte nie so recht begreifen können, wozu es gut sein sollte, sämtliche Könige und Königinnen aufzählen oder lange, schwülstige Gedichte aufsagen zu können oder alles über Berge in Afrika oder den längsten Fluss der Welt zu wissen. Aber zu wissen, wie Babys zustande kamen oder was die Polizei tat, wenn sie eine Leiche fand, konnte sehr nützlich sein. »Das meiste, was ich in der Schule lerne, kommt mir sinnlos vor, aber vielleicht gibt es ein paar Sachen, die dir nützen könnten.«
»Ich würd unheimlich gern so reden wie du«, sagte Ruby sehnsüchtig. »Und so sauber und ordentlich aussehen. Meinst du, du kannst ’ne Dame aus mir machen?«
Verity musterte ihre neue Freundin eingehend. Ruby trug dieselben Sachen wie am Vortag, das schmuddelige Kleid und das alte Jackett, aber sie hatte sich anscheinend redlich bemüht, etwas adretter auszusehen. Ihr Gesicht sah blitzblank geschrubbt aus, und ihr rotes Haar war gebürstet und sogar mit einem Stoffstreifen zurückgebunden. Sie war nicht unbedingt das, was man gemeinhin hübsch nennen würde, aber sie wirkte trotzdem sehr anziehend. Vielleicht lag es an ihren grünen Augen, die vor Übermut funkelten, an den Sommersprossen auf ihrer schmalen Nase oder an der Art, wie sich ihr voller Mund an den Winkeln hob, als würde sie ständig lächeln. Es war zweifellos ein gutes Gesicht.
Verity war vollkommen klar, dass ein paar gut sitzende Sachen – eine Jacke, ein Kleid, ein Paar Schuhe – einen neuen Menschen aus Ruby machen würden. Sie könnte so etwas problemlos aus dem Haus schmuggeln, aber es widerstrebte ihr, Ruby dieses Angebot zu machen, weil sie ihre Freundin nicht in Verlegenheit bringen wollte.
»Ich helfe dir gern.« Sie nahm Rubys Hand. »Wenn du nichts dagegen hast, bringe ich dir nächstes Mal ein paar Sachen zum Anziehen und Bänder fürs Haar mit, aber ich habe Angst, dass du dich dann mies fühlst.«
Zu ihrer Überraschung lachte Ruby. »Nee, bestimmt nicht, aber wenn ich mit neuen Klamotten nach Haus komme, bringt meine Ma sie todsicher sofort zum Onkel.«
»Warum sollte sie deinem Onkel Mädchenkleider bringen?«, fragte Verity.
Ruby schüttelte den Kopf, als fände sie die Frage lustig. »Ist nicht mein Onkel, so nennen wir den Pfandleiher. Davon weißt du wohl auch nichts. Da kriegt man Geld, wenn man Sachen hinbringt, die was wert sind. Um sie wiederzukriegen, muss man mehr Geld bezahlen, als man bekommen hat.«
»Es gibt Leute, die ihre Kleidung in so einen Laden bringen?« Verity war entsetzt.
»Tja, zum Beispiel solche wie meine Ma, die ständig Geld zum Trinken brauchen«, erwiderte Ruby. »Wenn du willst, kann ich dir mal einen zeigen.«
Ein, zwei Stunden später wusste Verity schon sehr viel mehr über sehr viele neue Dinge, unter anderem über Buden, an denen mit Aal gefüllte Pasteten verkauft wurden, und über Music Halls und die Hopfenernte in Kent. Aal in Aspik klang scheußlich, aber sie wäre schrecklich gern in eine Music Hall gegangen, und wenn Ruby über die Erntezeit in Kent sprach, klang es, als würde es Spaß machen, Kartoffeln zu klauben oder Hopfen zu reißen. Außerdem hatte Verity durch das reichlich schmutzige Fenster einer Pfandleihe gespäht und unter den Bergen von Kleidung, Bettwäsche und Büchern auch Herrenanzüge, polierte Stiefel, Schmuck und eine Trompete ausgemacht.
Einige der konventionelleren Sehenswürdigkeiten, die Ruby ihr gezeigt hatte – Trafalgar Square, Buckingham Palace und die Statue des Eros am Piccadilly Circus –, kannte sie längst. Auch die Theater, die Ruby ihr zeigte und dabei aufgeregt von den Schauspielern und Schauspielerinnen erzählte, die dort auftraten, hatte Verity schon mit ihren Eltern besucht, um sich Aufführungen anzuschauen. Aber alles wurde in eine ganz andere Perspektive gerückt, wenn Ruby darüber sprach.
»Ich steh unheimlich gern vor den Theatern rum und gucke zu, wie die feinen Pinkel antanzen«, sagte sie vor dem Haymarket Theatre. »Hab noch nie in einem Auto oder ’nem Taxi gesessen. Muss echt irre sein, genug Knete zu haben, um sich überall hin chauffieren zu lassen. Oder reich genug, um sich einen Pelz oder Brillanten zu leisten! Schon ein Platz ganz oben auf der Galerie kostet so viel, dass ich ’ne ganze Woche davon futtern könnte.«
Für Verity war es ganz normal, entweder im Auto ihres Vaters oder in einem Taxi durch die Stadt zu fahren. Ihre Mutter besaß sowohl Brillanten als auch einen Pelzmantel, und ihr war ganz sicher noch nie der Gedanke gekommen, dass eine Theaterkarte so viel kostete wie für manche Leute das Essen einer ganzen Woche. Auf einmal schämte sie sich, weil sie so viel besaß und Ruby so wenig. Das war einfach nicht gerecht.
Zu Hause hingen Kleider, die sie nur zwei, drei Mal getragen hatte, bevor sie ihr zu eng wurden, und bei jeder Mahlzeit blieb immer viel übrig. Zugegeben, manchmal wurde aus diesen Resten etwas für den nächsten Tag zubereitet, aber das meiste wanderte in den Mülleimer.
Aber so schlimm die Ungleichheit zwischen Ruby und ihr auch sein mochte, war sie nichts im Vergleich zu dem Schock, den Verity erlitt, als sie erfuhr, womit Rubys Mutter ihren Lebensunterhalt verdiente.
Sie saßen gerade im St. Jame’s Park auf einer Bank und beobachteten die Enten, die auf dem Teich schwammen, als Ruby erzählte, dass sie oft in den Jackentaschen ihrer Mutter stöberte, wenn diese schlief, um Geld für Lebensmittel und die Miete herauszunehmen. Wenn sie das nicht täte, meinte sie, würde es nur für Alkohol ausgegeben.
»Womit verdient sie denn ihr Geld?«, wollte Verity wissen.
»Auf dem Strich natürlich«, antwortete Ruby.
»Strich? Was für ein Strich?«, fragte Verity verwirrt.
»Sie lässt sich von Männern bumsen.«
Verity war so schockiert, dass sie ihre neue Freundin mit offenem Mund anstarrte. Sie hatte dieses Wort in der Schule vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört; das Mädchen, das ihr erzählt hatte, was es bedeutete, meinte, es wäre ein ganz schlimmes Wort.
»Das darfst du nicht sagen, das ist ein wirklich schlimmes Wort«, protestierte Verity.
»Da, wo ich herkomme, sagt man das dauernd«, gab Ruby trotzig zurück. »Außerdem macht meine Ma das nun mal. Und du brauchst mich gar nicht so anzuglotzen, du hast nämlich keine Ahnung, wie schwer es ist, eine anständige Arbeit zu finden, wenn du ein Balg im Schlepptau hast. Als ich zur Welt kam, hieß es, entweder das oder das Arbeitshaus. Mich hätte man ihr weggenommen, und das wollte sie nicht. Sie hat nur meinetwegen damit angefangen, und sie trinkt nur, um zu vergessen, was aus ihr geworden ist, das weiß ich.«
So entsetzt Verity auch war, rührte es sie, wie viel Verständnis Ruby für die Notlage ihrer Mutter aufbrachte und wie loyal sie ihr gegenüber war. Sie wirkte überhaupt nicht verbittert, und das machte Verity bewusst, dass sie im Grunde kein Recht hatte, sich über ihr eigenes Familienleben zu beklagen.
So etwas zu erfahren wäre für einen Tag schockierend genug gewesen, aber Ruby ging noch mit ihr nach Soho und zeigte ihr, wo die Prostituierten lebten.
»Tagsüber gibt’s hier nich’ viel zu sehen«, erklärte Ruby, als sie durch enge Straßen und Gassen schlenderten. Die Gegend war schäbig und schmuddelig und seltsam durchmischt, denn es gab zwar viele alte Gemäuer und einige mehr als zwielichtige Lokale, aber auch Betriebe, die durchaus anständig wirkten – Druckereien, Kleiderfabriken, Buchhandlungen und Kurzwarenläden –, und auf den Straßen sah man ganz gewöhnliche Leute. »Aber komm mal um sieben Uhr abends her, dann ist alles ganz anders. Da stehen die Nutten an den Straßenecken und in Haustoren und warten auf Kundschaft. Ihre Zuhälter und andere Ganoven tauchen auf, und dann kommen ziemlich viele feine Pinkel her, um in die Restaurants und Nachtklubs zu gehen.«
»Ehrlich?« Es überraschte Verity, dass reiche Leute in eine derart heruntergekommene Gegend kamen.
Ruby lachte in sich hinein. »Da staunen immer alle drüber! Angeblich kriegt man hier in der Gegend das beste Essen von London. Genau weiß ich das natürlich nicht, weil ich keinen roten Heller hab, aber angeblich wird in den Klubs auch total gute Musik gespielt und so.«
»Wahnsinn!« Verity hatte das Gefühl, absolut gar nichts zu wissen. »Ich habe heute wirklich viel gelernt.«
»Dann wird’s Zeit, dass du mir auch was beibringst«, lachte Ruby. »Wie wär’s, wenn wir beide irgendwo was futtern gehen, und du zeigst mir, wie eine Dame isst? Es muss nichts Feines sein, ich will dich ja nicht blamieren.«
Verity suchte ein Lokal aus, das nur ein bisschen schicker war als eine einfache Arbeiterkneipe. Auf den Tischen lagen rotweiß karierte Decken, und es gab eine Speisekarte mit Standardgerichten.
Sie hatten kaum an einem Ecktisch Platz genommen, als Ruby auch schon nach der Karte griff. Verity fiel auf, dass sie die Wörter mit einem Finger nachzog und die Lippen bewegte, als wollte sie ausprobieren, wie sie klangen.
»Das Licht hier drinnen ist furchtbar. Soll ich dir sagen, was es gibt?«, bot sie an, um ihrer Freundin die Peinlichkeit zu ersparen, zugeben zu müssen, dass sie nicht besonders gut lesen konnte. »Es gibt Würstchen mit Kartoffelpüree, Leber und Speck, Steak-und-Nieren-Pastete und Sheperd’s Pie.«
»Sheperd’s Pie!«, rief Ruby. »Da steh ich total drauf! «
Verity lächelte. »Erstens«, begann sie, »solltest du ein bisschen leiser sprechen, wir wollen schließlich nicht, dass sich alle nach uns umdrehen. Ich werde für uns bestellen.«
Verity bestellte für jede von ihnen Sheperd’s Pie und ein Glas Wasser.
»Ich mag Tee«, sagte Ruby, nachdem die Kellnerin wieder gegangen war. Sie hatte Ruby so durchdringend angestarrt, als hätte sie das Mädchen am liebsten aufgefordert, das Lokal umgehend zu verlassen.
»Das glaube ich gern, aber normalerweise trinkt man Tee oder Kaffee nach dem Essen«, sagte Verity ruhig. »Wenn gleich das Essen gebracht wird, stürz dich bitte nicht drauf, als hättest du seit einem Monat nichts gegessen. Und halte Messer und Gabel richtig, siehst du, so.« Sie hob ihr Besteck auf, um es Ruby vorzuführen. »Du darfst deine Gabel nicht herumdrehen, um das Essen in dich hereinzuschaufeln, sondern schiebst es mit dem Messer auf deine Gabel.«
Fast musste sie über Rubys verdutzten Gesichtsausdruck lachen. Wahrscheinlich benutzte Ruby einfach einen Löffel, wenn es ein Gericht war, das nicht kleingeschnitten werden musste. »Mach einfach nach, was ich tue«, meinte sie. »Und jetzt legst du deine Serviette auf deinen Schoß.«
Ruby machte ihre Sache sehr gut. Sie hatte ein bisschen mit Messer und Gabel zu kämpfen und musste daran erinnert werden, nicht mit offenem Mund zu kauen, aber sie schlang das Essen nicht hinunter und benutzte auch nicht ihre Finger. Ihr Teller war im Handumdrehen leer. »Leg Messer und Gabel nebeneinander auf den Teller«, wies Verity sie an. »Auch wenn du nicht alles aufgegessen hast, ist das für den Kellner das Zeichen, dass du fertig bist.«
»Was für ein Tamtam«, stellte Ruby fest. »Aber es war echt gut gewesen.«
»›Es war gut‹ reicht«, korrigierte Verity. »Aber Grammatik heben wir uns für einen anderen Tag auf.«
Als Nachspeise entschieden sie sich für Siruptörtchen und Tee. Verity konnte Ruby gerade noch daran hindern, etwas Tee in die Untertasse zu gießen, um ihn dort abkühlen zu lassen und dann wieder in die Tasse zurückzukippen.
»So etwas tut man nicht«, sagte sie fest. »Warte einfach, bis er abgekühlt ist.«
Draußen vor dem Café lobte Verity ihre Freundin. »Das hast du gut gemacht, du lernst schnell. Aber jetzt muss ich nach Hause, sonst bekomme ich großen Ärger.«
»Ich hab noch nie so ’ne Freundin gehabt wie dich«, sagte Ruby und wirkte dabei ein bisschen verlegen.
»Ich auch nicht«, erwiderte Verity. Sie spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten. »Aber ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen können. Wenn mein Vater daheim ist, kann es für mich schwierig werden, aus dem Haus zu kommen.«
Ruby runzelte die Stirn. »Ich komme morgen gegen halb zwei auf die Hampstead Heath. Wenn du es nicht schaffst, lass mir was im Red Lion in Camden Town ausrichten. Ich spüle dort abends Gläser, und die sagen mir dann schon Bescheid. Aber wenn du dich mit mir treffen willst, melde dich lieber ein paar Tage vorher, weil ich die Nachricht vielleicht nicht gleich kriege.«
Ruby brachte Verity zu der Haltestelle, wo der Bus nach Swiss Cottage hielt. Als der Bus sich näherte, drückte Verity ihrer Freundin einen Schilling in die Hand. »Für dein Fahrgeld«, sagte sie. »Und vielen Dank für den tollen Tag.«
Verity ging im Bus aufs Oberdeck und blickte zu Ruby zurück. Sie stand mitten auf dem Bürgersteig und schien all die Leute, die sich links und rechts an ihr vorbeidrängten, gar nicht wahrzuzunehmen. Sie sah furchtbar traurig und allein aus, und Verity ertappte sich bei dem Gedanken, dass sie sich genauso fühlte. Sie war natürlich nicht allein; sie hatte ihre Eltern, eine Tante und nette Nachbarn. Wenn sie ihr Leben mit dem von Ruby verglich, lebte sie im Paradies.
Aber es fühlte sich nicht so an.
Sie war schrecklich einsam.
KAPITEL 3
»Na, haste es geschafft, dich zu verdrücken?«, fragte Ruby, als sie Verity am nächsten Tag traf und mit ihr zusammen den Weg zum Park einschlug.
»Ja, aber irgendetwas stimmt daheim nicht. Mutter hat mich nicht einmal gefragt, warum ich gestern so lange in der Bücherei war und nicht zum Mittagessen zurückgekommen bin. Ich hatte den Eindruck, dass sie mich gar nicht richtig wahrgenommen hat.«
»Meinst du, sie hat ein bisschen gesüffelt? So ist meine Ma nämlich dauernd.«
Verity lächelte. »Nein, sie trinkt nie mehr als ein, zwei Gläser Sherry, und das auch nur vor dem Abendessen. Ich glaube, sie hat schlechte Nachrichten bekommen, als ich weg war. Sie bat mich, meinen Lunch bei Miss Parsons in der Küche einzunehmen, und ging auf ihr Zimmer. Ich fragte Miss Parsons, ob sie krank ist, aber sie meinte, Mutter hätte einiges zu überdenken. Was mag das bedeuten?«
»Keinen Schimmer. Vielleicht is’ irgendwas mit deinem Pa?«
»Aber was könnte das sein? Er hat eine andere? Er ist tot umgefallen?«
Ruby zuckte mit den Schultern. »Würde dir das gefallen?«
Verity schämte sich sofort. »Nein, natürlich nicht. Aber der einzige Grund, der mir für das Verhalten meiner Mutter einfällt, ist, dass es etwas mit meinem Vater zu tun haben muss.«
Sie redeten nicht weiter, bis sie auf der Heide waren und sich auf eine Bank am Whitestone Pond gesetzt hatten.
»Du magst deinen Pa nicht, oder?«, fragte Ruby plötzlich.
»Wie kommst du darauf?«
Wieder zuckte Ruby mit den Schultern. »Weiß nich’. Bloß so’n Gefühl.«
Verity erwiderte nichts. Nur zu gern hätte sie zugegeben, wie schrecklich ihr Vater sein konnte, wie er sie herabsetzte, indem er alles ins Lächerliche zog, was sie sagte, und sie grundlos anschrie. Aber vor allem hätte sie gern erzählt, was Weihnachten passiert war. Sie hatte das Gefühl, Ruby könnte ihr helfen. Aber sie konnte sich nicht überwinden, darüber zu sprechen, deshalb saß sie einfach schweigend da und beobachtete ein paar kleine Jungen, die ein Boot auf dem Teich segeln ließen.
»Ich hab hier in der Gegend was zu erledigen«, sagte Ruby nach einigen Minuten. »Du kannst hierbleiben und auf mich warten, es dauert nicht lang.«
»Was ist es denn?«
»Is’ besser, du weißt nix davon«, sagte Ruby und sprang auf. »Wenn ich beim Zurückkommen renne, tust du so, als ob du mich nicht kennst. Geh einfach die Heath Street runter, und wenn alles klappt, stoße ich später zu dir.«
Verity fiel ein, dass Ruby ihr bei ihrer ersten Begegnung erzählt hatte, sie käme nach Hampstead, um Milch und Lebensmittel zu stehlen, die vor den Haustüren standen, also hatte sie das vielleicht auch jetzt vor. Doch hatten die Leute ihre Lieferungen um drei Uhr nachmittags nicht längst hereingeholt? Wie auch immer, irgendeine krumme Sache musste Ruby im Schilde führen, sonst würde sie nicht befürchten, verfolgt zu werden.
Verity wartete und wartete. Eine halbe Stunde verging, dann noch eine, und sie wollte gerade aufstehen und nach Hause gehen, als Ruby um die Ecke geschossen kam, dicht gefolgt von einem großen dunkelhaarigen Mann. Verity konnte sehen, dass er schnell aufholte und ihre Freundin jeden Moment erwischen würde. Obwohl Ruby ihr eingeschärft hatte, in einem solchen Fall sofort zu gehen, brachte Verity es nicht übers Herz, sie im Stich zu lassen. Stattdessen ging sie mit der vagen Vorstellung, irgendwie einzugreifen, auf die beiden zu.
Ruby versuchte, sie mit einer kaum merklichen Handbewegung zu verscheuchen, aber Verity beachtete sie nicht, sondern lief ihrer Freundin direkt in den Weg. Sie traute sich nicht, ihr etwas zuzurufen, weil sie Angst hatte, der Mann könnte merken, dass sie Ruby kannte. Also vertraute sie einfach darauf, dass ihre Freundin erraten würde, was sie vorhatte.
Ruby war keine fünf Meter mehr von ihr entfernt, die Hand ihres Verfolgers bedrohlich nah an ihrer Schulter, als Verity einschritt. Sie wich zur Seite aus, um Ruby vorbeizulassen, und trat dann hastig auf die alte Stelle zurück, sodass der Mann in sie hineinlaufen musste.
Verity konnte selbst gar nicht mehr sehen, ob ihr Trick geklappt hatte, weil Rubys Verfolger mit solcher Wucht auf sie prallte, dass sie das Gleichgewicht verlor. Anscheinend hatte sie sich bei ihrem Sturz instinktiv an ihn geklammert, denn auch er fiel hin.
»Tut mir leid, Sir«, stieß sie atemlos hervor, während sie noch auf dem Boden lag und nicht nachzuschauen wagte, ob Ruby davongekommen war. »Ich habe Sie gar nicht gesehen.«
Der Mann schüttelte sie ab, rappelte sich hoch und durchbohrte sie mit einem finsteren Blick. »Ich weiß genau, dass ihr zwei unter einer Decke steckt«, keuchte er. Er schaute über seine Schulter zu ein paar Leuten, die den Vorfall beobachtet hatten, und rief ihnen zu, jemand solle die Polizei holen.
»Was meinen Sie mit ›unter einer Decke stecken‹?«, fragte Verity mit aller Entrüstung, die sie aufbringen konnte. Sie setzte sich auf und klopfte Straßenstaub von ihren Sachen. »Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen. Ich bin lediglich dem Mädchen ausgewichen, das eben angerannt kam, und dabei irgendwie mit Ihnen zusammengestoßen. Ich konnte nichts dafür. Und Sie haben mir wehgetan. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich aufstehen kann.«
Von den Passanten erhob sich ein Gemurmel, das, wie Verity hoffte, Mitgefühl ausdrücken sollte, aber zu ihrer Bestürzung sah sie einen Polizisten kommen. Obwohl ihr Herz vor Angst hämmerte, zwang sie sich, vorsichtig aufzustehen und dabei so zu tun, als wäre sie verletzt.
Der Polizist war nur noch wenige Meter entfernt, und der dunkelhaarige Mann zeigte anklagend auf Verity. »Die da macht mit dem Mädel, das eine wertvolle antike Uhr aus meinem Haus gestohlen hat, gemeinsame Sache!«, blaffte er so laut, dass alle ihn hören konnten. »Nehmen Sie sie sofort fest, Officer! Und schicken Sie ein paar Männer los, um ihre Komplizin zu schnappen. Sie hat rotes Haar.«
»Das andere Mädchen haben wir schon«, sagte der Polizist. »Sie ist in der Heath Street von dem Kollegen, mit dem ich auf Streife war, in Gewahrsam genommen worden. Wir haben gesehen, wie sie die Uhr fallen ließ, und ich kam gleich her, um nachzuschauen, was hier oben los ist.«
Bevor Verity wusste, wie ihr geschah, packte sie der Polizist am Arm und erklärte, er würde sie jetzt mit aufs Revier nehmen.
Verity bekam es mit der Angst zu tun. Alles war so schnell gegangen, und es war ein entsetzliches Gefühl, auf einmal wie eine gewöhnliche Kriminelle abgeführt zu werden.
Als man sie in die Wachstube führte, erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf Ruby. Ruby gab mit keinem Zeichen zu erkennen, dass sie einander kannten, weder mit einem Lächeln, noch mit einem Nicken oder Zwinkern. Offensichtlich wollte sie so tun, als hätten sie einander noch nie gesehen, damit die Polizei nicht auf die Idee kam, sie könnten tatsächlich unter einer Decke stecken.
Das Einzige, was man von Verity wissen wollte, war ihr Name. Danach wurde sie in einen bedrückend engen Raum gesteckt, der lediglich mit einem Tisch und zwei Stühlen möbliert war und nach Zigaretten und abgestandenem Schweiß roch. Als der Polizist hinausging, konnte Verity hören, wie er hinter sich die Tür abschloss. Dann passierte nichts mehr. Niemand kam herein, und sie konnte auch nicht hören, was hinter der geschlossenen Tür vorging. Es war, als hätte man sie vergessen.
Ihre Angst wurde allmählich so groß, dass sie anfing zu weinen. Sie hatte den großen Mann doch nur daran hindern wollen, ihre Freundin zu schnappen. Das war doch kein Verbrechen, oder?
Sie hatte keine Ahnung, wie spät es war, aber es musste inzwischen nach fünf sein. Wenn sie nicht bald heimkam, würde ihre Mutter böse werden. Was, wenn die Polizei zu ihr nach Hause ging?
Aber man hatte sie nicht nach ihrer Adresse gefragt, nur nach ihrem Namen. Insgeheim betete sie, Ruby würde bei der Wahrheit bleiben und aussagen, dass sie aus eigenem Antrieb gehandelt hatte und Verity überhaupt nicht kannte.
Endlich, als Verity schon das Gefühl hatte, in dem winzigen Zimmer bald den Verstand zu verlieren, ging die Tür auf, und ein älterer Mann im dunklen Anzug kam herein. Er war um die fünfzig und hatte einen dünnen Schnurrbart und schütteres graues Haar. Er stellte sich als Inspektor Charmers vor.
»Wie alt bist du, Verity?«, fragte er sie.
»Dreizehn, Sir«, antwortete sie.
»Alt genug, um den Unterschied zwischen richtig und falsch zu kennen?«
»Ja, ich glaube schon«, sagte sie. »Und es ist falsch, mich hier so lang einzusperren. Ich habe nichts getan. Meine Mutter wird außer sich sein.«
»Du warst vielleicht nicht aktiv an dem Diebstahl beteiligt, aber du bist eine Komplizin.«
»Wie sollte ich? Ich kenne das Mädchen gar nicht, ich bin bloß in sie hineingelaufen.«
»Oh doch, du kennst sie«, widersprach Charmers. »Wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie ihr vor dem Vorfall am Whitestone Pond zusammen auf einer Bank gesessen und euch unterhalten habt.«
Verity wusste, dass sie aufs Glatteis geraten war. Wenn der Inspektor nicht erwähnt hätte, wo sie mit Ruby gesehen worden war, dann hätte sie vielleicht an einen Bluff geglaubt. Aber wie es schien, gab es tatsächlich einen Augenzeugen.
»Siehst du?«, grinste er. »Da kannst du dich nicht herauswinden, Miss Verity Wood, du bist gesehen worden. Und möchtest du auch wissen, warum ihr jedem aufgefallen wärt?«
Verity zuckte die Achseln.
»Weil ihr total verschieden seid. Unser Zeuge hat sich gewundert, was ein gut gekleidetes Mädchen wie du mit einem solchen Gassenkind zu tun haben mag.«
»Ja, ich war da, aber ich kenne das Mädchen trotzdem nicht. Wir sind einfach ins Gespräch gekommen«, log Verity. »Ich weiß gar nichts über sie, wir haben uns bloß kurz unterhalten, und dann hat sie gesagt, sie muss gehen. Das Nächste, was ich von ihr gesehen habe, war, wie sie vor einem Mann davonrannte. Natürlich habe ich versucht, ihr zu helfen! Es hätte ja ein Überfall sein können. Ich hatte doch keine Ahnung, dass sie etwas angestellt hatte.«
Charmers starrte sie lange und eindringlich an, und Verity wand sich unter seinem Blick.
»Du hast dich wie eine dumme Gans verhalten«, sagte er schließlich. »Ich habe eine ungefähre Ahnung, was ein wohlerzogenes Mädchen an jemandem faszinieren könnte, der einer völlig anderen Sphäre entstammt. Aber glaub mir, ein Mädchen wie Ruby Taylor würde dich nur auf ihr Niveau herunterziehen. Und jetzt ist es an der Zeit, dich nach Hause zu bringen.«
Veritys Magen schnürte sich krampfhaft zusammen. Sie wusste, dass es keinen Sinn hatte, ihre Adresse nicht preiszugeben. Die Polizei hatte Mittel und Wege, so etwas herauszufinden, und es würde sie nur noch verdächtiger erscheinen lassen. Aber sie hatte schreckliche Angst, wie ihre Eltern reagieren würden. Diese Sache ließ sich nicht einfach unter den Teppich kehren.
»Kann ich nicht allein nach Hause gehen?«, bat sie. »Meine Mutter bekommt bestimmt Zustände, und es wäre gemein, sie aufzuregen, nur weil ich mit diesem Mädchen geredet habe.«
Charmers fasste sie am Arm und zog sie vom Stuhl. »Wenn ich dir das durchgehen ließe, würde ich mich deinen Eltern gegenüber ins Unrecht setzen«, sagte er. »Sie müssen wissen, was ihre Tochter treibt, wenn sie nicht daheim ist.«
Ein Polizist fuhr Inspektor Charmers und Verity nach Daleham Gardens. Ihr schwante, dass Charmers bereits mit ihrer Mutter telefoniert hatte, weil der andere Polizist nicht einmal nach der Adresse fragte. Das verschlimmerte ihre Lage, da ihre Mutter genug Zeit gehabt hatte, um sich auszumalen, in welche Schwierigkeiten Verity geraten sein könnte.
Miss Parsons öffnete die Tür, ihre Miene so frostig wie immer. »Mr. und Mrs. Wood erwarten Sie im Salon«, sagte sie kurz. Sie wusste eindeutig Bescheid.
Verity sackte das Herz in die Kniekehlen, als sie hörte, dass ihr Vater daheim war. Aber als sie und Charmers den Salon betraten, wusste sie, dass es noch schlimmer werden würde als befürchtet.
Archie Wood war eine einschüchternde Erscheinung. Er war groß – weit über einsachtzig – und kräftig gebaut. Er lachte oder lächelte kaum jemals und schien nie auch nur das geringste Interesse an seiner Tochter zu haben. Mit seinem glänzend schwarzen, zurückgestrichenen Haar, dem dunklen Teint und dem schwarzen Schnurrbart, den er regelmäßig ölte und zwirbelte, sah er wie der Schurke aus einem Hollywood-Film aus, fand Verity.
Bei Tisch sprach er zwar mit ihr, indem er sich nach der Schule und Ähnlichem erkundigte, aber für sie klang es immer, als wollte er nur höflich sein und wäre nicht wirklich interessiert. Seine Augen waren sehr dunkel, und in ihnen schien nie ein Funken Wärme zu liegen; sie waren genauso ausdruckslos wie die Augen der toten Fische, die beim Fischhändler auf dem Block lagen. Nie hatte er sie hochgehoben und geknuddelt, als sie klein war; sie konnte sich nicht erinnern, je auf seinem Knie gesessen zu haben oder von ihm Huckepack getragen worden zu sein. Deshalb war das, was ihn Weihnachten in ihr Zimmer geführt hatte, umso verstörender gewesen. Er hatte gesagt, er wolle ihr einen Gutenachtkuss geben, aber das hatte er noch nie getan. Und wie sich herausstellte, hatte er tatsächlich etwas ganz anderes gewollt. Verity konnte den Gedanken an das, wozu er sie gezwungen hatte, immer noch nicht ertragen.
Als sie jetzt sein zorniges Gesicht sah, bebte sie. Er sah aus, als würde er sie verabscheuen.
»Könntest du mir vielleicht erklären, was du daran findest, dich mit Gesindel abzugeben?«, fragte er.
»Ich habe mich nicht mit diesem Mädchen abgegeben«, erwiderte Verity. »Sie hat bloß eine Bemerkung über einen Jungen gemacht, der sein Boot auf dem Teich hat schwimmen lassen, und ich habe irgendetwas geantwortet. Ich kannte sie nicht, es war nur ein kurzes Geplauder mit einem Mädchen in meinem Alter. Hätte ich sie etwa einfach ignorieren und aufstehen und weggehen sollen, als wäre ich zu bedeutend, um mit gewöhnlichen Leuten zu reden?«