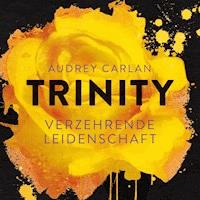Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Eine Sammlung amouröser Abenteuer der hübschesten Frauen. Inhalt: Das Mädchen als Jüngling Der Jüngling als Mädchen Der Gatte auf Probe. Die Gattin auf Probe oder die hübsche Haushälterin. Die gute Stiefmutter. Der hübsche Fuß. Der Weg der Tugend. Der Weg des Lasters. Das Modell Liebestod. Die beiden Witwer und ihre Töchter Liebe mit Gewalt Die Unbekannte Ehrlicher Betrug Liebe und Ehre. Liebe heilt! Der Unmann. Der Griesgram. Johannistrieb oder Das erste und letzte Abenteuer einer Frau von vierzig Jahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zeitgenössinnen
Nicolas Edme Rétif de la Bretonne
Inhalt:
Nicolas Edme Restif de la Bretonne – Biografie und Bibliografie
Zeitgenössinnen - Abenteuer hübscher Frauen
Einleitung
Das Mädchen als Jüngling
Der Jüngling als Mädchen
Der Gatte auf Probe.
Die Gattin auf Probe oder die hübsche Haushälterin.
Die gute Stiefmutter.
Der hübsche Fuß.
Der Weg der Tugend.
Der Weg des Lasters.
Das Modell
Liebestod.
Die beiden Witwer und ihre Töchter
Liebe mit Gewalt
Die Unbekannte
Ehrlicher Betrug
Liebe und Ehre.
Liebe heilt!
Der Unmann.
Der Griesgram.
Johannistrieb oder Das erste und letzte Abenteuer einer Frau von vierzig Jahren.
Zeitgenössinnen, N. Retif de la Bretonne
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Germany
ISBN: 9783849633691
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Nicolas Edme Restif de la Bretonne – Biografie und Bibliografie
Franz. Romanschriftsteller, geb. 22. Nov. 1734 in Sacy bei Auxerre, gest. 3. Febr. 1806 in Paris, lernte als Buchdrucker, gelangte 1767 zu Paris in den Besitz einer kleinen Druckerei und sing zugleich an zu schriftstellern. 1791 konnte er sich rühmen, seit 1767 nicht weniger als 1632 Erzählungen geliefert zu haben, die mehr als 200 Bände füllten. Seine Romane suchen ihren Stoff meist in den schlüpfrigsten Regionen; dabei ist der Stil inkorrekt und die Sprache gemein, ja sehr oft zynisch (daher sein Beiname le Rousseau du ruisseau). Den bei der Übermenge derartiger Erzeugnisse überraschenden Erfolg verdankt R. neben seiner Kühnheit und Originalität hauptsächlich dem Ton der Wahrheit und Offenheit, den seine Erzählungen zur Schau tragen. Für sein Meisterwerk gilt »Le paysan perverti« (1776, 4 Bde.). Von dem Werk »Les contemporaines, ou aventures des plus jolies femmes de l'âge présent« (1780–1785, 42 Bde.) hat Assézat 1875 einen Auszug der besten Schilderungen gemacht. Sein »Théâtre« (Par. 1793, 7 Bde.) enthält Stücke, die niemals ausgeführt worden sind.Vgl. Monselet, Rétif de la B. (Par. 1858); Lacroix (Bibliophile Jacob), Bibliographie et iconographie de tous les ouvrages de R. (das. 1875); Dühren (J. Bloch), R., der Mensch, der Schriftsteller, der Reformator (Berl. 1906) und Rétif-Bibliothek (Bibliographie, das. 1906).
Zeitgenössinnen - Abenteuer hübscher Frauen
Einleitung
Es gibt Bücher, gleichgültig welcher Gattung und welchen Inhalts, die in solchem Maße versteckte Autobiographien sind, daß man sie nicht lesen sollte, ohne ihren Verfasser zu kennen. Nur aus dessen Persönlichkeit, dessen Leben kommen die Lichter und Schatten her, deren Gruppierung das versteckte Bild hinter dem Bild hervortreten läßt. Meist sind solche Bücher nicht die Schöpfungen des Genies, denen ja keine Anekdote, keine biographische Notiz etwas hinzufügen kann. Es sind die Hervorbringungen sehr menschlicher Geister, die in erhöhtem Maße die Zufälligkeiten ihrer Person und ihrer Zeit geben, dafür aber auch ohne die Objektivierung des Kunstverstandes, ohne Distanz, Haß und Liebe, Lust und Unlust, frisch, rauschend, so wie der Strom ihrer Brust entbraust. Sie schaffen keine Kunstwerke, sondern verhandeln, von unbezwinglicher Leidenschaft der Mitteilung getrieben, die eigenen, im Augenblick sie bewegenden Angelegenheiten in ihren Büchern, sie enthüllen ihr Wesen, sagt Retif de la Bretonne, aber damit zugleich das Wesen ihrer Leser.
Die hier gebotene Auswahl aus den im ganzen zweiundvierzig Bänden der »Contemporaines« Retifs, dieser Naturgeschichte der Französin in der Schicksalsstunde des ancien régime, scheint, reiht man sie nicht in Retifs Werk und Leben ein, eine Sammlung amüsanter, geschickt erzählter faits divers, an der die Vielgestaltigkeit der Fabel und die unbedingte Beherrschung des Stoffes überrascht. Im Zusammenhang aber mit dieser ewig produzierenden Persönlichkeit, die das Leben, kaum erhascht, immer wieder aufs Papier warf, der der Umweg über die Feder in späteren, kargen Jahren schon zu lang dünkte und die daher die Erlebnisse des letzten Tags am Setzerpult gleich in den Satz formulierte, dehnt sich um diese raschen, scharf gesehenen Geschichten das Paris vom Ende des achtzehnten Jahrhunderts mit Avenuen und Gassen, mit Hof und Pöbel, mit Theatern und Bordellen und mit Frauen, Frauen, unendlich viel Frauen, über die Retif gearbeitet hat, wie nur je ein Naturforscher über sein Spezialfach. Alles ist nachkostende Tagebuch-Eintragung und alles Material zu dem großen, in zahllosen Büchern wieder und wieder behandelten, erweiterten und ergänzten Lebenswerk: Die Frau!
Retif war der Sohn eines kleinen Gutsbesitzers aus Burgund (den Beinamen holte er sich von einer Farm der Familie), kam nach frühen Liebeserfahrungen in seinem Dorf, nach einer großen Leidenschaft in Auxerre, um die sich, wie die Putten um die Madonna, tausend Eintagszärtlichkeiten schlossen, nach Paris, wo sich sein Schicksal erfüllte: jedes Auf und Ab eines langen Lebens nur durch Frauen zu erfahren. Erst Buchdruckergeselle, wird er durch die Liebe zum Schriftsteller, wird berühmt (mit dem Pied de Fanchette und dem Paysan perverti), verarmt durch die Assignatenwirtschaft, wird vergessen, alt, mit den Lastern des Alters, immer noch allen Frauen ergeben, immer noch jedes Erlebnis in die nie endenden Werke »Monsieur Nicolas« und »Contemporaines« einreihend, und stirbt endlich mit zweiundsiebzig Jahren, an den Strapazen und Krankheiten der Liebe, in einem Haus, das von oben bis unten mit den Ballen seiner Bücher, den Geschichten seines Lebens und seiner Frauen, angefüllt ist.
Aber die Frauen, die er genoß und liebte, gehörten nicht zu der Welt, wie sie Crébillon fils, Choderlos de Laclos und Louvet de Couvray beschrieben haben, und er liebte sie nicht, wie es die Herren jener Welt taten, nach einer unsentimentalen, gesellschaftlichen Tradition, die sie ebenso lernten, wie gutes Benehmen und reizvolle Konversation. Er kam aus der Tiefe und liebte die Frauen der Tiefe, von den Mädchen in den Pariser öffentlichen Häusern, wo er seine tiefste, bis zu den Frauen des Mittelstandes, wo er seine reinste Liebe fand. Und er hielt sich keine Geliebte, weil das hergebracht und nötig war, er suchte bei ihr keine Zerstreuung, keine Erholung, keine Tröstung, sondern die Frauen waren sein Leben, von dem er sich mit der Feder in der Hand oder an der Druckpresse ausruhte. Er lebt nur durch die Frau, er denkt oder empfindet fast nichts, das nicht durch eine Frau gegangen wäre oder mit einer Frau zusammenhinge. Die ganze Sentimentalität des Kleinbürgers, die sexuelle Leistungsfähigkeit des bäuerlichen Schlages, der Stoffhunger des Literaten, zusammen mit der geschäftsmäßigen Auffassung der Liebe in seinen Kreisen, denen Kuppelei und Prostitution unter günstigen und anständigen Bedingungen nichts Ehrenrühriges erschien: all das drängte ihn auf Schritt und Tritt zu den Frauen, drängte ihn in die Frauen, für deren Bezahlung er hungert und dürstet und die schließlich unmittelbar oder mittelbar seinen Hunger und seinen Durst stillen. Er hatte das Glück, die einheitlichste Form für sein Leben zu finden: auf dem Feld seiner Arbeit wuchs auch sein Genuß und wohin ihn Geilheit und Forscherdrang hetzten, dort fand er sein kümmerliches Auskommen und seinen Ruhm. Alles aber war und schenkte die Frau.
Er hat nur einen Vorgänger in Literatur und Sittengeschichte: Abbé Prevost, den Verfasser der Geschichte von Manon Lescaut und dem Chevalier Des Grieux. Dies unvergängliche Buch hat die Dirne in die Literatur eingeführt, die bis dahin nur Damen der Gesellschaft oder solche kannte, die der Liebe im Nebenberuf oblagen. Ein Menschenalter später hat Retif diesen Typus sozial und wirtschaftlich, industrialisiert wie er schon war, in tausend Spielarten festgehalten, während Prevost nur Verirrungen des Herzens in mitfühlender Neugier nachzeichnete. Man kann sagen: Prevost machte unwissentlich eine Entdeckung, deren System Retif bewußt zu schaffen sich bemühte. Aber bei Prevost war es noch ein Jüngling aus den herrschenden Ständen, der, wie bis zur Revolution immer mehr seiner Standesgenossen, dem dunklen Gift der Crapule zum Opfer fiel. Es geht nicht an, ihn als Zuhälter zu benennen, bis zum Schluß, über Hospital und Deportation, bleibt er der Bevorzugte, dem nur sein Stand die ersehnten Erniedrigungen an Manons Seite ermöglicht. Retif nun stellt das Mädchen aus dem Pöbel unter den Pöbel, in die Mansarde der Mutter Näherin, neben den kupplerischen Bruder, unter die neidischen Nachbarinnen, zwischen all ihre Konkurrentinnen, das ganze Gewimmel des dunklen Volkes, das den adligen Lichtstrahl, der auf eine seiner Töchter fällt, in Scheidemünze prägt und sich feilschend und unbedenklich darin teilt. Er hat, ein zweiter Kolumbus, dicht neben der ältesten Welt der Herrschenden die dunklen Kontinente der Namenlosen entdeckt und deren Bild auf Tausenden von Seiten der erstaunten Gesellschaft vorgehalten. Was bei den Früheren nur Mätresse, femme foutenue, Zögling der Frau Leblanc oder Zofe war, entpuppt sich mit einem Male als Tochter, Schwester, Gattin, zeigt, wie Wundmale, seine Schicksale auf dem Weg zu petite maison oder Bordell, wird aus einem Typus zu einem besonderen Menschen, ganz wie seine Herren und Herrinnen. Retif hat sich, sein Haus, seine Familie, seine Nachbarschaft, seine besonderen Mitmenschen in die Literatur geworfen, wie der Erdstoß der Revolution; all das in die Gesellschaft, in die Weltgeschichte warf.
Der Wurf – das ist die Gebärde des Schriftstellers Retif. Er kennt keine künstlerischen Mittel, keinen Aufbau, kein Ausmaß, keine Abtönung. Er kommt vom Stoff her, der Stoff nur treibt ihn, um seinetwillen greift er zur Feder oder zu den Lettern. Der Form achtet er kaum, kann er nicht achten, weil er den Stoff ja erst Tag für Tag erleben muß, also keine Übersicht hat, nicht wissen kann, was im Zusammenhang wichtig oder unwichtig sein wird. Nimmt er dann Episoden heraus, um sie zu selbständigen Gebilden auszubauen, wie seine Jugendgeschichte, seine große Liebe zu Frau Parangon und das Unglück seiner Schwester Marie-Geneviéve im »Paysan perverti«, dann gelingt, vielleicht nicht dem Schriftsteller, sondern dem starken Talent und Temperament eines Rundung, ebenso wie in den vielen, kurzen Novellen der »Contemporaines«. In den selbstbiographischen Werken muß eben der Wurf jeden Tag erneut werden, so daß auch Bruchstücke alle Reize der kleineren Erzählungen aufweisen. Aber Retif hatte, bei der größten Tugend des Schriftstellers, der Schamlosigkeit, das heißt dem unbedingten Zwang zu schrankenloser Mitteilung, zwei Kardinalfehler: er wollte mit seinen Publikationen etwas erreichen (was sich in den »Idées singulières« zur Groteske steigerte) und er hielt die dichterische Lüge für seiner unwürdig. Er schreibt im »Monsieur Nicolas«: »Ich sagte mir beim Schreiben: man darf nicht lügen, wer nur Lügen niederschreibt, erniedrigt sich selbst.« Seine Wirkungsabsichten treiben aber, mitten in der gegenständlichsten Schilderung, die trübsten didaktischen Blasen und seine Abneigung gegen das Lügen, das bewegende Element alles dichterischen Hervorbringens, kommt zwar dem Quellenwert seiner Werke zugut, zeitigt aber, diesem wirren Haufen wirklichen Lebens gegenüber, öfter als angenehm die Langeweile. Er war nicht Künstler und nicht Schriftsteller. Er war der Seismograph, der von den Ankündigungen nahender Erdbeben erzitterte und schrieb.
Als das Erdbeben da war und Robespierre herrschte, war Retif ein armer, gealterter Mann, aber immer noch der Arbeit und der Lust seines Lebens getreu, lief er hinter den kleinen Modistinnen her, ließ sich von den Freudenmädchen des Palais Royal die abenteuerlichsten Lebensläufe aufbinden und sparte sich den Liebeslohn für die Lupanare an Kleidung und Nahrung ab. Seine Presse stand nie still, die Bücherballen häuften sich. Aber die Pariser Nächte hatten eine blutige Färbung angenommen. Während er Schicksale der kleinen Mädchen suchte, stolperte er fast über ein Weltschicksal: er war in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni Zeuge der Flucht der königlichen Familie und sah auch die schmähliche Rückkehr von Varennes. Er erlebte, zitternd und in ewigem Wechsel seiner politischen Anschauungen, die Schreckenszeit, die sein Geschäft entwertete, seine Leser zerstreute und ihn zweimal wegen politisch mißfälliger Pamphlete, deren Urheberschaft er bestritt, zur Verantwortung zog. Dann kam Napoleon, und seine Regierung brachte dem gänzlich Verarmten eine kleine Stelle, die er bis zu seinem Tod bekleidete. Als dieser ihn ereilt hatte, schrieb das »Journal de Paris«: »Sein Leben selbst war nur ein trauriger Roman, dessen Moral die sein könnte, daß das Talent ohne maßvolles Betragen eine böse Himmelsgabe ist.«
Retif selbst hatte zu oft solch selbstgerechte, muffige Urteile für Leidenschaften gehabt, die gerade nicht die seinen waren, als daß man ihn gegen diesen Nachruf allzusehr verteidigen dürfte. Aber diese Stimme aus dem antirevolutionären, kaiserlichen Paris meinte im letzten Grunde mit dem »maßlosen Betragen« die Große Revolution und verdammte ihre reinigenden Ungeheuerlichkeiten noch einmal in dem Mann, der, aus all dem Schmutz des Pöbels aufragend, dem Pöbel Sitz und Stimme in der Weltliteratur verschafft und von all seinen Irrgängen immer wieder dasselbe Gut mit heimgebracht hatte: das enthüllte Menschenherz.
Ulrich Rauscher
Das Mädchen als Jüngling
Ich beabsichtige nicht, hier die Geschichte einer jener Tribaden zu schreiben, die dadurch von sich reden machten, daß sie sich nach Männerart kleideten und aufführten. Obwohl sie nicht alle verächtlich sind, stehe ich doch hinsichtlich ihrer auf dem Standpunkt Voltaires, der die zartsinnige Agnes Sorel der kriegerischen Jeanne d'Arc vorzieht. So sehr ich auch von Achtung für letztere durchdrungen bin, möchte ich doch nicht ein ihr ähnliches Wesen gegen meine Süße Anna eintauschen, auch möchte ich ebensowenig etwas von jener schönen Lothringerin wissen, von der erzählt wird, daß sie, in einen schmucken Grenadier verschossen, in dasselbe Regiment eintrat und eines schönen Tages – nein, es war in der Nacht – im Verfolg einer heftigen Kolik, der gegenüber die Ärzte am Ende ihres Lateins waren, einen kleinen Latulipe in die Welt setzte. Noch weniger gefällt mir dieses Tonnerreweib, ein wirklich zum Manne zugestutztes Weib, das Europa trotz ihrem Geschlecht nur ruhig hätte den Chevalier d'Eon nennen sollen.
Die Dame, die die Heldin meiner Novelle ist, ist eine sanfte und zarte Schöne, die leider zu schüchtern ist, um auf Heroismus Anspruch zu machen.
In einer Provinzialstadt, ich glaube der ehemaligen Hauptstadt des Departements Sens, die heute nur noch ein elendes Nest ist, während Paris, das damals ein Nest war, heute die Türme seiner Kirchen und die Giebel seiner großartigen Paläste bis in die Wolken hineinragen sieht, – in Sens also lebte ein junges, reizendes Mädchen, Tochter eines Landedelmannes von der Sorte derer, die die Finanzwelt mit Unrecht Krautjunker getauft hat. Dieser Edelmann besaß ein Vermögen von einigen 40000 Franken an Grund und Boden, das ihm eine jährliche Rente von nur 800 bis 900 Franken abwarf, da ein Teil seines Besitztumes aus Gestrüpp und wertlosem Gelände bestand. Mit diesen bescheidenen Mitteln hatte er eine Frau aus altadligem Geschlecht, die nichts mitgebracht hatte, und drei Kinder zu ernähren: einen Sohn, der ein Stipendium bezog und ein Kolleg in Paris besuchte, und zwei Töchter, die arm an Geld, aber reich an körperlichen Reizen waren. Die Älteste besonders, Armida Judith Victoria des Troches, war das reizendste Mädchen, das man sich denken konnte, eine wahre Nymphe mit sanftem Augenaufschlag und feinem Lächeln, goldblonden Haaren, einem kleinen Mündchen Korallenlippen usw. Für wen glaubt man nun, wurde um die Hand dieses reizenden Geschöpfes angehalten? Man wird es niemals raten: für einen gewissen sogenannten Baron von T .... ci, noch ein halbes Kind und Sohn des Herrn ***, der nicht nur ein Bürgerlicher war, sondern dazu von so niedriger Stellung und so niedrigem Range, daß der letzte aller Bürger sich mit Recht für über ihm stehend halten durfte. Aber der Vater der schönen Armida des Troches war des Elends müde, sah diese Partie mit günstigen Augen an und meinte, sein unbefleckter Adel würde die unreine Quelle klären, aus der die Reichtümer seines zukünftigen Schwiegersohnes stammten, der noch dazu mit dem Titel Baron maskiert war. Armida konnte an ihren zukünftigen Gatten nicht ohne Schauder denken. Sie dachte daran, wie ihr Vater in ihrer Kindheit stets sein edles Blut gepriesen hatte und wie er sich über die Emporkömmlinge (wenn sie es nicht hörten) ausließ, deren geringster noch hoch über dem falschen Baron stand. Vielleicht würde sie trotz allem gehorsam gewesen sein. Aber da kam die Familie ihres Freiers nach Sens. Sie sah den Vater, eine Art von Bulldogge, die Mutter, dicker als die dickste Katharina, ihre zukünftigen Schwägerinnen, deren Züge an junge Gauklerinnen auf Jahrmarktsbühnen erinnerten, und da schien ihr, daß der Tod dem Schicksal vorzuziehen sei, das ihr bevorstehe. Sie warf sich ihrer Mutter zu Füßen, und beide vergossen bittere Tränen. Aber durch ihren Gatten geschult, der ein wahrer Haustyrann war, riet die Mutter ihr zum Gehorsam und ging noch weiter, als sie den Widerwillen Armidas bemerkte, indem sie ihr sagte, es müsse sein.
Sich an ihren Vater zu wenden, dazu fehlte der Ärmsten der Mut. Inzwischen schritten die Vorbereitungen zur Hochzeit vorwärts. Armida entschloß sich, obwohl sie die Schwester des T...ci nicht ausstehen konnte, diese aufzusuchen in der Absicht, sich bei ihnen nach den Aussichten zu erkundigen, die ein junges Mädchen in Paris haben könnte. Die Damen N*** sprachen von gefügigen Mädchen, deren Glück reiche Männer begründeten, und von solchen, die Talent fürs Theater hätten und mit ihrer Person ihre Erfolge als Bühnenkünstlerinnen bezahlten, besonders diesen Stand priesen sie und rühmten die hohe Achtung, deren er sich erfreue.
»Aber gibt es denn in Paris nichts anderes, als nur ausgehaltene Frauen oder Schauspielerinnen?« fragte Armida enttäuscht.
»Wir kennen nur solche. Es gibt wohl auch anständige Frauen, aber die sind reich, das sind Töchter von Finanzleuten oder aus vornehmer Familie.«
»Aber was könnte denn eine Unglückliche ohne Mittel, die anständig bleiben will, in Paris anfangen?«
»Die müßte eine Stellung als Dienstmädchen oder Arbeiterin suchen, Dienstmädchen wäre noch vorzuziehen, den Arbeiterinnen geht es zu schlecht. Aber beide sind noch mehr verachtet, als die ausgehaltenen Mädchen und leben dabei in Armut: Sie endigen schließlich, indem sie sich doch der Schande preisgeben oder in Elend verfallen.«
Armida konnte von ihren zukünftigen Schwägerinnen keine Auskunft über das erhalten, was ihr am Herzen lag. Sie erkundigte sich daher bei ihrer Mutter, die mit schwerem Herzen alle ihre Befürchtungen bestätigte und ihr vom Hörensagen ein noch schwärzeres Bild von all dem Elend und den Gefahren ausmalte, denen arme Mädchen, wenn sie schön sind, als Arbeiterinnen oder Dienstmädchen in einer Stadt wie Paris ausgesetzt sind. Doch der Entschluß des jungen Mädchens stand fest: sie wollte die Flucht ergreifen. Nur sagte sie sich, das dürfe aus Sicherheit für ihr Ehre nicht in den Kleidern ihres Geschlechts geschehen, und traf demzufolge ihre Maßregeln.
Eines Tages – drei Tage vor der Hochzeitsfeier – gingen Vater und Sohn des Troches mit dem jungen de T...ci, dem bulldoggenhaften Vater, der würdigen Mutter und den schämigen Töchtern, die als Amazonen gekleidet waren, auf die Jagd. Armida hatte sich geweigert, mitzugehen, was ihr viele scherzhafte Vorwürfe und faule Bemerkungen eingebracht hatte. Frau des Troches war entschuldigt, da sie am Vorabend der Hochzeit viel zu tun hatte. Armida war also frei. Sie zog sofort eines der wenigen guten Kostüme ihres Zukünftigen an, steckte ihre kleinen Ersparnisse ein, verließ das Haus, warf sich in den Postwagen von Villeneuve-la-Guiarre und fuhr bis Montereau-faût-Jonne, acht Meilen von ihrem Heimatort entfernt. Dort langte sie an, bevor man ihre Flucht bemerkt hatte. Eine andere Eilpost brachte sie nach Melun, wo sie das Marktschiff nahm, das sie in Paris absetzte. Kaum gelandet, beeilte sie sich, vom Hafen Saintpaul fortzukommen, nahm einen Fiaker und bat den Kutscher, sie nach einem Absteigequartier für Dienstboten zu fahren. Der Kutscher, der in der Rue de l'Artre Sec wohnte, fand es bequemer für sich, den jungen Mann nach dem Hôtel d'Alique in der rue Saint-Honoré zu bringen, wo er seinen Fahrgast absetzte.
Armida, die ich von nun an einfach des Troches nennen werde, stand noch in der Einfahrt des Hotels, als eine glänzende Equipage in schneller Fahrt vorfuhr. Der vermeintliche junge Mann dreht sich um und zeigt den beiden Damen, die aus dem Wagen stiegen, eines der interessantesten Gesichter: seine schönen blonden Haare, die er im Schiff geflochten hatte, wurden auf dem Kopf durch einen Kamm festgehalten und hingen in welligen Zöpfen auf die eine Schulter herab, sein natürlich sanfter Blick war schmachtend, der Gesamtanblick seiner Person war ganz dazu angetan, der tugendhaftesten der Frauen, einer Alkeste, einer Artemisia oder einer de Ch*** den Kopf zu verdrehen. Eine der Damen, die ältere, sagte zu der jüngeren und schönen:
»Da haben sie ja, was sie brauchen, Marquise, wenn der junge Bursche eine Stelle sucht, sein Gesicht gefällt mir.«
Die junge Dame sieht ihn nachlässig an und meint: »Er ist zu jung.«
»Er wird älter werden ... Sagen sie, mein Freund, suchen sie eine Stelle? ...«
»Ach, Madame.«
»Dann engagiere ich Sie für die Marquise von M*** hier.«
»Haben sie jemanden, der für sie bürgt, mein Bester?« fragte darauf die junge Marquise.
»Ich werde ihm als Bürgin dienen,« sagte darauf die erste Dame.
»Aber, liebe Freundin, das ist doch unklug ...«
»Madame,« bemerkte des Troches, »ich treffe gerade im Augenblick aus der Provinz ein.«
»In diesem Augenblick?« rief da die erste Dame, »dann hast du also Paris noch gar nicht gesehen?«
»Nein, Madame.«
»Den müssen sie nehmen, Marquise, Sonst behalte ich selbst ihn ... Verständigen wir uns. Sie brauchen sofort einen Lakai, nehmen sie ihn. Wenn er Ihnen in einigen Tagen nicht mehr passen sollte, dann werde ich Sie von ihm befreien und ihn zu mir nehmen. Aber nehmen sie ihn nur sofort mit ...«
Die junge Marquise wußte keinen Einwand mehr zu machen. Sie gab Des Troches ein Zeichen, hinten aufzusteigen. Er tat so, wurde von den anderen Dienern begrüßt, und die Equipage kehrte ins Hotel der Marquise zurück.
Am selben Abend noch wurde Des Troches unter dem Namen Champagne dem Dienst der schönen Marquise zugewiesen, die an ihm ebensoviel Gefallen gefunden hatte, wie ihre Freundin. Sie sollte nicht enttäuscht werden: nie hatte es einen eifrigeren Diener gegeben. Des Troches erriet jeden ihrer Wünsche, verstand jede Bewegung, jeden Blick, jeden Ausdruck ihrer Züge. Hatte der falsche Champagne sie gleich anfangs für sich einzunehmen gewußt, so wurde er nach Verlauf von acht Tagen geradezu von ihr geliebt. Sie konnte nur noch ihn als Diener um sich haben, und er mußte sogar die Kammerzofe vertreten.
Doch das war noch nicht alles. Seine Unterhaltung fesselte die junge Marquise, denn der neue Lakai hatte so gar nichts von den rohen Sitten und der groben Ausdrucksweise seiner Kameraden an sich. Seine Worte waren anständig, gewählt, und nie entfuhr ihm etwas, das nicht aus dem Munde eines besterzogenen jungen Mädchens hätte kommen können.
Nach acht Tagen machte die Vicomtesse von ***, eben die Dame, welche die Marquise begleitet hatte, als sie Champagne in ihren Dienst nahm, ihrer Freundin einen Besuch. Ihr erstes Wort war:
»Und mein Schützling?«
»Nun,« antwortete die Marquise ziemlich unbefangen, »ich bin mit ihm zufrieden ...« Und ohne ihrer Freundin zu weiteren Fragen Zeit zu lassen, erzählte sie ausführlich über ihn.
»Sie sehen, daß ich recht hatte. Dieser Bursche hat ein Gesicht, das für ihn spricht, Sie behalten ihn also?«
»Gewiß. Er gefällt hier jedermann. Zephirette, mein Kammermädchen, scheint sich in ihn verschossen zu haben.« (Zephirette war eine hübsche Brünette, und ihre Herrin vermutete richtig. Vor die Wahl gestellt, auf Champagne eifersüchtig zu sein oder ihn zu lieben, hatte sie das letztere, als das natürliche und angenehmere gewählt.)
»Ich freue mich ungemein, daß dem so ist,« sagte die Vicomtesse, »kann ich ihn sehen?«
Die Marquise läutete, und Champagne erschien.
Er wurde rot vor freudiger Überraschung, als er seine Beschützerin erblickte, und machte ihr in seiner ersten Erregung eine halb männliche, halb weibliche Verbeugung, worüber die Damen herzlich lachten. Die Feinheit seiner Züge, sein weißer, rosiger Teint, die Zartheit seiner Haut, alles das frappierte die Vicomtesse. Sie vergaß sich einen Augenblick, ergriff die kleine, fleischige Hand des falschen Champagne und sagte zu ihm: »Deine Herrin ist mit dir zufrieden, und ich bin froh darüber, habe ich doch für dich gebürgt. Fahre so fort, und es wird dein Schade nicht sein ... Guter Gott, was für ein Teint!«
»Der kommt davon, daß er errötet ist.«
»Ich liebe so viel ehrsame Schüchternheit!«
Champagne küßte in lebhafter Erregung unüberlegterweise der Vicomtesse die Hand. Die Dame zog bewegt ihre Hand zurück und sagte zur Marquise:
»Entlassen sie ihn, denn offenbar ist der arme Bursche nicht für den Stand geboren, in dem er sich Augenblicklich befindet.«
»Oh, Madame!« bemerkte Champagne darauf, indem er sich zurückzog, »ich bin weit entfernt davon, mich über mein Geschick der gnädigen Frau zu beklagen, besonders seitdem ich das Glück hatte, Ihnen zu gefallen und in den Dienst zu treten.«
Als er hinaus war, äußerte die Vicomtesse:
»Wahrhaftig, der Bursche interessiert mich. Wenn wir ihn nicht zufällig im Dienstbotenvermittlungsbureau angetroffen hätten, würde ich glauben, er wäre bei Ihnen aus – Liebe eingetreten.«
»Welcher Gedanke! Sie sind manchmal wirklich ein wenig zu romantisch!«
»Das Romantische ist oft natürlicher, als man denkt. Und so plauderten die Damen noch lange weiter über Champagne.
Wenn dieser auch nichts von der Eifersucht der liebenswürdigsten aller Zofen zu befürchten hatte, so mußte er im Gegenteil mit dem Neide einer häßlichen, dicken Dienerin und der Diener rechnen, deren Livree auch er trug, deren Geschlecht er aber nicht angehörte. Ein Lakai besonders, der bisher das Vorrecht hatte, der Marquise Gebetbuch und Fußkissen zu tragen, wenn sie in die Kirche ging, war wütend darüber, sein schönes Recht an Champagne übertragen zu sehen, während er die Schleppe tragen mußte. Das war ihm zwar an sich nicht unangenehm, denn es war den Leuten der schönen Marquise stets ein Vergnügen, ihr zu dienen und den Saum ihres Kleides zu berühren, und ein Fürst würde ihn darum beneidet haben, wenn ein solcher dieses Recht als ihr Geliebter bewilligt erhalten hätte, aber Briasson wurde von Eifersucht verzehrt. Diese trat zwar nicht offen zutage, aber sie gärte in seinem Herzen. Als er ihrer nicht mehr Herr ward, eröffnete er sich der häßlichen, dicken Kammerfrau. Wie zwei Bergströme, durch ein Gewitter hochangeschwollen, bei ihrem Zusammenfließen an Gewalt und Wut wachsen, so schwollen die Eifersuchtsgefühle des Lakaien und der Kammerfrau, indem sie sich vereinigten, an Heftigkeit. Sie teilten sich gegenseitig ihren Kummer mit, sie stachelten sich zur Rache an und faßten endlich den Entschluß, Champagne bei ihrem Herren unmöglich zu machen, ohne aber ihrer Herrin zu schaden. Indem sie sich diese Beschränkung auferlegten, hielten Sie den Plan für unschuldig. Sie beobachteten nun genau alles, was Champagne tat und führten über alle seine Schritte und über das, was sie seine Unverschämtheiten nannten, genau Buch. Hier einige Proben davon.
Heute, am 2. August, hat der Laffe (das ist Champagne) Madame geschnürt, die weiter nicht darauf achtete, da sie zuerst Zephirette und dann mich, Barbe, gerufen hatte. Er tat es in einer Art und Weise und mit einer Miene, die Ohrfeigen verdient hätten, aber Madame merkte nichts davon.
3. August. Der Schlingel hatte Madame die Schuhe angezogen. Madame klagte, daß die Schnalle sie drückte und rief nach Zephirette, um dem Frechen ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Da warf der Geck sich auf die Knie, ergriff Madames Fuß und legte die Schnalle etwas besser zurecht.
4. August. Der Laffe hat Madame gekämmt, obwohl sie mehrmals nach Zephirette und Barbe rief. Aber der Bengel wußte sie so sanft zu kämmen, daß sie ihn gewähren ließ.
3. August. Ich wage beinahe nicht zu sagen, was ich heute sah: der Lümmel nahm aus der Hand von Madame ihren Fächer und ihre Handschuhe entgegen: er führte diese Gegenstände dann an den Mund, ohne daß Madame es sah.
6. August. Immer frecher werdend, stieß er heute Zephirette beiseite, um Madame, die aus der Oper kam, die Schuhe auszuziehen.
7. August. Der Unverschämte blieb heute länger als eine halbe Stunde im Zimmer von Madame und plauderte mit ihr ungeniert und lachenden Mundes, obwohl Madame von Zeit zu Zeit eine sehr ernste Miene annahm. Endlich war sie genötigt, ihn ziemlich kurz angebunden wegzuschicken. Usw. usw.
Das genügt wohl, um eine Idee von diesem Tagebuche zu geben. Im Grunde war alles richtig, was darin geschildert wurde, aber die beiden Eifersüchtigen verschwiegen dabei, daß Champagne, der stets schüchtern und ehrerbietig blieb, nichts tat, wenn er nicht dazu durch einen Blick seiner schönen Herrin ermutigt wurde, die seine Dienste wegen seiner Geschicklichkeit, seines Eifers und seiner leichten Hand vorzog.
Bevor ich weiter von den Folgen dieser Angeberei für Champagne spreche, möchte ich ein Wort von der Stimmung der Marquise gegen ihn sagen. Er hatte in der Tat Eindruck auf sie gemacht. Aber ihr Gefühl für ihn war durchaus ehrenwert, es war weniger Liebe als Freundschaft, allerdings eine sehr lebhafte. Sie wurde in ihren Gefühlen noch durch die Vicomtesse unterstützt, die Champagne mehr physisch zu lieben schien und sich um so weniger Zwang antat, als er nicht ihr Diener war. Eine Frau aber, die von einer anderen ermutigt wird, geht in der Regel immer weiter, als sie allein gehen würde, und bald glaubte die Marquise, für Champagne wirklich Liebe zu empfinden. Sie war darüber bestürzt, und ihr Stolz ließ sie grausame Augenblicke durchmachen. Schließlich beruhigte sie aber allmählig wieder die ehrenhafte, anständige Haltung Champagnes, der nie weiter ging, als sein Dienst es mit sich brachte, und sie nahm sich vor, ihn heimlich zu lieben, ihm Gutes zu erweisen und dabei stets tugendhaft zu bleiben. Um sich in ihrem Vorsatz zu bestärken und sich für ihre Schwäche zu bestrafen, entschloß sie sich, die Neigung Zephirettes für Champagne zu begünstigen und bisweilen Zeuge des Austausches ihrer Zärtlichkeiten zu sein.
Wer die schöne Marquise von M*** kennt, wird daher nichts Unwahrscheinliches dabei finden.
Zephirette, die keinen Grund hatte, ihre Liebe zu verheimlichen, tat ihrer Leidenschaft für Champagne keinen Zwang an und gab sich ihr schrankenlos hin. Als daher eines Tages der junge Mann ihr Entgegenkommen in zärtlicher Weise erwiderte – er wußte, wer er war, und war gerührt von der Zuneigung Zephirettes – faßte das junge Mädchen einen sonderbaren Entschluß, von dem die Marquise durch einen Zufall Kenntnis erhielt. Während alles dieses vor sich ging, hatten die beiden Eifersüchtigen ihr Komplott angezettelt.
Der Lakai sprach eines Tages seinen Herrn an und bat ihn um eine Audienz. Er gab dem Marquis das Tagebuch zu lesen, fügte einige weitere Beobachtungen hinzu und bat um die Erlaubnis, Barbe herbeizurufen. Der Marquis stimmte zu. Die Kammerfrau war noch beredter, als der Lakai, denn Verleumdung scheint besonders für den Frauenmund geschaffen zu sein. Herr von M*** war beunruhigt, wenn er auch nicht an die Schuld der jungen Marquise glaubte, doch aber annahm, daß sie in ihrer Güte zu weit gegangen sei, und daß es daher unstatthaft sei, eine junge Frau von neunzehn Jahren fernerhin solcher Versuchung auszusetzen. Um sie aber nicht zu peinigen und mit Verdächtigungen zu behelligen, die sie erniedrigt haben würden, beschloß er, Champagne verschwinden zu lassen, ohne daß jemand vermuten könnte, daß er seine Hand dabei im Spiel gehabt hätte. Er behielt daher seine Gefühle für sich und entließ die beiden Diener mit dem strengen Verbot, ihre Beobachtungen fortzusetzen und mit irgend jemandem darüber zu sprechen. Die beiden Intriganten wurden so für ihre Bosheit bestraft, denn selbst wenn sie ihren Zweck erreichten, so würden sie doch nichts davon erfahren haben.
Da jedoch der Marquis nichts dem Zufall überlassen wollte, nachdem er einmal beschlossen hatte, Champagne zu entfernen, wenn er unschuldig wäre, ihn aber schwer zu bestrafen, wenn er verbrecherische Absichten gehabt hätte, so prüfte er eingehend das Betragen des jungen Burschen. Er sah, daß nur allzuviel Gründe vorlagen, um die Wahrheit der Berichte der beiden Diener anerkennen zu müssen. Er glaubte sogar zu bemerken, daß sie seine Gemahlin geschont hatten, denn er sah mit eignen Augen, mit welchem Vergnügen die Marquise die Dienste Champagnes entgegennahm, und mit welcher Freude dieser sie leistete. Das machte ihn zornig und führte den Augenblick der Rache schneller herbei. Er setzte dafür den Abend desselben Tages an, an dem Zephirette einen sehr kühnen ihrer Liebe entsprossenen Plan ausführen wollte, den die Marquise in einem gewissen Eifersuchtsgefühl aus den von ihrer Zofe getroffenen Vorbereitungen durchschaut hatte, und den sie vereiteln wollte.
Es geschah, daß am gleichen Tage die Vicomtesse der Marquise einen Besuch machte. Mehr und mehr in ihren Schützling verliebt, wollte sie sich seiner Gegenwart erfreuen, und so kam es, daß die beiden mehr als zwei Stunden mit ihm beisammenblieben. Man plauderte, sprach auch von den Ehemännern, die auf ihre Diener eifersüchtig seien und führte einige Beispiele an, die junge Marquise konnte einen Seufzer nicht zurückhalten, den ihre Freundin bemerkte. Die Vicomtesse tat aber, als ob sie es nicht bemerkt hätte. Ihr waren einige Äußerungen des Marquis zu Ohren gekommen, und sie hatte das Gespräch mit Absicht auf dieses Thema gelenkt, um ihre Freundin, ohne sie zu fragen, zum Sprechen zu bringen. Champagne in seiner Unschuld konnte die Unterhaltung nicht auf sich beziehen. Ich habe vergessen, anzuführen, daß Champagne sehr fromm war, dies muß man aber wissen, seine Frömmigkeit war lebhaft und innig, man sah, daß sie von Herzen kam. Bei Erwähnung eines der Beispiele äußerte er:
»Ich glaube, meine Damen, daß man, solange man Gottesfurcht in sich trägt, nichts anderes zu fürchten hat. Wenn jene Leute sich der Vorsehung anvertraut hätten, so würde diese ihre Tugend ans Licht gebracht haben.«
Die Vicomtesse – ein wenig Freigeist – lächelte über solchen frommen Glauben, aber Champagne erschien ihr deswegen noch liebenswerter. Seine Leichtgläubigkeit sprach für seine Unschuld und Naivität, und das war ein Reiz mehr.
»Wenn sie es mir gestatten, meine Damen,« fuhr Champagne fort, als er die Vicomtesse lächeln sah, »so will ich Ihnen ein Beispiel zitieren, das meine Behauptung bekräftigen wird.«
»Gern,« bemerkte die Vicomtesse darauf, »ich höre Sie mit Vergnügen sprechen.«
»Zu der Zeit, als mein Vater in der Bretagne im Dienste des ... seines Herrn war (bald hätte er gesagt »des Königs«), war er Zeuge folgenden Vorkommnisses. Ein gottesfürchtiger Diener diente mit Eifer der Gräfin von K***, deren Gatte sehr reich war und in der Umgegend von Vannes oder Quimper ein Hüttenwerk besaß. Der treue Diener, der in seiner Herrschaft den lieben Gott selbst sah, wie sich der heilige Paulus ausdrückt, war stets rege in seinem Dienst: er würde den Grafen so gut bedient haben, wie die Gräfin, aber er gehörte letzterer an. Seine Aufmerksamkeit war so groß, daß er jeden ihrer Wünsche zu erraten schien. Wenn sie ihm etwas befahl, war seine Antwort meistens: »Ist bereits geschehen, Madame.« Die Gräfin war aufs höchste verwundert über seinen Eifer, und wenn eine ihrer Freundinnen sie besuchte, so geizte sie nicht mit dem Lobe Champagnes (so hieß auch er). Dabei war er ein schöner Bursche, den man stets sehen wollte, wenn seine Herrin sein Lob gesungen hatte. Er kam, antwortete auf die Fragen und betrug sich mit solcher Bescheidenheit, daß jeder der Gräfin zu einem solchen Diener Glück wünschte.
»Einer von Champagnes Kameraden, namens Pinson, war Zeuge dieser Lobsprüche gewesen und wurde darüber so eifersüchtig, daß er sein Verderben beschloß und ihn bei seinem Herrn anschwärzte. Er beschuldigte ihn, die Gräfin zu lieben, die aber davon nichts wisse und lieferte dem Grafen solche Beweise, daß dieser ihm glaubte. Indessen wollte er sich mit eignen Augen von der Wahrheit überzeugen. Aber wie behext von dem boshaften Lakeien, sah er überall nur das Böse. Da der Graf das Leben eines elenden Lakeien nicht groß achtete, dessen Verbrechen ihm so schwer erschien, so suchte er einen Knecht seines Hüttenwerkes auf und sagte zu ihm: »Höre, wirf den ersten, den ich mit der Anfrage zu dir schicke, ob du getan hast, was ich dir befahl, in den Ofen.« Diese Art Leute in der Hütte sind Halbwilde und sehr grausam. Der Knecht war daher auch ganz erfreut über seinen Auftrag und aus Besorgnis, ihn nicht gut auszufüllen, gesellte er sich noch einen Kameraden bei, der ebenso bösartig war wie er. Am anderen Morgen ließ der Graf Champagne durch dessen Feind Pinson rufen und befahl ihm: »Gehe in die Hütte und frage den Knecht am Ofen, ob er getan hat, was ich ihm befahl.« Champagne erwiderte: »Ja, Herr Graf,« und ging sofort, den Befehl auszuführen. Aber beim Weggehen kam ihm der Gedanke, ob nicht vielleicht die Gräfin auch einen Auftrag für ihn habe. Er ging also zu ihr und sagte: »Ich soll auf Befehl des Herrn in die Hütte gehen. Da ich im Dienste der Frau Gräfin stehe, wollte ich fragen, ob Frau Gräfin mir nichts aufzutragen hat?»Nichts, Champagne. Doch solltest du unterwegs zufällig die Messe läuten hören, so gehe du für mich wie für dich beten, da ich selbst heute etwas unpäßlich bin und nicht ausgehen kann.« Champagne freute sich über diesen Befehl, der auch zugleich seinen Wunsch erfüllte. Ohne ihn würde er nicht gewagt haben, sich bei der Ausführung eines Befehles seines Herren unterwegs aufzuhalten. Als er am Ende des Dorfes angelangt war, hörte er die Messe läuten. Es war Sommer, und da niemand außer einigen siechen Greisen zugegen war, der den Priester beim Lesen der Messe hätte bedienen können, so erbot er sich dazu, stellte die Meßkännchen bereit, reinigte den Hochaltar und sang, als der Priester seines Amtes waltete, die Responserien. Die Messe dauerte wohl drei Viertelstunden. Darauf brachte er alles wieder in Ordnung, wie ein richtiger Meßdiener es getan haben würde, und eilte dann zum Hüttenwerk, indem er unterwegs aus seinem Brevier für seine Herrin, seinem Herrn und sich selbst Gebete hersagte. Beim Ofen angelangt, fragte er den Knecht:
»Hast du getan, was mein Herr, der Graf, dir befahl?«
»Gewiß, es ist schon eine geraume Zeit her!« entgegnete dieser grinsend, »es ist keine Spur mehr von ihm da, so wenig, als ob er nie existiert hätte.« Champagne kehrte eilends zu seinem Herrn zurück. Aber als dieser ihn bemerkte, wurde er von Bestürzung und Zorn erfaßt und fuhr ihn an:
»Woher kommst du, Elender?«
»Vom Hüttenwerk, Herr Graf.«
»Dann hast du dich also unterwegs aufgehalten?«
»Nur um den Befehl der Frau Gräfin auszuführen, unterwegs die Messe zu hören und für sie zu beten. Das habe ich getan und auch für sie gebetet. Ich dachte nicht, daß der Auftrag des Herren Grafen so eilig sei.«
Bei diesen Worten fiel der Graf in tiefes Nachdenken. Dann fragte er Champagne nach der Antwort, die man ihm erteilt habe, und er erkannte aus ihr die Tatsache, daß der Angeber, den er aus Ungeduld ebenfalls nach dem Ofen geschickt hatte, um zu erfahren, ob Champagne sich eingestellt habe, als erster dort eingetroffen und in das geschmolzene Eisen geworfen worden sei. Er konnte sich nicht erwehren, in dem, was geschehen war, die göttliche Vorsehung zu erkennen. Er ging zur Gräfin und sagte ihr, auf Champagne deutend:
»Habe Vertrauen zu diesem treuen Diener. Ich habe heute erkannt, daß Gott ihn liebt.«
Und von diesem Tage an erhielt Champagne die Verwaltung des ganzen Hauses, der er stets mit Redlichkeit vorstand.
»Diese Geschichte, meine Damen, habe ich meinen Vater oft erzählen hören.«
Die Vicomtesse sah darauf die Marquise an und äußerte:
»Champagne hat eine Art zu erzählen, die ein wenig nach dem vorigen Jahrhundert schmeckt, nicht wahr, liebe Freundin?«
»In der Tat!« erwiderte die Marquise, »man glaubt ein Märchen zu hören, aber mir gefällt so etwas.«
»Gibt es in Ihrem Hause nichts Neues, Marquise?« fragte darauf die Vicomtesse.
»Nichts, liebe Freundin.«
»Nun, ich glaube, Sie werden mir Champagne bald abtreten müssen. Ich weiß aus guter Quelle, daß Ihr Gemahl sich über seinen Übereifer in Ihrem Dienste ärgert.«
»Davon ist mir nichts bekannt.«
»Gar nichts?«
»Nicht das geringste.«
»Dann wird man sich getäuscht haben.«
Während dieses kleinen Zwiegesprächs hatte Champagne leise gelächelt. Man entließ ihn, und als die Damen allein waren, erzählte die Vicomtesse bis ins einzelne, was sie erfahren hatte. Die Marquise verbarg ihre Unruhe, indem sie von Zephirettes Abenteuer sprach, die sie am Abend überraschen wolle, sie wolle sie aber nicht bestrafen, sondern nur zur Vernunft bringen. Die Freundin stimmte ihr bei, darauf trennten sie sich bis auf Wiedersehen am folgenden Tage.
So kam endlich diese Nacht heran, in der drei Personen so verschiedene Pläne ausführen wollten, die sich alle auf Champagne bezogen, der selbst ganz ruhig und in Unkenntnis des Guten und des Bösen war. Um Mitternacht hielt der Marquis auf dem Hofe seines Hotels einen Postwagen bereit, der den Ärmsten nach dem nächsten Hafen bringen sollte, um ihn dort nach Westindien einzuschiffen. Er rechnete darauf, ihn los zu werden, bevor er zu Bett ginge. Am nächsten Tage wollte er dann seiner Frau erzählen, es sei ihm ein Unfall zugestoßen, der ihm das Leben gekostet habe. Zephirette erwartete ungeduldig den Augenblick, wo ihre Herrin ihren Dienst nicht mehr nötig haben würde, um ihren Angebeteten in seinem Zimmer aufzusuchen und mit ihm glücklich zu sein, und die Marquise beeilte sich, Zephirette zu entlassen, indem sie Schlaf heuchelte, um sie überraschen zu können. Alles dieses wurde im nämlichen Augenblick ausgeführt.
Der falsche Champagne, der nicht wußte, ob seine Herrin ihn noch nötig haben würde, hatte sich angezogen auf sein Bett geworfen. Seine Kammer befand sich im Zwischenstock, ganz in der Nähe der Wohnung der Marquise. Da es heiß war, hatte er den Überrock aufgeknöpft, die Arme dienten ihm als Kopfkissen, seine Kleidung war in großer Unordnung, und durch das offene Hemd hätte man seine Alabasterbrust mit zwei schwellenden Kugeln sehen können. In diesem Augenblick betrat der Marquis, gefolgt von zwei seiner stärksten Lakeien, mit einer Blendlaterne und einem Knebel in der Hand, die Kammer. Er richtet das Licht auf Champagne und sieht
... Bei diesem Anblick, der auch einen Tiger hätte besänftigen können, gibt er den Lakeien ein Zeichen, sich zurückzuziehen und nähert sich dem Phänomen, um es in Muße zu betrachten: es ist ein Mädchen!
Er geht auf die andere Seite des Bettes zwischen Bett und Wand und vielleicht würde er mit indiskreter Hand den Schleier weiter gehoben haben, wenn er nicht den leisen Schritt einer Frau vernommen hätte. Der Marquis blendete das Licht seiner Lampe und versteckte sich. Eine Gestalt nähert sich, ein Licht in der Hand: es ist Zephirette. Sie bläst das Licht aus und nähert sich dem Geliebten. Sie neigt sich über ihn, ihn zu küssen. Champagne wacht auf und fragt:
»Wer ist da? Wer sind Sie?«
»Mein kleiner Champagne, ich bin es, Zephirette, die Sie liebt und nicht ohne Sie leben kann.«
»Ah! Sie sind's, meine liebe Zephirette! Sie lieben mich! Nun, auch ich liebe Sie von ganzem Herzen.«
»Oh! Champagne! Wie sehr muß ich manchmal unter meiner Eifersucht leiden! Denn ich habe es wohl bemerkt, daß auch Madame Sie liebt, und daß Sie schließlich nicht umhin können werden, als sie anzubeten.«
»Ja, meine kleine Zephirette, ich bete sie an, aber dieses Gefühl hat mit meiner Liebe für sie nichts zu schaffen ...«
In diesem Augenblick ließ ein leichtes Geräusch sich vernehmen, und zugleich erhellte sich die Kammer. Es war die Marquise, die im Nachtgewand, einen Leuchter in der Hand, ins Zimmer trat.
»Was machen sie hier, Zephirette?«
»Madame ...« (sie wirft sich der Marquise zu Füßen), Verzeihung! ... wenn Madame wüßte ...«
»Und Sie, Champagne?«
»Er weiß nichts von diesem Rendezvous, Madame.«
»Sprechen sie selbst, Champagne.«
»Ich bitte Sie um Verzeihung, Madame, mein Schicksal liegt in Ihrer Hand. Ich bin nicht schuldig,... Zephirette ebensowenig ..., vergeben sie uns, unsere Herzen schlagen nur für Sie! Wenn Sie mich kennen würden, müßten Sie die Gewißheit erlangen, daß wir nicht schuldig sind.«
»Gehen Sie sich hinaus, Zephirette. Aber ich will Ihnen zum Trost sagen, daß ich nachsichtig sein werde. Was mit Ihnen wird, Champagne, wollen wir morgen sehen.« Zephirette folgte schleunigst dem Befehl, und die Marquise war einen Augenblick mit Champagne allein.
»Ich beschwöre Sie, Madame, hegen Sie keinen Verdacht gegen mich«, bat Champagne sie »und seien Sie davon überzeugt, daß mir nichts leichter sein würde, als mich zu rechtfertigen, doch bitte ich Sie, mir zuzugestehen, es in Gegenwart der Frau Vicomtesse tun zu dürfen.«
Die Marquise antwortete nicht und zog sich zurück.
Sobald sie fort war, erhob sich der falsche Champagne, zündete eine Kerze an und hing seinen Gedanken nach, bisweilen ganz laut:
»Was hat dies alles zu bedeuten? Zephirette ... die Marquise ... Wenn ich die Gunst der Marquise verlöre, wäre ich ja untröstlich für mein Leben ... Wie unglücklich bin ich doch! ... Soll ich ihnen mein Geheimnis, mein Geschlecht und meine Geburt offenbaren? ... Ja, es muß sein, denn sonst würde die Marquise mich im Verdacht und von Zephirette eine schlechte Meinung haben! ... Soll ich mich nur ihr allein anvertrauen? ... oder wäre es nicht doch besser, wenn die Frau Vicomtesse, die mich gern hat, von mir auch diesen Beweis von Vertrauen empfinge?«
Nachdem Champagne noch lange mit sich zu Rate gegangen war, entkleidete er sich und bot dem Marquis den Anblick des schönsten Mädchens dar ...
Dann legte sie sich zu Bett. Als ihr Herr glaubte, sie sei eingeschlafen, wollte er sich entfernen. Dabei stieß er an etwas an, die junge Des Troches fuhr erschrocken empor und rief:
»Wer ist da?«
Man antwortete ihr nicht, die Tür wurde geöffnet, und es gelang dem Marquis, unerkannt hinauszukommen.
Er gab sogleich Befehl, den Wagen wieder in die Remise zu bringen.
Des anderen Tages war Herr de M*** in ganz ungewöhnlich guter Laune, so daß es jedermann auffiel. Er machte seiner Frau den Hof und war der erste, Champagne zu befehlen, der Marquise die intimsten Dienste zu leisten. War dies Ironie? Die junge Frau war in höchster Verlegenheit. Indessen war ihr Gemahl so heiter und freundlich, sogar so zärtlich zu ihr, daß sie sich beruhigte.
Gegen drei Uhr führte die Neugier die Vicomtesse herbei. Die Marquise erzählte ihr alles, was sie getan hatte. Man wollte speisen, aber die Damen waren so gespannt auf Champagnes Rechtfertigung, daß sie diese noch vor Tisch hören wollten. Man ließ ihn kommen. Seine Herrin befahl ihm, sich zu erklären.
»Ich muß gehorchen, Madame, aber darf ich auf Ihre Verzeihung rechnen?« fragte Champagne.
»Ja«, erwiderte die Vicomtesse, »wenn du aufrichtig bist.«
»Ich bin ein Mädchen ... (dieses Wort traf die Damen wie ein Blitz und machte sie unbeweglich wie Bildsäulen) ... ein Mädchen aus guter Familie. Man wollte mich zu einer Heirat mit einem gewissen Baron zwingen, der noch ein halbes Kind und gar kein Edelmann ist, sondern der Sohn eines Gauners. Ich hätte den Tod gesucht, habe aber jedenfalls lieber das angenehme Geschick vorgezogen, das sie mir bereitet haben, Madame.«
Bei den letzten Worten warf die Vicomtesse sich in die Arme des falschen Champagne und sagte:
»Sie wissen nicht, liebes Fräulein, welche Last Sie mir vom Herzen wälzen! ... Und wie ist Ihr Name?«
»Armida Judith Victoria des Troches.«
»Ah! Ich kenne die Familie Des Troches! Umarme Sie doch, liebe Freundin... . Aber was sollen wir nun anfangen?«
»Ich bitte Sie nur um eine Gnade, meine Damen: lassen sie mich in meiner Verkleidung. Denn mein Vater ist schrecklich, ihm liegt diese Heirat am Herzen, und wenn er erfährt, wo ich stecke, dann bin ich verloren.«
»Ja«, meinte die Vicomtesse, »das ist für einige Zeit noch wohl das beste ... wenigstens bis wir darüber beraten und beschlossen haben, welche Schritte bei Ihrem Türken von Vater zu tun sind.«
Die Schöne Marquise war der gleichen Ansicht. Sie behandelte den falschen Champagne von da ab mit Achtung. Nur in bezug auf ihren Gatten machte sie einen Einwand, woraus die Vicomtesse antwortete:
»Gerade über seine Eifersucht werden wir uns amüsieren! Wir müssen ihn rasend machen! ...«
Wir wollen hier nicht alle Pläne anführen, die die gute Seele ausheckte. Es genügt, zu erwähnen, daß die Damen das tiefste Stillschweigen über das Geschlecht und die Abenteuer Armidas – so nannte die Marquise sie von nun an, wenn sie allein waren – gelobten. Selbst Zephirette wurde nicht ins Vertrauen gezogen.
Der Marquis, der ja alles wußte, amüsierte sich köstlich über das Versteckensspielen seiner Frau ... Bisweilen tat er so, als ob er sich darüber ärgere, daß Champagne fast den ganzen Tag bei ihr sei. Da er sich für den alleinigen Besitzer des Geheimnisses hielt, so dachte er: wenn solche Art von Liebe die Marquise noch etwa fünfzehn Jahre lang gefangen hielte, würde er nichts mehr von dem schlechten Einfluß der Hauptstadt auf sie zu befürchten haben. »Wie glücklich bin ich, sagte er bisweilen zu sich, »daß der Flüchtling in mein Haus kam, und daß die Närrin, die Vicomtesse, die ich eigentlich ein wenig fürchtete, meine Frau überredete, ihn in ihren Dienst zu nehmen ...«
Leider besteht der schwache Sterbliche aus lauter Widersprüchen. Dieser Marquis, der gleich bereit war, den vermeintlichen Liebhaber seiner Frau auf die Antillen zu schaffen, der, solange er Armida noch für einen Mann hielt, es für sehr unangebracht gehalten hätte, wenn ihr rosiger Teint, ihre lilienfarbene, seidenweiche Haut, ihre feine Taille und die eleganten Linien ihres Wuchses Eindruck auf seine Frau gemacht hätten – er selber konnte sich nicht versagen, das alles bezaubernd zu finden, nachdem er erkannt hatte, daß diese Reize einem jungen Mädchen gehörten. Er spionierte jede Gelegenheit aus, sie allein zu überraschen. Er bezeigte ihr Vertrauen und freundschaftliche Gefühle und ging oft in seiner Vertraulichkeit so weit, mit seinem kleinen Lakeien zu scherzen und ihm komischerweise Vorwürfe darüber zu machen, daß er den Grausamen spiele. Champagne erstattete der Marquise und der Vicomtesse von dieser Haltung des Marquis Bericht, und die Damen amüsierten sich köstlich darüber, sie bewunderten vor allem, wie doch der Instinkt der Natur den Marquis zu diesem reizenden Wesen hinführte!
Um sich noch mehr über ihn lustig zu machen, kamen sie auf den Gedanken, Champagne im Fasching in die richtigen Kleider seines Geschlechts zu stecken. Einige Tage vorher mußte er sich krank stellen, und die Vicomtesse verlangte, daß er in ihrem Hause gepflegt würde, wohin er auch gebracht wurde. Am Montagabend war große Gesellschaft beim Marquis von ***. Die Vicomtesse war ebenfalls eingeladen. Sie erschien in Begleitung eines reizenden jungen Mädchens, das sie als eine Verwandte ihres Mannes vorstellte, die frisch aus der Provinz käme. Es ist unmöglich, die Anmut Armidas in ihrem eleganten Kostüm neuster Erfindung zu beschreiben. Die Tugendbolde sehen diese polnischen, oder cirkassischen Kostüme nicht gern, und doch kann man dreist behaupten, daß sie das Vernünftigste und Schönste sind, was französische Frauen sich ausdenken konnten. Doch ich will hier nicht darüber diskutieren. Es wäre besser, über diese Frage ein Spezialwerk zu schreiben, das den Titel führen könnte: Über die hohe Weisheit, den ausgezeichneten Geschmack und den überlegenen Verstand der Damen des letzten Viertels des achtzehnten Jahrhunderts in der wunderbaren Erfindung von Kostümen, die die Anmut ihres Wuchses hervortreten lassen und ihnen das Aussehen von wandernden Bienenstöcken nehmen usw.
Armida hatte die schönste Figur unter den schönsten jungen Mädchen: nach unten zu war sie schlank gebaut, nach oben breit, besonders anmutig traten bei ihr unterhalb des Rückens zwei mollige, appetitliche, runde Polsterchen von herrlichster Form hervor.
Die ganze Gesellschaft beglückwünschte die Vicomtesse wegen ihrer Verwandten und hatte nur ein Wort des Lobes für die bescheidene Lieblichkeit des jungen Mädchens, besonders die Marquise, von der man glaubte, daß es ihr ebenfalls unbekannt sei. Der Marquis brauchte nicht lange, um den falschen Champagne zu erkennen, und bei diesem Anblick gingen seine etwas freien Gelüste in wahre Liebe über. Er machte dem schönen Mädchen aus der Provinz in galantester Weise den Hof, er sah und bewunderte nur sie. Die beiden Damen wußten nicht, hatte er sie erkannt oder nicht. Aus seiner ehrerbietigen Haltung ihr gegenüber glaubten sie letzteres schließen zu müssen, Schließlich jedoch mußten sie sich sagen, daß er sie wohl erkannt habe, und nun mußten sie noch zu erfahren suchen, ob er sie tatsächlich für ein Mädchen hielt.
Sie ließen zu diesem Behufe gleich am anderen Morgen Champagne wieder zum Dienst antreten, aber der Marquis war ebenso schlau, wie die Damen, und kümmerte sich nicht im geringsten um ihn. Diese Haltung gab ihnen ihre Sicherheit wieder und beruhigte sie. Es bereitete ihnen vielen Spaß und sie freuten sich innerlich jedes Mal, wenn der Marquis den Wunsch ausdrückte, der schönen Verwandten der Vicomtesse seinen Besuch machen zu dürfen. Als er eines Tages ganz besonders darauf drängte, erwiderte man ihm, daß das Mädchen im Kloster sei.
Die Damen hatten indessen nicht eine andere Unannehmlichkeit voraussehen können, die sie jetzt durchzumachen hatten, und die viel gefährlichere Folgen haben konnte: die Vicomtesse hatte nämlich einen Sohn, der achtzehn Jahre alt war, und an dem Souper teilgenommen hatte, bei dem Armida erschienen war. Der junge Mann, der nicht in das Geheimnis eingeweiht war, hatte Geschmack an ihr gefunden und quälte seine Mutter beständig mit der Bitte, seine Cousine besuchen zu dürfen. Man gab ihm lächelnd ausweichende Antworten. Dieses sonderbare Verhalten stachelte die Neugier des jungen Mannes an. Er bemerkte wohl, daß man seine vermeintliche Verwandte vor ihm verstecken wollte, und beschloß, in Zukunft in seinem Zimmer auf der Lauer zu liegen, um jedem Besucher aufzupassen. Er mußte lange warten, aber zu Mittfasten sollte sein Wunsch erfüllt werden. Für diesen Tag hatten die Damen, um den Marquis außer sich zu bringen, ein Essen bei der Vicomtesse arrangiert, an dem Armida wiederum teilnehmen sollte. Der Sohn der Vicomtesse, Baron von D***, sah den falschen Champagne gegen fünf Uhr ins Haus treten, eine Ahnung sagte ihm, daß sein Kommen etwas bedeute und er gab mehr denn je acht. Er horchte an der Tür zum Zimmer seiner Mutter und sah durchs Schlüsselloch. Er sah Champagne in ziemlich ungezwungener Haltung neben seiner Mutter sitzen und war überrascht, an den Zügen des vermeintlichen Lakeis der Marquise seine hübsche Verwandte wiederzuerkennen. Auch sein letzter Zweifel sollte bald schwinden. Er sah seine Mutter aufstehen und hörte, wie sie zu Champagne sagte:
»Es ist höchste Zeit, daß du dich umkleidest, mein liebes Kind. Schließe die Tür, damit wir nicht überrascht werden.«
Der Jüngling zog sich in den Korridor zurück und ging darin auf und ab, um sicher zu sein, daß niemand sonst mehr käme.
Gegen neun Uhr fuhren mehrere Wagen vor. Der junge Baron beobachtete sorgsam alle Damen, die ausstiegen: keine Verwandte. Als er dann bei Tisch trotzdem seine schöne Cousine bemerkte, in die er verliebt war, da war er seiner Sache sicher.
»Kein Zweifel, es ist Champagne«, sagte er zu sich selber, »aber was soll die Verkleidung?« Er kannte sich nicht mehr aus. Aus der zarten Sorge, womit der Marquis bei Tisch die schöne Unbekannte umgab, schloß er, daß dieser eingeweiht sein müsse, begriff aber noch immer nicht, welche Gründe der Marquis und seine Frau haben konnten, ein so reizendes Mädchen in die Livree eines Lakeien zu stecken. Seine Mutter mußte natürlich alles wissen, er wagte aber nicht, sie zu fragen, aus Furcht, sie könnte seine Gefühle erraten.
Der Anblick Armidas, die noch reizender war, als das erstemal, brachte die Leidenschaft des Marquis für sie auf den Höhepunkt. Am anderen Morgen drang er in die Kammer des Lakeis seiner Frau, während dieser bei der Marquise war, und suchte nach irgendwelchen Papieren, die ihn hätten aufklären können. Er hatte über alles Erwarten Erfolg: er fand eine Art Tagebuch, worin Armida von Zeit zu Zeit alles eintrug, was ihr zustieß, um eines Tages, wenn es nötig sein sollte, ihre Aufführung rechtfertigen zu können.
Im Besitz dieses Geheimnisses, überlegte der Marquis, was nun zu geschehen habe. Armida war aus guter Familie, von Adel und seiner Frau gleichstehend ... Da faßte er einen edlen Entschluß: das junge Mädchen mußte durch ihn mit ihren Eltern ausgesöhnt werden, und dann wollte er ihre Freundschaft erwerben, indem er sie in eine ihrer würdige Lage brächte, in der sie keinerlei Gefahr ausgesetzt wäre. Unter dem Vorwande, eines seiner Landgüter zu besuchen, machte er sich nach Sens auf. Er besuchte Herrn Des Troches und ließ ihn das Tagebuch seiner Tochter lesen. Es gelang ihm den Vater umzustimmen, und man beschloß, daß Fräulein Des Troches bei der Marquise als ihrer Freundin bleiben sollte, die sich dann mit ihrer Zukunft beschäftigen würde. Sodann überredete er Herrn Des Troches, mit ihm nach Paris zu gehen.
Der Marquis war stolz auf seine Tat. Es lag in seiner Absicht, im Interesse Armidas nunmehr etwas Aufsehenerregendes zu veranstalten, das die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich lenken würde. Da alle Umstände dieses Abenteuers ihr nur zur Ehre gereichten, so konnte es nur zu ihrem Vorteil sein und vielleicht dazu beitragen, dem liebenswürdigen Mädchen einen Heiratsantrag seitens eines reichen alten Edelmanns zu verschaffen. Seine Wünsche gingen noch weiter, doch will ich über den zweiten Teil seines Planes hinweggehen, da er einen Flecken auf den ersten werfen würde. Wir sind ja alle nur Menschen! ...
Gleich am Abend seiner Rückkehr ließ der Marquis alle seine Freunde und alle Freunde seiner Frau für den folgenden Tag einladen. Die Vicomtesse und der junge Baron wurden nicht vergessen. Einen Augenblick vor Eintreffen der Gäste sagte Marquis M*** zu seiner Gemahlin:
»Ich möchte gern, daß Champagne allein bedient und auch beim Dessert dableibt. Er ist diskret und ich muß über gewisse Dinge sprechen, die die anderen Diener nicht zu wissen brauchen, er aber erfahren darf.«
Die Marquise wurde von diesem Verlangen sonderbar berührt. Nie hatte Champagne bei Tisch bedient. Indessen wollte sie keine Auseinandersetzung mit dem Marquis haben, und willigte demzufolge ein. Champagne mußte also servieren. Der Marquis sprach lächelnd mit ihm bei Tisch und schien ihm bisweilen die Mühe des servierens erleichtern zu wollen. Jedermann war erstaunt darüber. Da sagte Herr von M*** plötzlich:
»Eine Hebe genügte den Göttern bei Tisch. Sollten wir es ihnen nicht nachtun? Entlassen wir die anderen Leute, und behalten wir nur Champagne.«
Die Vicomtesse wollte dagegen sprechen, aber ihr Sohn bat sie, dem Einfalt des Marquis nachzugeben. Als die anderen Lakaien fort waren, wurde ein neuer Gast, ein Edelmann aus der Provinz, gemeldet.
»Er ist willkommen,« rief der Marquis, »dort ist sein Platz bereit.«
Herr Des Troches trat ein. Niemand kannte ihn außer Champagne, der kreideweiß wurde.
»Gib dem Herrn zu trinken, Champagne,« befahl der Marquis, »er wird Durst haben.«
Champagnes Hand zitterte beim Einschenken so sehr, daß der Marquis ihm die Flasche abnahm und selbst das Glas füllte. Es wäre unmöglich, das Erstaunen zu schildern, das alle Gäste ergriff. Die Marquise und die Vicomtesse machten sich auf eine Katastrophe gefaßt. Da sagte der Marquis zur letzteren:
»Madame, ich möchte Sie unter vier Augen um einen Gefallen bitten.«
Die Vicomtesse stand auf und trat mit ihm beiseite.
»Tun sie mir die Liebe und kleiden sie Armida des Troches so, wie Sie es schon zweimal taten, damit wir sie jenem Edelmann in würdiger Kleidung vorstellen können, denn er ist ihr Vater.«
»Oh, Sie Verräter!« entgegnete ihm die Vicomtesse, »aber sie haben es mit mir zu tun, wenn ihr etwas Unangenehmes passiert!«
»Befürchten sie nichts. Hier ist ihr Tagebuch, das mich in alles eingeweiht hat.« Er überreichte ihr das Buch und nahm darauf wieder seinen Platz an der Tafel ein.
Die Vicomtesse las eine Seite des Tagebuches, war damit zufrieden und kehrte ebenfalls auf ihren Platz zurück. Dann wandte sie sich an den falschen Champagne und sagte:
»Komm, liebes Kind, und setz dich zu mir. Fürchte nichts. Ich bin deine Zuflucht und dein Schutz gegen jedermann, selbst gegen deinen Vater.«
Und sie küßte ihn. Während alle Welt verblüfft war, benutzte sie das allgemeine Stillschweigen, um das Tagebuch vorzulesen, dessen Inhalt allen Gästen Tränen entriß. Armida warf sich ihrem Vater zu Füßen.
Der junge Baron eilte zu ihr, hob sie auf und bat seine Mutter um die Erlaubnis, sie heiraten zu dürfen. Der alte Des Troches war entzückt und weinte Tränen der Freude. Die Damen liebkosten den falschen Champagne, während die Männer verlangten, man solle ihn als Mädchen kleiden. Ihren Wünschen wurde entsprochen. Kurz, verehrter Leser, Armida ist heute Baronin von D***, und da ihr Gatte jung ist, hat der Marquis nicht die geringste Hoffnung.
Der Jüngling als Mädchen
In einem ehrsamen Hause in Paris, das nur von ehrenwerten Leuten bewohnt wurde, hauste ein Bruder mit seiner Schwester. Beide hatten angenehme Gesichtszüge und sahen einander so ähnlich, daß man sie nicht voneinander unterscheiden konnte, wenn beide die Kleidung desselben Geschlechts anhatten.
Die Schwester, Aglaé Caile mit Namen, war nur ein Jahr älter, als ihr Bruder. Als sie ihr siebzehntes Lebensjahr vollendete, machte sie die Eroberung eines vornehmen Mannes mit hervorragenden Eigenschaften. Der hohe Herr sah sie mit ihrer Familie auf der Promenade im Bois de Boulogne. Die junge Caile trug eine jener polnischen kurzen Pekeschen von Taubenhalsfarbe, die der Jugend so gut stehen, und deren Eleganz durch einen Besatz von Seidenspitzen mit silbernen Quasten noch erhöht wurde. Sie war so allerliebst in diesem Kostüm, daß sie die allgemeine Bewunderung erregte.