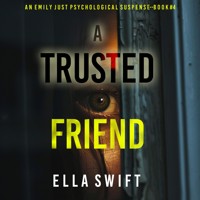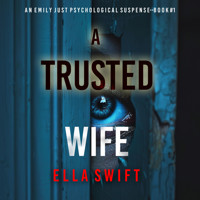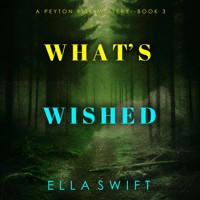4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lukeman Literary Management
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Cooper-Trace-FBI-Thriller
- Sprache: Deutsch
Als führende Köpfe der Pharmaindustrie tot aufgefunden werden – vergiftet durch ihre eigenen Medikamente – steht FBI-Agent Cooper Trace vor einem Rätsel. Doch kann er den Mörder rechtzeitig überführen, wenn sein eigener Verstand und Körper ihn im Stich lassen? ZERSCHMETTERTER TRAUM (Ein Cooper-Trace-FBI-Thriller – Buch 4)" ist der vierte Roman in einer neuen Reihe der Krimi- und Thrillerautorin Ella Swift. Die Serie beginnt mit "ZERBROCHENER GEIST (Buch 1)". Die Cooper-Trace-Reihe ist eine fesselnde und intensive Krimisaga, die einen vielschichtigen und zerrissenen Protagonisten in den Mittelpunkt stellt. Mit ihrer atemlosen Action, packenden Momenten, unerwarteten Wendungen und ihrem rasanten Erzähltempo wird Sie diese Reihe bis in die frühen Morgenstunden wach halten. Fans von Robert Dugoni, Mary Burton und Rachel Caine werden dieser Serie mit Sicherheit verfallen. Weitere Bände der Reihe sind ebenfalls erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
ZERSCHMETTERTER TRAUM
EIN COOPER-TRACE-FBI-THRILLER – BAND 4
Ella Swift
Ella Swift ist die Autorin der Krimireihe PEYTON RISK, die bereits fünf Bücher umfasst, und der neuen Krimireihe COOPER TRACE, die ebenfalls fünf Bücher umfasst.
Als begeisterte Leserin und lebenslange Liebhaberin des Krimi- und Thriller-Genres freut sich Ella über Ihre Nachricht. Besuchen Sie ellaswiftauthor.com mehr zu erfahren und in Kontakt zu bleiben.
PROLOG
KAPITEL EINS
KAPITEL ZWEI
KAPITEL DREI
KAPITEL VIER
KAPITEL FÜNF
KAPITEL SECHS
KAPITEL SIEBEN
KAPITEL ACHT
KAPITEL NEUN
KAPITEL ZEHN
KAPITEL ELF
KAPITEL ZWÖLF
KAPITEL DREIZEHN
KAPITEL VIERZEHN
KAPITEL FÜNFZEHN
KAPITEL SECHZEHN
KAPITEL SIEBZEHN
KAPITEL ACHTZEHN
KAPITEL NEUNZEHN
KAPITEL ZWANZIG
KAPITEL EINUNDZWANZIG
KAPITEL ZWEIUNDZWANZIG
KAPITEL DREIUNDZWANZIG
KAPITEL VIERUNDZWANZIG
PROLOG
Isabelle York starrte auf die roten LED-Ziffern ihres Nachttischweckers, diesen ständigen Spötter in ihrem Leben, der sie Sekunde um Sekunde verhöhnte. 3:37 Uhr. Beim letzten Blick war es 3:34 Uhr gewesen. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit - dabei waren es nur Minuten.
Sie wälzte sich auf die andere Seite und versuchte, zur Ruhe zu kommen.
Atme, Isabelle! Ein Atemzug nach dem anderen, genau wie Dr. Ferguson es dir beigebracht hat.
Isabelle blickte starr an die Wand und atmete ein und aus, ein und aus, ein und aus. Langsam schloss sie die Augen und leerte ihren Geist. Sie stellte sich eine große schwarze Leere vor, in deren Mitte das Wort "atmen" schwebte. Sie betrachtete das Wort und wiederholte es in Gedanken, während sie langsam ein- und ausatmete. Wann immer ihre Gedanken abschweiften, lenkte sie sie sanft zurück zu dem Wort, das in der pechschwarzen Leere hing.
Doch plötzlich veränderte sich das Wort leicht, und die Buchstaben formten sich aus denselben roten LEDs wie auf ihrer Uhr. Isabelle atmete weiter ein und aus, aber das Wort kehrte nicht mehr zu seiner ursprünglichen Form zurück. Sie stieß einen tiefen Seufzer aus, öffnete die Augen und starrte wieder auf die kahle Wand.
Ein Kratzen drang aus der Küche.
Isabelle blieb gelassen. Es war nicht ihre erste schlaflose Nacht, und in der alten Wohnung und von draußen kamen allerlei Geräusche. Doch sie wusste etwas Wichtiges: Sie hatte eine Katze, die nachts gerne auf Wanderschaft ging und tagsüber meist schlief.
Sie drehte sich um und warf erneut einen Blick auf die Uhr: 3:41 Uhr. Sie schüttelte den Kopf.
Isabelle stand auf. Sie hatte fast alles versucht, und der letzte Ausweg war eine weitere Tasse Kamillentee mit einem Hauch Honig. Wieder ertönte ein Kratzen aus der Küche, als ihr Kater seinen Napf mit der Schnauze herumschob.
"Warum quälst du mich?", murmelte sie, während sie aus dem Bett stieg. "Du weißt doch, dass du nachts schlafen und tagsüber aufstehen kannst, oder?"
Sie wohnte im siebten Stock. In dieser Höhe gab es keine Mäuse zu jagen. Es gab keinen Grund für ihre Katze, die ganze Nacht wach zu sein, es sei denn, sie wollte ihr bei ihrer Schlaflosigkeit Gesellschaft leisten.
"Hast du nicht genug zu fressen?", fragte sie, als sie die Küche erreichte.
Der Napf war leer. Isabelle schaltete zuerst den Wasserkocher ein, bevor sie den kleinen Behälter mit Katzenfutter aus dem Unterschrank nahm und etwas in den Napf schüttelte. Sie schüttelte die Dose, um die Katze anzulocken. Dann öffnete sie einen der oberen Schränke und holte eine Tasse, Honig und einen Teebeutel heraus. Sie gähnte, als sie den Teebeutel in die Tasse legte.
Darauf war sie schon einmal hereingefallen. Eines Abends war sie nach einem herzhaften Gähnen ins Bett gegangen, nur um dann die nächsten vier Stunden wach zu liegen. Sie schaute aus dem Fenster in die dunkle Nacht. Der Himmel war wolkenverhangen, die Sterne verdeckt. Es gab Dutzende anderer Hochhäuser, und in einigen brannte noch Licht.
Sie hörte, wie der Kater an seinem Napf kratzte, als er einen Teil des Futters fraß.
Isabelle fragte sich, was die Leute in den anderen Gebäuden wohl taten. Waren sie auch so schlaflos wie sie, oder hatten sie einen Grund, zu dieser nachtschlafenden Zeit unterwegs zu sein?
Isabelles Blut gefror in ihren Adern. Es war nicht das, was sie aus den Augenwinkeln sah, sondern das, was sie nicht sah. Sie konnte den Napf erkennen, der neben ihr auf dem Boden stand, aber es war keine Katze in der Nähe.
Das kratzende Geräusch ertönte erneut.
Das Eis, das durch ihre Adern floss, ließ sie erstarren. Sie starrte geradeaus, ihre Augen bewegten sich, um ihr Spiegelbild im Fenster zu sehen. Sie konnte ihren Umriss erkennen, der sich in der Scheibe abzeichnete, und dann gab es eine Bewegung hinter ihr, als jemand auf dem Flur vorbeiging.
Isabelles Instinkte erwachten. Adrenalin schoss durch ihren Körper, und sie war hellwach. Keine Spur mehr von Müdigkeit. Sie stürzte zur Seite und schnappte sich ein Messer vom Holzblock, drehte sich herum und hielt es vor sich.
Sie starrte auf die leere Tür, die auf den dahinter liegenden Korridor hinausführte. Isabelle verfluchte sich dafür, dass sie ihr Handy im Schlafzimmer auf dem Nachttisch liegen gelassen hatte.
"Hallo?", rief sie. "Ich rufe die Polizei. Ich habe ein Messer."
Ihre Worte verhallten in der Stille, und einen Moment später folgte das kratzende Geräusch. Sie starrte in die Leere und war wie angewurzelt, wusste aber, dass sie sich bewegen musste. Isabelle wog ihre Möglichkeiten ab: das Handy am Bett oder die Haustür in der entgegengesetzten Richtung.
Sie fasste einen Entschluss: zur Tür gehen, rennen und nicht zurückschauen.
Isabelle schlich sich langsam in den Flur und lauschte auf das kleinste Geräusch. Sie ging noch einen Schritt weiter und steckte ihren Kopf in den Flur, wobei sie erst in Richtung Schlafzimmer und dann zur Tür schaute. Es war niemand da, aber sie wusste, dass ihr Verstand ihr keinen Streich gespielt hatte. Es war keine schlaflose Halluzination. Es war real. Jemand war in ihrer Wohnung.
Sie atmete gleichmäßig ein und aus, erinnerte sich an ihre Entspannungstechnik und konzentrierte sich auf jeden Atemzug. Vorsichtig bewegte sie sich seitwärts den Flur entlang, den Rücken fest an die Wand gepresst. An der Badezimmertür angekommen, spähte sie mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit, um sicherzugehen, dass sich niemand darin verbarg. Doch ihre Augen hatten keine Zeit, sich an die Finsternis zu gewöhnen.
Isabelle schlich weiter zur Haustür, das Messer fest in der einen Hand, während sie mit der anderen nach dem Schloss tastete. Sie schob den Riegel zurück und drehte behutsam den Schlüssel. Er klemmte - das Schloss war schon immer etwas widerspenstig gewesen.
Plötzlich drang ein schabendes Geräusch aus dem Flur, und Isabelle fuhr herum. Das Messer entglitt ihren Fingern, als sie mit beiden Händen nach dem Türgriff griff.
Wieder ertönte das Kratzen. Sie umklammerte den Griff und begann ihn zu drehen. Die Präsenz war direkt hinter ihr. Isabelle öffnete den Mund, um zu schreien, doch kein Laut kam über ihre Lippen.
Eine Hand schloss sich um ihren Hals, die andere presste sich auf ihren Mund und erstickte jeden Schrei im Keim.
Mit vor Entsetzen geweiteten Augen sah sie, wie die Tür vor ihr in die Ferne rückte. Ihre Absätze kratzten über den Holzboden, als sie verzweifelt versuchte, sich aus dem eisernen Griff zu befreien.
KAPITEL EINS
"Ich bin gleich da, Papa", sagte Cooper, während er den Mietwagen über die von Schlaglöchern ��bersäte Straße lenkte, die vom Highway in die Kleinstadt führte.
"Wenn du etwas findest, möchte ich, dass du zurückkommst und es mir persönlich sagst", erwiderte Archibald Trace.
Cooper schwieg für einen Moment. "Ich werde dich auf jeden Fall anrufen. Was ich dann mache, hängt davon ab, was ich herausfinde. Wenn es mich woandershin führt, werde ich dem nachgehen. Trotzdem muss ich nach Seattle zurück."
"Du willst immer noch dorthin zurück?"
"Ich muss."
"Nein, musst du nicht", protestierte Archibald. "Du bist krank, Cooper. Du solltest hierher zurückkommen, damit ich mich um dich kümmern kann."
"Ich bin nicht krank, Papa." Der ganze Wagen wurde durchgeschüttelt, als er ein unvermeidbares Schlagloch in der Straßenmitte traf. "Ich habe eine degenerative Erkrankung, die sich langsam verschlimmern wird, aber im Moment geht es mir gut, und ich habe einen Job zu erledigen."
"Ja, und ich weiß, wann du lügst. Schon als kleiner Junge hast du immer so getan, als wärst du nicht verletzt, wenn du vom Pferd oder vom Fahrrad gefallen bist. Du bist sofort wieder aufgestanden und hast weitergemacht. Du hast die Zähne zusammengebissen, als wäre nichts passiert."
Cooper verlangsamte das Tempo und setzte den Blinker, bevor er abbog. "Ach ja? Beiße ich gerade die Zähne zusammen?"
Er passierte das Ortsschild von Linnenville.
"Nein, aber ich habe den Blick in deinen Augen gesehen", fuhr sein Vater fort. "Ich weiß, dass du die Sache herunterspielst, und ich bete zu Gott, dass du es nicht so sehr herunterspielst, wie ich befürchte. Halluzinationen! Migräne! Ohnmachtsanfälle! Funktionsverlust der Gliedmaßen! Gedächtnisverlust! Wie willst du deinen Job machen, wenn du mit all dem zu kämpfen hast?"
"Ich kenne diese Symptome, Papa. Ich habe dir alles gesagt, was im Laufe der Zeit passieren kann. Es ist nicht so, dass ich ständig halluziniere oder mich an nichts erinnern kann. Ich habe gerade fünf Tage mit dir verbracht. Musstest du dich die ganze Zeit um mich kümmern?"
"Ich möchte nur, dass du vorsichtig bist", sagte Archibald.
"Ich weiß, Papa, und ich schätze das."
Es hatte ihn viel Überwindung gekostet, seinem Vater von seiner Lindof-Syndrom-Diagnose zu erzählen, und sein Vater hatte Recht damit, dass es sich auf seine Arbeit beim FBI auswirkte. Aber sich das einzugestehen, würde bedeuten zuzugeben, dass er nicht mehr fähig war. Er hatte vor nicht einmal zwei Wochen einen Mörder überführt. Wenn er nicht in der Lage gewesen wäre, seinen Job zu machen, hätte er ihn nicht festnehmen und dabei eine Frau retten können.
"Papa, ich werde nicht zu dir ziehen. Du brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Wenn überhaupt, dann sollte ich derjenige sein, der sich um dich kümmert. Wenn du also wirklich willst, dass ich zurückkomme und auf der Ranch bleibe, dann heißt das, dass du nicht mehr alleine zurechtkommst. Ist es das, was du willst?"
"Komm mir nicht mit deinem psychologischen Kram. Ich bin zwar ein Rancher, aber irgendwoher musst du ja deine Intelligenz haben. Ich komme ganz gut alleine zurecht."
"Das kann ich auch", sagte Cooper. Er hielt den Wagen an der ersten Hauptstraße an, die er erreichte, und sah auf der Karte seines Handys nach. Die Stadt hatte auf der Karte klein ausgesehen, aber jetzt, wo er hier war, wirkte sie sehr ausgedehnt.
"Es war schön, dich zu sehen, Coop."
"Ja, es war auch schön, dich zu sehen, Papa. Hör zu, ich bin gleich da, also sollte ich jetzt Schluss machen, aber ich schicke dir eine Nachricht oder rufe dich an, wenn ich fertig bin, und lasse dich wissen, wie es steht."
Am anderen Ende der Leitung war ein leises, kaum hörbares Geräusch zu vernehmen. Archibald räusperte sich danach. "Ich habe alle Phasen der Trauer durchlebt und war darüber hinweg, dann wusste ich, dass sie da draußen ist, und jetzt weiß ich wieder, dass sie weg ist. Es ist schon so lange her, Coop. Ich weiß, dass sie, wo auch immer sie ist - ob auf der Erde oder im Himmel - stolz auf das wäre, was du tust. Sie hat immer zu dir aufgeschaut, und du hattest eine Art mit ihr umzugehen, die ich nie hatte. Ich weiß, dass ich dich nicht darum bitten kann, aber ich hoffe, du kannst herausfinden, was mit Alison passiert ist. Deine Schwester hat das nicht verdient."
"Nein, hat sie nicht", gab Cooper zu. Er wollte etwas sagen, das seinem Vater Hoffnung geben würde, aber es wäre fast grausam gewesen. Er konnte ihm keine Hoffnung machen, nachdem sie über vierundzwanzig lange Jahre langsam versickert war. "Ich rufe dich an, wenn ich fertig bin", sagte Cooper.
"Okay. Ich hab dich lieb."
"Ich hab dich auch lieb, Papa."
Cooper legte auf und nahm sich einen Moment Zeit. Sein Verhältnis zu seinem Vater war schon immer angespannt gewesen, und es fühlte sich immer noch seltsam an, so offen und liebevoll mit ihm zu sprechen. Sie hatten noch einen weiten Weg vor sich, aber die drei Tage, die sie miteinander verbracht hatten, waren gut gewesen. Er tippte auf den Knopf auf seiner Karte, um sich den Rest des Weges anzeigen zu lassen, und fuhr weiter.
Die Stadt war nicht besonders alt, aber die meisten Gebäude entlang der Hauptstraßen waren entweder so umgebaut worden, dass sie wie Gebäude aus dem Wilden Westen aussahen, oder man hatte ihnen entsprechende Fassaden verpasst.
Cooper bog in eine der Seitenstraßen ein und fuhr ein kurzes Stück, bevor er eine Meile lang ziellos durch die Gegend kurvte. Schließlich hielt er vor einem der älteren Häuser der Stadt.
Das Erdgeschoss lag halb unter der Erde - offensichtlich gab es einen Keller. Cooper war kein Mann voreiliger Schlüsse, und er rechnete nicht damit, seine Schwester in einem Keller gefangen vorzufinden, aber ausschließen konnte er es auch nicht.
Er stieg aus seinem Wagen und durchquerte die Lücke, wo eigentlich ein Tor hätte sein sollen. Während er den schiefen Weg zum Haus hinaufging, musterte er das Gebäude genau. Die Vorhänge im Erdgeschoss waren zugezogen, und die Kellerfenster von innen mit Brettern vernagelt.
Die Luft war schwül, obwohl es nicht besonders heiß war. Cooper spürte, wie sein Herz schneller schlug, als er die Haustür erreichte und klopfte.
Von drinnen ertönte ein schlurfendes Geräusch, dann herrschte Stille. Cooper legte seine Hand auf die Tür und konnte den Mann auf der anderen Seite förmlich spüren.
"Special Agent Cooper Trace", rief er laut.
Wieder Stille, dann bewegte sich die Tür leicht, als der Riegel zurückgeschoben wurde. Die Tür öffnete sich, und Cooper stand dem Mann von den Fotos gegenüber. Es mochten über zwanzig Jahre vergangen sein, aber er war sich sicher, dass er es war - das Gesicht hatte sich in sein Gehirn eingebrannt.
"Devon Barlow?", fragte Cooper.
"Äh, ja", antwortete Devon.
Cooper hielt dem Blick des Mannes stand und suchte nach dem kleinsten Anzeichen, das darauf hindeuten könnte, dass er etwas zu verbergen hatte.
Cooper zückte seinen Ausweis und zeigte ihn Devon. "Darf ich reinkommen?"
"Äh, ja, klar." Devon blickte über seine Schulter ins Haus, bevor er sich wieder umdrehte. "Worum geht's denn?"
"Darüber würde ich lieber drinnen reden", erwiderte Cooper.
Devon schaute erneut zurück. "Tja, ich weiß nicht so recht. Vielleicht kommst du ein andermal wieder."
"Nein, ich möchte jetzt mit dir sprechen." Coopers Herz raste bei diesem Widerstand, und er spürte ein Kribbeln im Nacken. Er rieb sich den Hinterkopf und starrte Devon an.
"Na schön, komm rein", gab Devon nach. Er trat von der Tür zurück, drehte sich aber nicht um.
Cooper trat ein und schloss die Tür hinter sich. Die schwüle Luft von draußen drang ins Haus. Als Devon sich umdrehte und Richtung Wohnzimmer ging, folgte Cooper ihm. Es fühlte sich an, als würde er durch Wasser waten. Er nahm das Haus in sich auf, während er hindurchging.
Abblätternde Tapeten mit großen Blasen, die lange weiße Streifen durch das verblasste Blau zogen. Bilder, die wie nachträglich an die Flurwand genagelt wirkten. An der Wand stapelten sich Kisten, aus denen Fotos und Dokumente quollen. Das Wohnzimmer war nicht viel besser. Sofa und Sessel waren so ausgeblichen, dass ihre ursprüngliche Farbe kaum noch zu erkennen war. Staub bedeckte alle Oberflächen, die nicht mit Büchern oder Krimskrams vollgestellt waren.
"Ich könnte einen Kaffee kochen", bot Devon an.
"Das wird nicht nötig sein", lehnte Cooper ab.
Devon wirkte unschlüssig und wollte offensichtlich am liebsten ganz woanders sein. Cooper nahm sich einen Moment Zeit, bevor er mit dem Verhör begann. Er wollte, dass Devon den Ernst der Lage begriff, ohne dass ein Wort gesagt wurde.
"Setz dich", befahl Cooper.
Devon gehorchte sofort. Er ließ sich in einen der Sessel sinken und sah zu Cooper auf.
Cooper holte die beiden Fotos aus seiner Tasche und zeigte sie Devon.
"Das bist du", stellte Cooper fest. Es war keine Frage.
Devon nickte. Auf den beiden Fotos war er viel jünger, aber die Gesichtszüge waren dieselben, vor allem die Augen. Devon war jetzt hagerer, älter, abgerissener und gezeichneter als der junge Mann mit dem scharfen Blick auf den Fotos.
"Kennst du dieses Mädchen?", fragte Cooper. Er tippte auf Alison, seine Schwester, auf beiden Fotos.
Devon rutschte auf seinem Sitz nach vorn, und Cooper reichte ihm die Fotos. Devon studierte sie, bestätigte oder leugnete aber nicht, sie zu kennen.
"Sie ist vor vierundzwanzig Jahren verschwunden", erklärte Cooper. "Spurlos verschwunden, und du warst einer der Letzten, die sie gesehen haben. Du warst ein Fremder in unserer Stadt. Was hattest du in Bellamy zu suchen?"
"Bellamy? Ach ja", murmelte Devon. Er rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her.
Coopers Herz schlug noch schneller, und er versuchte, sich unter Kontrolle zu halten. Er spürte, wie ihn die Taubheit überkam, während er auf neue Erkenntnisse in diesem Fall wartete. Er fühlte, wie sie über ihm schwebten wie Schnee auf einem Berggipfel. Es brauchte nur einen Auslöser, und die Informationen würden wie eine Lawine über ihn hereinbrechen.
"Was hattest du in Bellamy zu suchen?", wiederholte Cooper und bemühte sich, ruhig zu bleiben.
Er wollte Devon nicht bedrängen; das war nicht der richtige Weg, um mit ihm umzugehen.
"Es ist ... lange her, aber ich erinnere mich an diese Stadt." In Devons Stimme lag ein leichtes Zittern. "Ich war für ein paar Tage dort."
"Wozu?", hakte Cooper nach.
Devon legte die Fotos auf die Armlehne des Sessels und hob die Hände, als wolle er sich ergeben. "Ich kann dir alles erzählen. Ich brauche nur ein Glas Wasser. Ich will keinen Ärger, okay?"
Cooper konnte selbst eine Pause gebrauchen. Sein Herz raste in seiner Brust, und sein Atem ging flach. Das taube Gefühl in seinem Kopf war einem dumpfen Pochen gewichen, das im Rhythmus seines Herzschlags pulsierte.
"Ja, etwas Wasser wäre gut", sagte Cooper.
Er ließ sich in den anderen Sessel sinken, als Devon aufstand. Cooper beobachtete, wie er in die Küche ging, und kämpfte darum, seine Atmung unter Kontrolle zu bringen.
Nicht jetzt. Nicht, wenn ich endlich eine Spur habe.
Das Lindof-Syndrom wehrte sich gegen ihn und versuchte, ihn zu schwächen, während die Aufregung und der Stress der neuen Informationen über ihn hereinbrachen. Cooper blickte auf und sah Devon in der Tür stehen, der ihn ausdruckslos anstarrte.
"Was ist los?" fragte Cooper.
Devon stand wie versteinert da und starrte Cooper unverwandt an.
"Was zum Teufel soll das?" rief Cooper, als die Taubheit in seinem Kopf zu einem stechenden Schmerz wurde.
Devon rührte sich nicht. Er stand wie eine Statue.
Cooper stand auf, und die Welt um ihn herum begann sich zu drehen. Mit einem Ächzen fiel er zurück auf den Stuhl. Er sah zu Devon hinüber - der Mann war da, dann verschwunden, dann wieder da. Cooper rieb sich die Augen, unsicher, was real war und was er sich einbildete. Er starrte Devon an, als er erneut aufstand, sich mit beiden Händen abstützte und sich am Stuhl festhielt, um das Gleichgewicht zu bewahren. Er blickte in Devons leblose Augen.
In Coopers Kopf tobte ein Kampf. Ein Teil seines Gehirns wurde von dem Syndrom angegriffen, das seine körperlichen Funktionen lähmte, ihm seine Erinnerungen raubte und Halluzinationen hervorrief. Der andere Teil, die verbliebenen logischen Funktionen, wusste, dass etwas nicht stimmte. Als er in Devons leblose Augen starrte, wurde ihm klar, dass der Mann nicht wirklich da war.
Als hätte man den anderen Teil seines Gehirns entdeckt, durchzuckte ihn ein scharfer Schmerz, und Devon verschwand.
Cooper befahl seinen Beinen zu rennen, um den Mann zu verfolgen, doch sie verwandelten sich in Wackelpudding, als er zu Boden sank.
KAPITEL ZWEI
Mit einem Ruck öffnete Cooper die Augen und brauchte einen Moment, um sich zu orientieren. Er wusste nicht, wie lange er bewusstlos gewesen war – oder ob er überhaupt das Bewusstsein verloren hatte.
Devon Barlow.
Der Name schoss ihm durch den Kopf. Er befand sich in Devons Haus, und der Mann wollte ihm gerade erzählen, was er in Bellamy machte, als seine Schwester verschwand.
Es fühlte sich an, als hätte jemand einen glühenden Schürhaken in sein Gehirn gestoßen, doch der extreme Schmerz ließ allmählich nach und verwandelte sich in ein dumpfes Pochen, als hätte man ihn mit einem Hammer geschlagen. Cooper zwang sich auf die Beine, die diesmal standhielten. Er hatte keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, aber sein innerer Zeitgeber sagte ihm, dass es nicht lange her sein konnte.
Taumelnd ging Cooper durch die Tür, in der er die Vision von Devon gehabt hatte, und betrat die Küche. Diese Vision von jemand anderem war neu für ihn, besonders von jemandem, den er gerade erst kennengelernt hatte. Normalerweise wurde er von Visionen seiner Schwester heimgesucht.
In der Küche herrschte das reinste Chaos: Teller und Tassen türmten sich in der Spüle und auf den Arbeitsflächen. Von irgendwoher – vielleicht von überall – kam ein modriger Geruch.
Eine Hintertür stand leicht offen. Cooper stürzte darauf zu, riss sie auf und sprang die zwei Stufen hinunter. Mit Mühe gelang es ihm, auf dem weichen Gras das Gleichgewicht zu halten. Seine Sinne waren noch nicht ganz beisammen, kehrten aber langsam zurück. Er ließ den Blick über den Rasen schweifen, bis zu den kleinen Büschen, die den hinteren Teil des Gartens begrenzten – dahinter erstreckte sich ein weites Feld mit gelbem Raps.
Von Devon war keine Spur zu sehen.
Cooper rieb sich mit dem Handballen über das Auge, als dahinter ein Schmerz aufflammte. Frustriert stieß er einen Seufzer aus und kickte gegen einen kleinen Stein im Gras.
Reiß dich zusammen! Mach deinen Job!
Hastig zog Cooper sein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer der örtlichen Polizei. Er gab ihnen Devons Adresse durch und wies sie an, eine Fahndung nach Devon Barlow herauszugeben.
Kaum hatte er aufgelegt, rannte er zurück ins Haus. Schnell durchsuchte er das Erdgeschoss, für den Fall, dass Devon sich noch im Haus befand. Er fand nichts außer noch mehr Unordnung.
Cooper hielt den Atem an, als er die Tür zum Keller entdeckte. Er streckte die Hand aus und drehte den Knauf. Devon wusste etwas, und er war aus einem bestimmten Grund geflohen. Er hatte etwas zu verbergen, aber war in seinem Haus auch etwas versteckt?
Die Tür schwang nach außen auf und gab den Blick auf eine Treppe frei, die in einen stockdunklen Keller führte. Cooper fand den Lichtschalter an der Wand zu seiner Linken und betätigte ihn. Das Licht von unten war grell. Cooper wartete einen Moment und lauschte aufmerksam nach einem Lebenszeichen.
Er machte den ersten Schritt und betete, dass er nicht die Leiche seiner Schwester in den Tiefen des Kellers finden würde. Er machte einen weiteren vorsichtigen Schritt und horchte – jedes Geräusch würde auf Leben hindeuten.
Noch eine Stufe, und noch eine. Als er fast am Fuß der Treppe angelangt war, bückte er sich, um einen besseren Blick in den Keller zu werfen. Es war überraschend ordentlich und aufgeräumt. Reihen von Regalen standen dort, gefüllt mit verschiedenen Gegenständen und Habseligkeiten, die in durchsichtigen Plastikbehältern verstaut waren. Der Keller stand in krassem Gegensatz zu dem chaotischen Haus darüber.
Cooper betrat den Betonboden und überlegte, ob er seine Waffe ziehen sollte. Er tat es nicht, war aber bereit dazu, falls Devon beschlossen hatte, sich dort unten zu verstecken und ihn anzugreifen. Der Schmerz in seinem Kopf war nicht mehr so heftig wie zuvor, aber er wogte immer noch wie eine Welle hin und her.
Cooper drehte sich um, um hinter der Treppe nachzusehen, und ließ seinen Blick durch den gesamten Keller schweifen, auf der Suche nach möglichen Gefahren. Es gab keine.
Er begann, den Keller nach Verstecken zu durchsuchen, nach anderen Lebenszeichen als Devon Barlow. Seine Frustration wuchs, als er nichts fand. Er konnte nicht alles durchsuchen, aber es sah so aus, als wären nur Devons Habseligkeiten sicher verstaut. Er rieb sich die Stirn, als ihm klar wurde, dass seine Schwester oder irgendeine Spur von ihr nicht hier unten waren.
Plötzlich ertönte ein Knarren von oben, und Cooper machte sich auf den Weg zur Treppe. Er nahm immer zwei Stufen auf einmal, bereit, Devon zur Rede zu stellen. Er stürmte ins Erdgeschoss und prallte fast mit dem Mann zusammen, als er durch die sich schließende Kellertür stieß.
Der Mann griff nach seiner Waffe.
Cooper hob sofort die Hände. "Special Agent Cooper Trace! Ich habe den Vorfall gemeldet. Ich dachte, er wäre zurückgekommen."
"Officer Whyte", stellte sich der Mann vor und entspannte sich sichtlich. "Kann ich einen Ausweis sehen?"
Cooper kam der Aufforderung nach und bedankte sich bei dem Beamten.
"Was können wir für Sie tun?", fragte Officer Whyte.
"Ich möchte, dass das Haus abgeriegelt und gründlich durchsucht wird - insbesondere der Keller. Ich will über jedes Detail informiert werden, das sich dort unten befindet. Alles, was mit Alison Trace, der Stadt Bellamy oder irgendwelchen kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Devon Barlow steht, ist von Interesse. Selbst wenn etwas auf den ersten Blick unbedeutend erscheint, aber irgendwie fehl am Platz wirkt, möchte ich davon wissen. Außerdem würde ich gerne mit seinen Nachbarn, Freunden und Familienangehörigen sprechen. Ich will alles über Devon Barlow in Erfahrung bringen und herausfinden, wohin er verschwunden sein könnte. Kurz gesagt: Devon Barlow muss gefunden werden."
***
Cooper warf seine Schlüssel auf das kleine Sideboard neben der Tür und ließ seinen Blick durch die Wohnung schweifen. Es fühlte sich an, als wäre er eine Ewigkeit fort gewesen, obwohl es gerade mal etwas mehr als eine Woche her war. Er streifte seine Jacke ab, hängte sie an die Garderobe und kickte seine Schuhe achtlos auf die Fußmatte.
Mit schweren Schritten durchquerte er den Raum und trat ans Fenster auf der gegenüberliegenden Seite. Sein Blick fiel auf die Skyline von Seattle. Diese Stadt war zu seiner Heimat geworden, auch wenn er nicht hier aufgewachsen war. Mit achtzehn hatte er das Leben auf der Ranch gegen das Großstadtleben eingetauscht.
Cooper ließ sich in den Sessel fallen, der in der Nähe des Fensters stand und dieselbe Aussicht bot, wenn auch aus einer etwas tieferen Perspektive. Er hatte ein paar Souvenirs von seiner Reise nach Tennessee mitgebracht.
Eines davon war ein Fehlschlag. Er war so nah dran gewesen, endlich herauszufinden, was mit seiner Schwester geschehen war, und hatte die einzige Verbindung durch seine Finger gleiten lassen. Er wusste, dass es an seiner Diagnose lag, aber das machte es nicht leichter zu ertragen. Er war der ersten echten Spur seit Jahren gefolgt und stand nun mit leeren Händen da.
Ein Team durchkämmte gerade das Haus, hatte bisher aber noch nichts Nennenswertes gefunden. Es würde eine Weile dauern, alles zu durchsuchen, zu katalogisieren und dann Fotos an Cooper zu schicken. Vielleicht würde ihm etwas auffallen, das sie übersehen hatten. Devon Barlow war immer noch auf freiem Fuß, aber nach dem, was Cooper aus ihrer kurzen Begegnung über den Mann wusste, war er sich sicher, dass Devon früher oder später gefasst werden würde.
Eine weitere Sache, die er aus Tennessee mitgebracht hatte, waren hartnäckige Kopfschmerzen. Sie waren zwar nicht so lähmend wie die Migräneattacken, die er manchmal bekam, aber sie waren ständig präsent. Ein dumpfes Pochen in seinem Hinterkopf, das ihn unablässig quälte.
Cooper hatte seine Nachrichten seit seiner Abwesenheit ignoriert. Jetzt holte er sein Handy hervor und wählte die Nummer seiner Mailbox. Es gab keine verpassten Anrufe vom FBI-Büro oder von Sloane, mit dem er während seiner Abwesenheit ein paar Mal gesprochen hatte.
Eine Voicemail-Nachricht weckte jedoch sein Interesse.
"Cooper, hier ist Dr. Reed. Ich habe immer noch Kontakte in der medizinischen Gemeinschaft, und es gibt derzeit ein paar experimentelle Verfahren, die für kognitive Störungen erforscht werden. Falls Sie interessiert sind, könnte ich Ihre Daten weitergeben, aber ich möchte im Gegenzug Zugang zu den Ergebnissen haben. Ich habe Ihnen eine E-Mail mit weiteren Informationen geschickt."
Cooper beendete den Anruf, ohne sich die anderen Nachrichten anzuhören. Sofort holte er seinen Laptop aus der Tasche und schaltete ihn ein.
Dr. Reed war in seinem vorherigen Fall ein Hauptverdächtiger gewesen, und es hatte einen Moment gegeben, in dem Cooper dachte, Martin Reed sei ein Serienmörder. Das hatte sich zwar als falsch herausgestellt, aber Cooper vertraute dem Mann trotzdem nicht vollständig. Nur die Aussicht auf eine mögliche Heilung hatte ihn dazu bewogen, sich von Dr. Reed untersuchen zu lassen. Bisher hatte das lediglich bedeutet, dass er dem Arzt, der mit der medizinischen Gemeinschaft zusammenarbeitete, Blutproben zur Verfügung stellte und seine Symptome schilderte.
Cooper las die lange E-Mail und klickte dann auf die Links zu mehreren medizinischen Webseiten. Während er die Seiten durchforstete, schweiften seine Gedanken immer wieder zu Devons Haus ab. Es war nicht das erste Mal, dass er so abgelenkt war, und es würde sicher auch nicht das letzte Mal sein. Er hatte sich fast von dem Moment an, als Dr. Reed die experimentellen Verfahren in der Voicemail erwähnte, eine Meinung dazu gebildet. Am Ende der E-Mail war er sich völlig im Klaren darüber. Die Webseiten las er nur noch durch, um genau zu wissen, worauf er sich einlassen würde.
Cooper spürte, wie sein Herz wieder schneller schlug, aber diesmal aus einem anderen Grund als zuvor. Er wusste, dass es keine Garantien gab, aber er wurde zunehmend verzweifelter. Wenn es auch nur die geringste Chance gab, würde er sie ergreifen.
"Was bin ich bereit zu riskieren, um endlich Gewissheit zu erlangen?", fragte er sich leise.
Cooper scrollte durch seine Kontakte, bis er die Nummer seines ehemaligen Mentors und guten Freundes Dr. Charles Richards fand. Er tippte auf den Anrufknopf.
"Hey, Cooper", meldete sich Charles. "Bist du immer noch in Tennessee?"
"Bin gerade zurück. Du, sag mal, was weißt du über mesenchymale Stammzellen und induzierte pluripotente Stammzellen?"