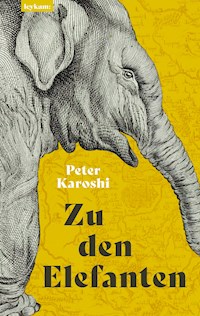
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zu sich selbst – auf einer Route voller Geschichten und Erinnerungen. Ein diffuser Schwebezustand hat sich in Theos Leben festgesetzt und der Kulturwissenschaftler fragt sich, ob es sich dabei um einen Übergang oder endgültigen Stillstand handelt. Sollte das Ziel ein geglücktes Leben sein, wird er die Beziehung zu Anna, seiner Frau, und seinem Sohn Moritz ändern müssen. Da könnte es sich anbieten, eine Vater-Sohn-Reise zu machen, entlang des Wegs, auf dem der spätere Kaiser Maximilian II. den Elefanten Soliman vor Jahrhunderten vom Mittelmeer nach Wien brachte. So soll es auf der gleichen Route, dieses Mal in umgekehrter Richtung, von Österreich über Südtirol bis nach Genua gehen. Doch schnell steht das seltsame Gespann vor großen Problemen. Scheinbar in sich selbst verloren und an der Gegenwart verzweifelnd, erzählt Theo in Tagebuchform von einer Reise in das Wissen, dass es die Vergangenheit, Erinnerungen und das Gedächtnis sind, die die Gegenwart tragen. Eine Reise, die eine dramatische Wendung nimmt und durch die der Erzähler erkennt, dass ein Leben ein langer Fluss aus Erklärungs- und Beobachtungsversuchen ist und man sich zuerst verlieren muss, wenn man zueinander finden will. Eine Novelle, die in ihrer Mischung aus Präzision und traumwandlerischen Atmosphäre den Ton von Musils "Drei Frauen" in die Gegenwart übersetzt. Bernd Melichar, Kleinen Zeitung: "Ein vorsichtiges Alter für beide – vierzig und neun. Mitten im Leben hinterfragt der Vater den "Bauplan des Lebens" und macht sich mit seinem Sohn auf zu einer gemeinsamen Reise. Der Historiker und Schriftsteller Peter Karoshi hat daraus – und diese Gefahr ist immanent bei diesem Thema – kein gezwungen cooles "On The Road" gemacht, sondern eine ehrliche Selbsterkundung, die unter anderem zu folgender Erkenntnis führt: Das Leben lässt sich in keinem Wikipedia-Eintrag zusammenfassen. Wer mehr darüber erfahren will, muss sich auf die Reise machen. So, wie Peter Karoshi das gemacht hat. Seine Figuren ruhen nicht in sich, seine unaufgeregte Sprache tut es schon. Und dass das titeltragende Tier ein Elefant ist, hat nicht nur historische Hintergründe. Dem Elefanten wird ja bekanntlich ein sehr gutes Gedächtnis nachgesagt. Darüber verfügt auch der Mensch – wenn er sich daran erinnert."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Einst kam ein großer Elefant von Süden her in unser Land. In dieses Haus da kehrt er ein und aß und trank viel guten Wein. Gesättigt froh und heiter zog er dann wieder weiter. Also geschehen anno domini 1551
Hotel Elefant, Auer in Südtirol
But these are scientific books, and science only deals with surfaces; it has nothing to do with realities – it is impertinent if it attempts to do with realities … A learned man said to me a few weeks ago: »When I have to choose between the evidence of tradition and the evidence of a document, I always believe the evidence of tradition. Documents may be falsified, and often are falsified; tradition is never falsified.«
The Terror, Arthur Machen
Montag, 2. Juli
Ich bin Theo, und alles was gekommen ist, ich habe es einfach immer angenommen. Das kommt mir manchmal so vor. Eine Eigenschaft, die eine Analyse dessen, was einem geschieht, nicht ausschließt, ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich dient dieses Tagebuch einer Reise trotz allem Verstehenwollen also auch der Untersuchung und Sammlung, was vielleicht gar nicht geändert werden kann. Deshalb dachte ich damals schon bei unserer Ankunft im Salzburger Lungau, dass das Dorf Sonnseit ein seltsamer Ort ist. Seit Stunden, seit Wien, um genau zu sein, hatte es geregnet. Sonnseit ist kein guter Ort, um die gesamten Sommerferien zu verbringen. Die Aussicht auf zwei Monate mit Anna, meiner Frau, und meinem Sohn Moritz allein in erschreckender Abgeschiedenheit war wenig erfreulich. Dementsprechend schlecht war meine Laune. Aber gut, auch das war ein wiederkehrender Moment der Angst, wenn man nur einmal nach der vierstündigen Autofahrt angekommen war.
Das Dorf ist über eine einzige Straße zu erreichen. Zuerst in engen Serpentinen durch den Wald herauf und dann das letzte Stück auf der Höhe zwischen Wiesen, teilt sich Sonnseit in einen Hauptort mit vielleicht fünfzehn Häusern, ehemalige Bauernhöfe und ein Gasthof, der seit drei Jahren geschlossen hat, danach senkt es sich in einen kleinen Talkessel, der am Fuße einer Bergkette endet. Unter dem linken, niedrigsten Gipfel, am Ende der asphaltierten Straße liegt, immer in Sichtweite des höchsten, rechten Gipfels, unser Haus, eng gedrückt an drei weitere Einfamilienhäuser, die wohl alle im gleichen Zeitraum errichtet worden sind. Auf dem Weg durch den Kessel hierher liegen noch vier weitere, wesentlich ältere Häuser.
Dass Moritz und ich dann schon nach etwas mehr als zwei Wochen allein von diesem Ort aufbrechen würden, war zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar.
Am frühen Abend dieses ersten Tages regnete es nur mehr leicht, der Wind in den Blättern der Hecken am Bachrand hatte das Rauschen des Regens abgelöst, ich überlegte mir erste Schritte in Richtung einer vorsichtigen Versöhnung mit Anna, als die Sonne noch einmal durch die Wolkendecke kam. Der Garten wurde von einem freundlichen Licht erwärmt und ich dachte mir, dass das ein gutes Zeichen dafür war, dass die Dinge selbst immer auf den für sie richtigen Moment zur Lösung, zum Weitermachen warten. Über die nasse Rasenfläche, auf der linken Seite von Sträuchern und der Straße, auf der anderen von einer zusehends verwilderten Fläche zum Wald hin begrenzt, hüpfte eine Bachstelze. Ich konzentrierte mich unvermittelt auf diese wenigen Sekunden, als der Vogel hurtig zu laufen schien. Vielleicht hatte der Regen die üblichen Würmer aus der Erde gelockt oder Käfer unbeweglich im Gras zurückgelassen. Was auch immer es war, was der Vogel suchte, er schien es in der ersten Eile nicht vorzufinden. Konnte er etwas übersehen haben? Ich starrte das Tier verdutzt an. So viele Sommerferien hatten wir schon in Sonnseit verbracht und nie waren mir diese Vögel als besonders aufgefallen. Hatte sich meine Aufmerksamkeit oder ihr Verhalten geändert? Wollte ich dem Tier helfen?
Noch schneller schien die Bachstelze durch die nasse Wiese zu laufen, ohne Plan und mit einem mir nicht bekannten Ziel. Die langen Schwanzfedern wippten zum Hüpfen des restlichen, so fragil scheinenden, Körpers. Wieder schoss der kleine, graue und blaue Pfeil nach vorne und der Schwanz hatte eine Extratour einlegen wollen, wurde beinahe mitgerissen. Der Rhythmus war mir ein Rätsel, ich verstand nichts von dem, was ich beobachtete. Es war, als würde ich ein aus dem Ruder gelaufenes Arbeitsvorhaben aus der Ferne zur Analyse vorgelegt bekommen. Der Vogel zeigte beinahe menschliche Züge in seiner Eile und Aufregung. Ich stand auf, um meine Anwesenheit zu zeigen, das Tier zu vertreiben aus seinem Unglück, so sehr rührte es mich. Eine Emsigkeit, ein großer Eifer trieb die grazile Gestalt an, die freundlichen Farben des Wassers in seinen Federn passten in Wirklichkeit zum Regenwetter. Vielleicht, dachte ich, bedarf der Vogel meiner Hilfe, weil ich hier stehe und verfügbar wäre, auf der anderen Seite war das natürlich mehr noch als eine Anmaßung, eine Blödsinnigkeit, ein Sich-Einmischen in Dinge, die einen nichts angehen.
Die Bachstelze ist ein sonderbares Tier, dachte ich da, wie sie mich anzustoßen scheint, mich mit mir zu beschäftigen, ganz so als würde sich alles hier nur um mich drehen. Ich befragte mich damals mehr und mehr nach meinem Lebensmittelpunkt, genauso wie es mir als naturgemäß von Älteren angekündigt worden war. (Damals hatte ich darüber gelacht, über die Freunde und ihre zweifelnden Vorstellungen, was ihre Leben anging.) Da beendete der Vogel vorläufig seine Reise durch den Garten und flog rasend schnell in ungelenk scheinenden Bewegungen in Richtung der Sträucher an der Straße. Der Zickzackkurs entsprach dabei der sympathischen, aber bemitleidenswerten Planlosigkeit von vorhin.
Ich war in der Lage, meine Gefühle einzuordnen, weil ich viel gelesen und gehört hatte in meinem Leben, und ich wusste um den Moment der Begeisterung und den Sturm, den er entfachen konnte, und genau deshalb verfiel ich keiner dieser Illusionen, um etwa sofortige Schlüsse und ernste Konsequenzen zu ziehen. Nein, ganz im Gegenteil, dort im Zwielicht des untergehenden Tages fand etwas statt, das ich nicht erklären konnte. Das bestätigte mich sehr, dahinter etwas Bedeutsames zu erahnen.
Ich hörte den Boden im Haus hinter mir knarren. Als ich ansetzte, um mich für meine Worte von davor bei ihr zu entschuldigen, kam stattdessen Moritz durch die Tür. Er nahm einen Anlauf, stürmte auf mich zu und versuchte mich niederzureißen. Ich hielt ihn lachend und nur mühsam auf, und er stellte sich neben mich und sah ebenso bedeutsam in den Garten. Ich legte eine Hand auf seine Schulter. Mit neun Jahren ist einem das Kind bereits entwachsen, und umso freundlicher drückte ich ihn, immer im Versuch, ihm nicht weh zu tun. Ein vorsichtiges Alter für uns beide, dachte ich, vierzig und neun.
»Warum bist du nicht drin?«, fragte er.
»Ich habe einem Vogel zugesehen.«
Doch da interessierte es ihn offenbar schon nicht mehr so besonders. Auf keinen Fall wollte ich ihn belehren, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Diese neun Jahre sind eine Grenze, ein Alter des Übertritts, mein Sohn hörte sich meine Gedanken über die Bachstelze und mein Erlebnis mit ihr an und betrachtete mich freundlich von unten.
Na ja, dachte ich da, es lässt sich auch nichts mehr festmachen, alles bleibt unbestimmt und im Vagen. Mehr als Gefühle ließen sich bei diesem seltsamen Erlebnis nicht ausmachen. Ich mutete mir zu viel zu. Was in der Erinnerung greifbar bleibt, sind solche wie ich, die einen dann von oben herab belehren. Darauf hätte ich früher einmal auch verzichtet.
»Habt ihr euch gestritten?«, erinnerte er mich. »Ihr solltet das nicht machen.«
Dieses sympathische Selbstbewusstsein, das ich sehr bewundere. Ich nickte. »Aber nicht wirklich gestritten. Eine Meinungsverschiedenheit eher.«
Das kannte er von uns, und so nickte auch er wissend und ich ging mit ihm hinein und entschuldigte mich nicht, denn es war nicht mehr nötig, weil wir uns gut verstanden und über andere Dinge zu reden begannen, ich den Vogel vergaß, und was mir mit ihm durch den Kopf gegangen war. In dieser Nacht, kurz vor dem Einschlafen, fiel mir die Begegnung mit der Bachstelze noch einmal ein. Als hätte ich mit den Fingern geschnippt, so stark war das Bild wieder da und ich erinnerte mich an meine Jugend, die sich unendlich vergangen anfühlte. Da dachte ich noch einmal über meine jetzige Lage nach. Dass ich mir früher beim Einschlafen ausgemalt hatte, was ich Großes vollbringen und welche Menschen ich damit letztlich beeindrucken wollte. Es kam mir so vor, als hätte das alles im Alter von neun Jahren begonnen, und als ich selbst ein Vater geworden war, hatte es aufgehört, das Hinlegen zum Schlafen war ein sofortiges Einschlafen geworden, so sehr ich mich auch noch daran geklammert hatte, wenigstens im Wegdämmern hinein in die Nacht Wunder zu vollbringen. Ich war erwachsen und alles war ein rasender Strudel geworden. Ständig kehrte ich an die gleichen Stellen zurück, die ich doch gerade vor kurzem erst verlassen geglaubt hatte: das Aufstehen, die Mahlzeiten, der Stillstand in der Arbeit und das Schlafengehen zu den möglichst immer gleichen Zeiten.
In dieser Nacht dachte ich mich weiter in den Strudel hinein, fürchtete schon die Schlaflosigkeit, doch da ließ mich das unverständliche Bild der emsigen Bachstelze plötzlich los und ich schlief ein, auch weil Anna sich im Schlaf an mich drückte.
Dienstag 3. Juli
Am nächsten Morgen verstanden wir uns glücklicherweise endgültig wieder gut. Ganz im Gegensatz zu unseren wenigen Bekannten sind wir beide morgens mit einem erstaunlich sonnigen Gemüt ausgestattet, an diesem Tag allenfalls getrübt von einer zu früh gerauchten ersten Zigarette auf der kalten Terrasse und den damit verbundenen Vorwürfen der Missachtung von Gesundheit und allen Konsequenzen eines solchen Verhaltens.
Wir saßen einander gegenüber, die ersten wirklichen Sommersonnenstrahlen auf unseren Profilen. Der glitzernde Rasen zu meiner linken, rechts das Haus vor dem Berg, von dem, immer das Bachbett entlang, ein kühler Wind herunterkam, der auch durch die Sträucher und Bäume nicht gebremst wurde. Gleichzeitig aber kam vom Tal herauf ausflockender Morgennebel, alles zusammen erinnerte uns daran, dass wir Glück gehabt hatten. Trotz der andauernd unsicheren Verhältnisse, was das finanzielle Auskommen, aber auch, in meinem Fall, die Beschäftigung überhaupt betraf.
Ich zündete mir eine neue Zigarette an.
»Ich habe gesehen, dass du wieder viele Bücher, gute Freunde quasi, eingepackt hast. Wie viele aber wirst du davon lesen? Fernand Braudel und Die Welt des Mittelmeeres? Wobei wir ja immer nur die Rezepte der Méditerranée gekocht haben, oder?«
Ich nickte, übersah ihr Grinsen geflissentlich. »Das vielleicht noch am ehesten, von den anderen: kein einziges«, sagte ich. Wir lachten. Eine Lüge, aber gut, wenn du von dreißig Büchern vielleicht eines, zwei lesen wirst, in zwei Monaten, dann macht das wirklich keinen großen Unterschied.
»Ein einziges neues ist mir aufgefallen: Die Geschichte der Kindheit.«
»Philippe Ariès«, ergänzte ich, »willst du wissen, worum es da drin geht?«
»Nur wenn du mir eine Zusammenfassung des Wikipedia-Artikels dazu sagen kannst.«
»Dann lieber doch nicht. Oder nein, viel besser: der Buchtitel wird dir in diesem Fall genügen müssen.«
Sie nickte ebenfalls, schätzte die Anerkennung ihrer Wünsche. Dann soll sie eben auch wirklich auf Wikipedia nachlesen, worum es sich da dreht. Was sie offenbar nicht wusste, und das wunderte mich sehr, war, dass ich dieses Buch in praktisch jedem Sommer nach Sonnseit mitgebracht hatte. Gut versteckt von mir entweder, nie aufgepasst von ihr, das wäre dann das oder.
»Brauchst du das für die Arbeit?«
»Nein, das ist ja völlig veraltet. Ich lese nur hin und wieder so hinein.«
»Mich kannst du ja mit sowas jagen, die Geschichte der Kindheit. Das wollen wir besser alles gut ruhen lassen.«
»Sagt die abgeklärte Biologin.« Aber darauf wollte sie gar nicht eingehen.
»Gerade weil wir Eltern sind, ist eine Geschichte des Kindes irgendwie auch nicht mehr so relevant? So irgendwie um die Ecke gedacht«, versuchte ich ihren Gedanken weiterzuführen.
»Ja, natürlich«, sagte sie versonnen, »die Kindheit geht zu Ende, neue Abschnitte beginnen.«
Ich sah sie ernsthaft an, weil ich’s mir nicht schon am ersten Tag nach einem Streit wieder mit ihr verderben wollte. Ich wollte, dass sie meine Bemühungen bemerkte und dachte doch daran, dass ich unserem Sohn gegenüber etwas als Meinungsverschiedenheit abgetan hatte, dass doch letztendlich viel gefährlicher war. Eigentlich, erkannte ich, fürchtete ich mich. Aber wovor ich mich fürchtete, war mir nicht so ganz klar.
»Ja«, sagte ich also leichthin, »beruhigend, das Kind so weit zu sehen.« Und nach einer Pause: »Eine erste Grenze wurde jedenfalls überschritten. Nach all dem Rennen um und für das Kind, auch einmal wieder zu sich selbst finden. Es war ja streckenweise so, als würde man einem Plan folgen, der tief in einem abgespeichert ist, ein Bauplan des Lebens, der zum Selbstläufer wird, zum Schutz der Kinder in diesen Anfangszeiten.«
»Ja, von mir aus, eine Grenze«, unterbrach sie mich, »das ist doch immer so, es sind vielleicht noch zwanzig Jahre, vielleicht auch nur zehn, wer weiß das schon jetzt, und dann sind wir Geschichte.«
Wir, fragte ich mich, als Gesellschaft, oder wir als Beziehung?
»Vielleicht, wir sind natürlich voll mit dem Kind beschäftigt, auch wenn wir jetzt vielleicht an einer neuen Grenze stehen, aber findest du nicht auch, dass so vieles schon geschafft ist?«
Da schüttelte sie ablehnend den Kopf. Ich zündete mir noch eine Zigarette an. Blies den Rauch in den Vormittag. In diesem Sommer planten wir, die gesamten Schulferien hierzubleiben, zum ersten Mal, Moritz und ich zumindest. Die Artikel, die ich mir zu schreiben vorgenommen hatte, würde ich Woche um Woche vor mir herschieben, um sie schließlich in Eile und halbfertig eine Woche vor der Deadline abzugeben.
Ich wollte ehrlich sein. »Eigentlich ist es dieses Gefühl einer tiefen Befriedigung, dass sich etwas eingestellt hat, von dem wir immer wussten, dass es schließlich eintreten würde. Es ist ja schließlich immer nur um unser Warten, Erwarten von mir aus, gegangen.« Sie lachte schon wieder, ich konnte den Spott in ihren Augen blitzen sehen. »Aber, dass es eintrifft, darauf haben wir uns ja immer verlassen« schloss ich.
Sie ersparte sich Vorwürfe, obwohl sie auch mit diesen recht gehabt hätte. Ich glaube tatsächlich, dass die Dinge auch ohne unser Zutun geschehen und verweise an solchen Stellen auf die Tatsache, dass es Entwicklungen gibt, die in jahrhundertealten Abläufen ruhen, und auf die wir keine Sicht haben. Ich selbst sehe mich hier gut eingebettet in eine abendländische Tradition eines sympathischen Determinismus.
Alles das habe ich an mir selbst erkannt, ich selbst entspreche genau dieser Tradition. Als wir uns kennenlernten, nach Beendigung unserer Studien, hatte Anna mich gefragt, warum ich ausgerechnet Historiker geworden war.
Kulturwissenschaftler, hatte ich sie korrigiert, um ihre Frage dann wahrheitsgemäß zu beantworten: Weil es mir angeboten worden war. Ich hatte ein Referat in einem Seminar meines späteren Chefs gehalten: Verbindungen des ersten Wiener Kreises zu irgendwohin, anderen Kreisen vermutlich, ich habe es vergessen, hatte es wohl damals schon nicht mehr gewusst. In diesem Moment hätte auch ich einen Wikipedia-Artikel gebraucht. Ich möchte das praktischste Lexikon der Welt nicht schlechtreden, ganz im Gegenteil, ich fordere jeden auf, sich im Zweifelsfall immer und so schnell wie möglich auf Wikipedia Klarheit zu verschaffen, für den ersten Überblick ist’s einfach das Beste. Jetzt, wo ich das hier niederschreibe, kommt es mir sogar vor, als hätte ich bei diesem Referat versucht, mit Diagrammen und grafischen Hilfsmitteln korrespondierende Mitglieder des Kreises aufzuzeigen. Oder hatte ich an anderer Stelle über Karl Popper gearbeitet? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht einmal mehr sicher, ob Popper etwas mit dem Wiener Kreis zu tun gehabt hat. Zwanzig Jahre sind vergangen und ich habe nicht die geringste Erinnerung daran, wie es eigentlich gekommen ist, dass ich in diesem Job gelandet bin. Denn, und das ist das zentrale Erlebnis, hatte ich damals zu Anna gesagt, es reicht, ein Referat zu halten, das offenbar etwas wie einen Nerv trifft, so sagt man doch. Danach hatte man mir Korrektur- und Lektoratsarbeiten für eine große Edition verschiedener wissenschaftlicher Texte zu Konstruktionen von Fremdheit und Vielfalt in National- und Vielvölkerstaaten angeboten. Und so war ich ins Geschäft hineingerutscht.
Interessant, hatte sie genickt. Es hatte sie natürlich keine Sekunde ernsthaft interessiert, das war mir von Anfang an klar gewesen.
Na ja, geht so, hatte ich geantwortet, ich war vor diesem Seminar drauf und dran gewesen, alles hinzuschmeißen, aber plötzlich schien es verlockend, ein Geisteswissenschaftler zu werden. Ich nahm das Angebot an, weil ich mich irgendwie auch nicht dagegen wehren wollte. Die Edition selbst wurde übrigens immer wieder verschoben. So lange, bis sich wohl niemand mehr dafür interessierte. Warum auch immer, ich habe nie herausgefunden, was genau der Grund dafür eigentlich war. Aber, und das ist wohl der entscheidende Punkt, ich habe auch nie nachgefragt.
Einen Beruf gewählt, weil man den Entwicklungen nicht entfliehen zu können glaubt und dabei die Verantwortung für die Gegenwart auf undefinierbare Strömungen, die außerhalb des eigenen Einflussbereichs liegen, geschoben: Sicher werden andere Leute diese Einstellung als leidenschaftslos feige ansehen. So deutlich ich auch zu anderen Zeiten gegen solche Vorwürfe aufgetreten war, so sehr zweifelte ich auch in diesem Moment, als Anna und ich uns in der Morgensonne an unserem zweiten Urlaubstag ansahen, an der Sinnhaftigkeit einer Verteidigung meiner selbst.
»Ich habe aber auch ganz andere Bücher mitgebracht. Du würdest deine Freude dran haben.«
»Daran möchte ich jetzt sehr gerne ein bisschen zweifeln.«
»Nein, nein, keine Sorge. Ich kann dir das sehr gerne ersparen.«
Ein oft gespielter Witz, vielleicht erschien er mir deshalb als realer Teil meiner Erinnerungen, gut aufgehoben in einem der vielen Schuber meines privaten Archivs.
Vielleicht war auch der Beruf des Kulturwissenschaftlers für die Kraftlosigkeit dieses Moments verantwortlich, dieses Verankertsein in strengen Abläufen, Hierarchien und Linien bei gleichzeitigem Anspruch, sich selbst und die tägliche Arbeit erfolgversprechend zu organisieren, um letztendlich etwas von Bestand zu hinterlassen. In Wirklichkeit spiegelt sich die Richtigkeit der Denkweise, den Dingen beim Werden zuzusehen und nur bedingt in deren Entwicklung einzugreifen, in unserer konkreten Arbeitsweise wider, dachte ich damals. Alle diese Artikel und Beiträge zu kulturwissenschaftlichen Analysen der urbanen Milieus verschiedener Zeiten schrieben sich im feindlichen Umfeld von einer uns nicht wohlgesonnenen Stimmung und, eng damit verbunden, der Stille hier am Land, denn hier hatte ich tatsächlich noch am ehesten Zeit für die Forschung gefunden. Tatsächlich waren wir, denn Anna bedient das gleiche Geschäft von der naturwissenschaftlichen Seite her, in ein absurdes Hickhack zwischen vormittäglichen Kaffee- und Zigarettenpausen und nachmittäglichen Jour Fixes über alle nur vorstellbaren Ismen eingebunden. Diese Gemengelage verbunden mit tristen Verwaltungstätigkeiten, die vom Brandschutzbeauftragten bis hin zum Verantwortlichen für die Auszahlung der per diems auf den Klausuren reichte, zwang einen geradezu, Zuflucht in der Hoffnung zu suchen, dass sich die eigentliche Arbeit, das, wo unser Herz lag, irgendwie von allein erledigen würde.
»Diese Arbeiten, diese Bücher, von der Geschichte der Kindheit angefangen bis hin zu den grundgegebenen Entwicklungen, auf die du keinen Einfluss zu haben glaubst, drücken auf dein Gemüt«, bohrte sie jetzt nach. »Du glaubst, dass es etwas in diesem Land, im Boden, in deinem Geist gibt, letztendlich ist dir das alles eins, eine Bewegung, die im Rahmen von irgendwelchen schicksalhaften Bestimmungen deine Berufswahl ebenso wie dein gesamtes Leben beeinflusst hat und am Ende des Tages«, sie begann zu kichern, »alles zu einem guten Ende bringt.« Und nach einer Pause: »Du vertraust auf einmal der Tradition? Das passt nicht zu dir.«
Mein Glück, dass sie die letzten Worte vor Lachen schon kaum mehr herausbrachte. Trotzdem ärgerte ich mich. Weil sie ja nicht falsch damit lag.
»Ja«, sagte ich, »stimmt von mir aus, weil ich dir keine Wahrheiten als Antwort geben kann. Aber habe ich nicht doch auch recht damit? Schau dir diese Momente hier an. Schau dir dieses Kind an: man möchte nichts daran ändern! So wie er jetzt ist, so wie er bis hierhergekommen ist, so ist alles erledigt! Haben wir nicht immer gesagt, dass es mit acht, zehn, vierzehn Jahren, ist ja egal wann wirklich, für ein Eingreifen zu spät sein wird? Auf eine gewisse Art ist alles bereits geschafft, das ist das Gefühl, das ich nicht mehr loswerde.«
»Wir reden aneinander vorbei. Merkst du das nicht?«, sagte sie leise und verärgert.
Dort, wo die Frühjahrsstürme im Mai bei unserem ersten Urlaub in diesem Jahr noch den Blütenstaub aus den Fichten zu braunen Wolken in die Höhe gejagt hatten, bewegten sich die Baumspitzen jetzt langsam und gemächlich ohne Spuren zu hinterlassen. Doch wenn es am Vormittag solchen Wind gibt, bedeutet das Regen am Nachmittag. Eine große Ruhe hatte sich über den Landstrich, mit unserem Ferienhaus in der Mitte, gelegt. Ich schaute in die grauen Wolken, die uns auf ihrem Weg vom Tal herauf gefunden hatten, vielleicht würde der Regen früher kommen.
»Ja, aber unser Sohn wird sich ändern«, sagte sie und langsam sah ich wieder zu ihr, »du verstehst das nicht, dass es nicht so bleiben wird, wie es jetzt ist. Umso schlimmer für dich, wenn du es jetzt als so stillhaltenswert empfindest.«
Da verstand ich, nur mit dem Kopf, dass sie recht hatte, es bestand die Möglichkeit, dass es einmal nicht mehr so schön wie in diesen Tagen sein würde, und ich wurde traurig. Ich sah wieder in die grauen Wolken und tatsächlich fielen in diesem Moment die ersten Regentropfen auf den Rasen, auf dem am Nachmittag davor die Bachstelze mir noch Hoffnung hatte geben wollen.
Mittwoch, 4. Juli
Auch am Tag danach regnete es noch immer. Mit Hilfe grauer, böser Wolken bewegte sich der Regen vom Talschluss her auf das Dorf zu. In dieser Landschaft, der Landschaft meiner Frau und ihrer Familie, fühlte ich mich schlecht aufgehoben, ein beunruhigendes Gefühl am Fenster im Trockenen zu stehen.
»Ich gehe hinaus, eine rauchen«, rief ich in eines der drei Zimmer hinter mir, »und nehme Moritz mit!«, und zwinkerte dem Buben mit einer Kopfbewegung zu. Er stand vom Tisch auf.
»Denk bitte dran, dass ein Gewitter kommen kann.«
»Okay«, sagte ich. Wir gingen unsere Schuhe holen.
»Es wird nicht blitzen, am Vormittag hat’s noch nie ein Gewitter gegeben«, sagte Moritz bestimmt, als er mühsam die Terrassentür öffnete.
Die Umgebung unseres Hauses war in grüne, kalte Feuchtigkeit gehüllt. Hinter der dichten Hecke aus Berberitzen, Hainbuchen und anderen, bis zu zwei Metern hohen Stauden, über die Straße hinweg, die einzige Verbindung mit der Außenwelt für diese letzten paar Häuser, erhob sich der Berg, stundenlange Fußmärsche entfernt, auf über zweitausend Meter Seehöhe. Wenn er nach all dem Regen auf die Straße niedergehen würde, dachte ich, dann wären wir gut abgeschnitten vom Rest der Welt. Einen Schrecken später gefiel mir der Gedanke dann ganz gut. Ich sah wieder zum Berg hinauf. Als ich noch neu hier gewesen war, hatte ich einen der Nachbarn gefragt, ob man mit dem Kind hinaufkonnte. Natürlich, er hatte mit den Schultern gezuckt, käme man mit Kindern, Kleinkindern sogar, auf den Berg hinauf, keine Frage, er wusste sogar von Touristen, die den Grat zum Gipfel hin mit Kindern auf den Schultern begangen hatten. Er selbst wäre, typisch für die Einheimischen, hatte er grinsend gesagt, allerdings noch nie oben gewesen.
Spitz und grau ragte der Berg über uns in die Wolken. An einer uns abgewandten Seite war in einer steilen Schotterrinne an einem Silvestertag eine Gruppe von jungen Männern, Einheimische, auf Schi abgefahren, hatte diesen Irrsinn mit Helmkameras und auf YouTube dokumentiert, vom angeblich drei Meter hohen Gipfelkreuz ragte am Beginn des Videos nur die Spitze aus dem Schnee. Ich sah zu meinem Sohn hinunter, er lehnte erwartungsvoll und auf die gleiche Art wie ich an der Hauswand, dachte sich dabei vielleicht etwas Konkreteres als sein gedankenverlorener Vater, der schon längst nicht mehr wirklich zu reden schien, aber immerhin vielleicht auch nicht schimpfte oder laut wurde. Ich fuhr ihm durch die Haare, genau so eine Frisur hatte ich in seinem Alter gehabt.
»Komm«, sagte ich, legte ihm schon wieder die Hand auf die Schulter, »stellen wir uns zur Hecke«, und zündete mir die Zigarette an.
»Wie lange wird es noch regnen?«, fragte er nach einer Weile.
»Weiß nicht, sehen wir drinnen dann nach, oder?«
»Okay. Das ist echt kein guter Beginn für die Ferien.«
»Das stimmt.« Und nach einer Pause fragte ich: »Sollen wir uns etwas Besonderes vornehmen, wir alle zusammen?«
Dazu nickte er nur und sah plötzlich genauso gedankenverloren in die Landschaft, wie ich vorher. Ich dagegen beobachtete ihn genau, wie wir dort standen und auch noch, als wir schon längst wieder im Haus waren.
Ich wollte ihm von einer Fossilienausstellung erzählen, die mir während der Autofahrt, vorbei an einem jener marinen Becken zwischen triassischen Gesteinen, genannt Gosaubecken, die besonders reich an Fossilien sind, aufgefallen war. Neben Landeck und einem Ort in der Steiermark – war das der Dachstein? – wusste ich von keiner weiteren Stätte, die für diese Besonderheit bekannt wäre. Anna warf etwas von einem Römermuseum aus dem Nebenzimmer ein, an einer der alten Römerstraßen, die sich durch diese Gegend zogen, wären sensationelle Funde zu besichtigen, sagte sie.
Da stand sie auf einmal in der Tür: »Du müsstest das doch wissen. Da war doch ein Artikel, vor kurzem erst, dass sie hier eine Straße, Teile einer Straße gefunden haben, die Oberitalien mit den germanischen Provinzen verbunden hat.«
»Eine Straße findet man doch nicht so einfach, von der hat man ja schon immer gewusst, die sieht man in Wirklichkeit noch heute, weil sie heute noch als Weg benutzt werden wird.« Ich stoppte, sah, dass sie sich über mich ärgerte.
»Dann hat man eben Fundstücke an einer alten Straße gefunden, Artefakte, sag schon, du weißt es ja sowieso besser.«
Doch mich hatte eine große Sprachlosigkeit ergriffen. Ich hätte meinen Menschen, den wenigen, die mir noch geblieben waren, sagen sollen, wie sehr ich sie liebte. Stattdessen ging ich unruhig und getrieben von etwas, das ich nicht fassen konnte, durch die alte Landschaft.
Ich sah meinem Sohn beim Lesen zu, bewunderte ihn für seine Ruhe und Ausgeglichenheit, beides Eigenschaften, von denen ich doch auch wusste, dass sie innerhalb von einer Sekunde in eine nichts verzeihende Wut, auch sich selbst gegenüber, umschlagen konnten. Mit Neid bewunderte ich, wie wenig irritiert sich meine Frau von meiner Unruhe zeigte, wie ungerührt sie mit ihren Arbeiten weitermachte. Ich dagegen sprang vom Schreibtisch auf, sobald ich gerade einmal einige Dateien geöffnet, blind für ihren Inhalt gebannt auf den Bildschirm gestarrt hatte, um letztlich doch bewegungslos zu bleiben: Um mich herum schien alles in Bewegung, diese offensichtliche Entwicklungshaftigkeit von allem Vergangenem, die nicht zuletzt in allen diesen Artikeln in meinem Notebook nicht nur vorgefunden, sondern geradezu gefordert wurde, wünschte ich mir für meine Gegenwart auf einmal nicht mehr.





























