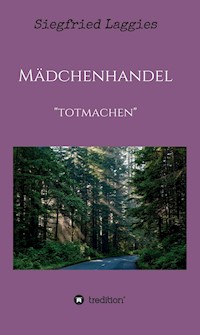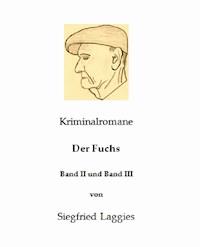2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieser Roman erzählt die Lebensgeschichte der Familie Heinz und Renate Walther aus Leipzig. Ihr Sohn Alexander ist dreizehn Jahre alt und geht noch zur Schule. Meine Erzählung beginnt an einem Tag im März. Hart getroffen durch die Abwicklungen vieler Betriebe die im Zuge der Wiedervereinigung unumgänglich wurden, verloren auch Heinz und Renate ihre Arbeitsplätze. Nur durch den Zusammenhalt in der Familie, konnte der sozialen Abstieg gestoppt werden. Heinz Walther bekam einen Arbeitsplatz in Frankfurt am Main angeboten, was sich zunächst auch als sehr positiv darstellte. Doch bei näherem Betrachten wurden auch die Nachteile sichtbar. Der neue Arbeitsplatz trennte die Familie. Späterer beruflicher Erfolg lässt zunächst noch alles positiv erscheinen. Doch Amor hat etwas anderes mit ihnen vor. Er schießt seine Pfeile nach Leipzig und vor allem nach Frankfurt. Die aufkeimende Liebe ist jedoch mit nahezu unlösbaren Problemen behaftet. Die bewundernswerte Zurückhaltung aller beteiligten Personen macht aus dem Roman ein kleines gesamtdeutsches Gesellschaftspanorama, das alles enthält, was eingutes Buch braucht: spannende Unterhaltung, menschliche Konflikte, aber auch knisternde Eritik. Ein Roman den Frauen gerne lesen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Zu neuen Ufern
IMPRESSUM:
Copyright: 2017 Siegfried Laggies
Autor: Siegfried Laggies
Umschlaggestaltung: Siegfried Laggies
Lektorat, Korrektorat: Siegfried Laggies
Bild: Quelle Pixbay
Verlag:
e-Book
ISBN: 978-3-7439-1531-2
Paperback
ISBN: 978-3-7439-1529-9
Hardcover
ISBN: 978-3-7439-1530-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung aus diesem Roman, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle Firmen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder vorhandenen Firmen sind reiner Zufall und nicht gewollt.
Einführung
Dieser Roman erzählt die Lebensgeschichte der Familie Heinz und Renate Walther aus Leipzig. Ihr Sohn Alexander ist dreizehn Jahre alt und geht noch zur Schule. Meine Erzählung beginnt an einem Tag im März. Benachteiligt durch die Wiedervereinigung verloren Heinz und Renate ihre Arbeitsplätze. Nur durch den Zusammenhalt in der Familie, konnte der sozialen Abstieg gestoppt werden. Heinz Walther bekam einen Arbeitsplatz in Frankfurt am Main angeboten, was sich zunächst auch als sehr positiv darstellte. Doch bei näherem Betrachten wurden auch die Nachteile sichtbar. Der neue Arbeitsplatz trennte die Familie. Späterer beruflicher Erfolg lässt zunächst noch alles positiv erscheinen. Doch Amor hat etwas anderes mit ihnen vor. Er schießt seine Pfeile nach Leipzig und nach Frankfurt. Die aufkeimende Liebe ist jedoch mit nahezu unlösbaren Problemen behaftet. Die bewundernswerte Zurückhaltung der beteiligten Personen lässt dieses Buch zu einer unterhaltsamen und spannenden Lektüre werden.
Siegfried Laggies
Zu neuen Ufern
Kapitel -1-
Es war ein Tag im Monat März. Der Frühling schickte seine Boten hinaus, um die Menschen zu erfreuen. Schon am frühen Morgen wehte ein angenehmes Lüftchen und das Thermometer zeigte bereits zwölf Grad. Ein Tag begann, an dem es Freude machte, aufzustehen.
»Nach dem Gong ist es sechs Uhr, heute ist Freitag, der 31. März«, hörte man aus dem Radio.
»Was uns wohl dieser Tag bringen wird?«, fragte sich Heinz Walther im Stillen. Der Maschinenbauingenieur in einem ehemaligen VEB-Betrieb in Leipzig und seine Frau Renate waren damit beschäftigt, alles für den kommenden Tag zu richten. Renate, eine gelernte Kindergärtnerin, war im gleichen Betrieb beschäftigt, ihr dreizehnjähriger Sohn Alexander ging noch zur Schule. Heinz, der sich ständig Arbeit mit nach Hause nahm, sortierte seine Unterlagen und steckte sie in seine Aktentasche. Frau Walther richtete das Frühstück und Alexander, nun ja, der bummelte so vor sich hin.
»Das Frühstück ist fertig«, rief Frau Renate und bat ihre zwei Männer, sich an den Tisch zu setzen. Der Tisch war reichlich gedeckt. »Schau mal, sogar das Brot bekommen wir jetzt eingepackt«, sagte sie.
Am Wetter oder gar am reichhaltig gedeckten Tisch lag es also mit Sicherheit nicht, dass Heinz Walther an diesem Morgen doch etwas verschlossen wirkte.
»Hast du was auf dem Herzen?«, fragte ihn seine Frau. »Ich weiß es nicht, aber hast du das gestern gesehen, na, ich meine den Besuch aus dem Westen?«
»Die dicken Autos waren ja nicht zu übersehen«, gab er ihr zur Antwort.
»Meinst du, dass das etwas zu bedeuten hat?«, wollte Renate wissen. »Es könnte ja sein, dass die Herren das nötige Geld mitgebracht haben.«
»Die Besprechungen wurden ja auf allerhöchster Ebene geführt. Da bekam doch niemand etwas mit.«
Man wird uns sicher angenehm überraschen, dachte Renate. Den Gedanken auszusprechen traute sie sich jedoch nicht. Sie wandte sich dem Junior zu und fragte: »Alexander, was ist mit dir, wie lange hast du heute Schule, hast du auch deine Hausaufgaben gemacht?«
Der Junge wusste gar nicht, wie ihm geschah. »Nicht alles auf einmal«, sagte er, dann nahm er seine Schultasche und zeigte seine Hausaufgaben.
»Wenn wir nachher weg sind, vergiss nicht abzuschließen, wenn du das Haus verlässt.« Mit diesen Worten verließen sie nach dem Frühstück das Haus. Es war jetzt sieben Uhr in der Früh, Renate und Heinz Walther setzten sich in ihren alten, für sehr viel Geld gekauften Golf und fuhren zur Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie es noch nicht ahnen, dass dieser Tag wohl der schwärzeste ihres Lebens werden würde. Vor den Werkstoren bemerkten sie ein reges Treiben. Fragte man jemanden, was denn geschehen sei, konnte einem niemand eine vernünftige Antwort geben. Die einen glaubten ans große Geld der Wessis, die anderen wiederum ahnten Böses. Plötzlich erschien der stellvertretende Betriebsleiter, Kollege Schachtner, ausgestattet mit einem tragbaren Lautsprecher, und forderte alle Kolleginnen und Kollegen auf, sich unmittelbar zur Werkskantine zu begeben, es sei eine Betriebsversammlung anberaumt worden.
»Was ist denn nun kaputt?«, fragte Renate ihren Mann, der ihr mit einer nicht zu überhörenden Bitterkeit zur Antwort gab: »Wir werden jetzt bestimmt alle freigestellt, um die blühenden Gärten zu bepflanzen, von denen der Kohl in seiner Wahlrede sprach.«
Zunächst trat wiederum der stellvertretende Betriebsleiter Schachtner an das Mikrofon und begrüßte die Anwesenden mit den Worten: »Liebe Genossinnen und Gen…, Entschuldigung, liebe Kolleginnen und Kollegen natürlich, außerordentliche Situationen erfordern auch außerordentliche Maßnahmen. Wir, die Betriebsleitung, haben in den letzten Wochen weder Arbeit noch Mühen gescheut, für unseren Betrieb kompetente und kapitalstarke Partner zu finden. Leider ohne Erfolg. Wie es Ihnen allen wohl nicht entgangen sein dürfte, haben wir nun seit gestern Besuch von der Treuhand aus Berlin. Leider brachte eine auch noch so sorgfältig vorbereitete Betriebsbesichtigung nicht den gewünschten Erfolg, es tut mir leid!«
Anschließend übergab er das Mikrofon an einen Herrn im blauen Nadelstreifen, den er wie folgt vorstellte: »Es spricht nun zu Ihnen Herr Dr. Kaltherz von der Treuhand Berlin.«
»Meine sehr geehrten Damen und Herren«, begann dieser, »ich bin von der Treuhand beauftragt zu überprüfen, ob dieser Betrieb eine Chance hat zu überleben.«
Da ertönte ein Zwischenruf: »Unsere Auftragsbücher sind doch voll.«
Dr. Kaltherz hielt inne: »Ja, Sie haben recht, aber die vorliegenden Aufträge wurden allesamt mit Ostblock-Staaten abgeschlossen. Diese Länder können aber zurzeit nicht in Deutscher Mark bezahlen. Das heißt, die dem Betrieb vorliegenden Aufträge sind wertlos. Ich muss Ihnen leider die schlechte Nachricht überbringen, dass auch dieser Betrieb abgewickelt wird. Das Arbeitsamt ist bereits unterrichtet worden. Bitte melden Sie sich dort, um die notwendigen Formalitäten für Ihre Arbeitslosigkeit zu erledigen. Ich danke Ihnen.«
Mit hängenden Köpfen verließen die Mitarbeiter das Betriebsgelände. Auch Renate und Heinz Walther fuhren niedergeschlagen nach Hause.
Kapitel -2-
Gut eine Stunde hatte Alexander noch Zeit. Wie nicht anders zu erwarten, beschäftigte er sich mit der Fußballbundesliga. Schade, dass Leipzig keinen Verein in der Bundesliga hat. Er war ein wenig traurig darüber, konnte er doch früher zu »Lok« Leipzig gehen und dort Fußball der höchsten Spielklasse sehen. Na ja, dachte er sich, vielleicht schaffen sie es ja in ein paar Jahren. Die Stunde verging sehr schnell und Alexander machte sich auf den Weg. Wie von der Mutter ermahnt, schloss er die Tür ab und marschierte los, es war ja so ein wunderschöner Tag. In der dritten Stunde stand Aktuelle Geschichte auf dem Lehrplan. Im Zuge der Eingliederung hatte Alexander seit drei Tagen einen Lehrer aus dem Westen, genauer gesagt aus Hof in Bayern. Stöckle war sein Name. Er erklärte den Schülern gerade den Unterschied zwischen den zwei politischen Systemen und stellte dabei die Vorteile der Demokratie besonders heraus. Vor allem aber machte er auf die wirtschaftlichen Vorteile aufmerksam und erklärte der Klasse, dass es von nun an besser werden würde, so wie es der Bundeskanzler in seiner Wahlrede gesagt hatte: »Es werden blühende Gärten entstehen.«
Kaum fähig, etwas zu tun, zwang sich Renate, das Mittagessen für die Familie herzurichten. Es war zwischenzeitlich zwölf Uhr dreißig und sie erwartete Alexander aus der Schule zurück. Es dauerte nicht lange, da konnte sich die Familie an den Mittagstisch setzen.
Alexander, von den verlockenden Prognosen des Lehrers noch ganz aufgewühlt, setzte sich mit einem strahlenden Gesicht an den Tisch. Ohne auf das Gesicht der Eltern zu achten, begann er sein neues Wissen loszuwerden. »Könnt ihr euch vorstellen, dass wir alle bald so leben wie die im Westen?«, sprühte es aus ihm heraus. Renate und Heinz Walther hoben die gesengten Köpfe und schauten den Jungen an. Erst jetzt merkte dieser, dass seine frohe Botschaft gar nicht wahrgenommen wurde. »Was ist mit euch?«, fragte er.
»Ja, mein Junge«, antwortete sein Vater. »Es wird sich bei uns alles ändern.«
Renate Walther schaute den Jungen an und sagte: »Wir haben heute unseren Arbeitsplatz verloren. Der Betrieb wird abgewickelt, er ist nicht mehr lebensfähig, so wurde es uns heute gesagt. Wir haben also kein Einkommen mehr und sind auf die Almosen vom Staat angewiesen. Den Gürtel müssen wir nun sehr, sehr eng ziehen.«
Mit diesen Worten war nun die Stimmung in der Familie auf dem absoluten Nullpunkt angekommen. Kaum jemand konnte auch nur einen Bissen zu sich nehmen.
Kapitel -3-
Frei nach der Empfehlung, über alles erst einmal eine Nacht zu schlafen, begannen die nüchternen und notwendigen Überlegungen am anderen Morgen. Renate und Heinz Walther setzten sich Prioritäten, nach denen sie vorgehen wollten. An erster Stelle stand das künftige Einkommen. Das heißt, es musste das Arbeitsamt aufgesucht werden, um alle Formalitäten für das Arbeitslosengeld zu erledigen. Wo sich die Familie Walther auch umhörte, alle anderen hatten die gleichen Probleme. Hoffnungslosigkeit und Frust machten sich breit. Heinz Walther konnte es immer noch nicht glauben, dass sein Betrieb, in dem er so viele Jahre gearbeitet hatte, einfach so dichtgemacht wurde. Wir leben doch in einer Demokratie, dachte er, und in einer Demokratie hat doch ein jeder Anspruch auf einen Arbeitsplatz. Aber Heinz Walther war ja auch Ingenieur, und als solcher wusste er, dass alles, was geschaffen werden soll, nicht ohne Kapital realisiert werden kann. Seine Firma, ein Betrieb mit fünfundachtzig Mitarbeitern, müsste doch irgendwie zu retten sein. Walther entschloss sich, noch einmal zu den führenden Leuten seiner Firma Kontakt aufzunehmen.
Gesagt, getan – die drei ehemals leitenden Mitarbeiter und Heinz Walther kamen zusammen und erarbeiteten einen Plan zur Fortführung des Unternehmens. Man berücksichtigte dabei auch, dass der Betrieb um einige Mitarbeiter schrumpfen müsse. Aufwendige und unproduktive Posten wie Pförtner, Werkschutz und noch einige andere wären zu streichen, auf diese Weise könnten die Lohnkosten erheblich gesenkt werden. Heinz Walther erinnerte seine drei Kollegen daran, dass er noch aus früheren Zeiten einige Konstruktionen zur Herstellung von Einkaufswagen und anderen fahrbaren Untersätzen in seiner Schublade habe, die zu DDR-Zeiten verworfen worden waren.
Mit dem Sanierungsplan und den Konstruktionsplänen im Gepäck setzten sich die vier Herren Schachtner, Rabe, Rück und Walther in Richtung Berlin in Bewegung.
Kapitel -4-
Renate Walther war indessen nicht untätig. Zunächst versuchte sie, anderweitig einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Sie musste aber sehr schnell feststellen, dass sie nicht den Hauch einer Chance hatte, in ihrem Beruf als Kindergärtnerin zu arbeiten. Sie merkte zu ihrem Entsetzen, dass ihr doch so geliebter Beruf flüssiger als Wasser war: Er war überflüssig. Dies war für sie nicht zu verstehen und ihre Enttäuschung war groß. Nun gut, dachte sie sich, wenn nicht als Kindergärtnerin, dann mach ich eben etwas anderes, Hauptsache, es kommt Geld in die Haushaltskasse. Renate Walther ging zum Arbeitsamt, um dort irgendetwas angeboten zu bekommen, selbst eine Putzstelle wäre ihr angenehm gewesen. Sie kam zum Arbeitsamt und dort aus dem Staunen nicht heraus. Eine Schlange von fünfzig Metern Länge stand vor ihr. Das hatte sie nun doch nicht erwartet. Sie fasste sich ein Herz und blieb stehen. Irgendwann werde auch ich wohl drankommen, dachte sie sich.
»Haben Sie denn schon eine Nummer gezogen?«, fragte sie die vor ihr stehende Frau.
»Ach du lieber Gott, das auch noch.« Renate ging und holte sich eine Nummer, es war die Dreiundachtzig.
Nach viereinhalb Stunden stand sie erschöpft im Zimmer des Arbeitsvermittlers.
»So, und was kann ich für Sie tun?«, war die Frage.
»Ich bin ohne Arbeit, Kindergärtnerin ist mein Beruf, ich nehme aber auch jede andere Arbeit, wenn Sie nur für mich etwas haben.«
»Gute Frau, woher soll ich Arbeit nehmen, wenn keine vorhanden ist. Ich nehme aber Ihre Personalien auf, damit es das nächste Mal schneller geht.«
Kapitel -5-
Alexander war ein aufgeweckter Junge, auch wenn er so manches Mal vor sich hin träumte und den lieben Gott einen guten Mann sein ließ. Wenn es aber darum ging, Probleme zu verstehen, dann war er, im Rahmen seines Alters, immer dazu bereit. Er erkannte schnell, mit welchen Problemen sich seine Eltern gerade herumschlagen mussten. Mit seinen dreizehn Jahren war er alt genug, um zu erkennen, wo der Weg hinführen könnte. Das schöne Häuschen, noch zu DDR-Zeiten gekauft und natürlich noch nicht bezahlt, sein schönes Zimmer – sollte das alles verloren gehen? Den Eltern gegenüber traute er sich nicht, dieses Thema anzuschneiden. Im Unterricht bemerkte auch Lehrer Stöckle das geänderte Verhalten von Alexander. »Junge, was ist mit dir?«, fragte er. Zuerst war Alexander verschlossen, er konnte keinen Laut von sich geben, dann aber löste sich die Zunge: »Das kann wohl doch nicht so das Wahre mit der Demokratie und dem Kapitalismus sein. Wenn ich sehe, wie mit meinen Eltern umgesprungen wird, dann wird mir angst und bange. Was wird mit unserem Haus, mit meinem schönen Zimmer, dem Garten, wir waren doch so glücklich!«
Lehrer Stöckle stand dem Jungen und der ganzen Klasse wie versteinert gegenüber. Was sollte er dem Jungen, ja der ganzen Klasse sagen? Denn den meisten Eltern erging es doch ebenso.
Kapitel -6-
In Berlin versuchte das Kollegenquartett, einen Termin bei der Treuhand zu bekommen. Man erkundigte sich zunächst, welche Abteilung für sie zuständig sei, und – oh Wunder – das Schicksal schlägt doch seine eigenen Haken: Auf dem großen langen Flur der Treuhand-Behörde wurde Heinz Walther plötzlich mit den Worten »Was machst du denn hier?« angesprochen. Heinz schaute hoch und erkannte seinen alten Schulfreund Klaus Schreiner.
»Mensch, Klaus, wie hat es dich denn hierher verschlagen. Du bist doch damals in den Westen rübergemacht. Und jetzt wieder hier?«
»Meine Landesregierung hat mich für die Zeit bis zur endgültigen Abwickelung nach hierher abkommandiert. Jetzt sage du mir doch einmal, was du hier machst, ich habe dich hier noch nie gesehen?«
Die drei mitgereisten Kollegen standen wie angekettet. Es traute sich niemand, auch nur einen Ton von sich zu geben. Heinz Walther hingegen dachte so für sich: Leistungssportler hätte man sein müssen, dann wäre man auch auf die andere Seite gekommen.
Klaus Schreiner wollte nun mehr wissen. Er fragte in die Runde: »Was kann ich denn für euch tun?«
Die vier, vor Erstaunen steif und stumm, mussten erst einmal Luft holen, dann fragte Heinz: »Hast du hier eine Möglichkeit, wo wir dir unser Problem erläutern können?«
»Aber natürlich, kommt bitte mit!« Klaus Schreiner führte das Quartett in sein Büro und forderte sie auf: »Bitte meine Herren, nehmen Sie Platz!«
Heinz Walther übernahm nun die Initiative, ließ sich von seinen Kollegen die Unterlagen geben, breitete sie aus und begann mit seinen Erläuterungen. Klaus Schreiner war ein aufmerksamer Zuhörer. Der Bericht dauerte gut eine Stunde. In dem Gefühl, das Beste gegeben zu haben, schauten nun alle vier Herren auf Schreiner.
Dieser stand auf, ging zu seinem Telefon und ließ sich die Akte der Metallwerke kommen. »Dann wollen wir mal schauen, was uns diese Akte zu sagen hat. Ihr habt hier ja schon vor einigen Wochen einmal vorgesprochen«, bemerkte er. Klaus Schreiner studierte die Akte sehr sorgfältig, dann wandte er sich seinem Schulfreund zu und sagte: »Heinz, ich möchte dir ja sehr gerne helfen, aber nach diesen Unterlagen kann und muss ich mich den Ausführungen und der Einschätzung des Herrn Dr. Kaltherz anschließen. Es tut mir wirklich leid.«
Mit gesenktem Haupt erhoben sich die vier Bittsteller.
»Habt ihr denn schon einmal über eine andere Lösung nachgedacht?«, fragte Klaus Schreiner noch einmal aufmunternd. »Wie meinst du das?« Heinz Walther schaute ihn groß an.
»Na ja, ich dachte an einen Partner oder an jemanden, der den Betrieb übernimmt. In dieser Richtung habe ich schon die eine oder die andere Nachfrage und diverse Mittel stehen da auch zur Verfügung. Was haltet ihr denn davon?«
Waren die vier Herren vorher weiß wie der Kalk an der Wand, so erröteten sie jetzt wie ein Feuerball.
»Nun setzt euch mal wieder hin«, ermunterte Klaus Schreiner sie. »Ich will euch jetzt einmal meinen Lösungsvorschlag unterbreiten. Hört bitte gut zu.« Voller Neugier darauf, zu erfahren, was denn wohl jetzt auf sie zukäme, lauschten sie den Worten des Herrn Schreiner. »Sollte es mir gelingen, für euch einen Partner zu finden oder gar ein Unternehmen, das an einer Übernahme interessiert ist, werde ich mich umgehend melden.«
Das wäre wohl die Lösung, dachte Heinz Walther.
»Natürlich sollte dieser Partner eine Produktpalette haben, in der eure Produkte einfließen könnten. Bei euch – und davon müsstet ihr ausgehen – vollzieht sich dann der Wandel von der Planwirtschaft zur freien Wirtschaft. Grundlegende Einschnitte werden die Folge sein. Ihr müsstet euch also darauf einstellen, dass das Unternehmen ein anderes neues Gesicht bekäme.«
Heinz Walter pflichtete ihm bei: »Wer das Geld gibt, hat nun mal das Sagen.«
»Um dieses nun alles abzurunden, ich will euch helfen. Ich werde meine Augen offen halten und an euch denken. Versprechungen kann ich natürlich keine machen. Es kann sein, dass ich schon bald einen Interessenten habe, es kann aber auch sein, dass es noch ein paar Wochen dauert …«
Irgendwie erleichtert und auch gelöst waren die vier jetzt schon. Heinz ging zu seinem Schulfreund, bedankte sich und bat ihn darum, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Auch die Herren Schachtner, Rabe und Rück verabschiedeten sich mit Dank von Herrn Schreiner, wobei Rabe die Bemerkung machte:
»Vielleicht war unsere Reise doch nicht umsonst.«
Das Quartett verließ das Gebäude der Treuhand und steuerte, ohne vorher auch nur ein Wort zu verlieren, das nächste Restaurant an. Man wollte noch etwas zu sich nehmen und ein kühles Bier sollte auch dabei sein. Der Film vom heutigen Tage sollte noch einmal an ihnen vorüberziehen. Nachdem man zu Abend gegessen hatte, wurde darüber diskutiert, wie sich wohl alles weiterentwickeln könnte.
»Meinst du, Heinz, der kann wirklich etwas für uns tun?«, fragte der Kollege Rück. Er war zu DDR-Zeiten Betriebsleiter und auch Parteigenosse gewesen, außerdem hatte er die Gabe, immer den Finger in das richtige Loch zu stecken. Schon damals setzte er seine eigenen Interessen vor die des Betriebes. Den Gerüchten zufolge soll er sogar einmal von der Partei ermahnt worden sein, und das wollte bei solchen Leuten schon etwas heißen.
Kapitel -7-
In der Regel sucht Renate Walther das Arbeitsamt alle vierzehn Tage auf, so auch heute. Irgendwie müssen sich die Zeiten geändert haben, dachte sie so für sich, früher schaute man auch zu mir hin, aber heute fressen mich die Männer bald auf, sogar der beim Arbeitsamt kriegt feurige Augen, wenn ich komme. Renate war eine äußerst attraktive Frau in den besten Jahren, hatte dunkelblonde Haare und eine tolle Figur. Mit ihren ein Meter und achtundsechzig wog sie gerade achtundfünfzig Kilo. Sie war einunddreißig Jahre jung, ihren Sohn Alexander hatte sie bereits mit achtzehn Jahren bekommen.
Gerade wollte sie das Haus verlassen, als der Briefträger ihr eine Karte vom Arbeitsamt überreichte. Sie nahm die Karte zur Hand und las: »Sehr geehrte Frau Walther, bitte haben Sie die Freundlichkeit und finden Sie sich am Dienstag, den Zweiundzwanzigsten um zehn Uhr dreißig zu einem Vermittlungsgespräch in Zimmer 34 ein. Mit freundlichen Grüßen, Arbeitsvermittlung Leipzig.«
Ja gibt es denn so was, dachte sich Renate. »Heinz«, rief sie, »es geschehen doch noch Wunder, ich habe eine Karte vom Arbeitsamt bekommen. Ich soll morgen um zehn Uhr dreißig dort vorsprechen.«
»Musst du wieder zu dem mit den feurigen Augen?« antwortete ihr Mann.
»Ja, aber der wird mich schon nicht fressen.«
»Na, hoffentlich hast du Glück, ich wünsche es dir von ganzem Herzen.«
Am anderen Morgen machte sich Renate auf den Weg, gespannt war sie auf alle Fälle. Beim Arbeitsamt angekommen, musste sie auch nicht so lange warten wie sonst.
»Guten Morgen, Frau Walther«, wurde sie freundlichst vom Sachbearbeiter begrüßt. »Es ist gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Ich glaube, ich habe etwas für Sie.«
»Machen Sie es nicht so spannend«, antwortete Renate. »Sie kennen doch die frühere Gießerei Vorwärts?« »Ja, die kenne ich«, antwortete Renate.
»Na sehen Sie, da sind wir doch schon ein gewaltiges Stück weiter. Zur Vorstellung gebe ich Ihnen eine Karte mit. Sollten Sie nicht angenommen werden, lassen Sie sich diese Karte bitte abstempeln mit dem Vermerk ›Nicht angenommen‹. Ach so, ich habe ja noch gar nicht gesagt, worum es sich handelt bzw. was die suchen … eine Kindergärtnerin, ist das nicht toll! Wie dort die Bezahlung ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ach ja, noch etwas, die Stelle ist zunächst für zwei Monate. Sehen Sie, jetzt habe ich doch noch etwas für Sie tun können.« Er schaute sie an: »Glauben Sie mir, ich habe es auch nicht leicht. Meine Braunschweiger Dienststelle hat mich hierher versetzt und meine Familie samt Häuschen ist in Niedersachsen. So hat jeder sein Kreuz zu tragen. Und immer hier alleine zu sein ist auch nicht angenehm. Oh, sollte ich Sie mit meinen privaten Dingen belästigt haben, dann entschuldigen Sie vielmals.«
»Nein, nein, vielen Dank für die Zuweisung. Hoffentlich habe ich Glück.«
Dann verabschiedete sich Renate und machte sich gleich auf den Weg. Zum Glück war es nicht allzu weit bis zur nächsten Haltestelle der Straßenbahn. Da kam auch schon die Linie zwölf, Renate stieg ein und löste einen Fahrschein bis zur Eisengießerei Vorwärts. Habe ich denn überhaupt meinen Personalausweis mit?, dachte sie, ohne den komme ich da doch gar nicht rein. Vor dem Eingangstor schaute sie sich um. Es war keine Volkspolizei mehr zu sehen, nur vorne im Häuschen saß der Pförtner.
»Guten Tag«, sagte sie, »ich komme vom Arbeitsamt.«
Dann zeigt sie ihre Karte, die der Pförtner sich ansah:
»Gehen Sie bitte dort in das graue Gebäude, in der ersten
Etage ist das Lohnbüro, dort melden Sie sich, junge Frau.«
Schon eigenartig, dachte Renate, so etwas war früher nicht möglich, da bekam man immer einen Aufpasser mit, also haben sich die Zeiten doch stark geändert. Im Lohnbüro angekommen, grüßte sie freundlich und legte wieder ihre Karte vom Arbeitsamt vor.
Die Dame dort fragte: »Hat man Ihnen gesagt, dass diese Stelle nur für zwei Monate besetzt wird?«
»Ja, das weiß ich.«
»Leider muss ich Ihnen aber auch sagen, dass dieser Kindergarten dann geschlossen wird. Sie haben in diesen zwei
Monaten noch zwölf Kinder zu betreuen.«
»Wie ist es denn mit der Bezahlung?«, fragte Renate.
»Nun, das hat sich auch geändert. Wir zahlen jetzt DM 6,00 in der Stunde. Wenn Sie damit einverstanden sind, können Sie morgen früh um sechs Uhr anfangen.« Die Lohnbuchhalterin zeigte durch das Fenster auf den Kindergarten und sagte: »Melden Sie sich dort bitte bei Ihrer Kollegin, sie betreut die andere Gruppe.«
Renate nahm die Stelle an, wenn sie auch über den niedrigen Lohn sehr erstaunt war. Dann verabschiedete sie sich und fuhr nach Hause.
Kapitel -8-
Lehrer Stöckle hatte der Klasse mitgeteilt, dass er in der Deutschstunde am Mittwoch einen Aufsatz über Goethe schreiben lassen wolle. Als Überschrift hatte er vorgegeben: »Was weiß ich über Johann Wolfgang von Goethe?« Mit diesem Aufsatz wollte er einmal erkunden, was die Schüler über den großen Denker und Dichter wussten. Dieses Wissen wollte Stöckle nutzen, um festzustellen, mit welchem Schwierigkeitsgrat er im Unterricht beginnen müsse.
Alexander saß oben in seinem Zimmer und beschäftigte sich gerade mit Goethe. Er hatte sich aus dem Bücherschrank den »Faust« geholt und blätterte drin herum: »Habe nun, ach!, Philosophie, Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie!, durchaus studiert, mit heißem Bemühn, da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.«
Alexander wusste, dass sein Vater ein Goethe-Verehrer war. Ob ich ihn in der jetzigen Situation wohl darauf ansprechen kann, dachte er. Vati fühlte sich ja in Auerbachs Keller immer sehr wohl, das wusste Alexander.
»Vati, kannst du mir ein oder zwei Zitate aus dem ›Faust‹ nennen, die auch fürs Leben wichtig sind?«
»Ja, das kann ich: ›Grau, teurer Freund, ist alle Theorie, und grün des Lebens goldener Baum‹ oder ›Es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden‹.« Der Vater wusste, dass diese Zitate es in sich hatten.
Der Tag ging zu Ende, Renate hatte nach ihrem Firmenbesuch noch einiges für das Abendessen eingekauft.
Nachdem sie den Tisch gedeckt hatte, rief sie ihre beiden Männer. Es entwickelte sich eine spannende Unterhaltung. Zuerst erzählte Renate, dass sie für zwei Monate Arbeit bekommen hätte. Über die Bezahlung würde sie am liebsten gar nicht sprechen, sechs Mark die Stunde, das ist ja ein Hungerlohn, aber doch noch besser als ohne Arbeit. Und dass es in der Eisengießerei Vorwärts sei, erzählte sie weiter. Heinz Walther stand immer noch zwischen Hoffen und Bangen, von der Treuhand hatte er noch nichts gehört.
Plötzlich richtet sich Alexander auf und sagt: »Was soll jetzt eigentlich aus uns werden?«
Die Eltern horchten auf, so hatte der Junge ja noch nie gesprochen.
»Alexander, was hast du?«, wollten die Eltern wissen.
»Ganz einfach«, sagt der Junge, »ich habe bald keine Freunde mehr! In unserer Klasse fehlen bereits drei Mädchen und vier Jungen. Die Eltern haben in den Westen rübergemacht. Der Vater hat dort Arbeit bekommen.«
»Ja, Junge, das ist ja alles gut und schön. Wir können das aber nicht. Wir haben unser Haus!«, sagte Heinz Walther.
»Vati«, nun wieder der Junge, »Vati, sage mir bitte, bist du für dieses Leben jeden Montag auf die Straße gegangen und hast du dafür demonstriert? Sage es mir ehrlich.«
»Nein, dafür nicht, wir haben nicht gewusst, dass man unsere Betriebe, auch die, die noch funktionieren, kaputt macht oder, wie es jetzt in der Wessisprache heißt, abwickelt. Und denen, die es uns vorausgesagt haben, denen haben wir es nicht geglaubt. Die SPD hat ja nicht umsonst haushoch verloren und mit ihr deren Vorsitzender. Und ich muss dir auch ganz ehrlich eingestehen, ich habe auch Helmut Kohl gewählt. Die meisten Menschen in unserem Lande haben doch denen geglaubt, die uns die bessere Zukunft versprochen haben. Ich laufe doch nicht den Leuten hinterher, die mir sagen, es wird mir demnächst schlechter gehen. So etwas liegt doch in der Natur der Sache.«
»Vati, hast du dabei nicht an Goethe gedacht: ›Grau, teurer Freund, ist alle Theorie‹?«
Heinz schmunzelte über die Bemerkung seines Sohnes. »Nun, trotzdem hoffen wir alle, dass sich die wirtschaftliche Situation in zwei bis drei Jahren merklich bessern wird! Was macht denn die Schule?«, wollte er nun wissen.
»Wir sollen morgen einen Aufsatz im freien Stil über Goethe schreiben, deshalb habe ich dich doch nach den Zitaten gefragt.«
»Ach, deshalb«, antwortete der Vater.
Hiernach ging Alexander auf sein Zimmer und bereitete sich weiter auf seinen Aufsatz vor.
Kapitel -9-
Die ständig schlechter werdende Atmosphäre im Elternhaus ging an Alexander natürlich nicht vorbei. Er sah mit an, wie sich die Eltern um Kleinigkeiten stritten. Was sollte er dagegen tun? Er zog sich zurück und wurde immer verschlossener. In seinem Zimmer beschäftigte er sich fast ausschließlich mit dem Computer, auch seine Schularbeiten, die sonst immer Vorrang hatten, wurden zur Nebensächlichkeit. Dieses Verhalten blieb natürlich dem Lehrer Stöckle nicht verborgen. Er kannte Alexander als einen aufmerksamen und strebsamen Jungen. Hier muss etwas geschehen sein, sonst hätte der Junge seinen Weg nicht verlassen, dachte er sich und beschloss, ihn einmal anzusprechen.
»Alexander, hör mal, ich beobachte dich jetzt schon einige Tage. Was ist mit dir? Deine schulischen Leistungen lassen gewaltig nach, dein Interesse am Unterricht schwindet. Junge, komm, wir unterhalten uns mal, vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube, du hast Kummer und fühlst dich in deiner Haut nicht wohl. Wenn du mein Angebot annehmen willst, sag es mir. Wir sprechen dann nach dem Unterricht darüber.«
Alexander fing an, über seine Situation nachzudenken. Ja früher, zu DDR-Zeiten, war das anders, da haben sich Vati und Mama nie gestritten, jedenfalls hatte er nie etwas bemerkt. Während der Messe hatte er die Autos der Wessis gewaschen und sich ein paar West-Mark dazuverdient. Er konnte sagen, dass es auch eine schöne Zeit gewesen war. Und Urlaub hatten wir auch im Ausland gemacht, wenn auch nur in Ungarn oder Rumänien.
In der nächsten Pause ging er zu seinem Lehrer und sagte ihm, dass er mit ihm sprechen möchte. Lehrer Stöckle bat Ale xander, nach dem Unterricht in das Klassenzimmer zu kommen, ab dreizehn Uhr seien sie dort ungestört. Wie abgesprochen, erschien Alexander im Klassenzimmer und sagte: »Hier bin ich.«
Stöckle war bemüht, eine lockere Atmosphäre zu schaffen. Alexander sollte sich ihm gegenüber auf eine Schulbank setzen, so saßen sie ungezwungen und konnten drauflosplaudern.
»Nun, Alexander, sag mir, wo drückt der Schuh?«
Der Junge überlegte: Wie fang ich an, was soll ich zuerst sagen? Dass meine Eltern nun ständig Streit haben, geht ihn ja eigentlich nichts an. Also beginne ich mit dem fehlenden Arbeitsplatz meines Vaters: »Unser größtes Problem ist die Tatsache, dass mein Vater, obschon er eine ausgezeichnete Berufsausbildung als Maschinenbauingenieur hat, keine Arbeit bekommt. Eine derartige Situation kannten meine Eltern bisher nicht. Bei uns verlief alles stets ruhig und harmonisch. Des Geldes wegen gab es nie Probleme. Vati war nicht in der Partei, deswegen wurde er auch nicht zum Betriebsleiter befördert. Er sagte immer, die brauchen mich und deswegen haben wir unser Auskommen. Dass man ihn aber jetzt so vor die Tür setzt, verkraftet er nur schwer. Er hat einen neuartigen Einkaufswagen konstruiert. Bei der Vielzahl der heutigen Supermärkte könnte man damit Geld verdienen, sagt er. Aber diese Konstruktion reißen sich jetzt die anderen in der Firma unter den Nagel. Vati sagt immer, bei so einer Ungerechtigkeit brauche man schon Nerven, um das zu verkraften. Es tut mir immer weh, wenn sich meine Eltern wegen jeder Kleinigkeit streiten, ich hab sie doch beide lieb.«
Lehrer Stöckle war zunächst beeindruckt, wie sachlich Alexander die Situation schilderte. Seine Argumente waren nicht zu widerlegen. Aber wie soll ich dem Jungen helfen?, dachte er bei sich.
»Alexander«, sagte er, um dem Jungen überhaupt eine Antwort zu geben, »für so eine Situation gibt es kein Patentrezept.« Stöckle überlegte weiter. Der Junge ist so intelligent, dem muss ich eine Antwort geben, die Hand und Fuß hat: »Wie du siehst, kann auch ich eine Antwort nicht aus dem Hut zaubern. Gib mir bitte Zeit bis Donnerstag, in den zwei Tagen werde ich mir überlegen, wie ich dir helfen kann.«
Kapitel -10-
Seit der Besprechung in der Berliner Treuhand waren drei Wochen vergangen. In seinem Inneren hatte Heinz Walther die Angelegenheit schon abgeschrieben, als er plötzlich einen Anruf von seinem Kollegen Erich Rück bekam, dem früheren Chef der Eisenwerke.
»Hallo, Kollege Walther, wie geht es dir?«, wollte Rück zunächst wissen.
»Ja, den Umständen entsprechend. Ich wäre glücklicher, wenn ich sagen könnte, dass es mir gut gehe.«
Rück machte zunächst eine kleine Pause, um anschließend sein Anliegen vorzutragen: »Was ich dich fragen wollte, sind deine Konstruktionen, so wie sie uns vorliegen, komplett?«
Walther überlegte einen Augenblick und antwortete dann: »Ja, hier zu Hause habe ich nichts mehr, aber sage mir doch bitte, warum du dich jetzt noch dafür interessierst?«
»Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber in meiner Eigenschaft als ehemaliger Betriebsleiter habe ich nochmals ein Gespräch mit der Treuhand aufgenommen. In diesem Gespräch stellte sich nun heraus, dass ab sofort eine andere Abteilung für uns zuständig ist. Mit deinem Schulfreund, dem Herrn Schreiner, haben wir nichts mehr zu tun. Für uns ist jetzt wieder Herr Dr. Kaltherz zuständig. Dr. Kaltherz sagte mir, dass er einen Investor für unseren Betrieb hätte und dass dieser uns übernehmen werde. Es ist die Firma Gerätebau Schneider GmbH aus Wernau bei Stuttgart. Erste Gespräche habe ich bereits mit Herrn Dr. Ing. Schneider geführt.«
Heinz Walther musste diese Nachricht erst einmal verdauen. Es vergingen einige Sekunden, bevor er fragte: »Wie soll es denn jetzt weitergehen?«
»Dr. Schneider beabsichtigt, etwa fünfzehn bis zwanzig Mitarbeiter zu übernehmen, der Rest bleibt beim Arbeitsamt. Er erklärte mir, wie er sich den weiteren Ablauf vorstellt. Er wies darauf hin, dass er lediglich einen Filialleiter und eine weibliche Bürokraft benötige. Das heißt, alle anderen werden in der
Produktion beschäftigt.«
Heinz Walther versuchte, sich einen Durchblick zu verschaffen. Er dachte dabei auch an seine Konstruktionspläne für neuartige Einkaufswagen. Mit diesem Produkt – davon war er überzeugt – könne man Umsatz machen und Geld verdienen. Das war in seinem Kopf entstanden, er hatte es zu Hause konstruiert. Zu Rück sagte er dann auch deutlich: »Die Konstruktion ist mein geistiges Eigentum.«
Rück, der ein Fuchs war, sagte nur: »Darüber sprechen wir später.«
Heinz Walther wollte sich nun Klarheit verschaffen und rief zunächst seinen Schulfreund in der Berliner Treuhand an: »Hallo, Klaus, Heinz hier, hör mal, was habe ich da von unserem Kollegen Rück erfahren, du bist nicht mehr zuständig für uns, stimmt das?«
»Ja, leider, bei unserem Gespräch dachte ich noch, ich könnte die Angelegenheit übernehmen. Dr. Kaltherz ist nun mal eine Etage über mir und dagegen kann ich nichts ausrichten. Ich kann dir nur den Rat geben, verliere jetzt nicht die Nerven.
Vielleicht wendet sich ja noch alles zum Guten.«
Es muss etwas geschehen, dachte sich Heinz Walter und rief seinen Kollegen Schachtner an: »Hallo, Kollege Schachtner, wie geht es dir, hast du auch schon von der neuen Situation erfahren?«
Walther merkte, dass Schachtner auf diese Frage nicht vorbereitet war, denn es dauerte einen Augenblick, ehe er antwortete: »Ja, ich habe auch davon gehört, ich bin aber davon überzeugt, dass der Rück das schon machen wird. Mehr kann ich dir auch nicht sagen.« Mit der Bemerkung, er bekomme soeben Besuch, beendete Schachtner auch gleich das Gespräch.
Sieh an, dachte sich Heinz Walther, die beiden haben da doch schon wieder gemauschelt. Dieser Rück, wie früher in den alten Zeiten, dieser Drecksack! Es können doch nicht alle gegen mich sein. Walther griff erneut zum Hörer, um nun den Kollegen Rabe anzurufen, einen immer in sich verschlossenen Kollegen, eben ein Buchhalter. Aber als Buchhalter müsste er doch eigentlich in nahezu alle Belange Einblick haben, also wählte er seine Nummer.
»Hallo, Kollege Rabe, hier spricht Heinz Walther. Wie geht es dir? Ich hoffe, dass die Gesundheit nichts zu wünschen übrig lässt. Nun will ich dir auch den Grund meines Anrufs sagen. Ich hatte heute ein langes Gespräch mit unserem Kollegen Rück. Das heißt, er hat mich angerufen und wollte etwas über meine Konstruktionen wissen.« Er berichtete seinem Kollegen, was er mit Rück gesprochen hatte. Auch Rabe war von Rück in den vergangenen Tagen angerufen worden, und aufgrund der Gespräche konnte Walther nachvollziehen, wohin das Schiff gesteuert wurde. Rück, ein Mann aus dem politischen Kader, der seinerzeit an die Spitze des Betriebes gesetzt wurde, war mit allen Wassern gewaschen. Das jetzt zur Kenntnis Genommene war zu viel, auch Rabe musste nun seinem Herzen Luft verschaffen und schilderte seinem Kollegen Walther, was Rück von ihm wollte: »Primär waren es Auskünfte über Personen und noch zu realisierende Aufträge. Die Buchhaltung interessierte ihn nur am Rande.« Die beiden Kollegen kamen in ihrem Gespräch überein, dass Rück, um seinen Posten zu behalten, auf Schachtner nicht würde verzichten können. Sie waren sich aber auch darin einig, dass diese Konstellation nicht lange gut gehen würde.
Die Zeit verging in den folgenden Wochen wie im Fluge. Heinz Walther hatte zwischenzeitlich viele Bewerbungen geschrieben, leider ohne Erfolg. Seine ehemalige Firma wurde von der Firma Gerätebau Schneider GmbH übernommen. Zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fanden dort einen Arbeitsplatz, jedoch nicht Heinz Walther. Er bekam aber eine Karte vom Arbeitsamt mit der Aufforderung, sich am Montag den Achtzehnten um zehn Uhr in Zimmer zwölf einzufinden.
Kapitel -11-
Wie besprochen, meldete sich Renate am anderen Morgen zum Dienstantritt bei ihrer Kollegin. Sie stellte sich vor: »Hallo, ich bin Renate Walther und soll für die letzten zwei Monate die zwölf Jungen und Mädchen übernehmen«
»Ja und ich bin die Heidi Klein, aber bleiben wir doch beim Du.«
»Okay«, sagte Renate und beide begannen mit den Vorbereitungen für den neuen Tag. Die beiden Frauen verstanden sich sofort. Beide wussten, hier kann keine einen Vorteil erhaschen. Der Tag verging sehr schnell, es war ja die gewohnte Arbeit.
Als Renate ihren ersten Arbeitstag hinter sich gebracht hatte und nach Hause kam, berichtete sie, wie der Tag verlaufen war und dass sie sich mit ihrer neuen Kollegin gut verstehe. »Vielleicht ist es ja der Anfang zum Guten«, sagte sie und bemerkte nicht, dass ihr Mann teilnahmslos zuhörte.
»Ja, ja«, sagte er nur, »das ist der Anfang.«
Renate schaute ihn erstaunt an und fragte: »Was ist mit dir, ist was geschehen?«
»Ja«, sagte Heinz Walther, »stell dir vor, heute hat mich der Rück angerufen und mir mitgeteilt, dass Klaus Schreiner nicht mehr für uns zuständig ist und es bereits eine Firma aus dem Westen gibt, die uns übernimmt. Mit dem Kollegen Rabe habe ich bereits darüber gesprochen, der wusste auch von nichts.« Eine kurze Zeit hielten beide inne.
»So kann es nicht weitergehen«, stellte Heinz fest und Renate stimmte dem zu. Auf dem Sparbuch mehrten sich die Auszahlungen und das mühsam angesparte Guthaben wurde immer kleiner. An Urlaub war schon gar nicht zu denken. Der gebrauchte Golf hielt auch nicht das, was man sich von ihm versprochen hatte, und jetzt fielen auch dort noch zu allem Übel einige Reparaturen an. Renate dachte nur: Wie sollen wir das bloß bezahlen? Neue Schulbücher benötigt der Junge auch. Es ist zum Verzweifeln! Wenn Heinz doch bloß bald Arbeit bekäme. Aber wie sagte doch der Schulfreund: Jetzt nicht die Nerven verlieren. Trotzdem, die immer größer werdenden Sorgen zehrten auch am Miteinander. Kleinigkeiten, die man sonst mit einem Lächeln übersehen hätte, wurden plötzlich zum Problem. Weder Heinz noch Renate hatten noch das Bedürfnis, den anderen mal in den Arm zu nehmen und zu drücken, ihm einen Kuss zu geben und ein paar liebe Worte zu sagen. Es war für die Ehe, ja für die Familie, keine gute Zeit.
Dennoch, am anderen Morgen richtete Renate für ihre »Männer« das Frühstück und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Mit »Hallo« und »Guten Morgen« begrüßte sie ihre neue Kollegin. Sie wollte nicht, dass sie bemerkte, welchen Kummer sie hatte. Und solange beide mit den Kindern beschäftigt waren, gab es keine Möglichkeit, ein privates Wort zu wechseln. Erst mittags, als die Kinder schliefen, konnten sich die Frauen vom Stress ein wenig erholen. Jetzt wurden die üblichen Fragen gestellt, man tauschte sich aus: Bist du verheiratet, hast du Kinder, wie alt bist du, was macht dein Mann? – und noch so einige Fragen mehr. Heidi war mit ihren einundvierzig Jahren zehn Jahre älter als Renate. Sie hatte blonde Haare und war, wie auch Renate, im Tierkreiszeichen der Fische geboren worden. Heidi machte auch gerne mal einen Spaß und war außerdem sehr zuverlässig.
Seit einigen Tagen beobachtete Heidi Renate nun schon. Sie merkte, mit der stimmt etwas nicht. Sollte sie sie ansprechen oder in Ruhe lassen, aber sie quälte sich doch sichtbar. Egal, dachte Heidi, ich spreche sie einfach an und frag, was sie hat: »Renate hör mal, ich beobachte dich jetzt schon einige Tage, und ich habe festgestellt, mit dir stimmt etwas nicht. Sag mir, was bedrückt dich, vielleicht kann ich dir helfen, deinen Kummer zu mildern.«
Renate hob bedrückt ihren Kopf: »Wer kann mir da schon helfen? In meiner Ehe gibt es Differenzen und Unstimmigkeiten. Das hatten wir früher nie. Heute finden wir selbst in unserem Schlafzimmer nicht mehr zueinander. Das halte ich auf die Dauer nicht mehr lange aus.«