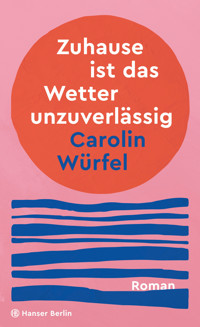
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Carolin Würfel erzählt mit Wut und Verve von uns: Frauen, Müttern, Töchtern. Von unserem Hunger nach Freiheit und unserer Sehnsucht nach Geborgenheit, unserer Angst und unserem Mut.« Annabelle Hirsch Eine Frau bucht ein Ticket, setzt sich eine Frist. Im Sommer ist Schluss, schreibt sie in ihr Tagebuch. In der neuen Stadt am Meer, unter gleißender Sonne, will sie den Erwartungen entkommen, nach denen sie ihr Leben zu lange ausgerichtet hat. Sie will keine Kinder, sie will Sex, will kompromisslose Freiheit. Aber kann sie die alten Muster einfach abstreifen? Was weiß sie von den widerständigen, duldenden, hadernden Frauen ihrer Familie, deren Leben sich ihrem eingeschrieben haben, von Anna und Rosa, Ella und Viola, von ihrer Mutter Romy? Carolin Würfel verknüpft den schnellen Puls der Gegenwart mit der Geschichte dreier Generationen Frauen, bis die Muster weiblichen Lebens hervortreten, die der Hauptfigur im Nacken sitzen. Ein vielschichtiger Roman über die Frage, ob wir wirklich frei sein können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
»Carolin Würfel erzählt mit Wut und Verve von uns: Frauen, Müttern, Töchtern. Von unserem Hunger nach Freiheit und unserer Sehnsucht nach Geborgenheit, unserer Angst und unserem Mut.« Annabelle HirschEine Frau bucht ein Ticket, setzt sich eine Frist. Im Sommer ist Schluss, schreibt sie in ihr Tagebuch. In der neuen Stadt am Meer, unter gleißender Sonne, will sie den Erwartungen entkommen, nach denen sie ihr Leben zu lange ausgerichtet hat. Sie will keine Kinder, sie will Sex, will kompromisslose Freiheit. Aber kann sie die alten Muster einfach abstreifen? Was weiß sie von den widerständigen, duldenden, hadernden Frauen ihrer Familie, deren Leben sich ihrem eingeschrieben haben, von Anna und Rosa, Ella und Viola, von ihrer Mutter Romy? Carolin Würfel verknüpft den schnellen Puls der Gegenwart mit der Geschichte dreier Generationen Frauen, bis die Muster weiblichen Lebens hervortreten, die der Hauptfigur im Nacken sitzen. Ein vielschichtiger Roman über die Frage, ob wir wirklich frei sein können.
Carolin Würfel
Zuhause ist das Wetter unzuverlässig
Roman
Hanser Berlin
1. Januar 2022
Habe beschlossen, in sechs Monaten ist Schluss. Die Details muss ich noch klären, aber das Ende eines Jahres hat mich eh nie interessiert, und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und am schönsten ist es im Sommer. Außerdem soll das keine tränenreiche Tragödie im Nebel werden. Ich will schwitzen, wenn es so weit ist, und blauen Himmel. Auch deshalb bin ich hierhergekommen. Das Wetter zuhause ist unzuverlässig.
4. Januar 2022
So surreal, endlich hier zu sein. Vor meinem Fenster kreisen Möwen am Himmel, Schiffe ziehen übers Wasser, und nachts funkelt die Küste wie tausend Edelsteine. Sehr guter Kitsch. Echt bekloppt, wie beschränkt man manchmal ist. Da hat man jahrelang denselben Traum und träumt, dass jemand einem ein Flugticket (One Way) schenkt, aber bis man (also ich) auf die Idee kommt, sich das Ticket einfach selbst zu kaufen, dauert’s. Warum ist das bloß so, dass man glaubt, andere zu brauchen, damit die eigenen Träume wahr werden?
5. Januar 2022
Okay, das permanente Kreischen der Möwen nervt etwas.
10. Januar 2022
War gestern Abend in einem Jazzclub. Herrliches Gejaule im Vergleich zu den Möwen. Habe sogar getanzt. Ob mir das Alleinsein so gefällt, weil es einen Stichtag gibt?
Früher war ich so oft wütend. Wut war mein Motor, aber hier ist die Wut bisher ganz still. Andererseits hat Wut vielleicht viele Gesichter. Ist Wut wirklich laut? Ist Wut ein Ball oder eine Linie? Was ist das erste Anzeichen von Wut? Eine Falte auf der Stirn oder ein gemeiner Stich in der Magengegend? Vielleicht auch egal. Viel wichtiger ist, dass sie mich hier nicht ständig begleitet. Mit der Wut kam auch stets die Traurigkeit, die mich an den unpassendsten Orten zum Heulen brachte und zur Verzweiflung trieb. Mein Gott, was habe ich gestampft und geflennt, ohne genau zu wissen, wieso. Wie oft habe ich, wenn die U-Bahn einfuhr, gedacht: Okay, jetzt springst du, und es dann doch nicht gemacht, weil ich dachte, das nervt die Leute bestimmt. Die wollen doch nach Hause.
Aber damit ist jetzt Schluss. Ich habe keine Lust mehr, mich einzureihen. Ich will raus aus dem verdammten Dunkel. Ich will ins Licht, auf niemanden achten müssen, gefallen, warten, mich absprechen. Ich will gehen, wann und wohin ich will. Der erste Schritt dafür ist nun getan, und darüber bin ich froh. Seit ich denken kann, habe ich brav mitgespielt, genickt, den Kopf gesenkt, geschluckt, angezogen, stillgehalten, weggeschoben. Ich habe Geschichten anderer Leute mit mir umhergeschleppt, als seien es meine eigenen. Ich will nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Dieser verdammte Dreck und diese verdammte Jammerei. Kotzen könnte ich, wenn ich daran denke. Ich will einmal nur mich sehen und verstehen, wer da stehen bleibt, wenn alles abgefallen ist. Es ist genug. Ich weiß nur noch nicht, ob der Preis dafür vielleicht zu hoch ist. Ob der Totalabbruch von allem, was bisher war, diese Ausflucht an einen Ort weit weg von zuhause und die gesetzte Deadline mich nicht im Verlauf der nächsten Wochen in den kompletten Wahnsinn treiben wird und meine Vorstellung, dass sich hier alles abstreifen und beenden lässt, nicht völlig naiv ist. Wie mutig, wie konsequent bin ich tatsächlich? Halte ich mich aus? Ich will einfach nur, dass es schön ist, will die Zeit auskosten, aber ein halbes Jahr kann lang oder kurz sein, und dazwischen kann alles Mögliche passieren.
12. Januar 2022
Marmeladenbrot
gekochtes Ei
Fenchelsalat
Zuhause war ich immer hungrig. Hier vergesse ich das Essen.
*
Anna, geboren 1910, wuchs in einer Kleinstadt am Meer auf, in einer Familie, in der viel getrunken und viel gebrüllt wurde. Mit vierzehn erzählte Anna allen Leuten, denen sie begegnete, dass sie später ein berühmter Komponist werden würde, wie Gustav Mahler, über den sie in der Schule gesprochen hatten. Der Musiklehrer hatte erzählt, dass Mahler seine Sommer in einer Villa an einem See verbrachte, wo er neben der Villa auch eine kleine Holzhütte zum Arbeiten hatte. Anna stellte sich vor, wie Mahler jeden Morgen in diese Hütte ging und jemand — seine Frau oder sogar ein Koch — ihm das Frühstück brachte. Frischer Kaffee, frisches Brot, Butter und Marmelade. Danach durfte ihn bis zum Mittag niemand mehr stören, er saß allein in der Hütte, komponierte und blickte auf den See. Nachmittags ging er stundenlang spazieren, pfiff neue Melodien in die Landschaft, schwamm, ließ sich von der Sonne trocknen. Was für ein anderes Leben. Wie das Komponieren von Musik genau ablief, verstand Anna nur in groben Zügen. Tonleiter, Intervalle, Quintenzirkel erschienen ihr genauso kompliziert wie Gleichungen mit binomischen Formeln, aber was Musik konnte, wenn sie einmal da war, wusste sie genau. Musik gab Anna frei, ließ sie reisen, trug sie an einen Ort, der mindestens so schön wie Mahlers Idyll am See war. An einen Ort, wo nicht gebrüllt und nicht getrunken wurde, wo sie nicht mit hochgezogenen Schultern und leisen Sohlen umherschleichen musste. Hier in dieser Kleinstadt am Meer war es anders. Hier in dieser Kleinstadt am Meer hatte man sich in den monotonen Chor der Mehrheit einzureihen. Hier reiste man nicht und brach auch nicht aus, weder mit Tönen noch sonst irgendwie, und wenn Anna überleben und ein Dasein führen wollte, das in Ordnung war und als in Ordnung galt, tat sie besser, was von ihr erwartet wurde. In dieser Kleinstadt am Meer fügte man sich besser ein, so gut es eben ging. Annas Kompromiss: Mit sechzehn verließ sie das polternde Elternhaus, begann eine Ausbildung zur Schneiderin und zog in ein Zimmer unterm Dach, Seestraße Nummer 10a. Das Haus war so verwittert, dass die Leute es als Schiffswrack bezeichneten. Dach undicht, Fensterläden schief, tiefe Risse in der Fassade, aber der Blick aus dem Dachstubenfenster aufs Meer und den endlosen Horizont war unendlich schön und sie endlich allein, wie Mahler in seiner Hütte. Jeder im Ort kannte das Haus. Und jeder im Ort kannte Anna. Anna war auffällig, trotz Kompromiss. Anna hatte feuerrotes Haar, trug ausschließlich Herrenanzüge, arbeitete beim besten Schneider im ganzen Norden, aber verdiente trotzdem nur einen Hungerlohn. Ihr Lieblingsgericht: Himbeermarmeladenbrote. Für sie war das ein Gericht, die Himbeeren mussten dafür schließlich gekocht werden. Himbeeren schmeckten in jeder Form nach Sommer, und den Sommer liebte sie von allen Jahreszeiten am meisten, weil sie im Sommer jeden Tag schwimmen gehen konnte. Körper schwerelos, Seele auch.
Im Winter 1928/29 ging Anna eine Zeit lang mit dem jungen Kaufmann aus, der im Gasthaus am Markt ein Zimmer belegte. Sie fertigte einen Anzug für ihn an, dunkelblauer Nadelstreifen. Er lud sie ins Gasthaus ein. Manchmal blieb sie über Nacht bei ihm. In ihrer Wohnung gab es keinen Ofen. Der Winter war brutal.
Im Herbst 1929 gebar Anna eine Tochter. Ihre Schreie hörte man im ganzen Ort. Dann war es tagelang still, und die Leute fingen an zu reden. Der Kaufmann hatte sich längst verabschiedet, war weitergezogen, in eine andere Stadt, zu neuen Kunden, neuen Frauen. Anna schrieb ihm einen Brief mit den Neuigkeiten. Ob die Adresse, die er ihr hinterlassen hatte, noch aktuell war, wusste sie nicht. Eine Antwort blieb aus. Sie legte das Kind in die oberste Schublade ihrer Kommode, ging weiter zur Arbeit in die Schneiderei und rannte in den Mittagspausen kurz nach Hause, um das Kind zu wickeln und zu stillen. Für mehr war keine Zeit. Für mehr hatte Anna auch weder Mittel noch Kraft. Gustav Mahler und die Träume von einst waren weit weg. Nur manchmal kamen sie zurück. Nach Feierabend kam ab und zu ihre Freundin Edith mit zu ihr in die Dachstube. Edith war Annas Arbeitskollegin und Verbündete. Früher, vor der Geburt des Kindes, schwatzten die beiden dem Wirt vom Gasthaus manchmal eine Flasche Schnaps ab, jetzt tranken sie Tee mit einem Schuss Likör, und während sie an ihren dampfenden Bechern nippten, hörten sie bis morgens um halb drei die langsam schleppende erste Sinfonie von Gustav Mahler auf dem alten Grammofon und wiegten abwechselnd das Kind in ihren Armen zum Takt der Musik in den Schlaf. An Samstagmorgen — wenn sie Glück hatten und das Baby noch in der Schublade schlief — gingen die beiden dann mit Augenringen und heißem Kaffee an den Strand, schoben ihre Füße tief in den Sand und breiteten Landkarten vor sich aus, fuhren mit ihren Fingern über die feinen Linien, die davon erzählten, dass es da draußen, hinter dem Horizont, noch ein Woanders, ein anderes Leben als in dieser Kleinstadt geben musste.
Drei Wochen nach der Geburt des Kindes, das außer Edith bis dahin niemand gesehen hatte, gab Anna eine Annonce in der lokalen Zeitung auf: »Kind zu verschenken. Gesundes Mädchen: 3500 kg, 52 Zentimeter. Bitte melden.« Ihre Anzeige stand auf Seite 3, neben verzweifelten Gesuchen für Anstellungen und Angeboten für Silberbesteck und Teeservices zu horrenden Preisen. 1929 war ein katastrophales Jahr.
Erst meldete sich niemand auf die Annonce, doch dann schrieb die Mutter des jungen Kaufmanns, die in einer anderen Kleinstadt an der Küste lebte. Mit Kutsche und Ehemann und scheelem Blick holte sie das Enkelkind ab. Anna ging daraufhin mit Edith tanzen. Zum Schwimmen war es zu kalt.
Vier Jahre später, am 12. Oktober 1933, einem trüben Donnerstag, erschien Anna nicht bei der Arbeit. Das war noch nie passiert. Am Abend zuvor hatten sie und Edith zusammengesessen. Es war spät geworden. Anna, die nie Röcke trug, hatte an einem Rock aus schwerem Wollstoff genäht, und Edith hatte ihr dabei zugesehen, bis sie die Augen nicht mehr offen halten konnte und nach Hause gegangen war. Am Morgen, als Anna nicht auftauchte, ging Edith zurück in die Dachstube, um nach ihr zu sehen. Aber Anna war nicht da. Ihr Bett war leer. Auf der Kommode lagen zwei Briefe. Einer adressiert an Edith, der andere adressiert an Ella, das Kind, das sie der unbekannten Großmutter übergeben hatte. In dem Brief an Edith dankte Anna der Freundin für die jahrelange Verbundenheit und zählte auf, was sie ihr überlassen würde: die Schallplatten, den Wintermantel. Das war nicht viel, aber alles für Anna. Sie schrieb von dem Schmerz, der Scham und endlosen Sehnsucht, die sie seit vier Jahren quälten und alles in ihr auffraßen. Davon, wie ihr die Gedanken an Ella jeden Tag das Herz zerrissen. Jede Nacht sah sie ihr kleines Gesicht, ihre kleinen Hände, die aus der Schublade nach ihr griffen. In den Morgenstunden hörte sie täglich Ellas Weinen und Wimmern. Sie konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr auf die Straße treten, ohne die Blicke und die stillen Verurteilungen der anderen zu spüren, in jeder einzelnen Zelle ihres Körpers. Was hatte sie getan? Was war sie nur für ein Mensch? Sie schrieb von Einsamkeit und Aussichtslosigkeit. In allem hatte sie versagt. Sie hatte ein Kind geboren und verstoßen. Sie hatte den Vater des Kindes nicht geliebt, wollte auch nicht mit ihm zusammenleben oder eine Ehe führen, aber allein Mutter zu sein und Ella großzuziehen war unmöglich und war auch jetzt, vier Jahre später, unvorstellbar. Sie konnte nicht, aber wieso konnte sie nicht? Sie war schwach, sie war müde, sie war sich so ungeheuer fremd geworden. Wer würde ihr noch trauen, wo sie sich selbst nicht mehr traute. Das war kein Leben, und das würde auch kein Leben mehr werden. Sie schrieb, dass sie nun — immerhin — den nötigen Mut gefunden habe. Dass sie das bisschen übrig gebliebenen Willen festhalten und übers Meer laufen würde, genauso wie es sich Anna und Edith als Kinder immer vorgestellt hätten. Edith solle sich keine Sorgen machen, Anna wisse jetzt, wie es gehe. Edith verstand sofort. Der schwere Rock. Wasser. Wellen. Strömung. Da musste man sich keine Hoffnungen machen oder anfangen zu suchen. Sie ging zur Polizei und meldete, dass Anna sich das Leben genommen hatte. Der zuständige Polizist nickte betreten, las den Brief an Edith und öffnete zur Beweissicherung auch den Brief an Ella, das Kind:
Meine liebe Ella,
heute wirst Du vier Jahre alt und ich bin ganz nah bei Dir, wie ich überhaupt die ganze Zeit bei Dir bin, weil ich Dich vom Meer aus sehen kann. Es trägt mich überallhin. Ich habe die ganze Welt gesehen. Sie ist groß und schön. Größer und schöner, als die Leute Dir erzählen. Hör nicht hin, schau sie Dir an.
Wahrscheinlich, das hoffe ich sehr, wächst Du prächtig heran und hast längst vergessen, dass es mich einmal gab, aber ich will Dir sagen, ich liebe Dich sehr.
Deine Mutter Anna
Dieser Brief erreichte Ella nie. Er verschwand. Erst in Aktenordnern, dann in den Trümmern eines Krieges.
*
16. Januar 2022
Ideen für Outfits:
blaue Hose, Rollkragenpullover in Apricot, goldene Sonnenohrringe
schneeweißes Oberteil, Winkelrock in Fuchsia
schwarze Anzughose, schokoladenbraunes Mesh-Top
18. Januar 2022
Zurück von einem langen Spaziergang über die große Einkaufsstraße und die kleinen Gassen rechts und links. Bin verschwitzt und habe eine furchtbare Blase an meiner rechten Ferse, weil ich natürlich die silbernen Loafers tragen musste. Manche Dinge lernt man nie. Habe immer das unpassendste Schuhwerk an.
War auch kurz in der Bibliothek und habe durch Zufall ein Buch über Mozarts letztes Lebensjahr entdeckt. Sehr faszinierend. Dabei interessiert Mozart mich überhaupt nicht. Aber in dem Buch gab es feine Skizzen seiner Wohnung. Sie war groß, eher spärlich eingerichtet, und in seinem Arbeitszimmer stand an den Fenstern jeweils ein Stuhl, als sei das Zimmer ein Zugabteil. Mozart, heißt es, war in seinem letzten Lebensjahr vor allem damit beschäftigt, neue Aufträge zu bekommen, und ziemlich verzweifelt, weil ihm das Geld ausgegangen war (oder er einfach zu viel ausgab?). Sein wertvollster Besitz soll seine Kleidung gewesen sein, was ich sehr sympathisch finde. Wer Kleider statt Häuser kauft, nimmt das Leben nicht so ernst.
23. Januar 2022
Habe einen Film auf Mubi geschaut, der hier spielt, und darin sagt eine alte Georgierin, die ihre verloren gegangene Nichte sucht, zu einem süßen Teenager: »Weißt du was, anscheinend ist diese Stadt ein Ort, wo die Menschen hinkommen, um zu verschwinden.«
25. Januar 2022
Vergangene Nacht hat mich wieder diese fremde Frau im Traum besucht. Der letzte Besuch ist etwa vier Jahre her. Sie kommt, seit ich neun oder zehn bin. Ich mag sie, sie ist mir vertraut und ich habe aus irgendeinem Grund stets Mitleid mit ihr. Diesmal lag sie in unserem Garten zuhause, mitten auf dem Rasen, eingehüllt in einen roten Schlafsack. Sie sah so zerbrechlich aus wie ein Kind oder eine Raupe, die sich verpuppt hat. Ich beugte mich über sie, streichelte ihre Wange und fragte: »Was tust du hier?« Sie sagte: »Ich wollte nur mal nachsehen, ob alles in Ordnung ist.«
Wie merkwürdig dieser Traum zu dem letzten Buch von Fleur Jaeggy passt, das ich gerade gelesen habe. Gleich am Anfang gibt es diese eine Szene, die mich ins Mark getroffen hat: Ein Kind, ein Mädchen, acht Jahre alt, wird von der Großmutter gefragt, was es einmal werden will, wenn es groß ist, und das Kind antwortet seiner Großmutter allen Ernstes, dass es sterben will, wenn es groß ist. Sterben. Manchmal sagen oder denken Kinder Sachen, die eigentlich Greisen vorbehalten sind, und das versteh ich gut, hätte ich aber nie so geradeheraus formulieren können. Mir ist dieses unbedarfte Kindsein auch früh abhandengekommen, und deshalb ziehen mich wahrscheinlich auch solche Geschichten an, in denen die Grenzen zwischen Erwachsenen und Kindern auf fast surreale Art und Weise verschwimmen oder verschoben werden. Wenn diese fremde Frau in meinen Träumen auftaucht, überkommt mich jedes Mal der Drang, mich um sie zu kümmern, sie aufzulesen und ins Haus zu tragen, aber sie verschwindet immer rechtzeitig.
*
Rosa kam 1908 auf die Welt. Rosa wie die Farbe, nur weniger lieblich. Rosa war beliebt in der Schule und gefürchtet. Ihre Lieblingsfächer waren Religion und Geschichte, ihr Lieblingsbuch die Bibel, und in dieser Wahl lag auch der Grund für die Furcht der anderen. Rosa war sehr religiös. Ihre Familie war es nicht. Die Religion gehörte nur ihr. Sie war Anhängerin der Siebenten-Tags-Adventisten, trug ausschließlich schwarze, graue oder dunkelblaue Kleider und strenge Flechtfrisuren, verabscheute Kaffee, verzichtete auf Fleisch und hätte sich nie eine Zigarette angesteckt, weil das für sie alles Teufelszeug war. Hosen fand sie für Frauen unangemessen. Lautes Lachen auch. Sie verehrte Ellen G. White, die Mitbegründerin der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, und glaubte fest daran, dass Jesus Christus, der Erlöser, früher oder später, im besten Fall aber zu ihren Lebzeiten, auf die Erde zurückkehren würde. Dann würde die große Auseinandersetzung, der universale Konflikt zwischen Christus und Satan, ein Ende finden und die göttliche Liebe obsiegen. Göttliche Liebe meinte Hoffnung und all die großen guten Begriffe, die sich Menschen wie Rosa vor dem Einschlafen wünschten: Frieden, Einigkeit, Gerechtigkeit, Schönheit. Für Rosa bestand wahre Schönheit nicht in Äußerlichkeiten, nicht in ihren tiefblauen Augen oder ihren langen schwarzen Haaren, sondern — und das war ernst gemeint — in dem unvergänglichen Schmuck der Freundlichkeit und Herzensgüte. Von Montag bis Freitag erledigte sie pflichtbewusst und hilfsbereit ihre Aufgaben als Schülerin und Tochter. Lernte, kochte, las, putzte, rechnete, schuftete. Sie war keine eigenständige Person, sie war Teil einer Gruppe, der sie zu Diensten stand. »Wie geht es Dir?« war eine Frage, die in ihrem Elternhaus nicht existierte.
Nur samstags durfte sie niemand stören. Samstage gehörten ihr. Samstags wusch sie sich gründlich die Füße und sprach nur mit Gott, beteuerte ihm ihre Reinheit und Demut und veranstaltete in ihrem Zimmer ein Abendmahl, weil es in ihrer Stadt weder eine passende Kirche noch einen passenden Ort gab, der heilig genug war, um die Zeremonie ordnungsgemäß durchzuführen. Die Stadt, in der sie mit ihrer Familie lebte, lag an einem Berg, umgeben von dunklem Nadelwald. Auch der war zum Fürchten. Manche Bewohner fanden, Rosa übertreibe es mit ihrer Religiosität. Wie schade, sagten sie, dass das schöne Mädchen nur ihren Gott im Kopf hat, reine Verschwendung bei diesen Haaren und diesen Augen. Andere hatten einfach Mitleid. Über den Tod des Bruders komme sie wohl einfach nicht hinweg, und bei dem Elend und den Schlägen zu Hause könne man ja nur zu beten anfangen. Ihr älterer Bruder, der einstige Liebling der Familie, war 1918 nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er fehlte Rosa jeden Tag. Er war ihr Verbündeter und ihr Schutz vor dem Vater gewesen. Nur der Vater war wieder heimgekehrt, aber stotterte seitdem, und weil er sich dafür so schämte, sprach er fast gar nicht mehr und schlug in seiner Verzweiflung die Mutter und manchmal auch Rosa.
Das Haus der Familie lag am Hang des Berges. Vom kleinen Garten aus sah man die Ruinen einer alten Burg. Im Zentrum, neben Rosas Schule, gab es ein Schloss, das — wie ihre Mutter ihr erklärte — als »Anstalt für Ungezogene« genutzt wurde und um das Rosa stets einen großen Bogen machte. Ihre Mutter drohte damit, Rosa dort einzuweisen, wenn sie sich bei Tisch schlecht benahm, was so gut wie nie geschah, aber die Angst hatte sich bereits beim ersten Mal erfolgreich in den zarten Kinderkörper eingenistet. Wer sich hinter den dicken Mauern der Anstalt verbarg, wusste Rosa nie so genau. Die meisten Leute arbeiteten in der Weberei oder in der Seifenfabrik. Ihre Mutter arbeitete nicht. Sie war Hausfrau. Der Vater ging nach seiner Rückkehr wieder in die Seifenfabrik. Über dem Werk prangte der Slogan: »Ich fühl mich wohl in meiner Haut.« Rosa konnte das von sich nie behaupten. Aber ein Körper war nicht da, um sich wohlzufühlen. Ein Körper musste kontrolliert werden.
Als demütige Dienerin heiratete Rosa 1926, kurz nach ihrem achtzehnten Geburtstag, einen Mann, um ihr Herz in Liebe zu verbinden, so wie Gott (und ihr Vater) es befohlen hatten. Was das genau meinte, wusste sie nicht. Der Mann war ein paar Jahre älter als sie und ein Kollege ihres Vaters. Er war ein eifriger Arbeiter, ein ordentlicher Mann mit ordentlichen Ambitionen. Die Eltern arrangierten alles Notwendige. Nach der Hochzeit zog der neue Ehemann bei ihnen ein und ersetzte den verlorenen Sohn. Rosa und er bekamen ein Zimmer im Obergeschoss. Gegessen wurde stets gemeinsam. Geküsst nur auf dem Bahnhof. Frauenstimmen sprachen nur, wenn sie dazu aufgefordert wurden. Bis zur endgültigen Vereinigung, der Geburt eines Kindes, dauerte es sechs Jahre. Rosa war überzeugt, dass diese Jahre und dieser grässliche Akt, den es auszuhalten galt, eine Prüfung waren. Ihr Glauben blieb standhaft. Ihr Körper tat, was er tun musste. Im Sommer 1932 brachte sie schließlich ein Mädchen auf die Welt. Viola. Rosa vergötterte das Kind. Apfelbäckchen. Mund wie ein Rosenblatt. Fast zu schön, glaubte Rosa manchmal und erinnerte sich an die Blicke, die sie als Mädchen dulden musste. Sie entschied, das Kind vorerst nicht in der Stadt auszuführen. Viola wuchs im Garten auf, in den zwei Stockwerken des Hauses am Hang und auf dem Schoß ihrer Mutter Rosa. Jeden Abend presste Rosa ihre Tochter fest an sich und flüsterte ihr ein Dutzend Gebete ins Ohr. Mit vier Jahren konnte Viola die achtzehn wichtigsten Glaubensüberzeugungen der Adventisten auswendig vortragen. »Als Satan Adam und Eva zur Sünde verleitete, brachte er den Geist des Aufruhrs auch auf unsere Erde. Diese Sünde hat das Bild Gottes im Menschen entstellt und die geschaffene Welt in Unordnung gebracht.«
Während Rosa und ihre Tochter Viola Sätze wie diese vor sich herbeteten, marschierten Ehemann und Vater mit roten Armbinden durch die Stadt und propagierten einen großen Neuaufbau ihres Landes. Rosa machte das Getöne dieser neuen Ideologie nervös. Dieser Neuaufbau versprach keine Liebe. Er versprach Hass und Dunkelheit. Die Erlösung der Menschheit, wo war sie? Was war sie? Rosa fing an, sich vor der Zukunft zu fürchten, und klammerte sich panisch an die heiligen Sätze. Jeder neue Tag war für sie ein weiterer Schritt Richtung Unheil. Sie fing an, sich die langen schwarzen Haare auszureißen, und wusch sich die Füße jeden Tag zur vollen Stunde. Auch nachts. Rein bleiben um jeden Preis. An den Spiegel ihres Badezimmers heftete sie eine Notiz mit einem Zitat von ihrer hochverehrten Ellen G. White: »Der Kampf gegen das eigene Ich ist der härteste, den es auszufechten gilt.« Als ihr Ehemann und ihr Vater 1939 zum Kriegsdienst eingezogen wurden, war Rosa halb kahl und trug ein Kopftuch, um die Narben auf ihrem Schädel zu verstecken.
*
27. Januar 2022
Die Frau vom Kiosk an der Ecke erkennt mich wieder und fragt, wie es geht. Spiel zwischen Fremdem und Vertrautem. Ich bin eine von Millionen. »Nimm’s leicht«, sagen die Leute, wenn sie den Laden verlassen. Das gefällt mir.
31. Januar 2022
Die Wohnung hier ist sehr gut.
In der Küche gibt es einen Gasherd, einen Backofen, eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher, einen Kühlschrank mit Eisfach, ein Spülbecken und einen Geschirrspüler. Es ist alles da, aber es gibt keinen Tisch. Im Flur hängt ein Schwarz-Weiß-Porträt von einem Mann mit Schnurrbart. Und ein großer Spiegel. Im Badezimmer steht eine Waschmaschine. Dusche, Toilette, Waschbecken. Die Toilette ist ungewöhnlich hoch. Das Wasser ist sehr weich. In dem Schrank unterm Waschbecken schimmelt es. Die Fenster von Wohn- und Schlafzimmer blicken aufs Wasser. Das ist das Beste. Und es gibt einen kleinen Balkon, aber die Brüstung ist so niedrig, dass ich mich nur in besonders gefasstem Zustand raustraue, und das ist nicht sehr oft. Im Wohnzimmer hängt eine orange Lampe, an der langen Wand steht ein lindgrünes Sofa aus Samt, vor dem Fenster steht ein Tisch aus dunklem Holz mit zwei passenden Stühlen. Sie sind sehr hart und nicht sonderlich bequem, aber man kann gut auf ihnen denken.
In der einen Ecke des Wohnzimmers steht ein Nadelbaum. Er ist groß und ausladend. In der anderen steht ein Feigenbaum. Als ich kam, hatte er nur ein Blatt. Jetzt hat er fünf. Das freut mich. Es gibt kein Bücherregal, aber die Fensterbänke sind breit und lang genug, um Bücher darauf abzulegen. Das Haus wurde 1910 erbaut. Die Wände im Schlafzimmer sind blau gestrichen. Eine Mischung aus Tauben- und Yves-Klein-Blau. Es gibt einen Einbauschrank, was ich genial finde. Und natürlich ein Bett. Und einen ramponierten Nachttisch mit einer weißen Lampe aus Plastik. Das Bett ist etwas ausgelegen. Die Matratze ist alt und hat Flecken. In der ganzen Wohnung liegen Dielen. Das ist großartig. Die Wohnungstür hat zwei Schlösser. Beide muss man abschließen, wenn man die Wohnung verlässt. Und vor der Tür gibt es ein Gitter, man soll es benutzen, wenn man für ein paar Tage wegbleibt, aber das tue ich nicht. Das Gitter steht immer offen.
*
Die sogenannte Anstalt für Ungezogene, von der Rosa als Kind noch nicht präzise wusste, wer und was sich dahinter verbarg, weil zuhause nur in bedrohlich unheimlichem Ton darüber gesprochen wurde, existierte seit 1892. Es war die Klassenlehrerin, die Rosa und ihre Mitschülerinnen in der Oberstufe darüber aufklärte, was auf dem Backsteingelände, hinter den drei Meter hohen Mauern, tatsächlich geschah. Ein blondes Mädchen hatte sich zu Beginn des letzten Schuljahres den Rock gekürzt und sich auf die entblößten Knie bunte Blumen gemalt. Dieser Akt wurde an der Schule brachial geahndet. Die Mitschülerin wurde von der Direktorin vor allen mit dem Rohrstock bestraft. Zehn Hiebe auf den Rücken. Nachahmerinnen, das war allen klar, würde es danach nicht mehr geben. Das war keine Sache von Mut, sondern Überlebenstrieb. Die Direktorin hatte währenddessen Wörter für dieses Mädchen benutzt, die in Rosas Vokabular bis dahin überhaupt nicht vorkamen. Böse Wörter, schmutzige Wörter, schlechte Wörter. Am nächsten Tag hielt ihre Lehrerin ihnen außerdem einen eindringlichen Vortrag über die Anstalt, denn genau dorthin würden Mädchen kommen, die sich unanständig verhielten. Die Drohung, in eine Anstalt eingewiesen zu werden, hatte Rosa schon genügt. Anstalt, das war schließlich bloß ein anderes Wort für Gefängnis. Aber die Lehrerin wollte sicherstellen, dass ihre Schülerinnen nicht nur verstanden, sondern vor ihrem inneren Auge sahen, was das wirklich bedeutete. Die Mädchen und Frauen, die in die Anstalt kamen, mussten sich als erstes ausziehen. Sie wurden mit kaltem Wasser abgeduscht und anschließend desinfiziert, wie kranke Pflanzen, auf denen sich Ungeziefer ausgebreitet hatte. Eine schreckliche Vorstellung. Danach wurden sie in Zellen gebracht, in denen es nichts gab außer alten Kasernenbetten. Die Mädchen und Frauen mussten Lumpen mit Löchern tragen und bekamen Akten mit vernichtenden Vermerken. Seit diesem Vortrag war Rosa nach der Schule noch schneller nach Hause gelaufen und hatte den Kopf nur kurz gehoben, wenn sie eine Straße überquerte. Ihr Blick hatte sich am Asphalt festgehalten. Vielleicht war für manche schon ein Augenaufschlag zu viel. Ab wann galt man genau als liederlich? Rosa wusste es nicht, und weil sie es nicht wusste, vermied sie jede unnötige Geste, jedes Lächeln. Die Sätze der Lehrerin und die Bilder, die sie auslösten, hatten sich so in sie eingebrannt, dass nicht nur die Anstalt, sondern die ganze Stadt Unbehagen in ihr auslöste. Kann sein, dass Rosa sich unterbewusst auch deshalb als junge Mutter entschied, Viola gar nicht erst in die Stadt mitzunehmen. Das Leben als Frau und Mädchen war riskant. Es genügte, zu lang am Bahnhof zu sitzen, mit der falschen Begleitung oder einem zu grellen Lippenstift gesehen zu werden, um aufgegriffen und in die Anstalt gebracht zu werden. Im Prinzip, das war Rosa bewusst, konnte jedes weibliche Wesen dort enden. Wer noch nach Einbruch der Dunkelheit allein durch die Stadt lief, galt als Herumtreiberin, und solche Frauen wurden weder von der einstigen Klassenlehrerin noch von irgendjemandem sonst toleriert. Solche Frauen waren gemeingefährlich und mindestens etwas eigenartig, und ein Land wie das, in dem Rosa und nun auch ihre Tochter Viola lebten und aufwuchsen, brauchte nicht eigenartig, sondern angepasst. Das stand zwar nirgendwo offiziell, aber das stand zwischen den Leuten, lag in ihren Blicken und auf ihren Zungen.
Als Rosas Ehemann und Vater anfingen, mit ihren roten Armbinden durch die Stadt zu marschieren, wurden auch neue Pläne für die Anstalt geschmiedet und auf einer Stadtversammlung verkündet, über die sie ihr Mann stolz informierte. Man würde die Bevölkerung ab sofort nicht nur vor promiskuitiven Frauen beschützen, sondern auch vor allen anderen, die sich nicht an die Regeln hielten, anders dachten, anders lebten, anders aussahen. Ab 1939, als das Unheil, vor dem Rosa sich so fürchtete und gegen das sie täglich anbetete, vollständig in ihrer Heimat angekommen war und Ehemann und Vater an der Front für ihre neue Ideologie kämpften, beobachtete sie manchmal, wie Menschen, Frauen und Männer, Junge und Alte aufgereiht vor die Anstalt treten und in Transporter steigen mussten. Was mit diesen Leuten geschah, blieb für sie im Verborgenen, aber Rosa verstand, dass diejenigen, die da einstiegen, nicht zurückkehren würden.
*
3. Februar 2022
Lerne neu, was mir gefällt: morgens nach dem Laufen auf dem lindgrünen Sofa sitzen, während die Sonne sich über die Hügel schiebt. Merken, dass es nichts Schöneres gibt, als dabei zuzusehen, wie der Tag beginnt. Danach im Café am Wasser sitzen. Virginia Woolf lesen (der irgendwann auch alles zu viel wurde). Die Leute beobachten, wie die junge Frau mit der roten Daunenjacke und der dunkelgrünen Wollmütze, die mit schnellen Strichen den Horizont in ihrem Notizbuch festhält. Der Himmel hier ist so blau.
5. Februar 2022
Habe den Nachmittag damit verbracht, meinen Ring zu suchen. So eine gottverdammte Zeitverschwendung. Ich hasse es, Dinge zu verlieren. Habe ihn schließlich in der Ritze vom Sofa gefunden. Wie früher. Hätte ich auch gleich draufkommen können. Unser Sofa damals war auch grün, aber etwas dunkler, eher so Tannengrün und aus Baumwolle und nicht aus Samt. Ich weiß noch, wie wir einzogen. Unsere erste eigene Wohnung. Ich war vier. Die Wohnung lag am Stadtrand in einem Neubau, schicker ging es damals nicht. Heute gruselt mich die Erinnerung an diese Häuserblocks. Mama schlief auf dem Sofa. Ich bekam mein erstes eigenes Zimmer und einen eigenen Schlüssel. Nach dem Kindergarten und später nach der Schule lief ich allein nach Hause. Manchmal schloss ich mich nachmittags aus, zog beim Müllrausbringen aus Versehen die Tür hinter mir zu und saß dann stundenlang auf den kalten Stufen im Treppenhaus und wartete. Telefone gab es nicht. Meine Mutter arbeitete. Sie kam selten vor Sonnenuntergang. Samstags schauten wir die Mini Playback Show und aßen Brote mit Spiegelei. Das war schön. Manchmal brachte meine Mutter einen Freund mit nach Hause, und wir tranken zur Feier des Tages Kakao, der viel zu heiß war und an dem ich mir die Zunge verbrannte. Die Freunde blieben nie über Nacht. Sonntags weinte meine Mutter, und ich versuchte sie zu trösten. Vielleicht hatte sie Heimweh. Sie war so jung, und Oma Vi wohnte am anderen Ende der Stadt. Oma Vi, die immer auf uns aufgepasst hatte. Wenn Mama weinte, wünschte ich mir in meiner Verzweiflung und manchmal auch Panik, sie würde kommen und helfen. Denn ich war gegen das Geheule macht- und hilflos. Aber Oma Vi kam nicht, weil ich sie nicht rufen konnte. Ich hatte damals ständig das Gefühl, aufpassen zu müssen. Mama das Kind.
Mutter, Tochter, Enkelin. Wer zieht wen auf? Wenn ich an meine Kindheit denke, frage ich mich, wer bei uns die Mutter war, wer in unserer Linie welche Rolle spielte und was das bei uns angerichtet hat.
*
Ella war fünf Jahre alt, als ihr 1934 ein Pferd die Hälfe ihres linken Mittelfingers abbiss. Seitdem war sie nie wieder auf eine Kutsche gestiegen, und wenn sich das Wetter änderte, merkte sie das Tage vorher an dem Ziehen und Stechen in ihrem schmalen, verkürzten Finger. Mit sechs Jahren kam Ella wie jedes Kind in die Grundschule, lernte lesen und schreiben und dass die Welt größer, aber auch komplizierter war, als sie sich vorgestellt hatte. Manchmal überforderte sie das. Kleine Geschichten mit ersten geschriebenen Worten und Zeichnungen zu erfinden half. Kurz nach ihrem siebten Geburtstag traute sie sich, das erste Mal nach ihrer Mutter zu fragen.





























