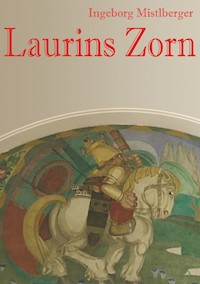Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Major Dr. Joschi Bernauer, Leiter der Mordkommission Salzburg, ermittelt international in allen Facetten der Welt des Glamours.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Autorin:
Ingeborg Mistlberger ist Verfassungsjuristin und begeisterte Bridgespielerin. Sie studierte Rechtswissenschaft und Katholische Theologie in Linz/Donau. Bekannt wurde sie mit der Vorstellung ihres ersten Romans „Mörderischer Kontrakt, Die Fälle des Major Joschi Bernauer“ auf der Leipziger Buchmesse 2016, die das Interesse von Fernsehen und Presse nach sich zog.
Alle in diesem Buch vorkommenden Personen, Schauplätze und Handlungen sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder Ereignissen sind rein zufällig.
Personen der Handlung:
Major Dr. Joschi Bernauer, Leiter der Mordkommission Salzburg
Hofrat Dr. Sassmann, Polizeidirektor Salzburg
Major Dr. Markovsky, Leiter der Mordkommission Linz
Dr. Jan Kapnic, Leiter der Mordkommission Prag
Adil Murad, Designer in Prag
Architekt Miroslav Nowotny, Stadtrat in Prag
Jurek Touschek, Bediensteter und Bodyguard bei StR Nowotny
Baron Jean Julian Dechaump, Geschäftsführer einer Schweizer Kunstgalerie
Karel Meston, Starfotograf in Prag
Marianne Burger, Sekretärin Karel Mestons
Detlef König, Jungfotograf in Prag
Irina Aigner, Model bei Adil Murad
Hedwig und Josef Aigner, Eltern Irinas
Chantal Popud, Leiterin einer Künstleragentur in Paris und ehemals Model bei Adil Murad
Eloise Landers, Model bei Adil Murad
Helene Dietrich, vlg. Leni, Freundin Eloise Landers, Tänzerin
Howdy Miller, Regisseur
Luth Murad, Adil Murads Bruder
Hatto Cornelius, Freund Markovskys
Dr. Joschi Bernauer legte kopfschüttelnd den Brief einer Prager Notariatskanzlei vor sich auf den Schreibtisch. Das ganze konnte nur ein Missverständnis sein, denn hier wurde er kurioserweise als persönlich Betroffener zu einer Testamentseröffnung in dieses Notariat in Prag gebeten.
„Der Onkel aus Amerika“, dachte er amüsiert und holte sein Handy aus dem Jackett, „ein Anruf und schon ist der Traum zu Ende.“
Noch während er damit beschäftigt war, die Telefonnummer der Kanzlei einzugeben, klingelte das Telefon neben seinem Ellenbogen.
Seufzend griff er zum Hörer, legte dann achtlos sein Handy beiseite und vergaß sofort Notar und Testament. In Gneis, einem Vorort Salzburgs, hatten Kinder beim Spielen im Scharfrichterhaus, im Volksmund Henkerhaus genannt, eine weibliche Leiche in merkwürdiger Verkleidung gefunden.
Spurensicherung und Gerichtsmediziner waren vor Bernauer eingetroffen und er registrierte verwundert, dass sich die Schar der Gaffer, die sonst üblicherweise die Arbeiten am Tatort behinderte, in überschaubaren Grenzen hielt.
Vermutlich lag es auch daran, dass das Gelände nicht besonders gut einsehbar war, denn Hecken und Gebüsche säumten die Gegend um das Haus, sodass zufällige Passanten eher nicht zu erwarten waren.
Die tote Frau lag immer noch in dem morschen Gebäude, obwohl der Gerichtsmediziner die Untersuchung bereits beendet hatte.
„Das Mädchen ist dem Anschein nach erstickt“, sagte er, „mehr dazu später.“
Bernauer trat durch die altersschwache Türe ins Innere des baufälligen Hauses und nahm erleichtert zur Kenntnis, dass die Spurensicherung den Tatort samt der näheren Umgebung stark ausgeleuchtet hatte. Das Mädchen lag höchstens einen Meter vom Eingang entfernt auf dem Fußboden, den zu betreten im überwiegend herrschenden Halbdunkel gefährlich gewesen wäre, da bereits mehrere Bohlen vermorscht oder ausgebrochen waren.
Nach Schätzung Bernauers war die junge Frau höchstens zwanzig Jahre alt, mittelgroß, langhaarig und blond. Ihr Gesicht hatte sich zwar durch den qualvollen Tod verändert, aber man konnte davon ausgehen, dass es ein sehr hübsches gewesen sein musste.
Bekleidet war die Leiche mit einem groben, ungebleichten Kittel aus Leinen, so, wie es in den dunklen Zeiten des Strafrechts üblich gewesen war, wenn man einen Delinquenten zum Galgen führte. Die Augen waren mit einem schwarzen Tuch, das nun neben der Leiche lag, verbunden gewesen. In den gefesselten Händen dürfte sie den Kranz, der um ein schwarzes Kreuz gebunden war und jetzt vor dem Haus lag, gehalten haben, da sich Tannennadeln in den weiten Ärmeln des Büßerhemdes verfangen hatten.
Um den Hals der jungen Frau lag ein Strick und unsichtbar, unter dem Kittel versteckt, trug sie einen breiten Lederriemen um den Brustkorb, der im hinteren Teil mit einer Metallöse versehen war, durch die ein festes Tau lief.
„Hier wurde eine Hinrichtung simuliert“, vermutete Bernauer. Es dürfte sich also um die Szene eines Theaterstückes gehandelt haben.“
War das ganze ein schrecklicher Unfall gewesen? Allerdings sah er in diesem baufälligen Gebäude keine einzige Halterung, die man einigermaßen mit Gewicht hätte belasten können und keine erkennbaren Spuren, die auf Zuschauer hingewiesen hätten. Ebenso gab es vorerst auch keine Hinweise auf die Identität des Mädchens oder die Veranstalter dieses geschmacklosen Schauspiels.
Bernauer trat vor das Haus während die Spurensicherung dabei war, ihren Tätigkeitsbereich auf die Umgebung auszudehnen.
Ein kleiner Junge, der sich bis an die Absperrung heran gedrängt hatte, versuchte jetzt durch heftiges Winken die Aufmerksamkeit Bernauers auf sich zu ziehen.
„Bist Du auch im Haus gewesen?“ fragte er das Kind.
„Ja, aber das soll Mama nicht wissen“, flüsterte der Bub, „wir dürfen da nämlich nicht spielen, weil die Geister noch nicht erlöst sind. Früher sind die Toten hier ganz lange ausgestellt gewesen, weil manchmal nicht alle zuschauen konnten, wenn die Mörder aufgehängt wurden. „Da“, sagte er und zeigte mit dem Finger auf den Rasen vor dem Haus, „da sieht man noch, wo der Galgen gestanden ist.“
Bernauer nickte verständig und blickte auf die Stelle, die der Junge bezeichnet hatte. Man sah tatsächlich noch immer, wo sich das Fundament des Galgens befunden hatte.
„Gut, dass Du mir die Stelle gezeigt hast. Sagst Du mir jetzt auch Deinen Namen?“ fragte Bernauer.
Das Kind trug sichtlich einen Kampf zwischen seiner Wichtigkeit einerseits und der Angst vor der Strafe wegen seines Ungehorsams andererseits aus.
„Nein, das geht nicht“, sagte der Bub entschlossen, „es ist wegen Mama“ und wieselflink war er durch das Gebüsch verschwunden.
„Wer hat denn nun den Leichenfund gemeldet?“ fragte Bernauer den Kollegen, der sich als erster am Tatort eingefunden hatte.
„Die Mutter eines der Kinder, eine Krankenschwester, sie ist aber derzeit im Dienst auf einer Unfallstation“, antwortete er, „soll sie vorgeladen werden?“
„Sagen Sie ihr, sie möchte sich so schnell wie möglich mit mir in Verbindung setzen, am besten gleich telefonisch“, entschied Bernauer, „wieso hat sie denn erst aus ihrer Dienststelle angerufen?“
„Sie war nicht sicher, ob sie die Behauptung ihres Sohnes überhaupt glauben sollte. An das alte Haus knüpfen sich jede Menge Gruselgeschichten, Kinder haben daran natürlich das größte Interesse und lassen dann auch noch ihre Phantasie spielen. Nachdem es ihnen streng verboten ist, dort zu spielen, den Zustand des Hauses haben Sie ja gesehen, wollte sich keines der Kinder den Eltern anvertrauen. Nur die kleine Schwester eines Jungen, die das Gespräch der Kinder belauscht hatte, verpetzte ihren Bruder Max, aber niemand schenkte der Geschichte von der bizarren weißen Gestalt im Henkerhaus Glauben.
Am nächsten Tag schlichen die Buben dann doch wieder vorsichtig in das unheimliche Haus zurück um nach der toten Frau zu sehen und wie am Vortag lag sie noch immer am Boden hinter der Tür.
Dieses Erlebnis war für Max zu viel. Er rief seine Mutter im Krankenhaus an, beichtete ihr den neuerlichen Besuch im Henkerhaus und beschwor sie, ihm zu glauben, dass er und seine Freunde heute, wie schon am Tag vorher, die Leiche auf dem Fußboden gesehen hätten. Sehr verunsichert hatte seine Mutter dann die Polizei gerufen.“
Bernauer war gerade wieder ins Büro gekommen, als bereits sein Telefon schrillte. Schneller als erwartet und äußerst besorgt fragte jetzt die Mutter des kleinen Max, ob er der zuständige Beamte in der Sache der Toten im Henkerhaus sei.
„Ja, da sind Sie richtig“, antwortete Bernauer, „ich danke für den schnellen Rückruf.“
„Das ist doch selbstverständlich“, sagte sie hastig, „was soll denn nun geschehen?“
„Ich müsste dringend mit Ihrem Jungen reden“, erklärte Bernauer vorsichtig, „und die Befragung wird auch keinen Schaden anrichten, denn wir sind im Umgang mit Kindern sehr erfahren, außerdem haben die Jungen am nächsten Tag freiwillig noch einmal dieses Haus aufgesucht um nach der Toten zu sehen und es wäre bestimmt nicht sehr sinnvoll, sie mit diesem Problem ihrer Phantasie zu überlassen. Sind Sie einverstanden?“
„Natürlich bin ich einverstanden“, sagte sie, „im Gegenteil: Max wird es genießen, im Polizeipräsidium als Zeuge auftreten zu dürfen, er wird der Held seiner Schulklasse sein.“ Bernauer lächelte und bat sie noch, Max nach den Namen derjenigen Buben zu fragen, die bei der Auffindung der Toten dabei gewesen waren.
„Wenn es Ihnen hilft“, erklärte sie sich bereit, „kann ich auch mit deren Eltern sprechen und könnte mir vorstellen, dass auch sie einer Befragung zustimmen werden.“
Bernauer bedankte sich erleichtert.
„Warten Sie“, sagte er, „allen Buben, die zu einer Aussage ins Präsidium kommen, verspreche ich, dass sie mit der Funkstreife geholt und dann wieder zu Hause abgeliefert werden.“
Am nächsten Tag waren fünf ungefähr Elfjährige im Stadtteil Gneis von einem Funkstreifenwagen abzuholen.
Die Erzählungen der Kinder wichen im Prinzip nicht voneinander ab, es sei denn, es ging um die Behauptung jedes einzelnen, er selbst sei in der gefährlichen Sache der mutige Rädelsführer gewesen.
Die Buben waren verbotener Weise um das Haus geschlichen und einer von ihnen rieb neugierig den Staub von einer Fensterscheibe, um in den Raum zu spähen. Aufgeregt entdeckte er einen hellen Fleck am Boden vor der Tür und obwohl sie alle davon überzeugt waren, es müsse sich um einen Geist handeln, der auf ein Menschenopfer lauere, war Max mutig hingegangen, um gegen die geschlossene Tür zu treten. Zu seinem Schrecken schlug sie jedoch auf und er stand vor der am Boden liegenden Gestalt, wobei er allerdings auf den ersten Blick erkannte, dass hier statt des erwarteten Geistes eine tote Frau lag.
Die Neugier war schnell verflogen und in ihrem Schreck waren die Buben weggelaufen. In der Sicherheit ihrer nahe gelegenen Siedlung angekommen, hatten sie sich dann geschworen, niemandem und unter keinen Umständen ihr schreckliches Geheimnis zu verraten. Unbeachteter Zeuge war Maxis kleine Schwester.
„Ist Euch im Haus oder in der Nähe vielleicht auch noch etwas anderes aufgefallen?“ fragte Bernauer. „Ein Mensch, ein Auto oder ein Gegenstand, auch wenn es nichts besonderes war.“
Die Kinder schüttelten die Köpfe.
„Nein“, sagte plötzlich Max, „aber vielleicht, die Zigarette.“
„Wo? Im Haus?“
„Nein, auf der Wiese vor dem Haus. In der zerknüllten Hülle war nur noch eine Zigarette.“
„Habt Ihr sie mitgenommen?“
„Ja“, sagte Max, „wir haben sie in den Bach geworfen, die Hülle schwimmt nämlich wie ein Schiff zwischen den Steinen und kentert dann unter der Brücke.“
Es war Bernauer völlig klar, dass die Buben heimlich die Zigarette geraucht und dann die Schachtel samt Plastikhülse in den Bach geworfen hatten, aber das würden sie in Anwesenheit der Eltern natürlich nicht zugeben.
„Erinnert sich jemand an die Zigarettenmarke?“ fragte er.
„Marlboro“, sagte einer der Buben.
„Nein“, widersprach Max, „die sind doch rot, es waren die, die auch der Mann im gelben Lamborghini geraucht hat. Die mit dem blauen Rand.“
„In einem gelben Lamborghini? Wo gab es denn solch einen Schlitten zu sehen?“
„Beim Gasthof Hölle“, erinnerte sich Max, „aber das war schon vor einer Woche, mindestens.“
Zwei Männer, erzählten die Buben, waren damals zu Fuß von der Siedlung heruntergekommen, in den Lamborghini gestiegen und weggefahren. Einer hatte dabei eine Zigarette geraucht und beim Wegfahren den Stummel samt leerer Schachtel aus dem Wagen auf die Straße geworfen und auch diese hatten die Buben zu einem Schiff umfunktioniert. Auf das Kennzeichen hatten sie allerdings nicht geachtet, aber Max glaubte sich an ein C auf der Nummerntafel erinnern zu können.
Beim Gasthof Hölle hatte der gelbe Lamborghini zwar ebenfalls Aufsehen erregt, aber die beiden Männer, die nicht Gäste des Hotels gewesen waren, hatten lediglich an einem der Gartentische Kaffee getrunken. Eine Kellnerin behauptete, am Wagen ein Schweizer Kennzeichen wahrgenommen zu haben, während der Hausdiener der Meinung war, es habe sich um eine tschechische Nummerntafel gehandelt.
Hingegen dürfte auch niemand das tote Mädchen gekannt oder wenigstens gesehen haben, allerdings kam das Foto der Toten dem Erscheinungsbild der lebenden jungen Frau vermutlich nicht sehr nahe.
Die Obduktion ergab, dass die Unbekannte ein Übermaß Haschisch zu sich genommen hatte, außerdem betrug der Alkoholwert zwei Promille. Ihr Alter musste zwischen achtzehn und zwanzig Jahren gelegen sein.
Der Tod war durch Ersticken eingetreten und dies zwei Tage bevor die Kinder sie gefunden hatten.
Ausgelöst durch den übermäßigen Genuss von Wodka nach dem Konsum des Rauschgiftes hatte die Muskulatur des Mädchens ihre Spannkraft verloren, die Zunge war in den Rachen zurückgerutscht und hatte den Atemweg versperrt, aber bei fachgerechter Behandlung wäre die junge Frau vermutlich zu retten gewesen.
Um ihren Brustkorb verlief eine ringförmige Drucklinie, die darauf zurückzuführen war, dass sich der Ledergurt fest um ihre Rippen geschlossen hatte, wahrscheinlich, als sie an dem Seil emporgezogen worden war. Dies wäre für die Frau völlig ungefährlich gewesen und sie sei auch nicht in vertikaler, sondern horizontaler Lage erstickt. Anzeichen von Gewalt hatte es nicht gegeben.
Auch die Spurensicherung erbrachte keine weiteren Hinweise.
---------------
„Ungeheuerlich“, empörte sich Hofrat Sassmann.
„Glauben Sie, dass es sich hier um eine der Darstellungen obsessiver Brutalitäten handelt, die jetzt langsam überhand nehmen? Man schreckt ja sogar im Fernsehen nicht mehr davor zurück diese Abscheulichkeiten zur besten Sendezeit anschaulich vorzuführen. Früher hat man Dinge lediglich angedeutet und den Rest der Phantasie des Zusehers überlassen, ich denke da zum Beispiel an den spannenden Hitchcock-Film ‚Psycho’. Heute verkauft sich offensichtlich nur mehr anschauliche, ekelerregende Realität.“
„Merkwürdig ist auch“, sagte Bernauer, „dass nicht festzustellen ist, ob oder wie viele Zuschauer es gegeben hat. Meinem Dafürhalten nach waren es für eine derartig aufwändige Inszenierung auffallend wenige, sonst müsste der Rasen um das Haus zertreten sein.
Nach dem Obduktionsergebnis dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben, natürlich mit unterlassener Hilfeleistung. Dies wäre dann wiederum ein stärkeres Indiz für die Abwesenheit von Zuschauern.“
„Haschisch“, meinte Sassmann, „da hätten wir doch einigermaßen Erfahrung.“
„Das Geschäft mit Gras ist noch immer ein Balanceakt zwischen Reden und Schweigen“, stellte Bernauer fest, „man wird uns nichts freiwillig mitteilen, wenn es nicht hinlänglich bewiesen ist.“
Dann holte Bernauer den Brief aus der Notariatskanzlei in Prag aus der Sakkotasche und legte ihn vor Sassmann auf den Schreibtisch.
„Sehen Sie sich so etwas an“, sagte er, „es kommt mir vor wie ein Witz. Ein tschechisches Notariat lädt mich ein, zu einer Testamentsverhandlung in Prag zu erscheinen, dabei kenne ich dort keinen einzigen Menschen.“
„Mysteriös, ja, aber ein Witz? Glaub ich nicht, es gibt da Dinge zwischen Himmel und Erde, na sie wissen schon. Warum tun Sie nicht, was Sie sonst immer tun, Bernauer, ermitteln Sie einfach.“
Die Auskunft aus Prag war aber dann ebenso simpel wie eindeutig. Bernauer wurde in einem Testament eines Prager Bürgers bedacht und daher dringend gebeten, in drei Wochen in der Notariatskanzlei in Prag zu einer Testamentseröffnung zu erscheinen.
„Bernauer“, sagte Sassmann, „vorderhand werden wir ohnedies nur Kleinarbeit leisten müssen und vielleicht haben wir sogar schneller Erfolg als man erwartet, also vernachlässigen Sie jetzt ja nicht Ihre persönlichen Angelegenheiten, vielleicht ist das ganze wider Erwarten absolut nicht wertlos. Glücklicherweise spricht der Notar tadelloses Deutsch, was wollen Sie mehr. Also, machen Sie schon.“
---------------
Joschi Bernauer sah ärgerlich auf die Uhr. Er hatte jetzt mindestens eine Viertelstunde damit verloren, sich im Prager Straßengewirr zurechtzufinden.
Wenn er nicht bald das Büro des Notars fand, kam er unweigerlich zu spät.
Sicher wusste er nur, dass er sich in Richtung Theater zu halten habe, fand die vermutlich direkte Straße und fuhr zielstrebig den Schienenstrang entlang, wobei er standhaft die Gewissheit verdrängte, dass das Befahren eines selbständigen Gleiskörpers überall verboten war.
Knapp vor Erreichung des ersehnten Zieles setzte von links her kommend eine Straßenbahn dazu an, sich in seine Fahrbahn einzuschleusen.
Bernauer blieb stehen und zeigte dem Fahrer seinen Verzicht auf den Vorrang an, nahm aber dann unangenehm berührt zur Kenntnis, dass dieser ihn verständnislos ansah. Bernauer schüttelte den Kopf, reihte sich ein und schon schloss hinter ihm eine weitere Straßenbahn auf. Da die Verkehrsampel der davor liegenden Kreuzung auf Rot stand, kam er nun nicht nur bewegungsunfähig eingekeilt zwischen den beiden Zügen zu stehen, sondern auch neben einer Haltestelle, von der aus ihn die Wartenden wie ein seltenes Tier im Käfig begafften.
Als sich der Verkehr endlich weiterbewegte, bog er schnell in die Na Prikope ein und etwa fünfzig Meter weiter fand er die Tiefgarage unter einem Einkaufszentrum. So erreichte er schließlich mit Mühe, doch noch zeitgerecht, die Kanzlei des Notars.
„Entschuldigen Sie mein Eintreffen in letzter Sekunde“, sagte er, „erst bin ich im Kreis durch die Stadt gefahren und dann wurde ich durch zwei Straßenbahnen blockiert.“
„Ich habe es vom Fenster aus gesehen“, meinte der Notar trocken, „dieses Straßenstück dient nur dem Schienenverkehr und unsere Polizei ist sehr schnell. Noch einige Minuten und Sie hätten hundert Euro bezahlt, denn unsere Polizei ist auch sehr humorlos.“
Dabei bot er Bernauer mit einer Handbewegung einen Stuhl vor seinem Schreibtisch an. Der zweite Sessel war von einer verhutzelten alten Frau besetzt, die auf seinen höflichen Gruß nicht im Mindesten reagierte, aber eine hinter ihr stehende jüngere Frau nickte ihm kurz zu.
„Lauter wenig freundliche Zeitgenossen“, dachte Bernauer erbittert, war aber dann doch sehr froh, dass wenigstens der Notar die deutsche Sprache so tadellos beherrschte.
Nach einigen umständlichen Formalitäten kam der Jurist zur Sache und Bernauer erfuhr staunend, dass er im Testament eines alten Mannes bedacht worden sei, genau genommen handle es sich um ein kleines Haus mit Garten in der Altstadt von Prag.
„Das muss ein Irrtum sein“, warf Bernauer verwirrt ein, „ich kannte diesen Herrn nicht einmal, wie kann es da sein, dass er mich zum Erben einsetzt?“
„Es liegt ein verschlossenes Kuvert bei“, sagte der Notar, „das dürfte die Lösung bringen.“
Bernauer öffnete den Umschlag und zog einen Brief in tschechischer Sprache heraus. Ratlos überreichte er ihn dem Notar und bat ihn, das Geschriebene für ihn zu übersetzen.
Widerwillig rückte dieser seine Brille zurecht und begann zu lesen.
Der Verstorbene sei ein langjähriger Freund und Bewunderer der Großmutter Bernauers gewesen, die sich jährlich einbis zweimal zur Kur in Marienbad aufgehalten hatte. Es sei eine unendliche Seelenverwandtschaft gewesen, schrieb er, die ihn, einen immer einsamen und unverstandenen Mann, mit Wärme und Glück erfüllt hätte.
Für diese Wochen hätte er das ganze Jahr gelebt und mit Freude und Interesse ihre Erzählungen gehört, die sich immer voll Stolz um ihren Enkel gedreht hatten. Er selbst hätte auch nach dem Tod der verehrten Frau den Lebensweg Bernauers verfolgt und sich riesig gefreut, als dann er, Dr. Joschi Bernauer, die Leitung des Salzburger Morddezernats übernommen habe.
Dann bat er Bernauer im Andenken an dessen Großmutter das Erbe anzunehmen.
Verwundert stellte Bernauer bei sich fest, dass die Tschechisch-Kenntnisse seiner Großmutter bei weitem besser gewesen sein mussten, als er geahnt hatte und dies, obwohl sie lediglich am Beginn ihrer Ehe ungefähr zwei Jahre in Prag gelebt hatte, als Großvater eine weitere Niederlassung seines Betriebes gegründet hatte.
„Überlegen Sie sich die Sache“, sagte der Notar, „wenn Sie den Nachlass ausschlagen, erbt die ehemalige Haushälterin des Verstorbenen den Besitz“ und zeigte auf die kleine Frau, die noch immer wie angegossen auf ihrem Stuhl saß.
„Sie kann nur nichts mehr damit anfangen und wird ohnedies im Altenheim ihrem Zustand entsprechend gut versorgt.“
„Ich weiß nicht“, sagte Bernauer, „muss ich mich sofort entscheiden?“
Der Notar sah ihn uninteressiert an: „Nein, Sie brauchen auch den Willen des Toten nicht zu respektieren, denn letzten Endes erbt dann in absehbarer Zeit ohnehin der Staat.“
„Ich melde mich morgen“, gab Bernauer zur Antwort, „aber vielleicht könnten Sie mir anderweitig helfen. Gibt es eine Möglichkeit in Prag am Abend irgendwo Bridge zu spielen?“ Plötzlich ging mit dem unangenehmen und bis dahin unsympathischen Notar eine unglaubliche Wandlung vor.
„Sie spielen Bridge?“ fragte er interessiert.
Als Bernauer zustimmend nickte, bat er ihn bei einem Kaffee kurz im Nebenraum Platz zu nehmen
„Hätten Sie Lust heute Abend mit einem meiner Gäste zu spielen?“ fragte der Notar, als er nach einer knappen Viertelstunde wieder ins Zimmer trat.
„Gerne“, antwortete Joschi Bernauer.
„Dann lade ich Sie zu einer privaten Bridgerunde bei mir zuhause ein. Meine Wohnung befindet sich einen Stock höher als die Kanzlei. Wo sind Sie denn abgestiegen?“
„Das Hotel heißt Josef.“
„Das liegt ja ganz in der Nähe, höchstens fünf Minuten entfernt, da können Sie wunderbar zu Fuß gehen. Passt Ihnen sieben Uhr mit einem kleinen Imbiss zuvor?“
„Sehr gut“, sagte Bernauer, „danke.“
Der Abend verlief äußerst vergnüglich und endete damit, dass ihn sein Partner, Adil Murad, libyscher Besitzer eines Modesalons in Prag, einlud, am nächsten Tag die in den Räumen seiner Boutique stattfindende Modenschau als sein Gast zu besuchen. Zur Verwunderung Bernauers konnte er sich auch mit dem Libyer in deutscher Sprache unterhalten.
„Die Eltern meiner Frau sind Prager“, erklärte er „und die gehobene Gesellschaft dieser Stadt beherrscht noch immer Ihre Sprache. Sie werden verstehen, dass ich mich dieser Tradition zu beugen habe.“
Diese Feststellung brachte für Bernauer bereits eine gewisse Vorstellung von der Bonität der honorigen Kundenschicht Adil Murads.
Es sollte aber noch besser kommen.
„Ähnliches werden Sie selten sehen“, sagte der Libyer, „ich kreiere die Kleider in erster Linie für große Auftritte reicher orientalischer Damen und die der östlichen Hochfinanz, bei Hochzeiten zum Beispiel. Natürlich tragen auch Damen der übrigen honorigen Gesellschaft meine Kreationen. Allerdings kein Kleid unter zweihunderttausend Euro.“
Bernauer glaubte nicht richtig verstanden zu haben, wollte aber dann nicht nachfragen, da ihn diese Summe so ungeheuerlich anmutete, dass er sich die Peinlichkeit, sollte der Preis in diesen Kreisen üblich sein oder er sich verhört haben, ersparen wollte.
Aber Murad überging ohnehin jede Entgegnung Bernauers und erläuterte selbst Vision und Gestaltung seiner Schöpfungen.
„Die Libyerin ist eine sehr natürliche Frau, legt aber doch großen Wert darauf, ihre Vorzüge zu pflegen und zu betonen“, sagte er. „Die Schönheit der Pariserin hingegen ist plakativ und daher auch ziemlich kompakt. Meine Intention ist es nun einen Weg zu finden, der gleichermaßen beide Sphären zu einem harmonischen Ganzen zusammenführt.“
„Eine äußerst kostenintensive Intention“, dachte Bernauer, und es waren dann zwei Argumente, die ihn, der sich bei derartigen Veranstaltungen eher langweilte, zusagen ließen. Einmal die Neugierde, wie so ein Kleid beschaffen sein musste um zweihunderttausend Euro zu kosten und zweitens die Tatsache, dass seine Freundin, Dr. Iris Adler, mindestens vier Wochen lang nicht mehr mit ihm sprechen würde, wenn er ihr nicht haargenau über die Sphäre von Reichtum und Glanz berichten würde, ganz abgesehen von der genauen Beschreibung der gezeigten Kreationen.
Im Schatten des angekündigten Ereignisses war nun Bernauer äußerst froh darüber, seinen Smoking mitgebracht zu haben, obwohl dies eher eine Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf einen erhofften Bridgeabend in Prag gewesen war. Schließlich konnte niemand die möglichen Kleidervorschriften der einzelnen Clubs voraussehen.
Bereits der Rahmen der eleganten Veranstaltung am nächsten Abend war ungemein beeindruckend.
Der Saal war höchstens für die Anwesenheit von vierzig Personen gedacht, vollkommen in Hellgrau und Beige gehalten und mit einem Meer weißer Calla-Blüten geschmückt. Die Kleidung der Gäste musste Unsummen gekostet haben und Bernauers Smoking kam ihm hier, obwohl er empfindlich teuer gewesen war, doch ziemlich einfach vor. Seine Skrupel legten sich aber sofort und absolut, als ihm bewusst wurde, wie unverhohlen interessiert ihn der Großteil der weiblichen Gäste in Augenschein nahm.
Hoch gewachsen und schlank hob er sich äußerst angenehm vom Habitus der übrigen anwesenden Herren ab, deren reichlich gefüllte Brieftaschen diesen Mangel im Augenblick sichtlich nicht ausgleichen konnten.
Die vorgeführten Modelle waren in Opulenz und Grazie schwierig bis kaum zu beschreiben. Seide, Tüll und Spitzen waren so überreichlich bestickt mit Gold und Steinen, dass Bernauer das Gefühl hatte, beim Anblick von so viel Glanz und Gloria ersticken zu müssen.
Wer sich in solchen Gewändern bewegte benötigte unbedingt Personal um bekleidet zu werden und später auch zur ständigen Betreuung, denn Schleppen, Schleier, Schleifen und Petticoats mussten auch während eines Auftrittes stets in Fasson gebracht und gehalten werden.
„Ich weiß nicht, ob es wirklich wünschenswert ist, in diesen Prunkpanzern zu stecken“, dachte er und blickte wohlwollend auf die brünette Trägerin eines weißen, mit Perlen überladenen Hochzeitskleides.
Bernauer mochte zierliche Frauen und gezierte Posen waren ihm zuwider. Dieses Mädchen aber hatte trotz großer Robe und aller kosmetischen Raffinessen ein untypisch bezaubernd natürliches Gesicht und ein beinahe scheues Lächeln, welches jedoch die schönen grauen Augen der jungen Frau nicht erreichen wollte.
„Wie eine Braut, die nur aus Gehorsam zum Altar schreitet“, dachte Bernauer, der diese barbarische Sitte zutiefst verabscheute.
„Bella Mora“, grinste neben ihm ein offensichtlich italienischer Gast, der Bernauers Interesse amüsiert wahrgenommen hatte.
In der Pause vor dem großen Finale nahm Joschi Bernauer eine der Champagnerschalen vom Tablett eines befrackten Kellners, schlenderte durch den hellgrauen Saal und besichtigte neugierig auch noch den eleganten Verkaufsraum, bei dem die Türen zu den Umkleidekabinen mindestens ebenso prächtig ausgefallen waren, wie die Schlafzimmertüren eines Rokoko-Schlosses.
Anschließend sollte der letzte Teil der Show beginnen.
Wieder am Laufsteg angekommen wurde Bernauer auf eine Bewegung am Seiteneingang aufmerksam. Der Libyer bat ihn durch ein Handzeichen aus dem Saal zu kommen.
Er verließ den Raum und folgte Murad durch das Entree in ein Büro, in dem bereits aufgelöst und kreidebleich eine junge Garderobiere stand, erstarrt und eine Hand an den Mund gepresst.
Seitlich des gläsernen Schreibtisches schien ein riesiger, leichter Schneeball zu liegen, den ein verschwommener roter Faden durchzog.
Das Model Irina müsse gestürzt und mit dem Kopf gegen die Kante des gläsernen Schreibtisches gefallen sein, vermutete der nach Atem ringende libysche Geschäftsmann. Der jungen Schneiderin, die zur Bedienung Irinas bestimmt gewesen war, fehlten jegliche Kenntnisse der englischen oder deutschen Sprache und auch psychisch wäre sie nicht in der Lage gewesen Auskunft zu geben. Ohne sich zu bewegen hatte sie jetzt still zu weinen begonnen.
Was konnte hier, in diesem abseits gelegenen Büroraum, geschehen sein?
Der Libyer, der nur durch Zufall in sein Büro gekommen war, um seine Nervosität vor dem Finale durch eine Zigarette zu dämpfen, erklärte Bernauer nun anschaulich, wie schwierig es sei, sich in einem solchen Kleid zu bewegen. Mehr als ein Dutzend Stofflagen bauschten sich unter dem Rock der Robe und es bedurfte eines sehr routinierten, konzentrierten Ganges, um nicht mit den hohen Absätzen in den einzelnen Stoffbahnen hängenzubleiben oder noch schlimmer, hinzufallen.
Was die junge Frau allerdings so knapp vor dem Defilee hier im Büro gewollt hatte, könne er sich nicht erklären.
Jetzt sah Bernauer durch das Stoffgewirr auch den Körper des Mädchens und die Blutspur, die sich durch Tüll und Seide mäanderartig ausgebreitet hatte.
Bernauer versuchte nun Adil Murad eindringlich klar zu machen, dass er sofort die Polizei rufen müsse und erklärte sich selbst dazu bereit, den Raum gegen das Betreten jeglicher Personen abzusichern.
Der Mann wollte aber starrköpfig noch das Defilee abwickeln, das ganze sollte ja nicht länger als etwa zehn Minuten dauern und es würde ohnedies schwierig genug für ihn werden, das Fehlen des Hochzeitskleides zu überspielen. Außerdem wollte er noch seine Gäste verabschieden, um sie vor dem schrecklichen Geschehenen und dem zu erwartenden Polizeieinsatz zu schützen. In diesen Kreisen wäre so etwas ausschließlich eine geschmacklose Zumutung.
Da half auch der Hinweis Bernauers nichts, dass die Polizei auf jeden Fall anhand der Gästeliste die einzelnen Personen ausfindig machen würde, um sie einer Befragung zu unterziehen.
Das Finale ging also noch ungehindert über die Bühne, der Designer nahm den versnobten Beifall entgegen und erst als die vornehme Gesellschaft das Haus verlassen hatte, rief der Libyer die Polizei.
Von Anfang an hatte Bernauer das Gefühl, dass der ermittelnde Beamte der Prager Polizei von seiner Anwesenheit wenig begeistert war. Förmlich bat er ihn, nachdem er seine Personalien aufgenommen hatte, für den nächsten Tag zur schriftlichen Protokollaufnahme in die Dienststelle und widmete sich dann weiter seinen Obliegenheiten.
Bernauer verabschiedete sich von Adil Murad, spazierte grübelnd bis über die Karlsbrücke und fand ein kleines gemütliches Lokal, in dem er dann noch etwas abwesend eine Kleinigkeit zu sich nahm, während seine Gedanken unermüdlich um das Geschehene kreisten.
---------------
Am nächsten Tag gab Bernauer dem Notar Bescheid, dass er das Erbe antreten werde und begab sich anschließend in die Polizeidienststelle zur Protokollaufnahme, die dann über einen Dolmetsch kurz und zielstrebig abgespult wurde. Als er später in sein Hotel zurückkehrte, bat man ihn noch an die Rezeption, da eine Nachricht für ihn abgegeben worden sei.
Neugierig öffnete er den Umschlag, der die Visitenkarte eines Fotostudios beinhaltete, auf der handschriftlich um seinen Rückruf gebeten wurde. Was hatte er denn mit einem Fotostudio in Prag zu schaffen?
Er ging in sein Zimmer und wählte die angegebene Nummer. Sofort fragte eine männliche Stimme, bevor Bernauer noch zu Wort kam, ob er der österreichische Polizist sei, der gestern die Modenschau besucht habe.
„Ja“, sagte Bernauer, „der bin ich.“
„Ich muss Sie dringendst sprechen.“ Die Stimme begann leiser zu werden.
„Es geht um den Tod von Irina, niemand darf wissen, dass ich zu Ihnen Kontakt aufgenommen habe.“
„Wer sind Sie?“
„Ich war mit Irina befreundet und stand gestern abends in der Nähe der Boutique, aber Sie haben mich nicht bemerkt.“
„Und was habe ich damit zu tun?“ fragte Bernauer scheinbar unbeteiligt.
„Ich bin Fotograf und kann über die bestimmte Sache nur mit Ihnen sprechen“, sagte der Mann, „es ist zu gefährlich.“
„Wieso gefährlich? Was fürchten Sie denn?“ hakte Bernauer nach.
„Können wir uns nicht irgendwo treffen? Ich habe da eine Auftragsarbeit im Park hinter dem riesigen roten Metronom am anderen Moldauufer. Das werden Sie doch sicher schon gesehen haben.“ Und hastig fügte er noch hinzu: „Sie werden doch nicht vorher abreisen wollen?“
„Ich glaube, das Metronom kenne ich“, sagte Bernauer,
„ziemlich in der Nähe gab es doch das Riesendenkmal Stalins?“
„Ja, genau dort“, hechelte jetzt die Stimme, „wäre Ihnen drei Uhr recht? Ich muss nämlich jetzt Schluss machen.“
„Woher wissen Sie denn, dass ich von der Polizei bin?“ fragte Bernauer schnell.
„Diese Gesellschaft bleibt vollkommen unter sich, also war Ihre Anwesenheit eine Sensation.“
„In Ordnung“, sagte Bernauer, „dann werde ich da sein.“
Ein guter Grund für ihn, sich auch das jenseitige Moldauufer anzusehen, fand er, irgendwo zu Mittag zu essen und den beeindruckenden Park, von dem er schon gehört hatte, zu besuchen.
Beschwingt schritt Joschi Bernauer über den Kiesweg der gepflegten Anlage im englischen Stil. Bernauer liebte englische Gärten im Gegensatz zu jenen à la française, wo ihm die absolutistisch vorgeschriebene Haltung der Pflanzen nie das Gefühl gab, selbst Teil eines lebendigen Gemäldes zu sein.
Vor dem mit dem Fotografen vereinbarten Treffpunkt sah Joschi Bernauer belustigt einem Mann zu, der im Rollstuhl saß und begehrlich auf die Hände eines Passanten starrte, der neben ihm stand und Tabak aus einem Päckchen Van Nelle nahm, um sich eine Zigarette zu drehen.
Als der junge Mann, sein Werk betrachtend, aus dem Augenwinkel wahrnahm, wie sehnlich der Blick des Rollstuhlfahrers auf seiner Zigarette haftete, bot er sie ihm an und begann dann etwas hastig für sich selbst eine weitere zu erzeugen.
Bernauer, der noch das Wechselgeld aus dem Gasthaus bei sich hatte, legte es nach dieser kleinen Szene amüsiert in die hölzerne Schale, die neben dem Mann im Rollstuhl auf einem niedrigen Mäuerchen stand.
„Danke der Herr, vielen, vielen Dank“, sagte dieser und strahlte ihn an.
„Sie sprechen Deutsch?“
„Wissen Sie, ich sitze hier vom Morgen bis hinein in den Abend wenn es nicht gar zu kalt ist“, gab er zur Antwort „und viele Touristen haben ein Herz für einen besitzlosen, alten Mann. Ich möchte allen in ihrer Sprache danken können und Österreicher erkenne ich ohnehin sofort.“
Listig, mit den verwitterten Äuglein blinzelnd, zog er genussvoll an seiner Zigarette und schickte einer vorübereilenden Blondine eine bewundernde Geste nach.
Bernauer fühlte etwas Wehmut und zugleich Freude in sich aufsteigen. Dieser Mann war arm, alt und auf den Rollstuhl angewiesen, aber er kostete jedes kleine Glück, das ihm geboten wurde, voll aus. Wie viel brauchte ein Mensch denn wirklich um glücklich zu sein?
Eine interessante Frage, aber er musste sich jetzt auf die Suche nach dem Fotografen machen.
Der Spaziergänger von vorhin war noch immer mit seiner Zigarette beschäftigt.
„Können wir weiter gehen?“ fragte er plötzlich leise und ohne aufzusehen. Bernauer nickte und sie schritten schweigend nebeneinander durch den Park.
Der andere mochte etwa fünfundzwanzig Jahre alt sein, groß und hager, die überschulterlangen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, mit bleichem Gesicht und großen braunen Augen, die müde blickten und von dunklen Schatten unterlegt waren.
Über seiner Schulter hing an einem Riemen eine große, ausgebeulte Jeanstasche, in der er anscheinend seine Fotoausrüstung bei sich trug.
„Ich habe heute zwei bösartige Kinder im Garten vor dieser Villa fotografiert“, sagte er dann und deutete mit der Hand auf ein ansehnliches Gebäude inmitten eines gepflegten Rasengrundstücks.
„Ich hasse Kinder, sie sind abscheuliche Ungeheuer“, murmelte er, „aber man muss ja schließlich von etwas leben.“
Doch dann, nach einer kurzen Überlegungspause schlug seine Stimmung in Begeisterung um: „Ich möchte gerne als Kriegsberichterstatter oder Modefotograf arbeiten, international, so richtig in die vollen, verstehen Sie?“
„Na, ja“, dachte Bernauer, „irgendwann wirst du dich wohl entscheiden müssen zwischen Howard Russell und Helmut Newton.“
Wenn er ihn nämlich so recht betrachtete, würde es wesentlich besser sein, wenn sich der Anwärter auf den Gipfel künstlerischen Ruhmes doch eher den ungefährlicheren Laufstegen zuwenden würde, beurteilte Bernauer die Angelegenheit wie immer pragmatisch.
„Ach ja“, ergriff der Fotograf wieder das Wort, „dass ich mich vorstelle, ich bin Detlef König, geborener Duisburger. Eigentlich sollte ich ja in Paris sein“, seufzte er, „aber man muss halt immer die größeren Chancen nutzen, in Prag habe ich künstlerisch bessere Entwicklungsmöglichkeiten.“
Bernauer nickte verständnisvoll.
Inzwischen waren sie am großen Teich, der sich in der Mitte des beeindruckenden Parks befand, angekommen.
„Also“, sagte der junge Mann und blickte forschend um sich, „es ist nicht alles so, wie es scheint.“
„Wie es scheint?“
„Ja. Es kann kein Unfall mit Irina gewesen sein. Sie hatte Angst.“
„Angst? Wovor?“ erkundigte sich Bernauer, „warum erzählen Sie das nicht der Polizei?“
Der Fotograf zuckte zusammen. „Polizei?“ fragte er und hob die Achseln, „ich bin doch nicht lebensmüde.“
„Hören Sie.“ Bernauer hob die Stimme etwas, sprach aber sofort wieder leiser als er sah, dass der Mann erschrocken zusammenfuhr. „Was ist denn nun eigentlich los?“ fragte er.
„Sie wollten mir doch erzählen was Sie bedrückt?“
Nach kurzer Überlegung entschloss sich der Fotograf dazu, sich endlich genauer auszudrücken.
„Irinas Eltern leben in einem kleinen Ort in der Nähe von Freistadt in Oberösterreich und glauben, sie wäre Verkäuferin in einem teuren Klamottenladen in Prag, mit einem tollen Modelvertrag dazu.
Tatsächlich aber musste sie jede Arbeit annehmen, die sie bekommen konnte und die einträglichste war noch die Aushilfe als Kellnerin. Es verkehren in diesem Café nämlich viele junge Künstler wie ich und alle haben wir unsere liebe Not damit, die täglichen Lebenskosten aufzubringen.
Einige Mädchen modeln dann auch in ihrer Freizeit, nicht nur wegen des Verdienstes, sondern auch als Basis um später groß rauszukommen, wie etwa Irina. Wir helfen einander so gut es geht und ich fotografiere zum Beispiel die Mädchen für ihre Vorstellungs-Mappen. Ich bin da sehr professionell.“
Er nickte zufrieden, besann sich aber dann wieder auf den Grund der Unterredung und berichtete nun zusammenhängend.
„Vor einigen Tagen habe ich Irina von der Anprobe für die Modenschau bei Murad abgeholt und wartete beim Schuhgeschäft gegenüber.
Irgendwann hielt ein Wagen vor der Boutique und ein Mann stieg aus. Ziemlich groß, weißhaarig und in einem Kaschmirmantel. Er war kaum an der Tür, als diese bereits geöffnet und er auch schon eingelassen wurde. Man musste auf ihn gewartet haben.
Da Murad bei seinen Anproben sogar einen Teil des Personals ausschließt, so sehr fürchtet er sich vor Bespitzelung, habe ich Irina gefragt, um wen es sich da gehandelt hätte. Daraufhin wurde sie blass und antwortete rasch: ‚Keine Ahnung, ich habe niemanden gesehen.‘
Wir haben dann beim Italiener noch Kaffee getrunken, aber Irina war fahrig und wollte schnell nach Hause.“
„Haben Sie zusammengelebt?“
„Nein, es war eine richtige Freundschaft, so unter Kollegen, eigentlich Leidensgenossen.“
„Das Schicksal vieler jungen Leute“, dachte Bernauer, „aber in diesem Alter ist man noch stark genug, um sich durchzubeißen.“
„War das alles?“ fragte er.
„Nein. Irina war dann die ganze Woche über nervös, hat beim Servieren Geschirr hinuntergeworfen und mich vor der Modenschau plötzlich gefragt ob ich ihr helfen könnte, noch während der Show zu verschwinden.“
„Verschwinden?“
„Ja, sie wollte abhauen. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt, meinte sie, um unbemerkt zu verschwinden. Man würde sie erst knapp vor dem Auftritt vermissen und bis dahin würde niemand den Saal verlassen und das Defilee müsste auf jeden Fall auch ohne sie stattfinden.“
„Also ging es um anwesende Personen?“
„Vielleicht, wahrscheinlich sogar.“
„Und welche Rolle sollten Sie in der ganzen Sache spielen?“
„Ich habe die notwendigsten Sachen aus ihrer Wohnung geholt, in meine alte Reisetasche gepackt und in mein Studio gebracht, dahinter wohne ich nämlich. Später sollte ich ihr beim Salon Murads helfen aus dem Bürofenster zu klettern.“
„Sie wollte aus dem Fenster klettern?“
„Vor dem Eingang um die Ecke steht bei Murads Veranstaltungen doch immer der Sicherheitsmann“, sagte Detlef König, „ich weiß nicht, vor wem sie genau zu diesem Zeitpunkt verschwinden wollte, aber für mich war der Mann im Kaschmirmantel daran beteiligt, denn mit ihm begann ja auch das ganze Unglück, doch leider ist es auch völlig unmöglich, Herrn Murad damit zu behelligen. Er ist schließlich ein reicher und angesehener Mann, ein Mäzen der Prager Kunstwelt und gilt als freigiebiger Förderer junger Designer. Wie Sie also sehen, habe ich keinerlei Möglichkeit irgendetwas zu unternehmen, schon gar nicht bei der Polizei. Man würde mich für verrückt halten und möglicherweise bekäme ich es dann selbst mit denjenigen Leuten zu tun, die Irina ermordet haben.“
Er wischte sich mit dem Handrücken über die Augen und versuchte, die Geste belanglos erscheinen zu lassen.
„Und“, sagte er, „vermutlich würden sie mich auch umbringen. Ja, ganz sicher sogar.“
Joschi Bernauer wusste jetzt nicht mehr was er denken sollte. Er kannte den jungen Mann nur so kurz und vermutlich war er ein Träumer, der für seine Zukunft rosige Luftschlösser baute und seine Nerven mochten durch das schlimme Ereignis angegriffen sein, aber würde dies so weit gehen, dass harmlose Wahrnehmungen zu derart kriminellen Visionen und Anschuldigungen ausuferten? Es war beinahe sicher, dass der Mann noch andere Beobachtungen gemacht hatte, die er ihm aber, aus welchen Gründen auch immer, vorenthielt.
„Hatte Irina außer Ihnen niemanden, mit dem sie etwas näher bekannt war?“ fragte er.
Detlef König wirkte unangenehm berührt.
„Beruflich schon“, antwortete er, „den Fotografen, den Murad immer beschäftigt, aber Sie sind der einzige Mensch, mit dem ich über die Sache reden kann.“
„Könnte Murads Fotograf etwas über die Sache wissen?“ fragte er.
König zuckte lediglich mit den Schultern.
„Wo ist er denn zu finden?“ erkundigte sich Bernauer.
„Zwei Haustüren weiter, nach der Boutique, aber Sie werden doch meinen Namen nicht nennen?“ Ängstlich blickten seine traurigen Augen auf Bernauer.
„Das verspreche ich Ihnen“, sagte Bernauer, „und sollten Sie wirklich Hilfe brauchen, dann haben Sie hier meine Karte. Rufen Sie mich an.“
Der Fotograf steckte rasch das Kärtchen ein, reichte Bernauer die Hand und verschwand blitzschnell aus seinem Blickfeld.
Gedankenverloren ging Bernauer nun den Weg zurück und als er das letzte Stück der Kiesfläche im Park überquert hatte, rief von der gegenüberliegenden Seite her der alte Mann im Rollstuhl: „Auf Wiedersehen der Herr, und schönen Aufenthalt noch.“
Bernauer lächelte und winkte ihm zu. Der Alte saß immer noch, wie angegossen, an der selben Stelle des Parks und hielt friedlich sein Gesicht der Sonne entgegen.
---------------
Zwei Tage vergingen, dann hatte Bernauer seine Angelegenheiten in Prag erledigt und machte sich auf die Heimfahrt nach Salzburg, aber er konnte den sonnigen Tag und die schöne Landschaft nicht richtig genießen, zu sehr waren seine Gedanken mit der Unterhaltung beschäftigt, die er mit Detlef König geführt hatte, auch wenn die Schlussfolgerungen, die der Fotograf gezogen hatte, nicht ganz so gravierend sein mochten, als er glaubte.
Aber was könnte er schon tun, fragte sich Bernauer. Ihm fehlte in Prag jegliche berufliche Kompetenz und dass seine Mitwirkung an dem Fall nicht gewünscht war, hatte man ihn deutlich spüren lassen. Dies machte ihn misstrauisch, aber er konnte auch nichts unternehmen, ohne den Namen des jungen Mannes preiszugeben und ihn möglicherweise sogar wirklich in Gefahr zu bringen.
Als er bei Freistadt in die Schnellstraße Richtung Linz einbog, kam ihm die Idee, seinen Linzer Freund Markovsky anzurufen. Vielleicht konnte er ihn erreichen und sich mit ihm verabreden. Den Freund zu sprechen würde ihm jetzt gut tun, denn mit wem sonst konnte er über die beunruhigende Angelegenheit reden? Und reden darüber musste er, daran bestand kein Zweifel. Wer wäre dazu also besser geeignet gewesen als der Chef der Mordkommission in Linz, Dr. Markovsky.
Markovsky meldete sich nach dem dritten Klingelzeichen.
„Joschi“, lachte er, „steht die Festung noch?“
„Ist zu vermuten“, meinte Bernauer, „aber ich bin jetzt nicht in Salzburg, sondern komme aus Prag zurück und müsste dringend mit Dir sprechen. Wie sieht es denn da zeitlich aus?“
„Ist es so ernst?“
„Nein. Also ja. Doch, könnte man sagen.“
„Bitte drück Dich nicht ganz so präzise aus“, amüsierte sich Markovsky, „wo bist Du denn gerade?“
„Die Ausfahrt nach Gallneukirchen sollte ich nach fünfzehn Kilometern erreichen.“
„Aha, das ist ja schon ziemlich nahe, also pass auf. Stell den Wagen in die Parkgarage vor dem Landestheater, die kennst du doch?“
„Ja, kenne ich.“
„Und dann gehst Du quer durch den Park in die gegenüberliegende Herrenstraße. Nach knapp zwanzig Metern stehe ich links an einem der Tische mit ein paar anderen Schluckspechten vor der Alten Metzgerei.
Erst entspannst Du Dich, dann ziehen wir uns zurück und Du erzählst mir alles, oder ist es noch dringender?“
„Nein, so eilig auch wieder nicht, aber es beschäftigt mich permanent.“
„Na, gut“, lachte Markovsky, „also dann bis gleich.“
Bernauer war erst wenige Schritte die Herrenstraße entlang gegangen, als er eine Traube von Menschen wahrnahm, die sich gut gelaunt um die Tischchen vor der Alten Metzgerei scharrten.
Mitten unter ihnen stand Markovsky im flüsternden Gespräch mit einer gut aussehenden resoluten Dame, die eine schwarze Schürze trug und beide brachen schließlich in fröhliches Gelächter aus.
„Er kann es nicht lassen“, dachte Bernauer.
Als er nun in die Runde trat, begrüßte ihn Markovsky höchst erfreut und stellte ihn den übrigen Gästen vor.
„Und das hier“, sagte er dann und zeigte auf die blonde Frau mit der schwarzen Schürze, „ist die Herrscherin dieses großartigen Tempels der Gaumenfreuden, meine Traumfrau Michaela.“