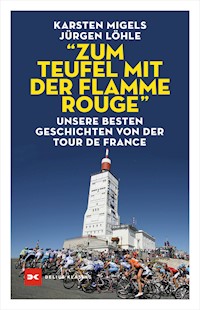
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Delius Klasing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Abenteuer Tour de France: Hinter den Kulissen des größten Radrennens der Welt Der eine berichtet seit 25 Jahren auf Eurosport von den großen Rundfahrten, der andere begann Anfang der 1990er-Jahre seine Sport-Berichterstattung für die Stuttgarter Zeitung. Gemeinsam erzählen sie nun in einem Buch ihre Geschichten von der Straße und werfen einen Blick hinter die Kulissen des größten Radrennens der Welt. Wie sieht eigentlich der Journalisten-Alltag während der drei Wochen in Frankreich aus? Welche logistischen Herausforderungen gilt es zu meistern? Was waren ihre schönsten und schrägsten Erlebnisse mit Fahrern und Teamchefs? Welche Tour war für sie die spannendste und warum? Wie haben sie den Doping-Skandal 1998 erlebt? Diese und viele andere Geschichten erzählen die altgedienten Radsport-Reporter Karsten Migels und Jürgen Löhle mit viel Erfahrung und Humor. Mit Insider-Blick berichten sie über die eisigen Höhen und begleiten die Fahrer durch frustrierende Tiefen wie Doping, Wolkenbrüche und Massenstürze. Pikante Begegnungen mit der Polizei (zu schnell gefahren!) und den Tour-Kommissären (viel zu langsam gefahren!!!) inbegriffen. Hauptsache man hat ein Hotelzimmer oder sonst ein Plätzchen, wo man die kurzen Nächte liegenden verbringen kann ... • Fachkundiger Blick hinter die Kulissen der Tour de France von Radsport-Insidern • Zwei Sportjournalisten erzählen, was Fans der Tour de France nur selten zu sehen bekommen • Humorvolle Geschichten aus dem Journalisten-Alltag: Skurrile Erlebnisse, logistische Herausforderungen und heitere Begebenheiten mit Tour-de-France-Fahrern und Teamchefs • Mit spektakulären Fotos von der Tour und persönlichen Einblicken der Sportredakteure Zwei Journalisten, eine Tour, viele Geschichten: Lustige Anekdoten von der Tour de France Karsten Migels und Jürgen Löhle sind alte Hasen im Sportjournalismus. Der eine berichtet seit 25 Jahren auf Eurosport von allen namhaften Fahrradrennen und ist als Sprecher des Podcasts "Windkante" bekannt. Der andere begann Anfang der 90er-Jahre seine Tour-Berichterstattung für die Stuttgarter Zeitung und andere deutsche Tageszeitungen und Magazine. Für dieses einmalige Buch haben sie sich zusammengetan und erzählen mit viel Sachkenntnis und noch viel mehr Humor die besten Anekdoten aus ihrer persönlichen Tour-de-France-Geschichte – zum Staunen, Schmunzeln und Amüsieren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
KARSTEN MIGELSJÜRGEN LÖHLE
“ZUMTEUFEL MITDER FLAMMEROUGE”
UNSERE BESTENGESCHICHTEN VON DERTOUR DE FRANCE
PROLOG
AUF DEN STRASSEN DER TOUR
UND PLÖTZLICH WAR ALLES SO GELB
DER TAG VON ANDORRA-ARCALÍS 1997
CHAOS AM STRASSENRAND
WOHNMOBILE, TEUFEL UND FANS
TYPEN, DIE MAN NICHT VERGISST
EDELHELFER, SPITZENFAHRER UND BODYGUARDS
DREI WOCHEN REPORTERSTRESS
IMMER WIEDER, IMMER WIEDER ANDERS
JOURNALISTENALLTAG IM WANDERZIRKUS
WIE MAN SICH BETTET … WENN MAN MAL DAZU KOMMT
HOTELS UND ANDERE STERNSTUNDEN
VON ALTEN HASEN UND JUNGEN HÜPFERN
DIE LIEBEN KOLLEGEN
STERNSTUNDEN UND ABGRÜNDE
»DIE TOUR MACHT ALLE VERRÜCKT«
DIE SPANNENDSTEN FRANKREICHRUNDFAHRTEN
GIFT FÜR FAHRER UND SPORT: DOPING
EPO UND ANDERE »HELFENDE« SUBSTANZEN
NICHT ZU ENTSCHEIDEN – UND IMMER WIEDER DISKUTIERT
DIE BESTEN FAHRER UND TEAMS
EPILOG
PROLOG
KARSTEN MIGELS:VOM TRAUM ZUR TOUR
Wie verbringt man als Jugendlicher seine Freizeit, wenn man in einer eher ländlichen Gemeinde aufwächst? Richtig, man spielt Fußball. Ich tat dies beim örtlichen SC Reute, in einer kleinen Ortschaft in Südbaden, nur ein paar Kilometer von der französischen Grenze entfernt.
Richtig ist aber auch: Mein damaliger Trainer Fritz Ganter drückte mir irgendwann fünf Mark in die Hand und riet mir, es doch besser mit einer anderen Sportart zu probieren. Er hatte schon recht bald gemerkt, dass Fußball nicht das Richtige für mich war. Ich verstand zunächst die Welt nicht mehr, hatte ich es doch trotz fehlenden Talents geschafft, mit der Mannschaft in der Saison 1975/76 Herbstmeister zu werden. Dazu hatte ich allerdings nicht wirklich viel beigetragen, war ich doch mehr auf der Ersatzbank als auf dem Spielfeld zu finden gewesen. Immerhin kann ich heute mit Recht behaupten, dass es ein Foto als Beweis meiner (ersten und einzigen) Meisterschaft im Fußball gibt.
Solcherart Beweise sollten sich bald häufen, allerdings in einer anderen Sportart. Durch meinen Schulfreund Christian Siegel angeregt, wollte ich mich bei meinem nächsten sportlichen Versuch wie er dem Radsportverein Concordia Reute anschließen. Dieser Weg war aber etwas schwieriger als gedacht. Denn um ordentlich Radsport zu betreiben, benötigt man ein Rennrad, und das konnten mir meine Eltern – mein Vater war Alleinverdiener einer siebenköpfigen Familie – nicht finanzieren. In den ersten Monaten ließ sich das noch ignorieren, denn das sogenannte Wintertraining in Form von Kraft-, Ausdauer- und Schnelligkeitsübungen fand in der Mehrzweckhalle der Gemeinde statt. Hätte mir damals jemand gesagt, dass dieser Einstieg in den Radsport mein weiteres Leben prägen würde, ich hätte es ihm sicher nicht geglaubt. Schließlich wollte ich nicht in einer Halle beim Stemmen von Medizinbällen, beim Klettern an Stangen und Seilen oder mit anderen merkwürdigen Übungen meine Form aufbauen – ich wollte auf einem Rennrad sitzen und durch die Gegend fahren!
Irgendwann war der Winter dann vorbei. Mein beständiges Nerven sorgte dafür, dass unsere Trainer Adelbert Kromer und Heinz Kleeb mir ein dem Verein gehörendes weißes Rennrad der Marke Mercier unter den Hintern schoben. Ich war stolz wie Oskar und drehte schon bald meine ersten Runden in Richtung Tuniberg und Kaiserstuhl.
Mein erstes Rennen durfte ich überraschenderweise schon im Frühjahr 1976 fahren. Ich schlage noch heute die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich daran denke, dass ich an diesem Sonntag in Gottmadingen am Bodensee mit roten Kniestrümpfen an den Start gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter damals auf die Idee kam, mir diese knallroten Kniestrümpfe mitzugeben. Bis heute ist die Erinnerung daran eine Art Trauma, das immer wieder wach wird, wenn ich Radsportler mit schwarzen oder farbigen Strümpfen sehe, und diese womöglich noch bis über die Waden hochgezogen sind.
Obwohl es bei diesem ersten Rennen nicht gereicht hatte, um ganz vorne mitzufahren, waren meine Trainer, meine Eltern und vor allem ich doch zufrieden und bereits vom Virus Rennrad infiziert. Schon am kommenden Wochenende stand ich wieder an einer Startlinie, und es dauerte nur ein paar Wochen, bis ich zum ersten Mal als Sieger ins Ziel kam.
Wir hatten bei uns im Verein eine sehr gute Kameradschaft, und mindestens zweimal in der Woche spulten wir unter Anleitung eines Trainers ordentlich Kilometer ab. Sieht man die aktuelle Anzahl an Fernsehübertragungen von Radrennen, dann ist es kaum noch vorstellbar, dass es vor 40 Jahren noch keinen Livestream via Internet gab und einzig und allein die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ein paar Szenen übertrugen. An Eurosport und eine Übertragung vom Start bis zum Ziel jeder einzelnen Tour-de-France-Etappe war noch gar nicht zu denken. In Südbaden jedoch wohnten wir im grenznahen Bereich und hatten das Privileg, unter anderem die Reportagen über die Radsport-Klassiker über das Schweizer Sendesignal empfangen zu können. Von diesen Übertragungen war ich damals schwer begeistert und versuchte, während der etwas langweiligeren Trainingsrunden meine Kumpels mit der entsprechenden Reportage vom vergangenen Wochenende zu unterhalten. Gerne kommentierte ich auch das Trainingsgeschehen, so gut es ging, mit angelerntem Schweizer Akzent und sorgte damit immer wieder für Stimmung.
Ich war so von dieser Sportart, von den Kommentatoren und den Rennfahrern begeistert, dass die Stars der damaligen Zeit schnell zu meinen Vorbildern wurden. Ob Klassiker- und Sprint-Spezialisten wie Francesco Moser, Freddy Maertens, Roger De Vlaeminck, Jacques Esclassan oder die damaligen Rundfahrer Joop Zoetemelk, Michel Pollentier, Lucien Van Impe und natürlich Eddy Merckx und Patrick Sercu – sie alle hatten es mir angetan.
Im Juli 1976 sollte ich dann zum ersten Mal persönlich mit der Tour de France in Kontakt kommen. Die 63. Austragung der Tour war in Saint-Jean-de-Monts in der Vendée, genauer gesagt am dortigen Strand Merlin-Plage, gestartet worden und hatte nach dem Prolog mit dem Belgier Freddy Maertens den ersten Träger des Gelben Trikots. Maertens, der im selben Jahr in Italien Weltmeister werden sollte, verteidigte es durch die Vogesen bis zur ersten Bergankunft in Alpe d’Huez.
Da die Vogesen nur etwa anderthalb Autostunden von Reute entfernt liegen, machten wir uns mit dem Kleinbus des Vereins auf den Weg zum Grand Ballon, dem mit 1.400 Metern höchsten Berg in den Vogesen. Heute weiß ich, dass die Vogesen die ersten Berge der Tour de France waren und bereits 1905 zum ersten Mal befahren wurden. 1976 hatte ich davon keine Ahnung – was wussten wir damals schon über die Geschichte der Tour? Wir warteten an diesem sonnigen 1. Juli einige Stunden auf das Feld und vertrieben uns mit der Werbekarawane die Zeit, bis es dann irgendwann so weit war. Schneller als gedacht war es auch schon wieder vorbei, und ich war zumindest glücklich darüber, dass Gelbe Trikot mit Freddy Maertens irgendwo im Feld entdeckt zu haben. Heute wäre es selbstverständlich, sich noch an Ort und Stelle vor den Fernseher, das Tablet oder Smartphone zu setzen, um das Etappenfinale nicht zu verpassen. Wir jedoch waren mit unserem Bus auf der Rückfahrt und erfuhren erst viel später davon, dass Maertens den Sprint in Mulhouse gewann und das Gelbe Trikot verteidigte.
Ein Jahr danach kam der Tross der Tour bereits zum dritten Mal nach Freiburg im Breisgau. Dort verbrachten die Fahrer am 14. Juli 1977 den zweiten der beiden Tour-Ruhetage. Heute wäre es unvorstellbar, dass am französischen Nationalfeiertag ein Ruhetag abgehalten wird, noch dazu im Ausland. Am nächsten Tag wurden zwei sogenannte Halbetappen ausgetragen, und der erste Teil ging im Freiburger Stadtteil Stühlinger zu Ende. Meine Vereinskollegen und ich waren die 15 Kilometer aus Reute angereist, drängten uns irgendwo unter die Zuschauer und genossen die großartige Atmosphäre.
Die Begeisterung hatte ihren Grund: In diesem Jahr hatte Didi Thurau aus Frankfurt den Prolog im südfranzösischen Fleurance mit vier Sekunden Vorsprung vor seinem TI-Raleigh-Teamkollegen Gerrie Knetemann und acht Sekunden vor Eddy Merckx gewonnen. Der 22-Jährige trug das Gelbe Trikot anschließend durch die Pyrenäen, die Bretagne und die Normandie bis nach Freiburg und hätte um ein Haar in der Eschholzstraße auch noch den Sprint um den Etappensieg für sich entschieden, aber Patrick Sercu und Rik Van Linden waren etwas schneller. Direkt im Anschluss wurden die Fahrer in Busse verfrachtet, damit um 14 Uhr im elsässischen Altkirch zur zweiten Hälfte der 13. Etappe nach Besançon gestartet werden konnte. Der »blonde Engel« Thurau verlor einige Tage später in den Alpen das Führungstrikot an den späteren Sieger Bernard Thévenet, aber ich war nach diesen beeindruckenden Tagen endgültig vom Mythos Tour de France gefangen.
Meine Vereinskollegen und ich träumten davon, Radprofis zu werden, und während unserer Trainingsfahrten trugen wir – sofern sie irgendwie zu bekommen waren – die begehrten Trikots unserer Idole. Das waren die schönen Wolltrikots der Mannschaften TI-Raleigh, Gan Mercier Hutchinson, Gitane Campagnolo oder La Vie Claire, und wer es besonders gut machen wollte und es sich leisten konnte, der trug das zu seiner Rennmaschine passende Trikot.
1981 nutzten wir erneut die Chance, der Tour möglichst nahe zu kommen, als in Mulhouse eines von vier Einzelzeitfahren ausgetragen wurde. Ich erinnere mich noch sehr genau an diesen heißen Tag im Juli und den Zielbereich im dortigen Sportstadion. Es war Bernard Hinault, der bereits 1978 und 1979 die Tour gewonnen hatte, der nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden 1980 der Konkurrenz jetzt erneut das Hinterrad zeigte. Le Blaireau (»der Dachs«), wie Hinault aufgrund seiner cleveren Fahrweise genannt wurde, gewann nach Nizza und Pau auch das Zeitfahren im Elsass vor dem Niederländer Gerrie Knetemann, verteidigte das Maillot Jaune über die nächsten acht Etappen und gewann die Tour schließlich zum dritten Mal.
Ich war in meinem Jahrgang inzwischen einer der Besten auf nationaler Ebene und Mitglied der Cross-Nationalmannschaft. Neben vielen Titeln bei Landesverbandsmeisterschaften gehören Medaillen bei Deutschen Meisterschaften und die Teilnahme an der Cross-WM 1982 im bretonischen Lanarvily zu meinen größten Erfolgen.
Mit meinem 20. Geburtstag stand das Thema Grundwehrdienst an, und ich wollte mich durch ein Rennen zur Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr qualifizieren. Eigentlich kein Problem, denn ich war bereits 1983 – im ersten Jahr als Amateur – vom C-Fahrer zum A-Fahrer aufgestiegen und hatte diese Resultate immer wieder bestätigt. Bis zum 6. Mai 1984. Dieser Sonntag sollte meinem Leben eine andere Richtung geben.
Eigentlich war das Rundstreckenrennen »Im Entennest« in Herbolzheim ein flaches und daher recht einfaches Rennen. Aber in der zwölften. von 45 zu fahrenden Runden touchierte ich das Heck eines an der Strecke abgestellten Fiat Ducato, das über die Bordsteinkante hinaus auf die Fahrbahn ragte. Ich wurde mit schweren Verletzungen in die Freiburger Uniklinik eingeliefert. Neben einem Bänderriss an der rechten Schulter machten mir damals vor allem die gebrochenen Rippen und der dadurch entstandene Pneumothorax zu schaffen. Seitdem weiß ich, was es bedeutet, wenn man keine Luft mehr bekommt und das Gefühl hat, ersticken zu müssen. Glücklicherweise waren die Ersthelfer gut geschult und versorgten mich schon an der Unfallstelle mit Sauerstoff.
Aber anstatt weiter Rennen zu fahren und mich für die Sportfördergruppe zu qualifizieren, lag ich nun im Krankenhaus und versuchte anschließend, irgendwie wieder fit zu werden. Das Jahr 1984 war ein verlorenes Jahr, auch wenn der darauffolgende Winter im Gelände gar nicht so schlecht war und die guten Resultate mir die Zuversicht gaben, dass es auch auf der Straße bald wieder laufen würde. Zudem bekam ich vom Radsportverein Freiburg das Angebot, diesem Verein beizutreten und parallel eine Arbeitsstelle bei der Stadt Freiburg anzutreten.
Am Vormittag am Schreibtisch und am Nachmittag auf dem Rad zu sitzen ist eigentlich eine ideale Kombination, um das Ziel Radprofi zu verfolgen. Aber während heute sehr systematisch und per Computer gesteuert trainiert wird, gab es für mich in den 80er-Jahren nur ab und an eine Leistungsdiagnostik in der sportmedizinischen Abteilung der Freiburger Uniklinik, ein paar Tipps vom Trainer und das eigene Wissen, um meine Leistung zu verbessern. Alles in allem muss es wohl nicht die richtige Mischung gewesen sein. Nachdem ich mich auch 1985 nicht für die Sportfördergruppe qualifizieren konnte, wobei dem auch ein paar verbandspolitische Entscheidungen im Weg standen, gab ich schließlich mit 21 Jahren meinen Traum vom Berufsradsportlerdasein auf.
Nach anderthalb Jahren war der Vertrag mit der Stadt Freiburg beendet. Ich leistete meinen Wehrdienst in der Böblinger Wildermuth-Kaserne als Soldat im Geschäftszimmer der Kompanie ab und arbeitete im Anschluss zunächst in einem Fahrradgeschäft. In dieser Zeit ließ mich der Gedanke, die Leidenschaft Radsport doch noch zum Beruf zu machen, nie wirklich los. Ich hatte immer noch einen sehr guten Draht zu früheren Vereinskollegen wie Jürgen Eckmann aus Kirchzarten, und über ihn und mit etwas Glück konnte ich tatsächlich 1992 mein erstes Rennen moderieren. Und das war nicht irgendein Rennen, sondern nach Berlin 1991 der zweite Mountainbike-Weltcup-Wettbewerb, der in Deutschland stattfand. Kirchzarten war damals so etwas wie das Mekka des MTB-Sports in Deutschland und richtete neben Deutschen Meisterschaften 1995 auch die Weltmeisterschaften im Cross-Country und Downhill aus.
Am 21. August 1992 stand ich also mitten im Wald beim sogenannten Hexenhäuschen und informierte die Zuschauer über das Rennen und die Sportler. Und so schlecht kann mein erster Auftritt als Sprecher damals nicht gewesen sein, denn direkt im Anschluss erhielt ich weitere Anfragen – vom MTB McDonalds Cup, dem Vorgänger der heutigen Bundesliga, bis hin zu allen möglichen Meisterschaften in Sachen Mountainbike.
Als Sprecher hatte ich mir in der Szene bald einen Namen gemacht. Ich schrieb Artikel für einschlägige Magazine und moderierte diverse Veranstaltungen, als mich im April 1997 Rainer Gerster anrief, damals Teamchef des erfolgreichen MTB-Teams GT mit Regina Marunde, Juli Furtado und dem Freeride- und Trial-Spezialisten Hans »No Way« Rey und vielen mehr. Er erzählte mir, dass der Fernsehsender Eurosport ihn angerufen hätte und für das Weltcup-Rennen im saarländischen St. Wendel einen Experten suchen würde. Nachdem seine Sportlerin Regina Marunde diesen Job wegen anderer Verpflichtungen nicht annehmen konnte, hätte er sofort an mich gedacht.
Er gab mir die entsprechende Telefonnummer. Und schon am 27. April 1997 fand ich mich zum ersten Mal an einem Eurosport-Mikrofon wieder. Der damalige Kommentator Ingolf Cartsburg (der heute mein Chef ist) bedankte sich hinterher und war mit dem, was ich als MTB-Experte zu erzählen hatte, offensichtlich ganz zufrieden. Schließlich fragte er: »Kennst du dich auch im Straßenradsport aus, und könntest du dir vorstellen, für Eurosport solche Rennen zu kommentieren? Um in Zukunft besser aufgestellt zu sein, benötigen wir noch einen weiteren Kommentator.«
Er ließ mir die gewünschte Bedenkzeit, rief aber schon einige Tage später mit der überraschenden Frage an, ob ich aus der Pariser Zentrale heraus die Katalonien-Rundfahrt kommentieren könnte, denn Eurosport hätte zu diesem Zeitpunkt schon zwei Rennen im Programm und bräuchte einen zusätzlichen Kommentator. Ich hatte mich inzwischen ohnehin schon für Eurosport entschieden …
Nur wenige Tage vor meinem geplanten Flug kam dann ein weiterer Anruf aus Paris mit dem Angebot, die Katalonien-Rundfahrt gegen die Tour de Suisse zu tauschen, da Kommentator Peter Woydt leider wegen einer Krankheit ausfallen würde, eventuell für länger. In Erinnerung an meine Zeit als Jugendlicher auf dem Rad und Imitator der Schweizer Reporter war dieser Tausch schnell beschlossene Sache.
Kurz darauf stand ich vor den Türen des Senders in Issy-les-Moulineaux, um schließlich am 17. Juni 1997 zum ersten Mal als TV-Reporter ein Radrennen auf der Straße zu kommentieren. Bis heute habe ich diese Rundfahrt nicht vergessen, mit der Soloflucht des Franzosen Christophe Agnolutto, der als Außenseiter am dritten Tag über zehn Minuten Vorsprung auf die Favoriten herausfuhr, das Führungstrikot übernahm und es bis zum Ende verteidigte. Heute bin ich ein wenig stolz darauf, über 20 Jahre später mit dem damaligen Etappensieger Rolf Aldag als Experte bei Eurosport zusammenzuarbeiten.
Nach sieben Etappen war auch ich mit meiner Form zufrieden und hatte endlich mein Hobby zum Beruf gemacht. Jedoch wurde diese Zufriedenheit von einer traurigen Mitteilung überschattet, denn Peter Woydt war während dieser Tour de Suisse in seiner Heimatstadt Berlin an Krebs verstorben. Eurosport befand sich in einer schwierigen Situation, denn es verblieben bis zum Start der 84. Tour de France in der Normandie nur neun Tage. Wer sollte sich gemeinsam mit dem Experten Rudi Altig auf den Weg nach Rouen begeben, wer sollte die Tour drei Wochen begleiten und die 21 Etappen kommentieren?
Noch vor meiner Rückreise nach Deutschland stellte Ingolf Cartsburg mir erneut die Frage, ob ich mir vorstellen könne, ein Radrennen für Eurosport zu kommentieren. Allerdings steckte diesmal nicht irgendein Rennen dahinter, sondern das größte Radrennen der Welt, die Tour de France. Ich überlegte nicht lange und gab die Zusage für den nächsten Sprung ins kalte Wasser.
Zu Hause blieb mir wenig Zeit zur Vorbereitung. Nur ein paar Tage später erfolgte der Aufbruch ins Ungewisse – die Anreise in die Normandie. Und ganz plötzlich war ich mittendrin in meinem Kindheitstraum: zwar nicht als Radprofi, aber als Reporter beim größten Radrennen der Welt.
JÜRGEN LÖHLE AN EINEM TAG IM JULI
»Also gut, wenn es denn sein muss, dann fahren Sie eben.« Man sah es Thomas Löffelholz, damals Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, deutlich an, dass er eine Dienstreise zur Tour de France für die höchstmögliche Kür hielt, vorsichtig gesagt. Zumal ich gestehen musste, dass die Chance auf einen Gewinn der Gesamtwertung durch einen deutschen Radprofi in diesem Jahr so wahrscheinlich war wie ein Lottosechser. Ich konnte auch nicht wegdiskutieren, dass fast parallel die Fußball-WM in Italien ausgespielt wurde, wo gleich zwei meiner Kollegen Reisekosten verursachten. Aber da die StZ ja die Zeitung der journalistischen Tour-Legende Hans Blickensdörfer war und der sich höchstpersönlich für den Jungspund starkgemacht hatte, kam schließlich das Okay – und es begann eine Vorbereitung, die aus heutiger Sicht an Naivität kaum zu toppen war.
Natürlich war ich schon vorher als Journalist bei Radrennen gewesen, am 1. Mai in Frankfurt beim Henninger Turm, auch bei Deutschen Meisterschaften. Die Tour de France kannte ich aber nur als Zuschauer ihres Gastspiels 1987 in Stuttgart, aus Büchern und aus dem Fernsehen. Ich hatte daher zwar schon eine Vorstellung, wie es da so zugehen würde en france, und natürlich war mir bekannt, dass die Tour die größte mobile Sportveranstaltung der Welt war (und ist). Aber das ist eben ein ziemlich abstrakter Begriff, wenn man es noch nicht selbst gesehen hat. Und vor allem nicht erlebt.
So fuhr ich also mit einem rennradverrückten Freund in meinem klapprigen VW-Campingbus am 9. Juli 1990 nach Genf. Das war ein Montag, und die Tour ging bereits in die zweite Woche. Tags zuvor hatte Olaf Ludwig im Trikot des niederländischen Teams Panasonic die achte Etappe von Épinal nach Besançon gewonnen, was in Deutschland aber kaum einer wahrnahm, weil an diesem Tag das Endspiel der Fußball-WM zwischen Argentinien und Deutschland stattfand. Daher auch mein später Einstieg in die Tour: Mein Ressortleiter entließ mich natürlich keine Stunde vor dem Ende der WM aus dem Innendienst, schon gar nicht für ein Radrennen, bei dem deutsche Sportler nur Nebenrollen innehatten.
Aber nun war ich da – und auch wieder nicht. Mein Freund hatte selbstverständlich sein Rennrad dabei, er wollte ja die Pässe der Tour fahren, während ich arbeitete. Aber auch ich hatte mein Rad nicht zu Hause gelassen, und beide Velos waren brav auf dem Heckträger des Busses montiert. Bei der Akkreditierung sagte mir dann ein Offizieller knapp, dass im Tross der Tour Fahrräder ausschließlich auf Team- und Werbeautos montiert sein dürften, und das nur auf dem Dach. Mein Auto würde also nur für die Strecke zugelassen, wenn die Räder verschwänden. Mein zarter Hinweis, dass die Marken unserer beiden Räder auch im Peloton vertreten seien, interessierte ihn nicht. Die Räder müssten weg, dann würde er auch ein Auge zudrücken: Klapprige Campingmobile wie meines seien eigentlich nicht Tour-Standard. Im Hochgebirge müsse ich damit lange vor dem ersten Rennfahrer in die Abfahrten gehen, sonst würde ich die Sportler behindern, was das sofortige Ende meiner Teilnahme bei der Tour bedeuten würde. Das habe ich mir all die Jahre gut gemerkt, und es ging auch nur einmal beinahe schief, aber dazu später. Am gleichen Abend war dann noch mein Erstkontakt mit dem salle de presse, dem Pressezentrum der Tour, das ungefähr die Größe eines Bierzeltes auf dem Münchner Oktoberfest hat, manchmal auch tatsächlich ein Zelt ist, in Genf aber eine Messehalle war. Im salle de presse können 800 Menschen arbeiten. Wer die Atmosphäre damals das erste Mal erlebte, erstarrte in Ehrfurcht: lange Tischreihen, an denen gebeugte Menschen auf meist zu kleinen Plastikstühlen über Tastaturen saßen, oft noch über mechanischen Schreibmaschinen. Ein Höllenlärm, die Luft verqualmt und dick, weil Journalisten damals eben rauchten. Bien sur! Sich einfach auf irgendeinen freien Platz zu setzen, war keine gute Idee. Man saß nach Nationen zusammen. Ganz vorne meist die Schweizer. Ich erinnere mich noch an einen hünenhaften älteren Herrn, der da mit seinem kleinen Hund saß, in die Schreibmaschine hämmerte, und dem die Zigarre nie ausging. Das war Serge Lang, der Erfinder und Gründer des Ski-Weltcups.
Die deutsche Delegation war damals sehr überschaubar. Die großen Nachrichtenagenturen dpa und SID waren vertreten; die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Rundschau und die Süddeutsche Zeitung hatten Reporter vor Ort; dazu die freien Journalisten Hartmut Scherzer und Klaus Blume – aber das war es dann auch fast schon von der Print-Fraktion. Die Fernseh- und Radioleute sah man im Pressezentrum eher selten, die waren mit dem Mikro unterwegs oder kommentierten auf ihrer Tribüne an der Ziellinie. Ich staunte in die riesige Halle und durfte tatsächlich dabei sein, weil wir die Fahrräder von nun an auf dem Bett des Wohnmobils transportierten.
Ziemlich schnell durfte ich auch lernen, was Tour de France wirklich bedeutet. Gleich an meinem dritten Tag endete die Etappe oben in Alpe d’Huez. Wir reisten schon am Tag vorher an, so schlau waren wir dann schon. Aber ein Hotel hatten wir nicht. »Es wird sich schon was finden lassen«, dachten wir. Wie naiv. Alpe d’Huez ist rund um die Tour complet, also ausgebucht. Immer schon, seit dem Debüt dort 1951. Wie man trotzdem in ein Bett kommt, zeigte uns dann der Journalist Klaus Blume, der damals eben schon ein alter Hase bei der Tour war. Auch er wusste nicht, wo er schlafen sollte, schaute aber in der aktuellen L’Équipe nach, bei welchem Team tags zuvor ein Profis ausgeschieden war. Siehe da: Beim spanischen ONCE-Team hatten gleich drei Fahrer aufgegeben. Dann schlug er nach, in welchem Hotel ONCE untergebracht war. Das herauszukriegen ist zum Glück einfach, da jeder Journalist bei der Anmeldung das Hébergement der Tour in gedruckter Form ausgehändigt bekommt.
Wir fuhren Blume dann zu diesem Hotel. Tatsächlich lagen auf der kurz vor Mitternacht längst verwaisten Rezeption auf einem weißen Zettel mit der Aufschrift ONCE etliche Schlüssel. Es stand allerdings nicht darauf, welcher Name zu welchem Schlüssel gehört. »Die meisten von denen kommen eh erst morgen«, sagte Blume, »die Fahrer sowieso.« Dann schnappte er sich einfach einen der Schlüssel und suchte das Zimmer. Wir schliefen, wie für solche Fälle geplant, lieber im Bus. Allerdings hatte tags zuvor die Standheizung aufgegeben, was auf 1.800 Meter Meereshöhe kein Spaß ist, weil es da auch im Juli nachts kalt wird. Aber immer noch besser, als es Klaus Blume erging, der sich wohl den Schlüssel eines Mitglieds der ONCE-Vorhut gegriffen hatte, der plötzlich mitten in der Nacht vor ihm stand. Der Mann alarmierte die Hotelleitung, Blume hatte kurz darauf kein Bett mehr und noch Glück, dass er von dem ONCE-Mann nicht verprügelt wurde. Der Patron behielt Blumes Gepäck ein, bis der das Zimmer bezahlt hatte. Da das Hotel bei so einem dreisten Akt nur Bargeld akzeptieren wollte, suchte der arme Kollege mitten in der Nacht einen Geldautomaten in der relativ weitläufigen Skistation …
Am Ende bekam er nach dem Zahlen sogar noch ein anderes Bett – tatsächlich eines von einem ausgeschiedenen ONCE-Profi. Und am Morgen sogar ein Frühstück. Das hatten wir auch, allerdings frierend vor einem Bäcker in der Morgensonne. Nach der eiskalten Nacht tat der heiße Kaffee gut, zumal wir auch keine dicken Schlafsäcke dabeihatten. Die Tour läuft immer im Juli, das steht für Hitze – zumindest, wenn man wie wir keine Ahnung von den Bergen hat. Aber wir waren eben zum ersten Mal oben in Alpe d’Huez, dem legendären Anstieg,





























