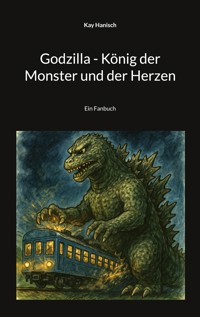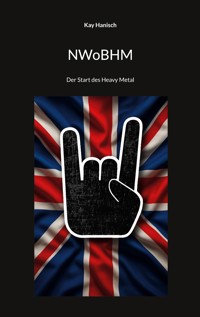Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zündschlüssel Ost - Von Schwalben und Eisenschweinen Aufgewachsen im Duft von Zweitaktgemisch, fuhr ich - Jahrgang 1973 - meine erste S 51 über Kopfsteinpflaster und Plattenwege. Heute erzähle ich als Zeitzeuge die ganze Geschichte der DDR-Zweiräder: vom ersten AWO-Tourer bis zum letzten Simson-Roller, von improvisierten Werkstattnächten bis zu Weltrekorden auf tschechischen Rennstrecken. Dies ist weder Typenatlas noch Bildband noch Schrauberhandbuch - es ist eine leidenschaftliche Mischung aus Industrie-, Alltags- und Kulturgeschichte. Interviews mit ehemaligen Werksingenieuren, Fahrberichte aus erster Hand und sorgfältig recherchierte Hintergrundkapitel machen das Buch zur wohl persönlichsten Reise durch die Motorenwelt "hinter der Mauer". Darum sollten Sie einsteigen: Authentisch & nah dran: Augenzeugenberichte statt archivierter Floskeln. - Herzblut auf jeder Seite: Geschrieben von einem, der die Maschinen fuhr, reparierte und liebte. - Historischer Tiefgang: Politik, Produktion, Export - verständlich erzählt. - Lebendige Technik: Was eine ES 250/2 im Alltag wirklich konnte und warum eine SR 50 Freiheit bedeutete. - Für Fans & Forscher: Nostalgiker, Schrauber, Historiker - alle finden Neues. Treten Sie den Kickstarter - und entdecken Sie, warum Rauch, Rost und Revolution bis heute Tausende Herzen schneller schlagen lassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Ankicken
Zeitstrahle für den Überblick
Verkehrspolitik
MZ & Simson
Unternehmensgeschichten
Motorradwerk Zschopau (MZ)
Der Start
1918–1945 (DKW)
1945 - 1990
Marktstellung, Zielgruppen und Außenhandel
1990 - bis zum Ende
Simson
Die Anfänge
In der Dunklen Zeit
1945 - 1990
1990 - Ende
Erfolge im Motorsport
Straßenrennsport
MZ-Cup
Geländerennsport
Rund um Zschopau
Classic Enduro
Internationale Sechstagefahrt
Stoye-Fahrzeugbau-Leipzig (Seitenwagen)
Das Stoye-MZ-Gespann
EMW
AWO
Groß-Roller
VEB Automobilwerke Ludwigsfelde (IWL)
1936-1945
1951-1964
Beginn der Lkw-Fertigung
Simson Verwandtschaft - DUO
Die Technik
Der Simson-Motor
Bezeichnugen
Technik und Eigenschaften
Übersicht M541- und M741-Motorvarianten
Fahrzeugvorstellungen
MZ
RT 125 (DKW, IFA, MZ)
BK 350
ES-Reihe
ES 125/150
ES 175/250/300
ETS-Reihe
ETS 125/150
ETS 250
ETS Eskort
ETS 175
TS-Reihe
TS 125/150
TS 250
TS 250/1
Sondermodelle
Bonusinfo
ETZ-Reihe
ETZ 125/150
ETZ 250/251/301
AWO
AWO 425
EMW
EMW R 35
Simson
Vogelserie
Schwalbe
Spatz
Star
Sperber
Habicht
S50
S51
SR 50
Großroller
Pitty
Wiesel
Berlin
Troll
Modellübersicht
MZ
DKW (1920–1966)
IFA / MZ (DDR-Ära 1950 –1990)
MuZ / MZ (Post-Wende 1990 –2009)
Simson
Vorkriegs- & BSW-Ära
AWO / Simson 4-Takt-Ära (1950–1963)
50-ccm-Frühzeit (1955–1963)
“Vogelserie” & Scooter-Pioniere (1964–1975)
S-Baureihen & GS-Geländesport (1975–1990)
Roller- und Mokick-Linien (1986-2002)
Zweitakt-Nachfolger & 4-Takt-Projekte (1993-2002)
ANKICKEN
Ich bin Anfang der 1970er-Jahre in der DDR geboren, aufgewachsen zwischen Plattenbau, Kohleofen und dem ewigen Geruch von Zweitaktgemisch in der Luft. Wie wohl jeder Junge in meinem Alter träumte ich früh von einem eigenen Motorrad. Die großen MZ-Maschinen flogen an einem vorbei wie Raketen, die kleinen Simsons knatterten durch die Dörfer – und ich stand daneben, mit leuchtenden Augen.
Doch der Weg dorthin war lang. Zum einen fehlte mir schlicht das Geld für den Führerschein. Zum anderen gab es in der DDR nur wenige Plätze in den staatlichen Fahrschulen, und die waren schnell vergeben. Es sah lange so aus, als würde mein Traum vom Motorradfahren ein Traum bleiben. Dann kam die Gelegenheit und Chance.
Während meiner Lehre bei der Deutschen Reichsbahn eröffnete sich mir eine Möglichkeit: Über die GST, die Gesellschaft für Sport und Technik, konnten wir im Rahmen der sogenannten militärischen Vorausbildung den Führerschein machen. Im ersten Lehrjahr war der Motorradführerschein geplant, im zweiten sollte der LKW-Führerschein folgen – alles im Sinne der Vorbereitung auf den Wehrdienst, als künftiger Militärkraftfahrer. Doch mit dem politischen Umbruch fiel die LKW-Ausbildung weg. Immerhin: Den Motorradführerschein durften wir noch beenden – und das zu erstaunlich günstigen Bedingungen. Ich erinnere mich noch genau: Eine Woche vor der Währungsunion hatte ich das begehrte Dokument endlich in der Hand.
Ein Moment voller Aufbruch – nicht nur politisch, sondern auch ganz persönlich. Und weil zu dieser Zeit viele ihre alten DDR-Mopeds und -Motorräder für wenig Geld loswerden wollten, schlug ich zu: Für gerade einmal 50 D-Mark kaufte ich mein erstes eigenes Moped – eine Simson S50 mit Vierganggetriebe. Sie war verkratzt, sie war laut, sie hatte Charakter. Und sie war der Beginn einer Leidenschaft, die mich bis heute begleitet.
Mehr als nur ein Hobby: Zweiräder in der DDR
Wenn man verstehen will, warum Mopeds und Motorräder in der DDR einen so hohen Stellenwert hatten, muss man sich ein wenig mit den Verhältnissen jener Zeit beschäftigen. Denn wer heute an ein Moped denkt, denkt vielleicht an Wochenendausflüge, an Schrauberhobbys oder an einen Hauch von Nostalgie. In der DDR jedoch waren Simson, MZ & Co. weit mehr als das – sie waren für viele Menschen schlichtweg notwendig.
Das hatte nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern auch mit politischen Entscheidungen und den begrenzten Möglichkeiten der zentral geplanten Verkehrspolitik zu tun. Wie genau das alles zusammenhängt – und warum ein Simson-Moped für viele Jugendlich der erste große Schritt in die Freiheit war – das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an.
Als die DDR 1949 gegründet wurde, stand sie vor einem gewaltigen Wiederaufbau – auch im Bereich der Mobilität. Die kriegsbedingte Zerstörung hatte große Teile der Infrastruktur vernichtet, und was an automobilindustrieller Basis noch existierte, konzentrierte sich im Wesentlichen auf zwei Standorte: Eisenach und Zwickau. Dort sind schon vor dem Krieg Fahrzeuge produziert worden – in Eisenach unter anderem von BMW, in Zwickau von Horch und später Auto Union –, doch nun fehlte es an allem: Maschinen, Material, Fachkräften. Hinzu kamen sowjetische Reparationsforderungen und die großflächige Demontage ganzer Produktionsanlagen. Der Wiederaufbau konzentrierte sich auf die Schwerindustrie – Maschinenbau, Bergbau, Chemie –, der private Pkw-Bau spielte in den zentralen Wirtschaftsplänen zunächst nur eine Nebenrolle. Stattdessen wurde das Wenige, was vorhanden war, auf den industriellen Bedarf und auf Nutzfahrzeuge ausgerichtet. Die Folge: Der Traum vom eigenen Auto blieb für viele DDR-Bürger über Jahrzehnte hinweg unerreichbar. Wer dennoch mobil sein wollte, musste sich nach Alternativen umsehen – und genau hier begannen Mopeds und Motorräder ihren Siegeszug.
Doch es waren nicht nur die begrenzten Produktionskapazitäten, die den DDR-Bürgern den Zugang zum eigenen Fahrzeug erschwerten. Auch die wirtschaftspolitische Ausrichtung spielte eine entscheidende Rolle. Die DDR hatte einen hohen Bedarf an Devisen, um auf dem Weltmarkt Waren einzukaufen, die sie selbst nicht herstellen konnte – von modernen Maschinen bis hin zu bestimmten Rohstoffen. Um an westliche Währung zu kommen, wurden viele der im Inland gefertigten Fahrzeuge lieber exportiert als an die eigene Bevölkerung abgegeben. Gerade modernere Modelle – etwa Wartburg – verließen direkt nach der Fertigung die Werksgelände in Richtung Westen oder in andere „sozialistische Bruderländer“. Der Inlandsbedarf wurde dagegen streng rationiert. Wer ein neues Auto beantragte, musste sich auf Jahre des Wartens einstellen. Die Verteilung folgte zentralen Planvorgaben – und wer keinen systemrelevanten Beruf oder „besondere Verdienste“ nachweisen konnte, hatte oft das Nachsehen. So entstand ein alltäglicher Mangel, den man hinnahm – aber auch kreativ umging. Wer mobil sein wollte, setzte auf das, was verfügbar war: das Zweirad. Mopeds, Kleinkrafträder und Motorräder wurden dadurch nicht nur zur Notlösung, sondern für viele zur ersten Wahl.
Im Jahr 1989 kamen in der DDR 225 Pkw auf 1 000 Einwohner. In der Bundesrepublik waren es im selben Jahr bereits 468 – also mehr als doppelt so viele. Diese Lücke zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Geschichte der DDR. Sie wurde nicht kleiner, sondern wuchs im Laufe der Jahrzehnte sogar weiter an.
Ein Neuwagen war für die allermeisten DDR-Bürger nur über eine verbindliche Vorbestellung zu bekommen. 1966 lag die durchschnittliche Wartezeit bei rund sechs Jahren – bis Ende der 1980er hatte sie sich auf bis zu 12 bis 15 Jahre erhöht, etwa beim Trabant. Das bedeutete: Wer ein Fahrzeug wollte, musste es sehr früh planen, in der Regel ohne genau zu wissen, wann oder ob es überhaupt geliefert werden würde.
Hinzu kam ein wirtschaftliches Paradoxon: Aufgrund der sozialistischen Preis- und Lohnpolitik blieben die Fahrzeugpreise über Jahrzehnte hinweg nahezu konstant. Ein Trabant kostete 1962 rund 7 850 Mark, 1986 waren es gerade einmal 8 500 Mark. Was auf dem Papier bezahlbar klang, führte in der Praxis zu einer enormen Übernachfrage – und ließ die Preise auf dem Gebrauchtmarkt regelrecht explodieren. Für einen sofort verfügbaren, gebrauchten Trabant zahlte man nicht selten deutlich mehr als für einen fabrikneuen, der aber Jahre entfernt war.
Diese strukturelle Unterversorgung mit Autos war keine Ausnahme, sondern fester Bestandteil der Realität in der DDR – und ein entscheidender Grund dafür, warum so viele Menschen auf Mopeds und Motorräder auswichen.
In den Städten verfügte die DDR über ein erstaunlich dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln. Straßenbahnen, S- und U-Bahnen, Oberleitungsbusse und der Nahverkehr der Deutschen Reichsbahn bildeten gemeinsam das Rückgrat der urbanen Mobilität. Die Fahrpreise waren bewusst niedrig gehalten – stark subventioniert vom Staat –, damit wirklich jeder zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen kam. Das funktionierte im Alltag meist gut, wenn auch nicht immer bequem.
Anders sah es auf dem Land aus. Dort war das Angebot deutlich dünner, der Takt ausgedünnt, Verbindungen fehlten oder fuhren nur ein- bis zweimal am Tag. Wer abseits der Hauptachsen wohnte, war aufgeschmissen – vor allem, wenn Schichtzeiten oder weite Wege dazukamen. Hier schlossen Mopeds und Motorräder die Lücke, die der öffentliche Nahverkehr hinterließ: zwischen Wohnort, Ausbildungsstätte, Arbeitsplatz oder dem nächsten Bahnhof.
Gerade auf dem Land waren Simson, MZ und Co. deshalb keine Liebhaberei – sie waren Notwendigkeit. Wer mobil sein wollte, musste selbst fahren. Das Zweirad wurde zur individuellsten Form der Fortbewegung in einem System, das Individualverkehr eigentlich nur am Rand duldete. Und je größer die Mobilitätslücke, desto wichtiger wurde das eigene Moped – ob für den Weg zur LPG, zum Kombinat oder zur Berufsschule.
Wer in der DDR mobil sein wollte, fand im Kleinkraftrad eine echte Chance – vor allem als Jugendlicher. Denn schon mit 15 Jahren durfte man mit der Fahrerlaubnis der Klasse 4 ein Kleinkraftrad bis 50 cm3 und 60 km/h fahren. Diese Fahrzeuge waren steuer- und kennzeichenfrei, und die Haftpflichtversicherung kostete gerade einmal 8,50 Mark im Jahr. Niedrigere Einstiegshürden konnte es kaum geben.
Kein Wunder also, dass sich diese Fahrzeuge im ganzen Land durchsetzten. 1975 kamen in der DDR 123 Kleinkrafträder auf 1 000 Einwohner – fast viermal so viele wie im Westen. Ob im Dorf oder in der Stadt, in Schulhöfen oder vor dem Werkstor: Das Knattern eines Simson-Motors gehörte zum Alltag wie das Pfeifen des ABV.
Hergestellt wurden diese Maschinen vor allem in Suhl und Zschopau. Simson fertigte in seiner Geschichte knapp sechs Millionen Kleinkrafträder – in den späten 1980er-Jahren verließen jährlich bis zu 200 000 Fahrzeuge das Werk. MZ in Zschopau wiederum avancierte in den 1960er-Jahren sogar zeitweise zum größten Motorradhersteller Europas. Beide Betriebe produzierten nicht nur für den Inlandsbedarf, sondern auch für den Export – zum Devisenerwerb und zur internationalen Präsenz des sozialistischen Fahrzeugbaus.
Auch preislich waren die Kleinkrafträder auf breite Bevölkerungsschichten ausgelegt. Eine einfache Simson S 50 N kostete in den 1970er-Jahren etwa 1 200 Mark, spätere Modelle wie die S 51/1 B lagen bei rund 2 000 Mark – also etwa einem bis zwei durchschnittlichen Monatslöhnen. Ein Trabant hingegen kostete über 8 000 Mark – von der Wartezeit ganz zu schweigen.
Das Kleinkraftrad war somit kein Ersatz, sondern das realistischste Fahrzeug, das man sich in der DDR leisten und zeitnah auch tatsächlich fahren konnte. Und für viele war es der erste Schritt in Richtung Unabhängigkeit – auf zwei Rädern.
Und wer nun denkt, Zweiräder seien nur etwas für alleinstehende Jungspunde gewesen, der irrt gewaltig. Das sozialistische Familienauto war – zumindest bei jungen Paaren ohne Westverwandschaft – oft eine MZ mit Beiwagen. Da saß dann vorn der Vati am Gasgriff, das Kind im Seitenwagen mit Einkaufstaschen auf dem Schoß, eingewickelt in einen NVA-Schal und die Mutti hinten auf dem Sozius. Regnete es, wurde eine Plane übers Boot gezogen – oder man blieb eben zu Hause. So sah der Alltag aus, wenn der Trabant noch zwölf Jahre entfernt war. Und ganz ehrlich: Viel enger zusammengerückt ist man selten im Leben.
In der DDR waren Mopeds und Motorräder für viele Menschen nicht nur Fortbewegungsmittel – sie ersetzten oft komplett den fehlenden Pkw. Mit dem Moped zur Frühschicht, mit dem Beiwagengespann zum Wochenendeinkauf, mit dem Motorrad und Zelt an die Ostsee – das war gelebte Realität. Wer keinen Regen scheute, kam überall hin. Wer improvisieren konnte, nahm auch mal die Schwiegermutter im Seitenwagen mit.
Die geringen Betriebskosten machten das Ganze noch attraktiver. Bei Kraftstoffpreisen zwischen 1,50 und 1,65 Mark pro Liter schlug der verbrauchsarme Zweitakter kaum ins Kontor. Während der Trabant auf der Warteliste stand, fuhr die Simson einfach los – sparsam, robust und jederzeit reparierbar, notfalls mit einem Stück Draht und einer Kombizange.
In einem Land, in dem vieles reguliert, knapp oder gar nicht verfügbar war, bedeutete ein eigenes Zweirad vor allem eines: Unabhängigkeit. Viele Jugendliche sparten eisern – und investierten ihr „Jugendweihe-Geld“ nicht in Kleidung oder Technik, sondern in eine Schwalbe oder eine nagelneue S 51. Wer so ein Moped besaß, war plötzlich mobil, selbstbestimmt, frei – zumindest ein kleines Stück.
Und diese Freiheit endete nicht mit der Wende. Im Einigungsvertrag wurde festgelegt, dass Kleinkrafträder aus der DDR mit bis zu 60 km/h auch weiterhin Bestandsschutz genießen. Während im Westen 45 km/h die Regel blieben, durften Simson-Fahrer weiter „eine Schippe drauflegen“. Dieser Sonderstatus machte die Mopeds aus Suhl bald zum Kultobjekt – nicht nur wegen der Geschwindigkeit, sondern auch wegen ihrer Robustheit, der Ersatzteillage und der aktiven Schrauberund Fahrerszene, die sich bis heute quer durch Deutschland zieht.
Der DDR-Verkehrsalltag war von einem Spannungsverhältnis geprägt: einerseits die strukturelle Knappheit an Pkw, andererseits eine regelrechte Massenmotorisierung auf zwei Rädern. Mopeds und Motorräder – erschwinglich, früh fahrbar und sparsam – wurden zum entscheidenden Motor individueller Mobilität. Sie prägten das Straßenbild der DDR von 1949 bis 1990 so nachhaltig wie kein anderes Fahrzeug.
Zeitstrahle für den Überblick
Verkehrspolitik
Jahr
Verkehrspolitik & Infrastruktur
Wartburg / Trabant & Pkw-Knappheit
1949
Gründung der DDR; Bildung der VVB IFA als staatlicher Automobil-Dachverband.
Wiederaufnahme der PKW-Fertigung in Eisenach (IFA F9) und Zwickau (IFA P70-Vorlauf).
1951
Regierung priorisiert Schwer- & Rüstungsindustrie private Pkw bleiben planwirtschaftlich nachrangig.
Entwicklungsstart Wartburg 311 (Eisenach) und AWZ P70 (Zwickau).
1956
Einführung bundesweiter Kraftstoff-Bezugskarten (monatliches Benzin-Kontingent für Privatfahrer).
1958
StVO-Novelle senkt zulässiges Gesamtgewicht für Pkw-Fahrerlaubnis (Klasse 3) ; Fokus auf Leichtfahrzeuge.
Serienanlauf Trabant P 50 (500 cm
3
, 18 PS).
1960
Erster Autobahnneubau der DDR (Berliner Ring, A10-Schlusslücke) fertiggestellt.
Pkw-Wartezeit bei Neuanschaffung ~ 3 J. (Trabant) / 5 J. (Wartburg).
1963
60-km/h-Regel für Kleinkrafträder 50 cm
3
(§ 18
StVO) + Führerschein Klasse 4 ab 15 J. eingeführt.
1964
Kraftstoffpreis auf 1,50 M / l festgesetzt (bleibt bis 1978 nahezu konstant).
Serienstart Trabant 601; Export nach Westeuropa via Inter-Import beginnt.
1966
Ausbau Nahverkehr: Beschluss „Komplexer ÖPNV-Plan 1970“ – Vorrang Kombinierter Nahverkehr (Bahn + Bus + Tram) in Großstädten.
Markteinführung Wartburg 353 (1000 cm
3
, 45 PS).
1971
„Benzinspar-Beschluss“: Senkung Privat-Kontingent von 90 l auf 60 l/Monat; Förderung Fahrgemeinschaften.
Ø Wartezeit Trabant 8 J.; DDR-Bestand: 1 Mio. Pkw (225 Pkw / 1000 Ew).
1973 / 74
Weltölkrise: DDR sichert Import – keine Preiserhöhung, aber befristete Wochenend-Fahrverbote für privat motorisierte Fernreisen.
1978
Benzinpreis erstmals auf 1,60 M / l angehoben (ab 1984: 1,65 M).
1984
Kooperationsvertrag IFA / VW: Lieferung 1,3-l-Vier-Takt-Motoren für Eisenach.
Ø Wartezeit Trabant 12 J.; Gebrauchtpreise über Neupreis.
1986
Beschluss „Öko-Programm 2000“ – Entwicklung schadstoffärmerer Zweitakter scheitert an Devisenmangel.
1988
Serienstart Wartburg 1.3 mit VW-Motor; Stückkosten 30 000 M nur Dienst- & Exportfahrzeug.
1989
9. Nov.: Grenzöffnung; Sofortimport West-Treibstoff; Sprit-Kupone entfallen.
Pkw-Neuzulassungen explodieren, Gebraucht-Trabis verlieren binnen Wochen 80 % Marktwert.
1990
1. Juli: Währungs-, Wirt-schafts- und Sozialunion; StVO-West tritt schrittweise in Kraft. 60-km/ h-Bestandsschutz für DDR-Kleinkrafträder im Einigungsvertrag verankert.
Produktionsende Trabant (31. Juli 1991) und Wartburg (14. Apr 1991) zeichnen sich ab.
MZ & Simson
Jahr
MZ - Schlüsselereignisse
Simson - Schlüsselereignisse
1906
J. S. Rasmussen kauft eine leerstehende Tuchfabrik in Zschopau – Grundstein der künftigen DKW-Motorenwerke, später MZ.
1929
Mit 60 000 Maschinen ist DKW größter Motorradhersteller der Welt.
1939
Entwicklung des RT 125 – Blaupause für Nachkriegs-Leichtmotorräder weltweit.
1949
DDR-Gründung; Zschopau-Werk firmiert unter IFA, produziert weiter RT 125.
Erste Nachkriegsmopeds entstehen in Suhl (Vorläufer der AWO 425).
1950
Serienstart IFA RT 125 in Zschopau.
1952
Umbenennung in VEB Motorradwerk Zschopau (MZ).
Werk heißt nun VEB Fahrzeug- und Gerätewerk Simson Suhl; AWO 425 T in Serie.
1955
Simson-Marke wiederbelebt; erstes Zweitakt-Moped SR 1 erscheint.
1956
Akronym MZ offiziell eingeführt.
1962
Start der ES 125/150 Baureihe – erstes Motorrad mit asymmetrischem Abblendlicht.
1964
ES 250/2 Trophy und Exporterfolge im Geländesport.
Kult-Scooter KR 51 Schwalbe geht an den Start.
1970
Einmillionstes MZ-Motorrad (ETS 250 Trophy Sport) rollt vom Band.
1975
Simson präsentiert S 50-Baureihe (3,6 PS, 60 km/h).
1980
Nachfolger S 51 erreicht den Markt – wird bis 1990 meistgebautes DDR-Moped.
1983
Zweimillionstes MZ-Motorrad: ETZ 250 mit Scheibenbremse & 12 V - Elektrik.
1989
MZ stellt Beiwagenbau ein; politische Wende.
1990
Privatisierung von MZ am 18. Dez.; Produktionskrise nach Währungs- & Marktöffnung.
Mopeds behalten per Einigungsvertrag 60-km/ h-Bestandsschutz; Simson sortiert Modellpalette neu (S 53/S 83).
1993
MZ geht in Insolvenzverwaltung; MuZ entsteht aus Restbetrieb.
Produktion der Schwalbe-Nachfolger SR 50/SR 80 läuft wieder an.
1999
Namensrückkehr zu MZ; Präsentation Skorpion 660.
2002 / 03
Simson meldet Insolvenz; Fertigung endet im Feb 2003.
2008
Finanzinvestor zieht sich zurück – Werksschließung in Zschopau, Motorradfertigung stoppt nach 88 Jahren.
2009
Ehemalige GP-Profis Wimmer & Waldmann kaufen Marke, lokales Bike- & E-Bike-Projekt startet.
2013
Insolvenzverfahren beendet Versuche zur Neuaufstellung; Traditionswerk endgültig insolvent.
2021
MZ-Cup (Einmarken-Rennserie für Skorpion) feiert 25-jähriges Jubiläum.
2025
Simson- und MZ-Fahrzeuge bleiben Kult – aktive Szene, Ersatzteilsicherung & Restauration boomen.
UNTERNEHMENSGESCHICHTEN
Motorradwerk Zschopau (MZ)
Zschopau – das ist für uns nicht nur ein Name auf der Landkarte, sondern ein Symbol für ostdeutschen Motorradbau mit Weltruf. Über Jahrzehnte hinweg war die Stadt an der Zschopau ein Zentrum der Zweiradproduktion – erst mit DKW, ab 1956 dann unter dem legendären Kürzel MZ. Zwischen 1922 und 2016 liefen hier Millionen Maschinen vom Band, vom Brot-und-Butter-Moped bis hin zur sportlichen 250er. Kriegszeiten und politische Umbrüche konnten die Produktion zwar zeitweise unterbrechen, aber nie ganz zum Erliegen bringen. Heute darf sich Zschopau ganz offiziell „Motorradstadt“ nennen – ein Titel, den sie sich redlich verdient hat. Wer einmal auf einer MZ durch den Harz getuckert ist oder mit seiner Simson den ersten Regen abgekriegt hat, der weiß: Hier wurde nicht nur Technik gebaut. Hier wurde Geschichte geschrieben – unsere Geschichte.
Der Start
Die Geschichte von MZ beginnt nicht mit einem Motorrad – sondern mit einem Dänen, der im sächsischen Chemnitz sein Glück suchte. 1904 ließ Jørgen Skafte Rasmussen zusammen mit Carl Ernst die Firma Rasmussen & Ernst ins Handelsregister eintragen. Verkauft wurde damals noch alles Mögliche: Maschinen, Apparate, Zubehör – ein klassischer Tüftlerbetrieb. 1906 zog Rasmussen mit seinem Unternehmen nach Zschopau, wo er eine stillgelegte Tuchfabrik am Bach Tischau übernahm. Die Handelsregistereintragung von 1907 nannte nur ihn als Inhaber – ein früher Fingerzeig darauf, wer hier wirklich die Richtung vorgab. Während der Name „Rasmussen & Ernst“ bis 1912 blieb, war es längst Rasmussen, der die Zügel in der Hand hielt.
In Zschopau wurde das Unternehmen schnell größer – von Haushaltsgeräten über Dampfanlagen bis hin zu medizinischen Apparaten wurde alles produziert, was findige Ingenieurskunst versprach. Doch mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam der zivile Betrieb nahezu zum Stillstand. Rasmussen reagierte pragmatisch: Er sicherte sich Militäraufträge und stieg mit der Produktion von Zündern ins Kriegsgeschäft ein. Das sicherte nicht nur das Überleben des Betriebs, sondern führte sogar zu einem Aufschwung – bis Ende 1915 arbeiteten rund 480 Menschen in der Fabrik.
In den Jahren 1916 und 1917 versuchte sich Rasmussen zusammen mit seinem Studienfreund Mathiesen an einem kühnen Projekt: einem dampfbetriebenen Kraftwagen, finanziert vom Militär. Nach Kriegsende war das Interesse an der Dampftechnik jedoch schnell erloschen – das Projekt wurde 1921 eingestellt, nur zehn bis zwölf Fahrzeuge wurden gebaut. Was blieb, waren drei Buchstaben: DKW – Dampf-Kraft-Wagen. Rasmussen ließ sie als Warenzeichen schützen – und damit begann die zweite, viel bedeutendere Phase seines Schaffens.
1923 gründete er die Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG – und führte den Namen DKW weiter. Was mit Spielzeugmotoren und Dampfkraft begann, sollte bald zu einer der wichtigsten Motorradmarken Europas werden.
1918–1945 (DKW)
Alles begann mit einem Spielzeug – aber was für einem! Im Jahr 1918 stellte der Maschinenbauingenieur Hugo Ruppe, den Rasmussen als Konstrukteur ins Boot geholt hatte, einen kleinen Motor vor, der es in sich hatte. Ursprünglich als Konkurrenz zur damals beliebten Spielzeugdampfmaschine gedacht, steckte in diesem Zweitakter bereits die technische DNA für den späteren Ruhm aus Zschopau. Der Motor nutzte eine Schlitzsteuerung über die Kolbenkanten, Kurbelgehäusespülung und eine raffinierte Einlasssteuerung per Hubscheibe auf der Kurbelwelle. Ein Fliehkraft-Schieber sorgte für eine automatische Drehzahlbegrenzung – ziemlich clever für die damalige Zeit! Besonders beeindruckend war aber die Schwungrad-Magnetzündung mit außenliegendem Unterbrecher, die nicht nur funktionierte, sondern dabei auch herrlich einfach aufgebaut war. Im Schwungrad integrierte Leitschaufeln bliesen Kühlluft direkt auf die Zylinder – ein Geniestreich in Sachen Kompaktheit und Effizienz. Schon in diesem kleinen Motor steckten viele Ideen, die später bei DKW und MZ in Serie gingen. Vermarktet wurde das Ganze augenzwinkernd unter dem Namen „Des Knaben Wunsch“ – aber wir wissen heute: Es war der Anfang von etwas viel Größerem. Bereits zur Leipziger Messe 1919 wurden der Spielzeugmotor und ein stationärer Bruder der Öffentlichkeit präsentiert – und legten den Grundstein für das, was später die Motorradstadt Zschopau werden sollte.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war das Geld knapp, Benzin rar – und wer etwas auf sich hielt, fuhr Fahrrad. Autos waren für die allermeisten unerschwinglich. Rasmussen erkannte früh, welches Potenzial in der Mobilität auf zwei Rädern steckte, und gab seinem Konstrukteur Hugo Ruppe den Auftrag, einen kleinen, zuverlässigen Hilfsmotor für Fahrräder zu entwickeln. Heraus kam ein erstaunlich kompakter Zweitakter mit 118 cm3 und 1 PS – nicht viel nach heutigen Maßstäben, aber damals ein echter Fortschritt. Der Motor wurde zwischen 1919 und 1923 gebaut, konnte einfach auf dem Gepäckträger montiert werden und war damit eine bezahlbare Lösung für viele, die sich endlich etwas „Motorisierung“ leisten wollten. Im Volksmund bekam er schnell einen liebevollen Spitznamen: „Arschwärmer“.
Der Name mochte scherzhaft sein – der Erfolg war es nicht. Bereits am 17. Juni 1922 rollte das 20.000ste Exemplar vom Band, und insgesamt wurden über 30.000 Stück verkauft. Für Rasmussen war das der erste große wirtschaftliche Durchbruch nach dem Krieg – und für viele Menschen ein Stück neue Freiheit auf zwei Rädern. Der Weg von Zschopau zum Zentrum des deutschen Motorradbaus hatte damit endgültig begonnen.
In den Jahren 1921 und 1922 wagte man in Zschopau ein kleines, aber interessantes Experiment: Man nahm das sogenannte Golem-Sesselrad ins Verkaufsprogramm auf – ein ungewöhnliches Fahrzeug, das von der Berliner Firma Eichler & Co. gebaut wurde. Es sah ein wenig aus wie ein zu groß geratenes Fahrrad mit Sitzlehne, angetrieben von einem Ruppe-Motor, der liegend im Rahmen verbaut war. Die Idee war gut, doch in der Praxis hakte es: Das Fahrverhalten war wacklig, der Schwerpunkt ungünstig – ein gemütlicher „Sessel“ auf Rädern, aber eben kein fahrdynamisches Erlebnis.
Eichler ließ sich davon jedoch nicht entmutigen und brachte 1922 einen Nachfolger auf den Markt: das Lomos-Sesselrad. Mit diesem Modell wagte man sich in die Nähe des späteren Motorrollers – und tatsächlich war der Lomos in mancher Hinsicht seiner Zeit voraus. Der DKW-Motor war nun um etwa 45 Grad nach hinten geneigt und unter dem Sitz verbaut, was den Schwerpunkt verbesserte. Gebläsekühlung sorgte für Zuverlässigkeit, und die Hinterradschwinge mit Federbeinen brachte echten Fahrkomfort – ein Novum damals. Doch trotz all dieser technischen Finessen blieb der große Durchbruch aus. Die Kunden waren noch nicht bereit für diese neue Art der Fortbewegung. Der Lomos blieb ein mutiger, aber kommerziell erfolgloser Zwischenschritt – ein leiser Vorbote dessen, was viele Jahre später als Motorroller die Straßen erobern sollte.
Manchmal braucht ein Unternehmen genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit – und Rasmussen hatte dieses Glück gleich doppelt. Als sich 1920 der einst so wichtige Motorenkonstrukteur Hugo Ruppe nach Differenzen mit dem Chef verabschiedete, trat der Chemnitzer Ingenieur Hermann Weber auf den Plan. Er kam nicht, um bestehende Konzepte zu verwalten – er kam, um sie weiterzuentwickeln. Rasmussen träumte mittlerweile nicht mehr nur von Motoren, sondern von eigenen Fahrzeugen. Weber erkannte das Potenzial und schuf mit seinem Team eine verbesserte Version des bisherigen Fahrradhilfsmotors: mit Gebläsekühlung, angetrieben vom Schwungrad, und einem verstärkten Rahmen, der zwar noch ans Fahrrad erinnerte, aber technisch bereits Richtung Motorrad ging.
1922 wagte das Zschopauer Werk den nächsten großen Schritt – und trat mit mehreren dieser Maschinen bei der Reichsfahrt an, einem Prestige-Wettbewerb für neue Fahrzeuge. In ihrer Klasse belegten die Zschopauer Maschinen die ersten drei Plätze – ein Triumph für die junge Marke. Der Erfolg war so groß, dass man das Modell fortan selbstbewusst Reichsfahrtmodell nannte. Zwar besaß es anfangs noch Fahrradmerkmale wie den Tretkurbelantrieb, doch rückblickend war es das erste echte Serienmotorrad von DKW. Rund 20.000 Stück wurden davon gebaut – und damit war endgültig klar: Zschopau war nicht mehr nur ein Motorenbauer. Es war ein Motorradstandort geworden.
Auf das erfolgreiche Reichsfahrtmodell folgte 1923 das Zschopauer Leichtmotorrad – ein weiterer Meilenstein. Der Motor saß nun tiefer im Rahmendreieck, was den Schwerpunkt verbesserte und das Fahrverhalten deutlich ruhiger machte. Mit dem ein Jahr später vorgestellten Zschopauer Modell brachte DKW erstmals mehrere Hubraumvarianten auf den Markt – zwischen 128 und 206 cm3 war für fast jeden Anspruch etwas dabei. Eine weitere technische Neuerung war das platzsparende Zweiganggetriebe, das direkt ins Kurbelgehäuse integriert war: Zwei unterschiedlich große Zahnräder übertrugen die Kraft auf eine Vorgelegewelle, die zugleich als Abtriebswelle diente – ein kompaktes und robustes System. Insgesamt wurden von beiden Modellen rund 9.200 Stück gefertigt – kein Massenprodukt, aber ein klares Signal: DKW war auf dem Weg nach oben.
Neben den technischen Fortschritten erwies sich eine weitere Personalentscheidung als echter Glücksfall: Im April 1922 trat der junge Österreicher Carl Hahn ins Unternehmen ein – auf Empfehlung zunächst als persönlicher Assistent Rasmussens. Doch schon bald zeigte sich, dass in Hahn mehr als ein guter Mitarbeiter steckte. Er wurde Verkaufsleiter – und später einer der Architekten des kometenhaften Aufstiegs von DKW zur weltweit größten Motorradfabrik. Während Weber die Technik nach vorn brachte, sorgte Hahn dafür, dass die Maschinen auch verkauft wurden – und zwar nicht zu knapp.
In diese Phase großer Umbrüche fiel auch die wirtschaftliche Umstrukturierung: Kurz nach Einführung der Rentenmark, die der Hyperinflation ein Ende setzte, wandelte Rasmussen sein Unternehmen am 22. Dezember 1923 in die Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen AG um. Fast alle Aktien blieben in seinem Besitz, seine Frau Therese übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat – eine Familien-AG mit großen Plänen. Carl Hahn stieg in den Vorstand auf – und Zschopau war bereit für den Sprung in eine neue Ära.
In den 1920er-Jahren galt der Viertaktmotor vielerorts als das Maß der Dinge – ausgereift, zuverlässig, modern. Der Zweitakter dagegen hatte einen schweren Stand: Er galt als laut, hungrig und thermisch überfordert – ein „Heißsporn mit Spülverlusten“, wie man in der Werkstatt sagte. Doch Rasmussen dachte anders. Für ihn war der Zweitaktmotor die ideale Grundlage für eine bezahlbare Massenmobilität. Einfach aufgebaut, mit nur drei bewegten Teilen – Kolben, Pleuel, Kurbelwelle – ließ er sich kostengünstig produzieren und reparieren. Was ihm an Effizienz fehlte, sollte durch clevere Technik und gute Fertigung wettgemacht werden.
Chefkonstrukteur Hermann Weber setzte genau da an. Mit seinem Team tüftelte er unermüdlich an einer Lösung für die größte Schwachstelle des Zweitakters: die thermische Belastung. Die Antwort war ebenso simpel wie genial – eine vom Schwungrad angetriebene Gebläsekühlung, die zuverlässig für frischen Wind an den heißen Zylindern sorgte. Und Verkaufsleiter Carl Hahn machte aus der Not eine Tugend: Er stellte die Einfachheit des Zweitaktmotors ins Rampenlicht und bewarb ihn offensiv als Motor „für jedermann“.
Während andere Hersteller mit komplexen Lösungen wie Drehschiebern, Ladepumpen oder Kompressoren experimentierten, setzten die Zschopauer auf etwas anderes: auf Serienreife, Alltagstauglichkeit und Robustheit. Die Dreikanalspülung – technisch simpel, aber wirkungsvoll – wurde zur Basis der Serienmotoren. Dazu kamen sinnvolle Details wie Mittelständer, Innenbackenbremsen und Lenkungsdämpfer – alles entwickelt, um das Motorrad massentauglich zu machen. Schritt für Schritt entstand in Zschopau etwas Einmaliges: ein klar durchdachtes, konsequent umgesetztes DKW-Konzept. Kein Firlefanz, sondern Technik fürs Volk – robust, ehrlich, ostdeutsch.
1925 kam sie auf den Markt – und wurde zum ersten großen Verkaufsschlager aus Zschopau: die DKW E 206. Mit 206 cm3 Hubraum, 4 PS Leistung und einem robusten Zweiganggetriebe war sie das perfekte Gebrauchsmotorrad für den Alltag. Sogar ein Sozius ließ sich mitnehmen – und das Ganze zum konkurrenzlosen Preis von nur 750 Reichsmark. Das war im Schnitt rund 200 Mark günstiger als vergleichbare Modelle der Konkurrenz. DKW bewarb die E 206 selbstbewusst: „Trotz modernster Konstruktion, unerreichter Zuverlässigkeit und bester Qualität ist die E 206 bei weitem das billigste Motorrad.“ Und das war nicht nur Werbesprech – das war Strategie.
Rasmussen hatte auf seinen USA-Reisen die Automobilfertigung studiert – und in Zschopau ab 1926 das Fließband eingeführt. Damit war DKW weltweit der erste Motorradhersteller, der diese Produktionsweise einsetzte. Die Folge: sinkende Stückkosten, steigende Stückzahlen, wachsender Marktanteil. Doch der eigentliche Clou kam 1928, als eine Gesetzesänderung zweirädrige Fahrzeuge bis 200 cm3 von Steuer und Führerscheinpflicht befreite. DKW reagierte blitzschnell, senkte den Hubraum leicht ab und brachte die E 200 auf den Markt. Für bereits verkaufte E 206 wurden sogar Umrüstsätze angeboten – kundenfreundlich und geschäftstüchtig zugleich. Bis 1929 liefen über 68.000 Maschinen vom Band – ein gewaltiger Erfolg, der DKW endgültig in die erste Reihe der deutschen Motorradhersteller katapultierte.
Bereits 1926 hatte man in Zschopau mutig ein Zweizylindermodell mit 500 cm3 vorgestellt – doch wegen häufiger Kolbenklemmer durch Überhitzung blieb die Stückzahl mit etwas über 1.000 Exemplaren bescheiden. Mehr Erfolg hatten die Einzylinder-Modelle E 250 und E 300, die ab 1927 ins Programm kamen. Von der E 250 wurden rund 8.000, von der E 300 sogar 13.000 Stück produziert – der Beweis, dass DKW mit einfacher, durchdachter Technik genau den Nerv der Zeit traf.
Der Erfolg der DKW-Motorräder ließ in Zschopau nicht nur die Produktionszahlen steigen – auch das Werk selbst wuchs rasant. Ab Mitte der 1920er-Jahre entstand ein moderner Industriebetrieb nach dem Vorbild amerikanischer Großfabriken. Bis 1928 wurden mehrere mehrgeschossige Hallen in Stahlbetonbauweise errichtet, entworfen vom Chemnitzer Architekten Willy Schönefeld. Einige davon stehen bis heute unter Denkmalschutz – stille Zeugen eines Industriebooms, wie ihn die Region bis dahin nicht erlebt hatte. In dieser Hochphase liefen täglich bis zu 450 Motorräder vom Band – rund 60.000 im Jahr. 1928 war DKW damit erstmals der größte Motorradhersteller der Welt. Jeder dritte deutsche Biker saß damals auf einer DKW – und jeder zweite fuhr zumindest mit einem Zschopauer Motor unterm Tank.
Der rasante Aufstieg brachte aber auch neue Herausforderungen. Vor allem Wohnraum für die stetig wachsende Zahl an Beschäftigten wurde knapp. Die Werksleitung wandte sich deshalb 1927 an den Stadtrat, um eine Werkssiedlung zu errichten. Mit Erfolg: Am 10. Juli 1928 wurde das Bauvorhaben genehmigt, das Land Sachsen stellte 250.000 Reichsmark zur Verfügung – und Rasmussen selbst gab jedem Siedler zusätzlich ein Darlehen von 1.000 RM. Bereits im November 1929 konnten 68 Familien ihre Häuser am Zschopenberg beziehen – Industriepolitik zum Anfassen.
Trotz allem Erfolg blieb eines ungelöst: ein Gleisanschluss für das Werk. Die Bahnlinie verlief zwar nur ein paar hundert Meter entfernt im Zschopautal, doch der Höhenunterschied war zu groß. Alle Versuche – auch später zu DDR-Zeiten – eine Werksbahn zu bauen, scheiterten an den Kosten. So mussten sämtliches Rohmaterial und jede fertige Maschine mühsam per Lkw zum Bahnhof transportiert werden – ein logistischer Kraftakt, der Jahrzehnte lang anhielt.
Auch technisch setzte DKW Maßstäbe: Ab 1929 führte man in der Luxus-Typenreihe den neuen Pressstahlrahmen ein. Im Vergleich zum klassischen Einrohrrahmen war er deutlich verwindungssteifer und ließ sich durch verschraubte Einzelteile rationell in großen Stückzahlen fertigen. Auch bei Gabeln und anderen Bauteilen ging man Schritt für Schritt zur Pressstahl-Bauweise über. Nur bei kleineren Maschinen bis 200 cm3 hielt man noch eine Weile an den Einrohrrahmen fest.
Die Modellvielfalt von 1929 war beachtlich – sie reichte vom sparsamen Alltagsmotorrad bis hin zur sportlichen DKW Supersport 600, einem wassergekühlten Zweizylinder mit 600 cm3, ausgelegt für den Seitenwagenbetrieb. Möglich wurde diese Breite nicht nur durch neue Modelle wie die Luxus-Typenreihe, sondern auch durch clevere Modularität: Viele Anbauteile ließen sich untereinander kombinieren – ein Baukastenprinzip, das seiner Zeit weit voraus war.
Der Börsencrash von 1929 hatte weltweit Folgen – und auch in Zschopau blieben sie nicht aus. Die Motorradverkäufe brachen dramatisch ein: 1930 konnte DKW noch rund 36.000 Maschinen absetzen, doch schon ein Jahr später waren es nur noch 12.500, 1932 kaum mehr als 11.000. Auch einfache, billig herzustellende Modelle wie das Volksrad ES 200 oder die Z 200 konnten den freien Fall nicht aufhalten. Selbst eine Marke wie DKW, noch wenige Jahre zuvor weltgrößter Motorradhersteller, geriet ins Straucheln.
Die angespannte Lage traf auch die anderen Werke des DKW-Konzerns, darunter die Tochtergesellschaft Audi. Die Sächsische Staatsbank – mit 25 Prozent an der DKW AG beteiligt – verweigerte neue Kredite und drängte stattdessen auf eine grundlegende Neuordnung. Das Ergebnis war ein Meilenstein der deutschen Industriegeschichte: Am 29. Juni 1932 wurde rückwirkend zum 1. November 1931 die Auto Union AG mit Sitz in Chemnitz gegründet.
DKW war nun nicht mehr allein, sondern Teil eines Bündnisses aus vier Marken: Audi, DKW, Horch und Wanderer – jede mit ihrer eigenen Geschichte, aber vereint unter einem neuen Dach. Das Symbol dieses Zusammenschlusses sind bis heute weltbekannt: vier ineinander verschlungene Ringe. Zunächst befand sich die Verwaltung der Auto Union im DKW-Stammwerk in Zschopau, ab 1936 dann im ehemaligen Chemnitzer Presto-Werk.
Für Unternehmensgründer Jørgen Skafte Rasmussen war diese Entwicklung ein tiefer Einschnitt. Zwar saß er zunächst noch im Vorstand der neuen Auto Union, doch seine Pläne, das Unternehmen später wieder zu privatisieren, stießen auf Widerstand. 1934 ließ er sich beurlauben, noch im selben Jahr wurde sein Vertrag gekündigt. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit erhielt er 1938 eine Abfindung – aber sein Werk, das er aus dem Nichts aufgebaut hatte, gehörte ihm nicht mehr. Rasmussen musste gehen. Die Ära des großen Tüftlers und Visionärs war damit vorbei – aber seine Maschinen blieben.
Der Zweitaktmotor war einfach, günstig und leistungsstark – doch je größer der Hubraum und je höher die Drehzahlen wurden, desto deutlicher zeigten sich seine Schwächen. Besonders die hohe thermische Belastung machte den Zschopauer Konstrukteuren zu schaffen. Schon 1931 musste man bei der sportlichen DKW Sport 500 mit einer aufwendigen Thermosiphon-Wasserkühlung gegen Kolbenklemmer ankämpfen. Zwar hatten Modelle wie die Block 350 durch die Membraneinlasssteuerung bereits spürbare Fortschritte bei der Gemischfüllung erzielt, doch das eigentliche Problem blieb ungelöst: Die Motoren wurden bei hohen Drehzahlen schlicht zu heiß.
Ende 1931 stieß Jørgen Skafte Rasmussen auf eine Dissertation des jungen Ingenieurs Herbert Josef Venediger. Darin hieß es sinngemäß, dass ein bestimmtes Spülverfahren – die Umkehrspülung, bislang nur bei langsam laufenden Großmotoren verwendet – auch bei schnelllaufenden Fahrzeugmotoren möglich sei, dort aber „merkwürdigerweise noch gar nicht versucht worden“ sei. Rasmussen wurde hellhörig. Anfang 1932 stellte er Venediger als Entwicklungsleiter ein. Parallel dazu nahm man Kontakt zu Adolf Schnürle auf, dem geistigen Vater der Umkehrspülung, der das Verfahren bereits 1924 hatte patentieren lassen. Da Schnürles Arbeitgeber, Klöckner-Humboldt-Deutz, kein Interesse an einer aktiven Vermarktung hatte, schloss die Auto Union kurzerhand einen Alleinlizenzvertrag – begrenzt auf Zweitakt-Ottomotoren. Ein Geniestreich.
Was dann geschah, war ein technologischer Quantensprung: Innerhalb kürzester Zeit wurden alle Fahrzeug- und Stationärmotoren auf das neue Spülverfahren umgestellt. Die Folgen waren dramatisch – im besten Sinne: Die bis dahin nötigen, aufwendig herzustellenden Nasenkolben verschwanden, einfache Flachkolben reichten aus. Die Leistung stieg, der Motorlauf wurde ruhiger, der Verbrauch sank um rund 40 %. DKW-Zweitakter rückten plötzlich in die Effizienzbereiche von Viertaktern vor – ohne auf deren Komplexität angewiesen zu sein. Auch die thermischen Probleme waren gelöst: Ab 1932 kam kein Großserien-Motorradmotor aus Zschopau mehr mit Wasser- oder Gebläsekühlung – so grundlegend hatte die Schnürle-Umkehrspülung das Spiel verändert.
Der Erfolg der Auto Union in den 1930er-Jahren beruhte auf einer einfachen, aber wirkungsvollen Formel: große Vielfalt, clevere Vereinfachung. Vom bezahlbaren DKW-Motorrad über die sportlichen Wanderer-Modelle bis hin zum prestigeträchtigen Horch-Luxuswagen – das Typenprogramm deckte die ganze Bandbreite des Markts ab. Forschung und Entwicklung wurden konzernweit gebündelt, die Fertigung zunehmend vereinheitlicht. Ziel war es, günstiger produzieren zu können als die Konkurrenz – ohne auf Qualität zu verzichten.
Ein Paradebeispiel für diese Strategie war die 1934 eingeführte SB-Baureihe. Sie deckte die Hubraumklassen von 200 bis 500 cm3 ab – mit maximalem Gleichteile-Einsatz. Egal ob SB 200 oder SB 500: Viele Baugruppen waren identisch, was Herstellung und Wartung vereinfachte und die Kosten deutlich senkte. In den Klassen 200, 350 und 500 cm3 gab es die Maschinen sogar ab Werk in speziellen Geländesportausführungen – robust, leicht und mit sportlicher Note.
Unterhalb der 200er-Klasse legte DKW im selben Jahr mit einem echten Dauerbrenner nach: der RT 100. Für nur 345 Reichsmark bot sie ein leichtes, zuverlässiges Leichtmotorrad, das sich schnell zu einem Verkaufsschlager entwickelte. Bis 1940 wurden über 70.000 Stück gebaut – mehr als von jedem anderen DKW-Motorrad. Auch die RT 100 war auf Wunsch in einer Geländesportversion erhältlich – ein Zeichen dafür, wie durchdacht und vielseitig das Programm von DKW in dieser Zeit geworden war. Vom Schüler bis zum Werksfahrer – für jeden gab es das passende Motorrad.
Der enorme technische Vorsprung, den sich DKW mit der Schnürle-Umkehrspülung und der hochgradig rationalisierten Fertigung erarbeitet hatte, hatte auch seine Schattenseite: eine gewisse technische Selbstzufriedenheit. Warum etwas Neues wagen, wenn sich die bestehenden Modelle wie geschnitten Brot verkaufen? Die beliebte SB-Baureihe lief hervorragend – da sah man in Zschopau zunächst keinen dringenden Handlungsbedarf. So kam es, dass die bereits im Herbst 1936 serienreif entwickelte NZ-Typenreihe erst zwei Jahre später, 1938, in Produktion ging.
Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fand die zivile Fertigung bald ein Ende – doch die wenigen Jahre reichten, um ein weiteres Kapitel Motorradgeschichte zu schreiben. Die DKW NZ 500 war das erste Serienmotorrad aus Zschopau mit verstellbarer Hinterradfederung – ein technisches Novum, das den Komfort und die Fahrdynamik deutlich verbesserte.
Noch bedeutender war jedoch das, was 1940 auf den Markt kam: die DKW RT 125 – von vielen als das „Meisterstück Hermann Webers“ bezeichnet. Klein, leicht, zuverlässig und einfach zu bauen, vereinte sie alles, wofür DKW stand. Sie war nicht nur der Nachfolger der RT 100 – sie wurde zum Motorrad einer neuen Ära. Nach Kriegsende fehlte es an Patentschutz – und so trat die RT 125 einen Siegeszug um die Welt an. Ob als Harley-Davidson Hummer in den USA, BSA Bantam in Großbritannien oder MMZ/Minsk in der Sowjetunion: Überall wurde kopiert, was aus Zschopau kam. Die RT 125 – ein Motorrad, das Geschichte schrieb, nicht nur bei uns.
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wandelte sich die Auto Union AG rasch vom Industrie- zum Rüstungskonzern. Auch im DKW-Stammwerk Zschopau wurde die zivile Fertigung zunehmend zurückgefahren und durch militärische Aufträge ersetzt. Ab Mai 1940 entstanden hier stationäre und mobile Einzylindermotoren für verschiedenste Aggregate der Wehrmacht, darunter kleine Stromerzeuger und Pumpenantriebe. In großer Stückzahl wurde zudem ein Zweizylindermotor für eine Tragkraftspritze der Flader-Feuerlöschgerätefabrik produziert, die im Luftschutz zum Einsatz kam. Im Geschäftsjahr 1940/41 verließen 33.646 Zweitaktmotoren die Werkshallen – ein Großteil davon für militärische Zwecke. Parallel dazu wurden noch über 20.000 zivile Motorräder gefertigt. Selbst 1942 entstanden noch rund 7.000 zivile Maschinen, doch schon ab 1941 liefen die ersten Militärmodelle vom Band: die DKW RT 125-1 und die NZ 350-1 in speziell angepasster Ausführung.
Dass DKW überhaupt weiterhin Motorräder bauen durfte – und nicht vollständig auf reine Rüstungsgüter umgestellt wurde – ist vor allem Carl Hahn zu verdanken. Mit diplomatischem Geschick und klarem Blick für industrielle Realitäten überzeugte er das Heereswaffenamt davon, DKW als Heereslieferanten für Krafträder zuzulassen. Damit sicherte er nicht nur den Fortbestand des Werks, sondern auch den Arbeitsplatz Tausender Zschopauer in einer Zeit größter Unsicherheit.
Ein dunkles Kapitel der Werkgeschichte darf nicht verschwiegen werden: Vom 21. November 1944 bis April 1945 befand sich auf dem Werksgelände ein Außenlager des Konzentrationslagers Flossenbürg. Rund 500 jüdische Frauen und Mädchen, verschleppt aus dem Lager Auschwitz, wurden hier zur Zwangsarbeit in der Rüstungsproduktion gezwungen – unter unmenschlichen Bedingungen. Sechs von ihnen, darunter ein Kleinkind, überlebten die Tortur nicht. Seit 2005 erinnert ein Gedenkstein auf dem Zschopauer Friedhof an ihr Schicksal – und daran, dass industrielle Leistung auch immer eine moralische Verantwortung trägt.
Schon früh wurde in Zschopau nicht nur geschraubt, sondern auch gefeiert. Bereits am 29. Juli 1922 wurde die Fertigstellung des zweitausendsten DKW-Motorrads begangen – ein stolzer Moment nur wenige Monate nach dem Start der Serienproduktion. Zwei Jahre später verließ das 10.000ste Motorrad das Werk, 1926 waren es bereits 25.000, und 1928 wurde das 100.000ste DKW-Motorrad gebaut – eine Zahl, die damals nur wenige Werke weltweit erreichten.
Doch der Wachstumsmotor in Zschopau lief weiter: 1935 feierte man das 300.000ste Motorrad, und am 6. Februar 1939 war es schließlich soweit – Nummer 500.000 rollte vom Band. Es handelte sich um eine DKW SB 500, ein Spitzenmodell der damaligen Baureihe. Das Jubiläum wurde mit einer feierlichen Zeremonie im Werk begangen. Als besonderer Höhepunkt setzte niemand Geringerer als Walfried Winkler – mehrfacher deutscher Meister und Aushängeschild der DKW-Rennabteilung – den Motor erstmals in Gang.
Für Zschopau war das mehr als nur ein Meilenstein: Es war ein Symbol für den Aufstieg aus der Provinz zur Motorradmetropole. Hunderttausende Motorräder, gebaut von Arbeitern, Ingenieuren und Technikbegeisterten – und jedes einzelne ein Stück ostdeutscher Industriegeschichte.
Der Aufstieg von DKW zur weltgrößten Motorradfabrik nach Stückzahlen beruhte auf einem perfekten Zusammenspiel aus Technik, Strategie und Emotion. Neben den bahnbrechenden Entwicklungen am Zweitaktmotor und der kostengünstigen Fertigung am Fließband war es vor allem einer, der DKW an die Spitze brachte: Carl Hahn. Als Verkaufsleiter war er der Architekt eines flächendeckenden Vertriebsnetzes – und weit mehr als das. Er führte die Ratenzahlung ein, rief Händlerkongresse ins Leben, ließ Werkstattbetreiber schulen und sorgte so dafür, dass der Name DKW in der Fläche präsent war – greifbar, bezahlbar, vertraut. Aus Händlern wurden Partner, aus Kunden wurde eine Gemeinschaft von Zweitaktgläubigen.
Auf Hahns Betreiben entstanden im In- und Ausland zahlreiche DKW-Motorradclubs – oft initiiert durch lokale Händler. So wurde aus der Marke eine Bewegung. Der emotionale Kitt dafür kam aus einer anderen Ecke: dem Rennsport. Seit Gründung der Zschopauer Rennabteilung 1927 eilten die Werksfahrer von Sieg zu Sieg. Bereits 1929 warb DKW mit über 1.000 Rennsiegen – ein Wert, der für viele Kunden mehr sagte als jeder Prospekt. Die Nähe zwischen den Idolen auf der Rennstrecke und den Fahrern auf der Landstraße war greifbar. Markentreue wurde zur Leidenschaft, fast schon zur Überzeugung – wie ein Glaube an die Zweitaktkraft aus dem Erzgebirge.
Den technischen Vorsprung zementierte DKW ab 1932 mit der exklusiven Lizenz auf die Schnürle-Umkehrspülung. Kein anderer Hersteller durfte diese Technologie einsetzen – ein Vorteil, den DKW nicht nur nutzte, sondern vermarktete. Während andere noch mit Nasenkolben kämpften, rollten in Zschopau längst kultivierte, sparsame und durchzugsstarke Zweitakter vom Band. Technik, Vertrieb und Rennsport griffen perfekt ineinander – und machten DKW zu einem Mythos auf zwei Rädern.
1945 - 1990
Der Neuanfang in Zschopau begann – wie so oft in der Geschichte dieses Ortes – mit einem Verlust. Am 3. Juli 1945 begann auf Befehl der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) die komplette Demontage des DKW-Stammwerks. Bis April 1946 wurden die modernen Fertigungsanlagen zerlegt und in die Sowjetunion abtransportiert – das Ende einer Ära. Eine geplante Sprengung der Werkgebäude konnte in letzten Verhandlungen gerade noch verhindert werden.
Doch das Wissen ging nicht verloren. Eine Gruppe von DKW-Ingenieuren – unter ihnen Werkleiter Otto Hoffmann, Chefkonstrukteur Hermann Weber und Technologe Ernst Volkmar – wurde zur Unterstützung des Wiederaufbaus sowjetischer Produktionsstätten zwangsverpflichtet. Unter ihrer Anleitung entstand in Moskau auf Zschopauer Maschinen ab 1946 das Modell M1A „Moskwa“, basierend auf den Vorkriegsplänen der RT 125. Später wurde die Produktion nach Minsk verlegt. Weitere Maschinen gelangten nach Kowrow, wo die К-125 entstand, sowie nach Ischewsk, wo aus der NZ 350 die sowjetische ISCH-350 wurde. Was in Zschopau begonnen hatte, verbreitete sich nun – unter Zwang und Entbehrung – über ein halbes Dutzend sowjetische Städte.
In der Sowjetischen Besatzungszone keimte derweil zaghaft ein Neuanfang: Anfang 1946 beauftragte die SMAD die von ehemaligen DKW-Mitarbeitern gegründete Maschinenbaugenossenschaft Zschopau mit der Herstellung von Ersatzteilen. Im Juli wurde sie in den Industrieverband Fahrzeugbau (IFA) eingegliedert. Der neue Produktionsstandort war das erhalten gebliebene Zweigwerk im nahegelegenen Wilischthal. Erste Versuche, wieder ein Leichtmotorrad zu bauen, mündeten 1947 im Modell L60 mit 60 cm3 Hubraum – gemäß der damaligen Vorgaben der Besatzungsmächte. Doch zur Serienfertigung kam es nicht. Die Hubraumgrenze wurde aufgehoben – und plötzlich war der Weg frei für die Rückkehr eines Klassikers.
Als die RT 125 am 5. September 1949 von der SMAD offiziell zur Fertigung freigegeben wurde, war das mehr als ein Produktionsauftrag – es war die Wiedergeburt des Motorradbaus in Zschopau. Die Markenrechte von DKW waren nach der Löschung der Auto Union aus dem Handelsregister verfallen, und so konnte man auf eigene Faust neu beginnen. 1950 kehrten die Produktionsabteilungen von Wilischthal ins Stammwerk zurück. Unter dem Markenzeichen IFA-DKW wurde die RT 125 wieder gebaut – ein Symbol des Neuanfangs auf alten Fundamenten. Zwar sollten 5.000 Maschinen entstehen, doch Materialknappheit erlaubte zunächst nur 1.700 Stück. Und doch: Der Klang des Zweitakters war wieder da. Zschopau lebte.
Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1951 präsentierte sich der ostdeutsche Motorradbau erstmals wieder mit einer echten Neuentwicklung – und was für einer: Die BK 350 wurde vorgestellt, ein technisch ambitioniertes Modell mit Zweizylinder-Zweitakt-Boxermotor und Kardanantrieb. Es war das erste – und bis heute einzige – DDR-Serienmotorrad mit Boxermotor. Wer wollte, konnte das neue Motorrad sogar ab Werk mit Seitenwagen bestellen – ein Angebot, das die BK 350 als repräsentatives und vielseitiges Fahrzeug positionierte.
Der Kardanantrieb zur Kraftübertragung auf das Hinterrad war dabei nicht nur eine technische Besonderheit, sondern auch eine pragmatische Lösung: In der frühen Nachkriegszeit waren Antriebsketten schwer zu beschaffen, während sich Kardanwellen aus vorhandenen Fertigungskapazitäten herstellen ließen.
Auch wenn die fahrerprobten Vorserienmodelle bereits 1951 gezeigt wurden, ließ der offizielle Serienstart noch auf sich warten – erst Ende 1952 lief die Fertigung an. Gründe dafür lagen in der Materialknappheit, dem langsamen Hochlauf der Industrie und der gleichzeitig hohen Erwartungshaltung an dieses Prestigeobjekt. Doch mit der BK 350 setzte Zschopau ein deutliches Zeichen: Der Neuanfang war nicht nur gelungen – er war selbstbewusst.
Der letzte sichtbare Faden zur alten DKW-Vergangenheit wurde am 1. Oktober 1951 durchtrennt. Auf staatliche Weisung durfte das Kürzel DKW nicht länger verwendet werden – ein symbolischer Schlussstrich. Von nun an hieß alles nur noch IFA, schlicht und funktional. Doch in Zschopau arbeitete man längst an einer eigenen Identität. Am 21. Oktober 1953 wurde das Werk in VEB Motorradwerk Zschopau umbenannt, und ab 1956 trugen alle Modelle ein neues Markenzeichen: MZ – Motorradwerk Zschopau. Den grafischen Ausdruck dieser Neuausrichtung schuf Arthur Meinig, der bereits seit 1936 in Zschopau tätig war. Sein entworfenes Schwingenlogo, mit kleinen Anpassungen, sollte bis weit in die 1980er-Jahre die Motorräder aus dem Erzgebirge zieren – ein neues Zeichen für eine neue Ära.
1952 kam es dann zu einem Zufall mit weitreichenden Folgen: Walter Kaaden, Ingenieur und begeisterter Hobbyrennfahrer, fuhr ein selbstgebautes Motorrad mit einem technisch verblüffenden Auspuffsystem – Prallbleche zur Verstärkung von Resonanzwellen, eine frühe Form des Resonanzauspuffs. Das blieb Alfred Liebers, Technischer Direktor des VEB, nicht verborgen. Er stellte Kaaden ein – mit dem Auftrag, eine eigene Rennabteilung aufzubauen. Was damit begann, sollte später den Namen MZ in die Welt hinaustragen. Zunächst war die Abteilung im Stammwerk untergebracht, doch ab 1959/60 zog sie mit Teilen der Verwaltung in ein leerstehendes Gebäude im benachbarten Hohndorf, direkt an der Fernverkehrsstraße 174.
Parallel dazu schraubte man in Zschopau an einer Lösung für ein ganz alltägliches Problem: schlechte Kettenqualität. Die neue RT 125/1, ab 1954 in Serie, brachte die Lösung: Kettenschläuche und ein Kettenkasten, die die Antriebskette vor Schmutz und Verschleiß schützten. Eine pragmatische Innovation, wie sie typisch war für MZ. Das System wurde patentiert – und später von anderen Herstellern wie Bultaco übernommen.
Mitte der 1950er-Jahre entstand schließlich eine spürbare Lücke im Modellangebot zwischen 125 und 350 cm3. Gleichzeitig etablierte sich international die Langarmschwinge als moderne Vorderradführung. Bei MZ dachte man praktisch – und entwickelte ein Motorrad, das sowohl im Alltag als auch auf kurvigen Landstraßen überzeugte. 1956 kam die ES-Baureihe auf den Markt – mit Vollschwingenfahrwerk und Motoren in 175 und 250 cm3. Komfortabel, stabil, durchdacht – die ES war das erste echte Motorrad des neuen Namens MZ. Und sie wurde zum Gesicht einer ganzen Motorradgeneration in der DDR.
Mit der ES-Baureihe traf MZ genau den Nerv der Zeit – nicht nur in der DDR, sondern weit darüber hinaus. Die Modelle mit 175 und 250 cm3 Hubraum überzeugten durch einen durchzugsstarken, zuverlässigen Motor, der komfortables und wirtschaftliches Fahren ermöglichte – auf dem Landweg zur Arbeit ebenso wie bei der Tour in den Thüringer Wald. Die Motorleistung der ES 250 wurde im Laufe der Modellpflege konsequent gesteigert: von anfangs 12 PS auf beeindruckende 19 PS im Jahr 1969 – und das mit einem Zweitakter! Zusammen mit den Rennsporterfolgen der 1960er-Jahre verschaffte sich MZ auch im Westen einen Ruf als Hersteller ehrlicher, robuster und erstaunlich potenter Motorräder. Die Produktion stieg rasant – MZ wurde zum größten Motorradhersteller Europas.
Parallel boomte der Markt für Motorroller. Die Industriewerke Ludwigsfelde (IWL) entwickelten dafür das Fahrgestell, den Antrieb lieferte MZ – mit dem bekannten 125er-Motor, nun ergänzt um eine Gebläsekühlung. Die Roller Pitty, Wiesel, Berlin und Troll nutzten allesamt diesen bewährten Antrieb, der ab dem Modell Berlin sogar auf 150 cm3 erweitert wurde. Zwischen 1955 und 1964 entstanden über 239.000 Rollermotoren für IWL – ein beeindruckendes Kapitel ostdeutscher Mobilitätsgeschichte.
Auch MZ selbst wagte einen Vorstoß: 1957 wurde ein großer Motorroller mit dem Motor der ES 250 zur Probe entwickelt. Die Fahreigenschaften waren top – 105 km/h Höchstgeschwindigkeit, Radaufhängung und Fahrverhalten auf dem Niveau der ES. Doch das Projekt hatte einen Haken: Das Fahrzeug wog 168 Kilogramm leer – zu schwer für den Alltag. Die Serienfertigung wurde daher verworfen.
1961 setzte MZ ein Zeichen der Erinnerung: Auf Schloss Augustusburg wurde das firmeneigene Motorrad-Museum eröffnet – heute eine der bedeutendsten Zweiradsammlungen Europas und ein Pilgerort für Fans der Marke.
In technischer Hinsicht wurde Anfang der 1960er klar: Der klassische Rahmen der MZ 125 war am Limit. Um auch in der kleinen Hubraumklasse den Komfort und die Stabilität eines Vollschwingenfahrwerks zu bieten, entwickelte MZ einen völlig neuen Pressstahlrahmen. Seine Hälften wurden ohne Schweißpunkte durch Bördeln über Falze verbunden – eine Neuheit in der Serienproduktion. Beim Antrieb blieb es beim bewährten Motor aus MZ 125 und IWL-Rollern, der weiter verbessert wurde. So entstand die erste MZ mit 150 cm3, die ab 1962 zusammen mit den überarbeiteten kleinen ES-Modellen erschien – und dabei auch ein Weltneuheit mitbrachte: asymmetrisches Abblendlicht – serienmäßig und weltweit einmalig.
1966 stand MZ am Abgrund – politisch, nicht technisch. Obwohl die Motorräder aus Zschopau im westlichen Ausland gefragt waren wie nie und dort als solide, zuverlässige Maschinen mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis galten, plante das zuständige Ministerium für Allgemeinen Maschinen-, Landmaschinenund Fahrzeugbau den Motorradbau in Zschopau schrittweise einzustellen. Stattdessen sollte das Werk künftig Teile für Fahrräder produzieren – ein drastischer Rückschritt, der das Ende des Motorradstandorts Zschopau bedeutet hätte.
Gerettet wurde MZ durch die eigene Stärke: Auf der Leipziger Herbstmesse 1966 konnte das Werk überaus lukrative Exportverträge abschließen. Die Aussicht auf dringend benötigte Westdevisen überzeugte schließlich auch die politischen Entscheidungsträger – der Motorradbau durfte weiterbestehen.
Ende der 1960er-Jahre hatte MZ sein ziviles Serienprogramm fast vollständig auf Vollschwingen-Fahrwerke umgestellt. Nur einige wenige Geländesportmodelle wurden noch in Kleinserie gefertigt. Doch weltweit setzte sich ein neuer Trend durch: Teleskopgabeln. Um international konkurrenzfähig zu bleiben, entwickelte MZ aus der bewährten ES-Baureihe eine modernisierte Modellreihe – die ETS-Baureihe. Mit nur wenigen Änderungen an Rahmen und Fahrwerk, aber dem neuen Look mit Teleskopgabel, erschienen ab 1968 die ETS-Modelle. Sie wurden zunächst vor allem für den Export gebaut und liefen bis 1973 parallel zu den weiterhin erhältlichen ES-Maschinen vom Band.
Damit bewies MZ erneut die Fähigkeit, auch unter ideologisch und wirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen zeitgemäße Technik auf die Räder zu stellen – ein Kraftakt zwischen sozialistischer Planung und westlichem Marktdruck.
Ende der 1960er-Jahre griff die Planwirtschaft tief in die Autonomie der ostdeutschen Fahrzeughersteller ein. Im Zuge der weiteren Zentralisierungsbestrebungen der Staats- und Parteiführung wurde der VEB Motorradwerk Zschopau zum 1. Januar 1970 dem neu gegründeten „VEB IFA-Kombinat für Zweiradfahrzeuge“ unterstellt. Die Leitung dieses Kombinats hatte der Stammbetrieb VEB Simson in Suhl inne.
Für MZ bedeutete dies den Verlust der Eigenständigkeit. Die Betriebsleitung hatte fortan Weisungen aus Suhl zu befolgen, und Gewinne mussten an zentral gesteuerte Projekte des DDR-Automobilbaus abgeführt werden. Eines der ersten Opfer dieser neuen Struktur war die geplante Serienproduktion eines neu entwickelten Einheitsmotors – das Projekt wurde gestoppt, bevor es zur Marktreife kam.
Zum 1. Januar 1972 wurde auch der traditionsreiche Leipziger Seitenwagenhersteller Walter Stoye Fahrzeugbau dem VEB MZ als Werk IV angegliedert. Doch trotz solcher Erweiterungen war klar: Auch bei MZ hielt die wirtschaftliche Erstarrung der DDR Einzug – wenn auch nicht so ausgeprägt wie im Automobilbau.
Ab 1973 ging MZ mit einer neuen Modellfamilie an den Start: der TS-Baureihe. Sie sollte die in die Jahre gekommenen ES-und ETS-Modelle ablösen. Das Flaggschiff, die TS 250, brachte zumindest technische Fortschritte mit sich: Ein neuer Brückenrahmen sorgte für erhöhte Steifigkeit, der bewährte Antrieb wurde überarbeitet, und der Motor nun elastisch aufgehängt, was Laufkultur und Fahrkomfort verbesserte.
Die kleineren Modelle, TS 125 und TS 150, konnten da nicht mithalten. In ihnen schlummerte weiter die Grundkonstruktion eines Motors aus den 1930er-Jahren – robust, aber technisch überholt. Die Fachpresse reagierte entsprechend kritisch. MZ konnte zwar weiterhin solide Motorräder für Alltag und Export liefern, aber die Zeichen der verlorenen Innovationskraft wurden unübersehbar.
Unabhängig von politischen Entscheidungen wurde dem VEB MZ zunehmend die topografische Lage des Stammwerks in Zschopau zum Verhängnis. Eingezwängt in das enge, tief eingeschnittene Tal der Tischau fehlten jegliche Erweiterungsmöglichkeiten – ein Umstand, der eine Modernisierung und Effizienzsteigerung der Produktionsabläufe nachhaltig behinderte. Das Platzproblem galt als chronisch. Um diesem Missstand dauerhaft zu begegnen, wurde im August 1979 der Grundstein für einen neuen Werksteil im benachbarten Hohndorf gelegt, an der Alten Marienberger Straße. In die 1981 eingeweihte erste Produktionshalle zog die Zylinderschleiferei ein, 1988 folgte mit der Eröffnung einer zweiten Halle ein weiterer Ausbau des Standorts.
Im April 1981 startete die Großserienproduktion der MZ ETZ 250, die als Nachfolgerin der TS 250/1 antrat. Der Motor beruhte auf einer Weiterentwicklung des bewährten Antriebs, erstmals wurde für den Export eine Variante mit Getrenntschmierung angeboten. Das Fahrwerk mit neu konstruiertem Kastenprofil-Brückenrahmen erwies sich als deutlich verwindungssteifer als das des Vorgängermodells. Zudem hielt mit der ETZ 250 bei MZ die 12-Volt-Elektrik sowie eine vordere Scheibenbremse Einzug – beides längst etablierte Standards in der internationalen Motorradproduktion. Trotz positiver Einschätzung der Fahrleistungen durch die Fachwelt blieb der Wunsch nach weitergehenden technischen Verbesserungen. Diese scheiterten jedoch offenkundig an den begrenzten Möglichkeiten der DDR-Wirtschaft.