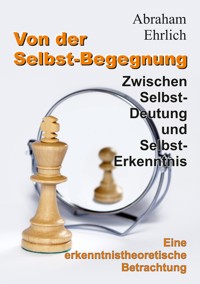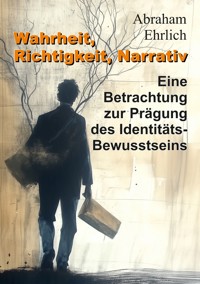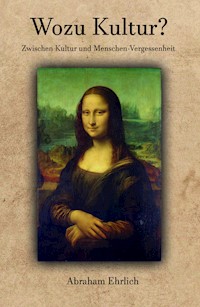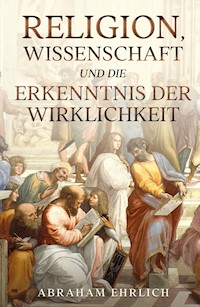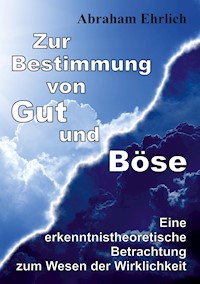
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bestimmte Erscheinungen in unserer Realität verlangen nach klarer Erklärung. Es geht nicht bloß um Aggressivität und Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen und Gestalten. Es geht besonders um die Frage, wie all das inmitten einer Kultur möglich ist, die »uns so klar und so ausdrücklich schon seit Langem die Mittel zum Leben in persönlicher und gesellschaftlicher Harmonie zur Verfügung stellt«. Die Frage nach der Bestimmung von Gut und Böse begleitet den Menschen von Anfang seines Bestehens in der Welt. Die Intensität der Beschäftigung mit dieser Frage im Mythos, in der Religion, in der Philosophie und in allen Kunstzweigen deutet auf eine Bedeutung hin, die weit über die Grenzen des ethischen Handelns hinaus führt: »Der Gesamtzusammenhang der Wirklichkeit«, in der der Mensch sein Leben führt. Es geht um zwei Arten des Verständnisses der Wirklichkeit, die sich in zwei gegensätzliche Visionen der Beziehung zwischen Mensch und Welt zum konkreten Ausdruck bringen: Eine, die den Menschen ohne Einschränkung bejaht, und eine, die sich erlaubt, den Bereich des Menschlichen einengend zu bestimmen und sich so als eine Vision des Schreckens und des Todes zu offenbaren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Abraham Ehrlich
Zur Bestimmung von
Gut und Böse
Eine erkenntnistheoretische Betrachtung
zum Wesen der Wirklichkeit
Copyright: © 2021 Abraham Ehrlich
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Titelbild: © I_g0rZh (depositphotos.com)
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover 978-3-347-49988-1
Hardcover 978-3-347-49989-8
E-Book 978-3-347-49990-4
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
„Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Friedenund jage ihm nach“
Psalm 34, 15
„Denn es ist nicht von etwas Beliebigem die Rede,sondern davon, auf welche Weise man leben soll“
Sokrates (in Platon, Staat, 352d5)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
I. Einführendes
II. Die Vision des Bösen: Die „wahre“ Wirklichkeit, die „arische Rasse“, der „Gottmensch“ und das „Untermenschentum“
II.1. Einführendes
II.2. Die „Natur“, ihre „wissenschaftliche“ Erkenntnis und deren „zwingenden“ Folgen
III. Die nationalsozialistische Revolution und die Institutionalisierung des Menschen-Vergessens: Ein universalgeschichtliches Ereignis
III.1. Einführendes
III.2. Zum ideologischen Schema des Nationalsozialismus I
III.2.a. Exkursion zum Verständnis der sogenannten „totalen Revolution des Vergessens“
III.2.b. Zum ideologischen Schema des Nationalsozialismus II – Vom Kampf gegen den „Fluch der jüdischen Tafeln"
IV. Von der angeblichen „universal-geschichtlichen Auserwähltheit“ der „nordisch-germanischen Rasse" und ihrer einmaligen „geschichtlichen Bestimmung zur Weltherrschaft"
IV.1. Was stellen ‚Jude‘ und ‚Judentum‘ in ihrem Wesen und in ihrem Bestehen „wirklich“ dar
IV.2. Was müssen die Völker der Welt unbedingt tun, damit sie nicht aus dem „Paradies" vertrieben werden?
V. Einführendes über Sinn und Bedeutung der jüdischen Geschichte
V.1. Welche Grundtatsache bringen alle Einzelheiten der jüdischen Geschichte zum Ausdruck?
V.1.2. Warum die universal-geschichtliche Kategorie die einzige ist, die es uns möglich macht, die geschichtlichen Erscheinungen des Judentums zu verstehen?
V.1.3. Die Sinai-Offenbarung als Beispiel für die radikale Abweichung des Verständnisses der jüdischen Geschichte vom herkömmlichen Verständnis dessen, was „Geschichte" genannt wird
V.1.4. Der sehr genau bestimmte Volkscharakter des jüdischen Volkes
VI. Die Vision des Guten I: Wirklichkeit, Wahrheit und die Erkenntnis der Wirklichkeit
VI.1. Das Denken als der systematische Ausgangspunkt zur Erkenntnis der Wirklichkeit
VII. Die Vision des Guten II: Der Menschen, seine Würde und seine innige Rechte
VIII. Die Verantwortungslehre I: Das Sitten-Gebot und die Menschenrechte
IX. Die Verantwortungslehre II: Die staatliche Ordnung und die Frage nach Solidarität und Gerechtigkeit
X. Schlusswort: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – zur Frage nach Wahrheit und Toleranz
Vorwort
1. Liebe Leserin, lieber Leser, meine letzte Publikation unter dem Namen „Wozu Kultur?“ bezog sich auf die aktuelle Situation der Menschen in der Corona-Krise und auf die Rolle der Kultur in dieser Situation, aber auch im Leben des Einzelnen im Allgemeinen. Die Vorliegende Arbeit will die Frage nach dem, was Gut und Böse genannt wird, klären. Auch hier spielt Kultur eine entscheidende Rolle – in der Möglichkeit der Verwirklichung des Guten und der Verhinderung des Entstehens des Bösen.
Die Betonung der erkenntnistheoretischen Orientierung zur Klärung der oben genannten Frage, will deutlich machen, dass eine solche Klärung, um verbindlich zu sein, eine philosophisch systematische Grundlage benötigt. Die für diese Arbeit relevanten System-Aspekte entnehme ich aus der Gesamtdarstellung meines philosophischen Systems, das in den folgenden Publikationen enthalten ist:
• Das System der Philosophie. Die systematische Grundlage zur Erkenntnis der Wirklichkeit und zur Bestimmung der Stellung des Menschen in ihr, Frankfurt am Main 2012 (zitiert: System I)
• Der Mensch und seine Welt: Zur erkenntnistheoretischen Klärung der Stellung des Menschen in der Welt und der Bedingungen der Verwirklichung seiner Freiheit – das System der Philosophie II, Frankfurt am Main 2013 (zitiert: System II)
• Die Grenzen der Erkenntnis und dahinter: Zur Klärung der erkenntnistheoretischen Grundlage des religiösen Glaubens – das System III, Frankfurt am Main 2014 (zitiert: System III)
Hinzu kommen folgende systematische Ergänzungen:
• Religion, Wissenschaft und Erkenntnis der Wirklichkeit, Hamburg 2020 (zitiert: Religion)
• Zur Wesensbestimmung der Philosophie, Hamburg 2021
• Wozu Kultur? Zwischen Kultur und Menschen-Vergessenheit, Hamburg 2021 (zitiert: Kultur)
Zu besonderen Dank bin ich meinem Sohn Jonathan verpflichtet, der mir bei der sprachlichen Gestaltung des Manuskripts eng zur Seite stand. Für die Verwandlung des Manuskripts in ein fertiges Buch möchte ich mich bei Herrn Erik Kinting herzlich bedanken; für die Betreuung der Publikation meines Buches möchte ich mich beim Publikationsteam des „tredition“-Verlags herzlich bedanken.
2. Der Drang, die Frage nach Gut und Böse zu klären, schlummert schon lange in meinem Inneren. Bestimmte Erscheinungen in unserer Realität verlangen nach klarer Erklärung. Es geht nicht bloß um Aggressivität und Gewalt in ihren unterschiedlichen Formen und Gestalten. Es geht besonders um die Frage, wie all das in mitten einer Kultur möglich ist, die uns so klar und so ausdrücklich schon seit Langem die Mittel zum Leben in persönlicher und gesellschaftlicher Harmonie zur Verfügung stellt.
Die Frage nach der Bedeutung der Kultur für das Verständnis des Menschen, für das Verständnis seines Handelns und für das Verständnis der dem Menschen angemessenen Gesellschaftsorganisation, ist für die individuelle wie gemeinschaftliche Art der Lebensführung entscheidend1. Nicht weniger entscheidend ist die wesensmäßige Unterscheidung zwischen dem, was als „das Gute“ und „das Böse“ bezeichnet wird.
Dabei geht es nicht um die Attribute „gut“ und „böse“, also um die Qualifikation und um die Bewertung unterschiedlicher Zusammenhänge, sondern um die Bestimmung von etwas, das den Menschen unbedingt angeht, von ihm aber unabhängig ist und ihm in Bezug auf das, was er sein soll, erkenntnis-mäßig aufgezwungen ist.
Der Klärung der Frage nach der Bestimmung von Gut und Böse ist die vorliegende Arbeit gewidmet. Die Tatsache, dass es sich um eine erkenntnis-theoretische Klärung handelt, bedeutet, dass der Zusammenhang dieser Klärung die Wirklichkeit als Ganzes ausmacht. Konkret heißt das, dass die Bestimmung des Wesens des Guten und des Bösen in dem Zusammenhang der Beziehung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit erfolgt. Als konkretes Beispiel der Bestimmung des erkenntnis-theoretischen Zusammenhanges zwischen Gut, Böse, Wirklichkeit und Wahrheit möchte ich den Nationalsozialismus und die von ihm geplante und in die Tat umgesetzte Vision betrachten, die im Holocaust – in der Schoa – einen eigentümlichen Ausdruck fand.
Die Schoa ereignete sich doch inmitten des Zentrums der westlichen Kultur, im Zentrum des christlichen Abendlandes.
In einem solchen Zusammenhang zwingen sich die zwei Fragen – „Wozu Kultur?“ und die Frage nach Gut und Böse – auf eine gewaltige Weise auf. Mit welchen Kategorien lässt sich die Schoa, lässt sich das, was verkürzt „Auschwitz“ genannt wird, beschreiben und verstehen?
Die gewaltige Dimension dieses Ereignisses, wie auch die gewaltige Dimension der geistigen Grundlage des Nationalsozialismus, die „Auschwitz“ konkret möglich machte, verlangt nach dem Verständnis dafür, was unvollständiger Weise mit „Zivilisationsbruch“ bezeichnet wird, eine Kategorie, die oft genannt wird: Die nationalsozialistische Ideologie will nicht mit unserer Zivilisation brechen; sie will vielmehr mit unserer Wirklichkeit brechen!
Die NS-Ideologie hat vor, das nach ihrem Verständnis wahre Wesen der Wirklichkeit zu offenbaren, eine Wirklichkeit zu schaffen, die in ihrem Fundament von unserer grundsätzlich unterscheidet!
Die nationalsozialistische Vision will die bestehenden Umstände in der Welt nicht ändern (wie z.B. der Kommunismus), sondern dafür sorgen, dass die radikal andere Wirklichkeit, die „wahre“, zur vollen Geltung kommt.
Die Tatsache, dass in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus von Terror, Massenmord und Völkermord die Rede ist, darf die Tatsache nicht verwischen, dass es sich hier nicht – wie etwa im Fall des Stalinismus und des Maoismus – um die Durchsetzung eines politischen, ideologisch bestimmten Programms handelt: Dem Nationalsozialismus geht es in erster Linie und vor allem um die Verwirklichung der umfassenden Idee der Rasse!
„Die Rassenlehre“, schreibt Karl Saller, „war die entscheidende geistige Grundlage des Nationalsozialismus. Sie war nicht der Grund zu seiner Machtergreifung – zur Macht ist der Nationalsozialismus durch seine Demagogie gekommen […]. Aber seine Rassenlehre war das Ziel dieser Macht, und durch sie in erster Linie glaubten die Nationalsozialisten ihre Macht für alle Zeiten – in einem mindestens „tausendjährigen Reich“ – erhalten zu können. So kann ihre Bedeutung für die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit kaum überschätzt werden“.2
Selbstverständlich verlangte diese Verwirklichung der Idee der Rasse nach einem umfassenden politischen Programm; dieses Programm war aber in dieser Idee „objektiv“ begründet und zielte ausdrücklich auf die Schaffung der neuen rassisch bestimmten Gesamt-Wirklichkeit.
Der Zivilisationsbruch, der tatsächlich geschehen ist, stellt an sich nur einen, wenn auch wesentlichen, Teil eines (versuchten) gewaltigen Wirklichkeitsbruchs dar: Das, was in der Wirklichkeit geschieht bzw. zwangsläufig als Aufgabe des Ariers geschehen soll, folgt mit Natur-Notwendigkeit aus der (vermeintlichen) Erkenntnis des Wirklichkeits-Ganzen!
In der folgenden Darlegung geht es mir darum, klar zu stellen, dass das Böse keine nur moralische Angelegenheit ist. Die eigentliche Dimension des Bösen gründet in dem eigentümlichen Bestreben, Wirklichkeits-bestimmend zu sein und auf die Erkenntnis dieser Wirklichkeit als die wahre Wirklichkeit zu drängen. Es geht also um die existentiell schicksalhafte Auseinandersetzung um die Wahrheit der Erkenntnis der Wirklichkeit und um die Bedeutung dieser Erkenntnis für den Menschen, individuell und gemeinschaftlich.
Die Vision des Bösen drückt sich nicht in der „Sprache“ des Bösen aus, sondern sie redet sehr bestimmt von der „naturgemäßen“, „wahren“ Wirklichkeit, die von unzähligen Menschen ignoriert bzw. nicht wahrgenommen wird. Diese Vision drängt dazu, mit dem „verzerrten“ Wirklichkeitsbild und dementsprechend mit der ihm entsprechenden „falschen“ Wirklichkeit zu brechen, um so den Raum für die Schaffung der „einzig legitimen“, der „wahren Menschennatur“ frei zu machen.
In der Bereitschaft, einen solchen Wirklichkeitsbruch zu vollziehen, steckt das gewaltig große Potenzial der Wirklichkeit des absoluten Bösen!
1 Vgl. dazu: Kultur
2 Karl Saller, Die Rassenlehre des Nationalsozialismus in Wissenschaft und Propaganda, Darmstadt 1961, S. 9
I. Einführendes
1. Die Frage, was unter Gut und Böse zu verstehen ist, ist so alt, wie der Mensch selbst. Diese Tatsache deutet auf die Eigentümlichkeit des Menschen hin: Ein Lebewesen, das zwar als solches ein Teil der Natur ist, gleichzeitig aber sprengt es, seinem Wesen nach, die Grenzen der Natur.
Die Natur, wie sie uns beobachtungsmäßig und wissenschaftlich bekannt ist, kennt weder das Gute noch das Böse: Sie stellt ein selbstgenügsames Gebilde dar, das wert-neutral und somit wert-frei ist.
Es geht also bezüglich des Guten und des Bösen um eine Bestimmung des Menschen, die ihn und sein Leben betrifft. Dabei ist es wichtig zwischen dem Adjektiv „gut“ und dem Substantiv „das Gute“ zu unterscheiden. Eine enzyklopädische Erläuterung kann uns helfen, den Unterschied zwischen beiden deutlich zu erkennen:
„Das Adjektiv „gut“ ist in der Form guot im Althochdeutschen schon im 8. Jahrhundert bezeugt. Seine Bedeutungsentwicklung führte von der ursprünglichen Grundbedeutung „passend“, „geeignet“ zu „tauglich“, „wertvoll“, „hochwertig“ und auf Personen bezogen „tüchtig“, „geschickt“, auch den sozialen Rang anzeigend „angesehen“, „vornehm“. In ethischer Verwendung bedeutete es schon im Althochdeutschen „rechtschaffen“, „anständig“.
Während das Adjektiv „gut“ eine Vielzahl von Bedeutungen hat, stammt das Substantiv „das Gute“ aus der philosophischen und theologischen Fachsprache und wird in einem spezielleren Sinn verwendet, der von der fachsprachlichen Herkunft des Begriffs geprägt ist. Als „gut“ werden unter anderem Gegenstände bezeichnet, wenn sie qualitativ hochwertig und zu einem bestimmten Zweck tauglich sind, oder Leistungen, wenn sie bestimmte Anforderungen erfüllen, oder Verhältnisse und Zustände, wenn sie angenehm und erfreulich sind. Ein Mensch gilt als „gut“, wenn er sozial erwünschte Eigenschaften aufweist. „Das Gute“ hingegen steht in der Regel für ein höchstrangiges Ziel des Menschen: für das unbedingt Wünschenswerte und als richtig Erachtete, das durch entsprechende Handlungen verwirklicht werden soll. Hier geht es nicht um Tauglichkeit, die etwas Zweckdienliches als gut erscheinen lässt, sondern um das schlechthin Gute als Selbstzweck“.3
Zu betonen ist die Tatsache, dass „gut“ und „böse“ – wie sie oben beschrieben wurden – relativ in ihrer Bedeutung und in ihrer Gültigkeit sind: was heute als gut empfunden und verstanden wird, kann morgen als das Gegenteil davon empfunden und verstanden werden. „Gut“ und „böse“ sind personen- (oft dieselbe), ort- und zeitbedingt. Dem gegenüber ist „das Gute“ seinem Wesen nach unbedingt und absolut in seiner Bedeutung und in seiner Gültigkeit.
Abgesehen von der hier beschriebenen Deutung der Adjektive „gut“ und „böse“, die sich relativ an dem angestrebten Zweck orientiert, muss man eine weitere Bedeutung dieser beiden Adjektive hervorheben: die moralisch-sittlichen Qualifikationen „gut“ und „böse“. Die Adjektive „gut“ und „böse“ in ihrer moralisch-sittlichen Bedeutung entstammen den Begriffen „des Guten“ und „des Bösen“.
Die moralischen Attribute „gut“ und “böse“ sind unmittelbare Ausdrücke der Autonomie des Menschen: Es handelt sich um einen Aspekt des menschlichen Wesens, der in seiner Fähigkeit zur Selbst-Gesetzgebung und zur ursprünglichen Bestimmung seines Willens zum bewussten, absichtsvollen Handeln zum Ausdruck kommt.
Es geht um die Fähigkeit des Menschen, Möglichkeit in Wirklichkeit umzuwandeln. Es handelt sich dabei jedoch nicht darum, auf die Um-Welt zu wirken und in ihr etwas zu ändern. Es handelt sich vielmehr um die eigentümliche Fähigkeit des Menschen, sich auf eine fundamentale, singuläre Weise zu verwirklichen.
Konkret heißt das: Je echter, authentischer eine Person ist, desto wirklicher ist sie! Wenn eine Person, geleitet durch Wirklichkeits- und Selbsterkenntnis, danach strebt, das zu sein, was sie sein soll, wird sie immer wirklicher, also immer deutlicher Teil der Wirklichkeit.
Die weltliche Überzeugung, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wie auch die religiöse Überzeugung, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist, beide haben zur gewaltigen geschichtlichen Entwicklung der Bedingungen der Möglichkeit der persönlichen Freiheit und der ihr angemessenen gesellschaftlichen freiheitlichen, sozial-gerechten Ordnung geführt. Auch die gewaltige Entwicklung der Wissenschaft und der Technik, die immer mehr Menschen zum menschen-würdigen Leben verhelfen, sind ein sehr konkreter Ausdruck dieser Selbst-Verwirklichung des Menschen, also für die Schaffung einer menschen-gerechten Wirklichkeit im umfassendsten Sinne des Wortes.
Die moralischen Werte und Normen, die die persönliche Lebensführung in ihrer Gültigkeit begründen und leiten, haben ihren Grund im Wesenskern des Menschen und sie besitzen daher objektive Gültigkeit.
Im Unterschied zur Naturgesetzlichkeit, die uns aufgezwungen ist, gründen die moralischen Werte und Normen in der vom Wesenskern des Menschen bestimmten Gesetzmäßigkeit, die uns deshalb nicht aufgezwungen ist, weil sie ihrem Wesen nach eine Gesetzmäßigkeit ist, die von uns erkannt, verinnerlicht, gewollt und in unserer persönlichen Lebensführung konkretisiert werden soll.
Die auf diese Weise zum Ausdruck kommende Autonomie und mit ihr die Freiheit des Menschen, birgt in sich die eigentümliche Kraft, dem persönlichen Dasein zur authentischen Wirklichkeit zu verhelfen.
Was die moralisch-sittliche Qualifikation einer Person betrifft, müssen wir zwischen „nicht gut“ und „böse“ unterscheiden. Eine Person kann als „nicht gut“ in unterschiedlichen Intensitätsgraden beschrieben werden: Es sind – umgangssprachlich – unterschiedliche Grade des „Schlechten“ („ein schlechter Mensch“). Ein wirklich böser Mensch ist einer, der ganz bewusst und mit voller Absicht die erkenntnismäßig festgestellte, also die wahre Wirklichkeit negiert.
2. Das Böse, wenn man es als den Gegensatz zum Guten verstehen will, bedeutet nicht bloß die Negation der Qualität des Guten, wie etwa „einem bestimmten Zweck untauglich“, oder etwas „nicht-unbedingt-Wünschenswertes“ usw. Diese Negationen haben in Bezug auf das Gute gar keinen Sinn.
Der Gegensatz des Guten – das Böse – besteht nicht in der bewussten Verhinderung und Bekämpfung der Verwirklichung dessen, was das Gute darstellt, sondern in dem Entwurf einer neuen Wirklichkeit: Es geht um ein anderes Gutes – das „natur-gmäße“ Gute!
Dieser Entwurf ist zunächst nüchtern. Die Realisierung dieses Entwurfs ist jedoch nur mit tiefster Überzeugung möglich. Denn nur wer überzeugt ist, den Entwurf für eine „gute neue Welt“ in den Händen zu halten, wird dessen Realisierung mit Enthusiasmus vorantreiben.
Es geht hier also um eine Vision der angeblich natur-bedingten Verwirklichung von etwas Umfassendem, das nach dieser Vision als die wahre Wirklichkeit verstanden wird.
Die Negation des gültigen Begriffs der Wirklichkeit und insofern des Begriffs der Wahrheit dieser Wirklichkeit, so wie diese in der Naturgesetzlichkeit und in der ethisch-sittlichen Gesetzlichkeit zum Ausdruck kommt, – eine Negation in gleichzeitiger Bestimmung einer ihr gegenüber stehenden „wahren“ Wirklichkeit, wird mit der Bezeichnung „das Böse“ versehen.
Das Böse besitzt also keine eigenständige Bedeutung und insofern auch keine wahre eigenständige Wirklichkeit – und dementsprechend bringt es keine eigenständige „Wahrheit“ zum Ausdruck. Diese „Wahrheit“ benötigt die Wahrheit, um sich als deren Negation zu bestimmen und als ihre Negation zu „verwirklichen“.
„Gut“ und „Böse“ sind keine Relativ-Begriffe; wir benötigen den Begriff des Bösen nicht, um das Gute zu bestimmen: Das Gute, als das Wirklichkeitsmäßige und so als das Wahrheitsmäßige, steht bedeutungsmäßig an und für sich als eine geschlossene Einheit da. Der Versuch, das Gute zu verhindern, kann nur durch die Verwendung der Kategorien des Guten selbst, also durch die Verwendung der „natur-gemäßen“ Kategorien der Wirklichkeit und der Wahrheit gleistet werden.
3. Wir sind daran gewöhnt, das „Gute“ als ethisch-sittliche Kategorien zu bestimmen: Autonomie, Freiheit, Handlungsnormen. Dabei muss jedoch bedacht werden, dass solche Kategorien keinen eigenständigen, selbstgenügsamen Bereich konstituieren.
Wie die systematischen Überlegungen klar gezeigt haben, gehören Autonomie, Freiheit und andere Aspekte zur Bestimmung des Bereichs des Menschlichen; dieser Bereich ist aber Teilbereich der Wirklichkeit im Ganzen, und erst in diesem Zusammenhang kann vom Menschen und von einem von ihm konstituierten „Bereich“ die Rede sein.
Die Loslösung der ethisch-sittlichen Kategorien vom Gesamtzusammenhang der Wirklichkeit und ihre Wertung als eigenständiger „Themenbereich“, wird sie in ihrer Bedeutung relativieren: Worin soll ihre Allgemeingültigkeit – und ja ihre Notwendigkeit für eine dem Menschen angemessene Orientierung seiner Lebensführung begründet sein?
Diese verlangte Grundlage kann nur und ausschließlich die philosophisch-systematische Erkenntnis der Wirklichkeit sein! Die Erkenntnis der Wirklichkeit ist immer schon in allen Systementwürfen der erste Schritt zur Bestimmung einzelner Phänomene der Wirklichkeit. Das ist der einzige Weg zur unvoreingenommenen, wertneutralen Erkenntnis der Wirklichkeit und von allem, was als wirklich verstanden werden kann.
Geht man stattdessen, um die Erkenntnis der Wirklichkeit zu erlangen, von einem bestimmten Wirklichen aus, kann das nur in einem bestimmen „Licht“, aus einer bestimmten Perspektive geschehen, also wertorientiert und so verfälscht.
Geht man zum Beispiel von einem bestimmten Menschenverständnis und von einer bestimmten gesellschaftlichen Zielsetzung aus, dann wird man dazu geführt, das Wirklichkeitsganze diesem Verständnis und dieser Zielsetzung zu unterwerfen. Das ist eine „Interpretation“ der Wirklichkeit im Licht dieses Verständnisses, sie stellt das dar, was als Ideologie bekannt ist.
Die Tatsache, dass die Philosophie alles in der Welt in die Perspektive der Wirklichkeit als Ganzes stellt, unterscheidet sie von der Ideologie und macht es unmöglich, dass sie zu einer solchen wird. Ideologie ist im Sinne von R. Lauth eine scheinwissenschaftliche oder scheinphilosophischeInterpretation der Wirklichkeit im Dienste einer gesellschaftlichen Zielsetzung, die sie rückläufig legitimieren soll. Das heißt, hier besteht der Bezug auf das Ganze, aber in umgekehrter Richtung: Es ist die Stellung des Ganzen in der Perspektive von bestimmten gesellschaftlichen Zielsetzungen oder Werten. Daher ist es eine Interpretation der Wirklichkeit und keine Erkenntnis derselben. Dies hat zur Folge, dass in der Ideologie der Bezug zur Wahrheit im eigentlichen Sinne fehlt.
Wenn eine Gruppe von Vorstellungen erstens ein bestimmtes Bild der gesellschaftlichen Wirklichkeit darstellt und zweitens bestimmte Ziele und Werte stellt, nach deren Verwirklichung die Gesellschaft streben soll oder die sie, wenn sie schon Wirklichkeit sind, erhalten soll, wenn also diese Gruppe von Vorstellungen gedanklich im Zusammenhang mit einer gesamten Weltauffassung entwickelt wird, dann heißt sie „Ideologie“.
Wesentlich für die Ideologie ist nicht nur ein allgemeines Interesse an einer gesellschaftlichen und politischen zielorientierten Gestaltung, sondern die Absicht, das Handeln eines jeden Mitglieds der Gesellschaft zu bestimmen. Die Weltauffassung, die eine Ideologie darstellt, betrachtet alles in der Welt aus der Perspektive von den zu verwirklichenden oder zu erhaltenden gesellschaftlichen und politischen Zielsetzungen und Werten, was das konkrete Zeichen für das Fehlen eines jeden Bezugs auf Wahrheit im eigentlichen Sinne ist. Hier wird der Versuch unternommen, nicht nur die gesamte Wirklichkeit und die Vielfältigkeit ihrer Erscheinungen mittels Kategorien eines bestimmten Bereiches der Wirklichkeit zu interpretieren, sondern diesen Bereich selbst in die Perspektive von bestimmten verabsolutierten Werten und in den Dienst der von ihnen abgeleiteten Zielsetzungen zu stellen. Der konkrete gesellschaftliche und politische Ausdruck eines solchen Totalitätsanspruchs von verabsolutierten Werten, welcher der Ideologie wesentlich ist, ist der Totalitarismus.4
Vor diesem Hintergrund verliert der grundsätzliche Unterschied zwischen „gut“ und „böse“ und zwischen dem „Guten“ und dem „Bösen“ seine Bedeutung! So bahnt sich der Weg zu einer Art von ethisch-sittlicher Orientierung, die aus philosophisch-systemati-schen, kritisch-aufklärerischen wie auch aus religiösen Standpunkten nur und ausschließlich alsMenschen-verachtend verstanden werden kann!
Genau das vollzog der Nationalsozialismus auf eine sehr effiziente Weise!
4. Ein Beispiel aus der Alltags-Wirklichkeit der Einsatzgruppen kann uns eine Andeutung geben, was damit gemeint ist: „Hauptmann Wolfgang Hoffmann war ein fanatischer Judenmörder. Als Chef von drei Kompanien des Polizeibataillons 101 befehligte er mit seinen Offizierskameraden seine Leute, die keine SS-Männer, sondern ganz normale Deutsche waren, in Polen bei der Deportation und der Massentötung Zehntausender jüdischer Männer, Frauen und Kinder. Und während er sich an diesem Völkermord beteiligte, weigerte sich eben dieser Hoffmann strikt, einem Befehl zu gehorchen, den er für moralisch unannehmbar hielt.
Dieser Befehl verlangte von den Angehörigen seiner Kompanie, eine Erklärung zu unterzeichnen, die ihnen zugegangen war. Hoffmann leitete seine schriftliche Weigerung mit der Bemerkung ein, nach der Lektüre habe er geglaubt, es liege ein Irrtum vor, ‚denn es erscheint mir als Zumutung, daß von einem anständigen Deutschen und Soldaten verlangt wird, daß er eine Erklärung unterschreiben soll, in der er sich verpflichtet, nicht zu stehlen, zu plündern und ohne Bezahlung zu kaufen.
Er halte eine solche Forderung für überflüssig, fuhr er fort. Seine Leute seien sich aufgrund ihrer einwandfreien weltanschaulichen Überzeugung der Tatsache vollkommen bewußt, daß derartige Handlungen strafwürdige Verbrechen darstellten. Er erläuterte seinen Vorgesetzten Charakter und Handlungsweise seiner Leute, wozu er vermutlich auch ihre Mitwirkung an Ermordungen von Juden zählte. Die Befolgung der deutschen Normen von Moral und Haltung, schrieb er weiter, beruhe ‚auf innerer Freiwilligkeit und [wird] nicht aus Sucht nach Vorteilen oder aus Furcht vor Strafe begründet …‘.
Dann erklärte Hoffmann herausfordernd: ‚Als Offizier aber bedaure ich, mich in meiner Auffassung in Gegensatz zu der des Herrn Batl.-Kommandeurs stellen zu müssen, und in diesem Fall den Befehl nicht ausführen zu können, da ich mich in meinem Ehrgefühl verletzt fühle. Ich muß es ablehnen, eine allgemeine Erklärung zu unterschreiben.‘
In mehrerlei Hinsicht ist Hoffmanns Brief ein erstaunliches und aufschlußreiches Dokument. Ein Offizier, unter dessen Führung seine Leute bereits Zehntausende Juden ermordet hatten, hielt es für einen Affront, wenn irgend jemand annahm, er und seine Männer könnten den Polen Lebensmittel stehlen! Die Ehre dieses Massenmörders war verletzt, und dies in einem doppelten Sinne, nämlich als Soldat und als Deutscher. Seiner Vorstellung nach hatten die Deutschen den polnischen »Untermenschen« gegenüber weit größere Zurückhaltung zu üben als gegenüber den Juden. Außerdem war sich Hoffmann sicher, daß die ihm übergeordnete Dienststelle tolerant genug sein würde zu akzeptieren, daß er einen direkten Befehl nicht nur verweigerte, sondern seine Insubordination auch noch schriftlich niederlegte. Die Beurteilung seiner Untergebenen – die sich zweifellos auf ihre »Beteiligung«, auch am Völkermord, stützte – lief darauf hinaus, daß sie nicht aus Furcht vor Strafe handelten, sondern aufgrund freiwilliger Bereitschaft aus innerer Überzeugung also.“5
Und der oberste Vorgesetzte von Hoffmann, Heinrich Himmler, betont: „ Dies [die Judenvernichtung AE] durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwächen – anständig geblieben zu sein, das ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte […]. Insgesamt können wir sagen, dass wir diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk erfüllt haben. Und wir haben keinen Schaden in unserem Inneren, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen“.6
Generalfeldmarschall Walter von Reichenau, der Hitlers Weltanschauungskrieg im Osten führte, verdeutlicht in seinem vom 10. Oktober 1941 erlassenen Befehl, welche Art des Verhaltens der Truppe im Osten verlangt wird: „Das wesentlichste Ziel des Feldzuges gegen das jüdisch-bolschewistische System ist die völlige Zerschlagung der Machtmittel und die Ausrottung des asiatischen Einflusses im europäischen Kulturkreis. Hierdurch entstehen auch für die Truppe Aufgaben, die über das hergebrachte einseitige Soldatentum hinausgehen. Der Soldat ist im Ostraum nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln der Kriegskunst, sondern auch Träger einer unerbittlichen völkischen Idee und der Rächer für alle Bestialitäten, die deutschem und artverwandtem Volkstum zugefügt wurden. […] Deshalb muß der Soldat für die Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben. Sie hat den weiteren Zweck, Erhebungen im Rücken der Wehrmacht, die erfahrungsgemäß stets von Juden angezettelt wurden, im Keime zu ersticken“.7
„Wir müssen uns damit auseinandersetzen“, schreibt Johann Chapoutot, „dass die Nationalsozialisten nicht nur Europäer des 20. Jahrhunderts, sondern schlicht und einfach Menschen waren. Menschen, die in besonderen Zusammenhängen aufgewachsen sind und gelebt haben […], die sich aber, wie wir und andere, in einem sinn- und werthaltigen Kontext bewegten. Um es knapper zu fassen: Es ist fraglich, dass ein Franz Stangel in Treblinka, ein Rudolf Höß in Birkenau oder Karl Jäger, der das Einsatzkommando 3 der Einsatzgruppe A leitete, Tag für Tag aufstanden und sich dabei schon auf all die Schandtaten freuten, die sie im Lauf des Tages begehen sollten. Diese Leute waren nicht Verrückt und betrachteten ihre Taten nicht als Verbrechen, sondern als Aufgabe, als zwar unangenehme, aber notwendige Aufgabe“.8 Aber auch wenn sie zögerten, Juden zu ermorden, „doch dann verrichten sie mit zunehmender, im ganzen entschlossener Bereitwilligkeit das Mordgeschäft.“9
„Die Juden sind die ewigen Feinde des deutschen Volkes und müsse ausgerottet werden“, schreibt der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß. „Alle für uns erreichbaren Juden sind jetzt während des Krieges ohne Ausnahme zu vernichten. Gelingt es uns jetzt nicht, die biologischen Grundlagen des Judentums zu zerstören, so werden einst die Juden das deutsche Volk vernichten“.10
Der Jude stellt den ‚gewaltigsten Gegensatz‘ zum Arier11: Was heißt das ‚rein wissenschaftlich‘ betrachtet? Wenn der Arier „allein der Begründer höheren Menschentums überhaupt war, mithin den Urtyp dessen darstellt, was wir unter das Wort ‚Mensch‘ verstehen“12, dann kann man verstehen, was der Jude nach dieser Auffassung eigentlich darstellt: Die unterste Stufe des Untermenschentums, denn er ist nur „ein Parasit im Körper anderer Nationen und Staaten und darin liegt seine Eigenart begründet“.13Die Juden wurden so außerhalb der Grenzen der Menschheit als ihr schlimmster Feind gesetzt!
Hier wird nicht etwas angedeutet, das mit den üblichen Kategorien von „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, „Völkermord“ und „Kriegsverbrechen“ erschöpfend verstanden und beschrieben werden kann: Angedeutet wird die Schaffung einer neuen Wirklichkeit im umfassendsten Sinne des Wortes – wie auch die Notwendigkeit der Schaffung einer entsprechenden Begrifflichkeit!
Hinter dieser Bestimmung birgt sich eine Vision – die Vision von der aktiven Schaffung einer Wirklichkeit, die für die „eigentlich wahre“ Wirklichkeit gehalten wird. Im Lichte dieser Vision wird unsere Wirklichkeit als falsch und un-natürlich verstanden. Es gibt hier ausschließlich entweder oder – in beiden Richtungen: Die Wahrheit unserer Wirklichkeit oder deren aktive Negation durch Schaffung einer „natur-mäßigen“ und insofern „wahren“ Wirklichkeit!
Wir haben es hier nicht bloß mit zwei Begriffen bzw. Sachverhalten theoretischer Bedeutung, sondern von Anfang an mit zwei einander ausschließenden Wirklichkeits-Verständnissen und somit mit zwei einander ausschließenden Wahrheits-Verständnissen zu tun!
Es geht um die Vision einer der Wirklichkeit, die es durch die Negation des Guten schafft, sich als Vision des einzig Richtigen im Sinne des wirklich Natürlichen erscheinen zu lassen.
Wenn die Entstehung von „Auschwitz“ mittels des Schemas „Rechtsextremismus-Beseitigung der Demokratie-Holocaust“ verstanden wird, und wenn „Auschwitz“ selbst als „unfassbar“ betrachtet wird, und darüberhinaus der Nationalsozialismus verteufelt wird, dann kann man aus dieser Vergangenheit wenig lernen. Dann bleibt uns nur noch Informationen zu sammeln und ständig zu mahnen, „nicht zu vergessen“ und aufzurufen, dass „so etwas sich nicht wiederholen darf!“.
Der Holocaust zeigt uns eindeutig, dass Bestialität und Unmenschlichkeit in einer ganz durchschnittlichen menschlichen Gestalt daherkommen. Dafür kann uns die Gestalt Adolf Eichmanns als Muster dienen.
Der Lyriker Leonard Cohen fasst „alles, was es über Adolf Eichmann zu wissen gibt“, so zusammen:
„Augen……………………. Mittel
Haar………………….……. Mittel
Gewicht…………………… Mittel
Größe……………………… Mittel
Besondere Kennzeichen…… Keine
Anzahl der Finger…………. Zehn
Anzahl der Zehen………….. Zehn
Intelligenz…………………. Mittel
Was haben sie erwartet?
Krallen?
Übergröße Schneidezähne?
Grünen Speichel?
Wahnsinn?“14
5. Die Ankündigung und die klare Beschreibung der oben genannten Vision sind in der „Bibel des Nationalsozialismus“ (Klemperer) – in „Mein Kampf“ – offen dargelegt.
„Nie ist ein Lehrbuch des Priestertrugs […] mit schamloser Offenheit geschrieben worden als Hitlers „Mein Kampf“. Es wird mir immer das größte Rätsel des Dritten Reichs bleiben, wie dieses Buch in voller Öffentlichkeit verbreitet werden durfte, ja mußte, und wie es dennoch zur Herrschaft Hitlers und zu zwölfjähriger Dauer dieser Herrschaft kommen konnte, obwohl die Bibel des Nationalsozialismus schon Jahre vor der Machtübernahme kursierte“.15
„Während andere Diktatoren viel Zeit und Mühe darauf verwenden, ihre eigentlichen Pläne und Ziele zu verheimlichen, war dies bei Hitler anders. Sein Buch hatte nicht nur den Zweck der Selbst Darstellung und der Propaganda, es ging immer auch um Ankündigungen, um Zukünftiges, und zuweilen enthüllte Hitler darin mit einer frappierenden wie gerade zu naiven Offenheit das, was er sich vorgenommen hatte“.16
Was lässt – trotz eindeutigen geschichtlichen Lektionen mit mörderischen Regimen (Stalinismus, Maoismus und vor allem und im Besonderen der Nationalsozialismus) – das Gute so blass erscheinen, dass dem Bösen der freien Raum überlassen wird, um seine Vision als die Vision des (angeblich) Guten zu verwirklichen??
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gute; 4.5.2021, 21:00
4 Vgl. System I, S. 61f.
5 In: Daniel Jonah Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Berlin 1998, S. 15f. Die Verwendung die Textstelle aus Goldhagens Buch geschieht ohne jegliche Verpflichtung meinerseits zur in ihm von Goldhagen vertretenen Haltung!
6 Rede des Reichsführer SS bei der SS-Gruppenführertagung in Posen am 4. Oktober 1943. In: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0008_pos_de.pdf; 16.5.2021, 14:00
7 https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/der-zweite-weltkrieg/201407/reichenau-befehl-zum-verhalten-der-truppe-im-ostraum, 9.8.2021 18:30; vgl. auch: Jonathan Littell, Die Wohlgesinnten, Berlin 2008, S. 206f.
8 Johann Chapoutot, Das Gesetz des Blutes, Von der NS-Weltanschauung zum Vernichtungskrieg, Darmstadt 2016, S. 13; zitiert GB
9 JF, S. 89; vgl. dazu: Christopher Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizei-Bataillon 101 und die ‚Endlösung' in Polen, Reinbek bei Hamburg 2016
10 Rudolf Höß, Aufzeichnung des Kommandanten von Auschwitz. In: Die Ermordung der europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941-1945. Hrsg. von Peter Longerich, München 1989
11 Vgl.: Adolf Hitler, Mein Kampf, München 1940, S. 329; zitiert MK
12 MK 317
13 Ebd. S. 334
14 Cohen Leonard, Was können wir von Adolf Eichmann lernen? In: Dein Aschenes Haar Schulamith. Dichtung über den Holocaust, hrsg. von Dieter Lamping, München 1993, S. 83
15 Viktor Klemperer, LTI, Leipzig 1975, S. 29f.
16 Adolf Hitler, Mein Kampf, Ein kritische Edition, Hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte München - Berlin 2021, Bd. I, S.44; zitiert: MKkA
II. Die Vision des Bösen: Die „wahre“ Wirklichkeit, die „arische Rasse“, der „Gottmensch“ und das „Untermenschentum“
„Sie sollen wissen, daß wir eine historische Vision der Ereignisse haben.“
Adolf Hitler17
II.1. Einführendes
1. Die Idee, dass die uns bekannte Wirklichkeit, deren sichere Erkenntnis wir harter, vielfältiger wissenschaftlicher Arbeit verdanken, nicht die „richtige“ sei, ist schwindelerregend.
Wäre der Versuch, diese Art des Wirklichkeitsverständnisses durchzusetzen, keine geschichtliche Tatsache, ginge man vermutlich von einem schlechten Science-Fiction-Projekt aus. Wir haben es aber nicht mit einer Fiktion zu tun: Der Versuch, eine solche Idee, die den Namen „Nationalsozialismus“ trägt, zu verwirklichen, ist mit großer Effizienz – zum Glück nur mit Teilerfolg – unternommen worden.
Als Grundlage sollte eine Welt-umfassende, globale Ordnung geschaffen werden: „Die nordische Rasse hat ein Recht darauf, die Welt zu beherrschen, und wir müssen dieses Recht der Rasse zum Leitstern unserer Außenpolitik machen. Glauben Sie mir, der ganze Nationalsozialismus wäre nichts wert, wenn er sich auf Deutschland beschränkt und nicht mindestens 1000 bis 1200 Jahre lang die Herrschaft der hochwertigen Rasse über die ganze Welt ausübt“.18
Welche Art des Weltverständnisses bringt eine solche Haltung zum Ausdruck und was bedeutet dieses für die Bestimmung des Wesens der Wirklichkeit und für deren wissenschaftliche Erforschung?
2. Die Grundlage für das Verständnis des Nationalsozialismus machen in erster Linie Hitlers „Mein Kampf“ und Alfred Rosenbergs „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“19 aus.
Frau Barbara Zehnpfennig macht in ihrem Werk20 auf „eine merkwürdige Ambivalenz in der öffentlichen Diskussion um Buch und Autor [Hitlers ‚Mein Kampf‘; AE] aufmerksam. Fürchtet man auf der einen Seite die Verführbarkeit des Bösen, die von Mein Kampf ausgehen und volkspädagogisch konterkariert werden soll, so beschwört man auf der anderen Seite die unendliche Banalität und Flachheit des Werkes“.
„Doch ist Hitlers denken wirklich so banal wie hier unterstellt? Weshalb musste man die Öffentlichkeit dann so lange davor schützen? Und wieso konnte der Nationalsozialismus auch unter Intellektuellen Anklang und Anhänger finden, ja sogar einen so großen Geist wie Martin Heidegger zu dem Glauben motivieren, es hier mit einer zukunftsweisenden Bewegung zu tun haben, wenn die Gedanken ihres Führers nichts weiter als dumm und flach waren?“21
Aber auch wenn wir davon ausgehen, dass Hitler eine „Mischung aus Demagogie, Kälte und Phantastik […] eigen war“, auch wenn man „vielfach den Ausdruck einer tief gestörten, krankhaften Verfassung“ bei Hitler gesehen hat – „weitaus beunruhigender ist […], daß er für seinen Furor des Vernichtens und Zugrunderichtens ungezählte Helfer ohne jede psychische Deformation fand.“22
Angesichts der Wirkung und der Wirksamkeit wie auch der geschichtlichen Einmaligkeit des Nationalsozialismus, schätze ich im Rahmen unserer erkenntnis-theoretischen Erörterung die Bedeutung von Hitlers Schrift und Aussagen, aber auch die Bedeutung von Rosenbergs Schrift, nicht nur als sehr hoch, sondern im historischen Vergleich – abgesehen von der Bibel – gar als einmalig ein.
3. „Hitler selbst hat in ‚Mein Kampf‘ und danach immer wieder von der nationalsozialistischen Weltanschauung gesprochen, ohne jemals deren Inhalt systematisch dargestellt zu haben. Dennoch lassen sich bereits in ‚Mein Kampf‘ die entscheidenden Gedanken dieser Weltanschauung erkennen, an denen Hitler bis zu seinem Selbstmord am 30. April 1945 im Wesentlichen festgehalten hat.
Ausgangspunkt war für Hitler nicht irgendeine transzendentale Offenbarung, auch nicht eine als subjektiv empfundene Meinung, sondern die Natur mit ihren ewig gültigen Gesetzen, die er objektiv erkannt haben will. Im elften, „Volk und Rasse“ überschriebene Kapitel von ‚Mein Kampf‘ spricht Hitler von „Wahrheiten, die so sehr auf die Straße liegen, daß sie gerade deshalb von der gewöhnlichen Welt nicht gesehen oder wenigstens nicht erkannt werden. Sie geht an solchen Binsenwahrheiten manchmal wie blind vorbei und ist auf das höchste erstaunt, wenn plötzlich jemand entdeckt, was doch alle wissen müßten […].
So wandern die Menschen ausnahmslos im Garten der Natur umher, bilden sich ein, fast alles zu kennen und zu wissen, und gehen doch mit wenigen Ausnahmen wie blind an einem der hervorstehenden Grundsätze ihres Waltens vorbei: der inneren Abgeschlossenheit der Arten sämtlicher Lebewesen dieser Erde.“23
Lars Lüdicke führt auf: „‘Formationen, Sippschaften, Stämme, Völker, Staaten‘ hätten sich, so Hitler, im Laufe der Zeit herausgebildet, und deren Entwicklung offenbare, dass die Geschichte der Menschheit ‚die Darstellung ihres Entstehens und ihres Vergehens‘ und somit ‚die Wiedergabe eines ewigen Lebenskampfes‘ sei. Im Ganzen also erschien ihm, so einfach wie umfassend, die Menschheitsgeschichte als ‚die Darstellung des Verlaufs des Lebenskampfes eines Volkes.‘ Alles ‚weltgeschichtliche Geschehen‘ sei folglich nur die Äußerung des Selbsterhaltungstriebes der Rassen im guten oder schlechten Sinn‘. In diesem Verständnis der ‚Rassenfrage‘ glaubte Hitler das Bewegungsgesetz der Geschichte erkannt zu haben; sie gab ihm, wie er schrieb, nicht nur den ‚Schlüssel zur Weltgeschichte, sondern auch zur menschlichen Kultur überhaupt.‘
‚Nicht sozial-ökonomische‘, fährt er fort, „sondern ethnisch-biologische Gruppen bildeten für Hitler also die entscheidenden Kräfte, die den Lauf der Menschheitsgeschichte bestimmen. Gott hat Völker, aber keine Klassen geschaffen‘, sagte Hitler in diesem Sinne, und ‚Rassen‘, nicht Klassen bedingten in seinem Verständnis die Höherentwicklung der Menschheit, deren Treiber der Lebens- und Rassenkampfes war. Deutlicher konnte die Abgrenzung zum historischen Materialismus nicht formuliert werden, ja Hitler hatte im Grunde den genauen Gegensatz zu Marx und Engels entwickelt, von denen die ‚Geschichte aller bisherigen Gesellschaft‘ als ‘Geschichte von Klassenkämpfen‘ interpretiert worden war. Indem er sich ‚in die Lehre des Marxismus‘ eingearbeitet habe, habe ihm ‚das Schicksal selber seine Antwort‘ gegeben: ‚Die Lehre des Marxismus lehnt das aristokratische Prinzip der Natur ab und setzt an die Stelle des ewigen Vorrechtes der Kraft und Stärke die Masse der Zahl und ihr totes Gewicht. Sie leugnet so im Menschen den Wert der Person, bestreitet die Bedeutung von Volkstum und Rasse und entzieht der Menschheit damit die Voraussetzung ihres Bestehens und ihrer Kultur‘.“24
„Es ist ein müßiges Beginnen, darüber zu streiten, welche Rasse oder Rassen die ursprünglichen Träger der menschlichen Kultur waren und damit die wirklichen Begründer dessen, was wir mit dem Worte Menschheit alles umfassen. Einfacher ist es, sich diese Frage für die Gegenwart zu stellen, und hier ergibt sich auch die Antwort leicht und deutlich. Was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Ariers. Gerade diese Tatsache aber läßt den nicht unbegründeten Rückschluß zu, daß er allein der Begründer höheren Menschentum überhaupt war, mithin den Urtyp dessen darstellt, was wir unter dem Worte ‚Mensch‘ verstehen. Er ist der Prometheus der Menschheit, aus dessen lichter Stirne der göttlichen Funke des Genies zu allen Zeiten hervorsprang, immer von neuem Feuer entzündend, das als Erkenntnis die Nacht der schweigenden Geheimnisse aufhellte und den Menschen so den Weg zum Beherrscher der anderen Wesen dieser Erde emporsteigen ließ. Man schalte ihn aus – und tiefe Dunkelheit wird vielleicht schon nach wenigen Jahrhunderten sich abermals auf die Erde senken, die menschliche Kultur würde vergehen und die Welt veröden“.25
„Ein zutiefst ernster Satz eines großen Militärphilosophen besagt, daß der Kampf und damit der Krieg der Vater aller Dinge sei. Wer einmal einen Blick in die Natur wirft, wie sie nun einmal ist, wird diesen Satz bestätigt finden als gültig für alle Lebewesen und für alles Geschehen nicht nur auf dieser Erde […]. Das ganze Universum scheint nur von diesem einen Gedanken beherrscht zu sein, daß eine ewige Auslese stattfindet, bei der der Stärkere am Ende das Leben und das Recht zu leben behält und der Schwächere fällt. Der eine sagt, die Natur sei deshalb grausam und unbarmherzig, der andere aber wird begreifen, daß diese Natur damit nur einem eisernen Gesetz der Logik gehorcht. Der davon Betroffene wird natürlich immer darunter zu leiden haben; er wird aber durch sein Leid und seine persönliche Einstellung das Gesetz nicht aus dieser Welt, wie sie nun einmal uns gegeben ist, zu schaffen vermögen. Das Gesetz bleibt bestehen. Wer glaubt, aus seinem Leid heraus, aus seiner Empfindung oder seiner Einstellung sich gegen dieses Gesetz auflehnen zu können, beseitigt nicht das Gesetz, sondern nur sich selbst“.26
„Indem der Mensch versucht, sich gegen die eiserne Logik der Natur aufzubäumen, gerät er in Kampf mit den Grundsätzen, denen auch er selber sein Dasein als Mensch allen verdankt. So muß sein Handeln gegen die Natur zu seinem eigenen Untergang führen“.27
Das Jahr 1933 „bedeutet […] nicht nur einen schlichten Austausch an der Spitze des Staates, sondern eine echte Revolution in der Absicht, die Natur wieder in ihre Rechte einzusetzen“.28
II.2. Die „Natur“, ihre „wissenschaftliche“ Erkenntnis und deren „zwingenden“ Folgen
1. Die Betrachtung der oben angeführten Stellungnahmen und kurzen Erläuterungen deuten klar darauf hin, dass die nationalsozialistische Rassenlehre nicht einfach mit Rassismus und Antisemitismus gleichgesetzt werden kann und darf