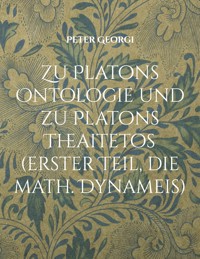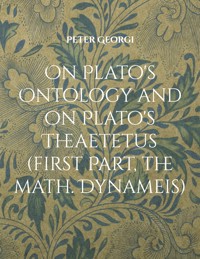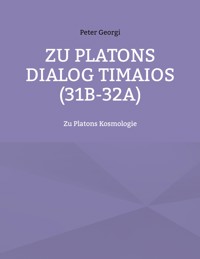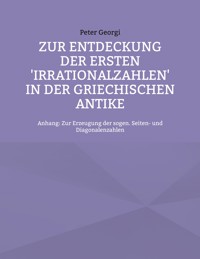
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In der griechischen Antike kannte man keine Irrationalzahlen im modernen Sinne, sondern nur Paare von Strecken, die kein gemeinsames Streckenmaß haben, die sich somit nicht zueinander verhalten, wie eine Grundzahl zu einer Grundzahl; d.h. solche Streckenverhältnisse sind nicht durch einen Bruch, durch eine rationale Zahl darstellbar, sie sind (wie man sagt) irrational. Die vorliegende Arbeit will nun darlegen, von welchen Streckenpaaren wahrscheinlich und in welcher Weise jeweils wohl erstmals gezeigt werden konnte, dass ihre Strecken kein gemeinsames Maß haben. Im Anhang wird ein antikes Verfahren 'rekonstruiert', welches das irrationale Verhältnis von Quadratseite und -diagonale (das sind die mutmaßlich erstgefundenen Strecken ohne gemeinsames Maß) näherungsweise durch Paare von Grundzahlen (durch Brüche) darstellt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 52
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsübersicht
§ 1 Einleitung
§ 2 Der früheste überlieferte Beweis von ‚√2‘
§ 3 Eine Entdeckungsmöglichkeit von ‚√2‘
§ 4 Eine Entdeckungsmöglichkeit von ‚√3‘ ‚√5‘ … ‚√15‘ ‚√17‘ bei jeweils individueller Betrachtung
§ 5 Eine Entdeckungsmöglichkeit von ‚√n‘, wo n allgemein Nichtquadratzahl ist
§ 6 Eine Entdeckungsmöglichkeit von ‚n‘, wo n allgemein Nichtkubikzahl ist
§ 7 Zur Verallgemeinerung von ‚√n‘ und ‚n‘
Anhang: Zur Erzeugung der sogen. Seiten- und Diagonalenzahlen
Terminologie-Glossar
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
§ 1 Einleitung
Zunächst ist zu sagen: die Griechen der Antike kannten keine Irrationalzahlen im modernen Sinne; deswegen wird im Titel der vorliegenden Arbeit, Anführungszeichen gebrauchend, von ‚Irrationalzahlen‘ gesprochen (dies nur, um den Titel kurz zu halten).
An Zahlen kannten die Griechen in der ‚reinen‘ Mathematik nur die Zahlen 1, 2, 3 usw. (Deswegen sind, wenn in der vorliegenden Arbeit von Zahlen die Rede ist, immer nur Zahlen der Reihe 1, 2, 3 usw. gemeint.) In der Praxis, beim Handel gab es auch gebrochene Zahlen wie z.B. 2 ⅓ usw. In der ‚reinen‘ Mathematik aber gab es keine Brüche; an ihrer Stelle traten die Verhältnisse von Zahlen (als besonderen Größen); dabei ist anzumerken, dass in den Euklidischen Elementen (der wesentlichste uns bekannte Part der griechischen Mathematik) nur an einer Stelle etwas näher ausgesagt ist, was ein Verhältnis (λόγος) von Größen sein soll (EE V Def.3).
Für die ganze Arbeit seien gleich noch zwei weitere Kurzausdrücke eingeführt: • n sei eine Nichtquadratzahl (n ≠ 22, 32, 42, …). Dann steht der Ausdruck ‚√n‘( einschließlich der Anführungszeichen) für: die Seite eines vorgegebenen Quadrates und die Seite des n-fach so großen Quadrates sind inkommensurabel. • α sei eine Strecke. Dann steht der Ausdruck α2 für: das Quadrat über/von α.
Die wesentliche Frage ist: Anhand welcher geometrischer Figurationen und in welcher Weise haben die Griechen erstmals inkommensurable Strecken gefunden?
Die Quellenlage (Platon, Aristoteles, Euklid) spricht ziemlich eindeutig dafür, dass in der Tat zuerst Quadratseite und -diagonale als inkommensurabel erkannt wurden.1) Es besteht aber auch die Ansicht, bei eigentlich sehr schwacher Quellenlage, dass zuerst Fünfeckseite und -diagonale als inkommensurabel erkannt wurden.2)
§ 2 Der früheste überlieferte Beweis von ‚√2‘
Ein erster Beweis für die Inkommensurabilität zweier Strecken ist erst in den EE als Nachtrag zum X. Buch zu finden; dort wird die Inkommensurabilität von Quadratseite und -diagonale bewiesen. Im folgenden der Beweis in freier Wiedergabe:
Behauptung: Die Seite σ und die Diagonale δ eines Quadrates sind inkommensurabel.
Annahme: σ und δ sind kommensurabel.
Dann verhält sich σ zu δ wie eine Zahl s zu einer Zahl d.
s und d seien dabei die kleinsten Zahlen, die hierbei möglich sind. s und d sind dann zueinander teilerfremd. Daraus folgt: s und d sind nicht zugleich gerade,3) anderenfalls würde die Zwei beide Zahlen messen.
d2 ist also gerade. Dann ist auch d gerade. Wäre nämlich d ungerade, so müsste auch d2 ungerade sein.
Daraus folgt: σ und δ sind inkommensurabel (haben kein gemeinsames Streckenmaß).
Gemessen an den EE ist der Beweis ziemlich voraussetzungsreich. Gibt man nach ihnen seine Voraussetzungen an, hat man folgende Liste von Sätzen inklusive einer Definition (in der Reihenfolge ihrer Verwendung): X 5, VII 33, 22, Def.6, I 47, X 9, IX 23,4) wobei die angegebenen Sätze, bis auf IX 23, ebenfalls voraussetzungsreich sind.
Zur Stellung des Satzes mit Beweis als tradierender Nachtrag am Ende des X. Buches der EE sei erwähnt: „ … am Ende eines ‚Buchs‘ eines antiken Schriftstellers stehen häufig Nachträge, die aus technischen Gründen dort am Rollenende am bequemsten Platz fanden. Solche Fälle gibt es in den metaphyischen Pragmatien des Aristoteles und auch sonst. Ja in den Elementen selbst findet sich ein weiteres Beispiel in dem letzten … Satz des X. Buchs … Die modernen Herausgeber (so schon E.F. August 1829 und später Heiberg) haben mit dem Satz nichts anzufangen gewußt und ihn daher aus dem Text entfernt, ein Verfahren, das nur dann berechtigt ist, wenn hinzugefügt wird, daß es sich hier um sehr altes, bei weitem voreuklidisches Gut handelt … .“5)
1 Genannt seien: (1) Platon: Menon 83e, Staat 510d, Theaitetos 148a-b. Die Platon-Stellen sind eher nur andeutend. Im Menon wird ‚√2‘ angedeutet durch die Worte: Wenn Du nicht zählen (zählend messen) willst, so zeige, aus welcher Strecke das zweifach so große Quadrat entsteht. Im Staat wird, allgemein bleibend, vom Beweisführen in Ansehung des Quadrates an sich und der Diagonalen an sich gesprochen; welches Beweisführen gemeint ist, wird als selbstverständlich angenommen. Im Theaitetos wird von ‚√3‘, ‚√5‘ usw. gesprochen, aber offenbar als selbstverständlicher Fall nicht von ‚√2‘. (2) Aristoteles: Erste Analytik 41a26-7, 46b28-32, 50a37-8, Metaphysik 983a12-20. Nach dem Index von Bonitz 1870 (Stichwort: ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ ἀσύμμετρος, p.185, l.7-16) wird in Aristoteles‘ Schriften 26mal auf die Inkommensurabiltät von Quadratseite und -diagonale Bezug genommen. Aristoteles‘ jeweils kurze Anspielung auf den Sachverhalt macht deutlich, dass er schon ‚klassisch‘ genug war, um auf ihn einfach verweisen zu können.
2 Siehe hierzu Georgi 1989 p.12-4, 19-32.
3 Eine Zahl ist gerade, wenn sie in zwei gleiche Teile zerlegt werden kann. Siehe EE VII Def.6.