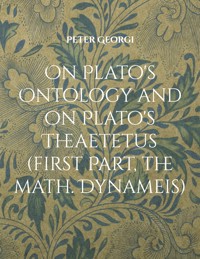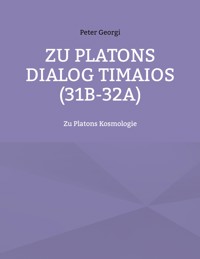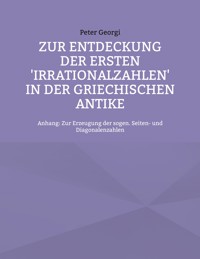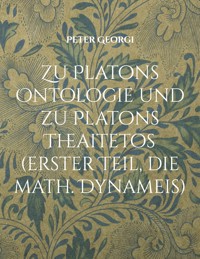
Zu Platons Ontologie und zu Platons Theaitetos (erster Teil, die math. Dynameis) E-Book
Peter Georgi
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Ontologie-Teil des Buches wird im Titel seiner allgemeineren, gewichtigeren Bedeutung wegen zuerst angezeigt; er ist aber aus dem Theaitetos-Teil hervorgegangen und findet sich so im Buch nach diesem. Beide Buchteile können weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden. Zum Theaitetos-Teil: Der Dialog Theaitetos ist der Frage gewidmet: Wissen - was ist das eigentlich? Im Dialog wird problematisiert, wie überhaupt der Begriff von etwas, also auch der des Wissens bestimmt werden kann. Dabei spielt die 'berühmte' Dynamis-Stelle eine wesentliche Rolle. Zu ihr wird wesentlich Neues aufgezeigt. Zudem ergibt sich neue Sichtweise auf die Versuche im anfänglichen Dialogteil, zu bestimmen, was Wissen ist. Zum Ontologie-Teil: Hier wird, ausgehend vom Dialog Phaidon, mit bereitgestellten Mitteln der mathematischen Logik, ein Modell zu Platons Ontologie entwickelt. Dieses, insbesondere seine Fassung von Begriff, ermöglicht (nach Kenntnisstand des Autors) ein teilweise neues Verständnis der sogenannten Ideenlehre Platons.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Πάντες ἄνθρωποι τοῦ εἰδέναι ὀρέγονται φύσει.
Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.
(Aristoteles, Metaphysik 980a21)
Il y a assurément un autre monde, mais il est dans celui-ci.
Es gibt gewiss eine andere Welt, sie ist aber in dieser.
(Paul Éluard)
Einleitung
Zum Buchtitel und zur Anlage des Buchs: Im Titel wird „Zu Platons Ontologie“ als das allgemeinere und bedeutendere Thema vor dem spezielleren Thema „Zu Platons Theaitetos (erster Teil, die math. Dynameis)“ genannt; bei der Behandlung der Themen ist aber die Reihenfolge umgekehrt, dies gemäß der Genese des Ontologie-Teils des Buchs: er ist nämlich – mit der Intention, zu klären, was unter einem Begriff zu verstehen ist – aus dem Theaitetos-Teil hervorgegangen. Beide Buchteile können weitgehend unabhängig voneinander gelesen werden.
I Zu Platons Theaitetos: die mathematischen Dynameis, der erste Dialogteil
Die Angelegenheit mit den mathematischen Dynameis im Anfangsteil von Platons Dialog Theaitetos ist von besonderer Bedeutung (a) in Hinsicht auf das Thema, wie ein Begriff (im Dialog inbesondere der des Wissens) zu bestimmen ist – womit in wesentlicher Weise Platons Ontologie in den Blick rückt – und nicht weniger (b) in mathematikhistorischer Hinsicht.
Die Frage, wie die („berühmt“ genannte) mathematische Dynamis-Stelle zu verstehen ist, ist ein vielerörterter Topos der Theaitetos-Interpretation; dabei zieht diese Frage die Frage nach sich, wie die Stelle thematisch mit dem Kontext (dem anfänglichen Dialogverlauf) bzw. mit dem zentralen Problem des Dialogs, nämlich zu bestimmen, was Wissen eigentlich ist, in Zusammenhang steht, wobei das Eingehen auf diese Folgefrage meist vernachlässigt wurde. Die Bemühungen, die Dynamis-Stelle bzw. auch ihre Funktion im anfänglichen Dialogverlauf hinreichend zu verstehen, haben eine lange Geschichte. Vielleicht ergab sich schon bald, vielleicht schon als Platon selbst oder seine unmittelbaren Schüler nicht mehr befragt werden konnten, ein Auslegungsbedürfnis. Erstes Zeugnis für ein solches ist uns ein anonymer Theaitetos-Kommentar aus dem ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Und insbesondere in der Neuzeit (seit ca. 1900) sind die beiden obigen Fragen (die erste mehr, die zweite weniger) Gegenstand der Erörterung.
Ein in jeder Hinsicht abschließendes Verständnis der Dynamis-Stelle ist wohl kaum zu erreichen; so scheint z.B. nicht definitiv klärbar, warum gerade mit dem Wort Dynamis gewisse Quadratseiten (oder Quadrate, wie andere Interpreten meinen) bezeichnet werden, auch wenn hier eine mögliche Entstehungsweise des Terminus Dynamis dargestellt ist.
Die vorliegende Arbeit ist aber bestrebt, einen wesentlichen Zugewinn an Verständnis der Dynamis-Stelle – deren Thema primär eine Begriffsbestimmung ist und erst sekundär eine summarische Darstellung mathematischer Leistungen von Theaitetos – und ihres Kontextes zu erreichen; dabei ergibt sich insbesondere auch wesentlich neue Sichtweise (nach meinem Kenntnisstand) auf die im anfänglichen Dialogverlauf gemachten Versuche, zu bestimmen, was eigentlich Wissen ist (der Dialog ist ja i.w. dieser Frage gewidmet).
II Zu Platons Ontologie
Da bei der Thematik von Teil I wesentlich auch Platons Ontologie angesprochen wird, wird in Teil II ein Modell zu dieser entwickelt. In diesem gibt es neben den Dingen der Wahrnehmungswelt die ‚jenseitigen‘, idealen Dinge. Diese sind den Eigenschaftsausdrücken (Aussageformen mit genau einer freien Variablen) zugeordnet, wobei einem solchen nur ein ideales Objekt zugeordnet ist, und werden auch deswegen Eigenschaften genannt. Gewissen Eigenschaftsausdrücken ist dieselbe Eigenschaft zugeordnet, z.B. sinngleichen (die Problematik ihrer Bestimmung wird nur angedeutet). Bei der Zuordnung stehen die Eigenschaftsausdrücke und die ihnen zugeordneten Eigenschaften in einer gewissen (Kongruenz genannten) Beziehung zueinander: ein beliebiges Objekt hat teil (im platonischen Sinne) an der einem Eigenschaftsausdruck zugeordneten Eigenschaft genau dann, wenn das Objekt den Eigenschaftsausdruck (in einem genau definierten Sinn) erfüllt. Begriffe sind nun besondere Eigenschaften (die gewissen gleichgebauten Eigenschaftsausdrücken zugeordnet sind): Zu jedem idealen Objekt A gibt es genau eine Eigenschaft B, Begriff (von A) genannt, sodass B Gesamtheit (in einem genau definierten Sinn) all der idealen Objekte ist, an welchen dieselben Objekte teilhaben wie an A. Textstellen/Formulierungen sprechen dafür, dass Platon im Verlauf seiner ideentheoretischen Betrachtungen diese Begriffe, wenn auch in noch vager, unentwickelter Weise im Sinne hatte. Zudem hat der Begriff einer Eigenschaft A eine wesentliche ideentheoretische Funktion: er bewirkt das Teilhaben von Objekten an der Eigenschaft A.
In modifizierter/erweiterter Fassung des Modells (§ 21) hat man für Relationsausdrücke, Relationen und Begriffe von Relationen analoge Sachverhalte wie bei den Eigenschaftsausdrücken, Eigenschaften und Begriffen von Eigenschaften; hierbei ist aber insbesondere zu beachten: ein ideales Objekt ist entweder einem Eigenschaftsoder einem Relationsausdruck zugeordnet, Begriffe von Relationen bleiben Eigenschaften.
Für das Verständnis von Teil II ist (neben anderen Grundkenntnissen der Logik) das Vertrautsein mit der rekursiven Definition der Gültigkeit einer objektsprachlichen Aussage (basierend auf Tarskis Definition), wie sie in Lehrbüchern der (mathematischen) Logik zu finden ist, von Vorteil – was aber nicht vorausgesetzt wird; deshalb findet sich besagte Definition (in § 8.2), modifiziert für die Intentionen von Teil II, so ausführlich wie für diese nötig, dargestellt.
Vorbemerkungen technischer Art
Ausdrücke in Teil I, die mit hochgestellten einfachen Anführungszeichen ('…') angeführt sind, gehören eigentlich einer in Teil II (§ 8.2) zur Darstellung von Platons Ontologie in einer Rahmentheorie konstruierten Sprache an.
Die Anführung griechischen Textes (einzelner Wörter, von Syntagmata, Sätzen und Satzperioden) wird, um das Schriftbild zu entlasten, in der Regel nicht durch Anführungszeichen („…“) kenntlich gemacht.
Ist von Zahlen die Rede, so sind damit immer Zahlen der Folge 1, 2, 3, 4, 5, … gemeint.
Zur Sache Begriff: Ist etwa vom „Begriff des Schönen (an sich)“ die Rede, so ist damit durchgehend eine gewisse zum Schönen gehörige, ihm zugeordnete Entität gemeint (possesiver Genetiv) und somit nicht angezeigt, dass das Schöne als ein Begriff zu verstehen ist (appositiver Genetiv).