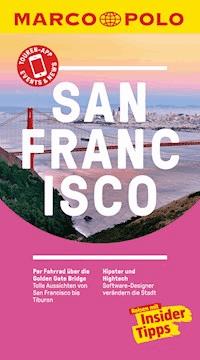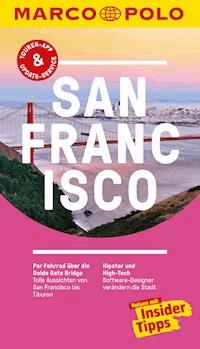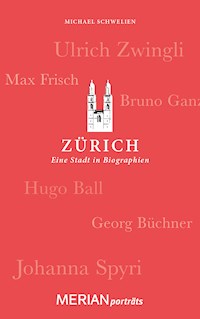
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Merian / Holiday, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Zürich. Eine Stadt in Biographien - Eine Stadt wird nicht nur von Gebäuden und Straßenzügen geprägt, die Identität von Zürich entsteht erst mit den Geschichten seiner Bewohner. Denn was wäre die Stadt ohne Ulrich Zwingli, Johanna Spyri oder Johann Heinrich Pestalozzi? 20 ausgewählte Biographien zeichnen ein lebendiges, historisches wie auch aktuelles Bild der Stadt. Die Porträts werden durch Adressen ergänzt, die eine Stadterkundung auf den Spuren der porträtierten Personen ermöglichen. Dieser Band umfasst Porträts von: Rudolf Brun, Ulrich Zwingli, Johann Heinrich Pestalozzi, Georg Büchner, Richard Wagner, Alfred Escher, Gottfried Keller, Johanna Spyri, Wilhelm Conrad Röntgen, Lenin, Albert Einstein, James Joyce, Hugo Ball, Erika Mann, Max Bill, Rolf Liebermann, Max Frisch, Daniel Keel, Hugo Loetscher, Bruno Ganz. Autor: Michael Schwelien
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Ähnliche
Michael Schwelien
ZÜRICH
Eine Stadt in Biographien
TRAVEL HOUSE MEDIA GmbH
Herausgegeben von Norbert Lewandowski
INHALTSVERZEICHNIS
DER AUTOR
Michael Schwelien lebt nahe der Schweiz in Staufen im Breisgau und war viele Jahre Reporter der »Zeit« mit Schwerpunkt Außenpolitik. Er hat zahlreiche Reiseführer sowie politische Biographien u.a. über Joschka Fischer und Helmut Schmidt geschrieben.
Große Kleinstadt oder kleine Großstadt? Trend-Standort oder internationaler Finanzplatz? Die Bezeichnungen für Zürich sind zahlreich. Eine allein würde der Stadt an der Limmat auch nicht gerecht werden.
Zürich ist von allem etwas, vor allem wird es international als Weltstadt wahrgenommen, trotz seiner »nur« knapp 400 000 Einwohner. Wie alle anderen Metropolen wird auch Zürich nicht nur von der umgebenden Landschaft und seinen Bauwerken, sondern in erster Linie von den Menschen geprägt, die hier geboren und gestorben sind oder hier gelebt haben. In MERIANporträts begleiten 20 Personen die Leser wie individuelle Reiseführer durch Zürich.
Wir begegnen auf unserem Spaziergang durch die Altstadt dem ersten Bürgermeister Rudolf Brun, stehen vor den Denkmälern von Ulrich Zwingli und Johann Heinrich Pestalozzi, wandeln auf den Spuren von Alfred Escher und Richard Wagner. Natürlich ist es schwer, die »richtigen« 20 Personen auszuwählen; vermutlich ist es sogar unmöglich, schließlich wurde Zürich in seiner über 1000-jährigen Geschichte von weit mehr als 20 Menschen geprägt. Doch in der Summe soll unsere subjektive Auswahl das Kaleidoskop Zürich ergeben, nicht nur eine Stadt der gehobenen Lebensart, sondern auch das Zürich der Freiheit und der Andersdenkenden.
Wir erleben mit Johanna Spyri, Gottfried Keller, James Joyce, Max Frisch, Hugo Loetscher und Daniel Keel das literarische Zürich, mit Georg Büchner, Lenin, Hugo Ball und Erika Mann die Stadt der Exilanten, mit Röntgen und Einstein die Aura der Genies und mit Rolf Liebermann, Max Bill und Bruno Ganz das künstlerische Reservoir.
Und wir entdecken jenseits der Fassaden von Banken und Bürgerlichkeit den Geist des Widerspruchs, der zu Zürich gehört wie sein See.
AUF EINEN BLICK
Ohne ihre Bewohner wäre die Stadt eine andere. Ohne Georg Büchner, Johanna Spyri und Max Frisch … wäre Zürich nicht Zürich.
ORIENTIERUNG
Farbige Kästchen mit Ziffern 1 und farbige Buchstaben-Ziffern-Kombinationen (▶D 3) verweisen auf die Orientierungskarte.
RUDOLF BRUN
1300–1360
Auf ihn geht der Titel »Bürgermeister« zurück. Er war der erste Meister der Züricher Bürger und gab der Stadt ihre Zunftverfassung. Und er war ein gerissener Diktator, der nur auf den eigenen Vorteil bedacht war.
Sein Geburtstag ist unbekannt. Auch über das Jahr seiner Geburt bestehen Zweifel, es dürfte um 1300 gewesen sein. Wann er starb, wissen wir genau. Er wurde mit seinem Koch im Chor der Kirche Sankt Peter19( ▶D 3) begraben. Ihr schlichter, spitzer Turm mit den großen Zifferblättern prägt bis heute die Silhouette der Stadt. Rudolf Brun wurde in Sankt Peter ein Grabstein gesetzt. Der verschwand ebenso wie der spätromanische Kirchenbau, der um das Jahr 1450 von einem gotischen Bau ersetzt wurde, der wiederum im 18. Jahrhundert einem barocken weichen musste.
An dessen Nordseite ist eine Kopie der ursprünglichen Grabplatte angebracht: Ein Schild mit einem sechszackigen Stern trägt einen Helm, auf welchem wiederum ein sechszackiger Stern mit Kugelköpfen an den Spitzen thront. Der Schleier auf dem Helm, der im Wind zu schweben scheint und dessen Ärmel so leer sind wie die eines Zeichentrickgespenstes, gibt der Grabplatte etwas Leichtes, Modernes. Der Todestag, mit einem Kreuz markiert, ist klar benannt. Es ist der 17. September 1360.
Andererseits benennt die Grabplatte auch den Kirchherrn von Sankt Peter. Es war der Tote selber. Er hatte 1345 bereits die Rechte und Pflichten der Gemeinde übernommen. Das heißt: Er diktierte die Geschichte, die sie schrieb – womöglich auch seine eigene.Alles an Rudolf Brun wirkt irgendwie skurril, auch die Sache mit dem Koch. Weshalb sollte der würdige Herr Bürgermeister ausgerechnet zusammen mit seinem Koch bestattet worden sein? Warum nicht mit seiner Gattin? Oder seinem Sohn Ulrich, dem Ritter, der 1361, ein Jahr nach seinem Vater, verschied? Die Geschichtsschreiber vermuteten, der Bürgermeister sei vom eigenen Koch vergiftet und deshalb gleich mit diesem begraben worden. Die Grabstätte wurde 1972 anlässlich der erneuten Renovierung von Sankt Peter geöffnet. Bei dieser Gelegenheit unterzog man die Gebeine einer eingehenden Untersuchung. Nichts da – kein Gift!
Eigenartig auch die Geschichte von einem handgreiflichen Streit, in den Brun geraten sein soll. Man sagt, er habe sich im Jahre 1330 in einer Schänke namens Estrich mit dem Ritter Rudolf Biber geschlagen. Dafür sei er mit einer Geldbuße von 550 Gulden bestraft worden, einer ungeheuer hohen Summe. Er wird sie schlicht nicht haben zahlen können. Einigermaßen verbrieft scheint zu sein, dass Brun drei Jahre nach der Tat gemahnt wurde, die Strafe endlich zu bezahlen. Ausgesprochen hatte die Strafe der Rat der Stadt.
Und damit kommen wir zur nächsten Skurrilität. 1336 stürzte Brun den Stadtrat. Wegen der immer noch nicht bezahlten Buße? Wohl kaum. Bei genauerem Hinsehen wird alles noch eigenartiger. In der Geschichtsschreibung sind keine Hinweise zu finden, dass Brun zuvor politisch aktiv gewesen wäre. Und nichts lässt darauf schließen, dass er Erfahrung gesammelt hätte, die ihn befähigte, einen solchen Putsch vorzubereiten und durchzuführen.
Er wurde berühmt für das, was Historiker den »Umsturz« nennen. Denn Brun hat, daran gibt es nun keinen Zweifel, mithilfe der Handwerker und sogar des einfachen Volkes den von sechs Familien beherrschten alten Rat der Stadt gestürzt. Das hört sich demokratisch an, war es aber nicht lange. Denn Brun schwang sich sogleich zum Alleinherrscher auf und regierte fortan ohne jeglichen Rat. Den gab es zwar weiterhin. Dominiert wurde er vom alten Stadtadel und der nun aufstrebenden Handwerkerschaft. Doch zu sagen hatte er wenig – das hatte ausschließlich Brun, denn er gab der Stadt eine Verfassung, die nach ihm benannte »Brunsche Zunftverfassung«. Sie bevorzugte zwar eben jenen alten Stadtadel und die Handwerker, die sich in 13 Zünften organisierten, von denen heute noch sichtbare Zeichen vielerorts in der Altstadt zu erkennen sind, die Zunfthäuser ( ▶ E 2-F 4).
Aber auch diese Verfassung war nicht so demokratisch, wie man meinen könnte. Sie war nämlich eine Verfassung, die dem Bürgermeister eine lebenslängliche Amtszeit garantierte und die vorsah, dass alle Bürger einen Treueeid auf ihn, den Bürgermeister, schwören mussten. Womit sie Brun zum Diktator machte.
Immerhin wissen wir ziemlich genau, wie er aussah. Es gibt nämlich ein »Bildnijßs Herren Rodolf Brun, Ritter, und Erster Burgermeister der Respub: Zürich«. Dieses wurde gezeichnet nach einem Stich von Johann Meyer aus dem Jahr 1396. Es zeigt den kantigen Brun mit Vollbart und einer Frisur, die an Cäsars Haarschnitt erinnert. Wobei es durchaus denkbar ist, dass der Herr Kupferstecher sich von Abbildungen des römischen Herrschers inspirieren ließ. Dessen Laufbahn war womöglich auch für Brun von Vorbild. Schließlich hatte sich Cäsar aus dem Kreis der gleichberechtigten Senatoren Roms ebenfalls zum Alleinherrscher aufgeschwungen.
Wie genau es zu Bruns »Umsturz« kam, ist, wie gesagt, umstritten. Es scheint, als habe nicht Brun selber die Pläne geschmiedet, als habe nicht er die Aufständischen mobilisiert. Viele vermuten, dass ein anderer die treibende Kraft hinter dem Umsturz war: der Ritter Götz Mülner. Er war mächtig, hatte Einfluss, stand schon lange in Gegnerschaft zur Ratsmehrheit. Er hatte ein Amt als Chorherr inne, kurz, er, nicht Brun, scheint der Mann gewesen zu sein, der die Herrschaftsverhältnisse in Zürich umzukrempeln in der Lage war. Aber er starb. Und zwar genau in den Tagen der Ständerevolution.
Brun, der mit Mülner verwandt war und der für ihn arbeitete, scheint die Gunst der Stunde erkannt zu haben. Und er dürfte ein Meister der Taktik gewesen zu sein. Am 7. Juni 1336 stürmten die Aufständischen das Rathaus( ▶ E 3), die alten Räte sollten festgesetzt werden. Doch sie waren gewarnt worden, konnten fliehen und somit der Verhaftung entgehen. Tags darauf wurde Brun im Barfüsserkloster von einer Versammlung von Aufständischen zum Bürgermeister auf Lebenszeit ausgerufen.
Und schon begann die Jagd auf die alten Räte. Nach unterschiedlichen Graden der Gefährlichkeit ließ Brun seine Gegner – all jene, die ihm nicht die Treue schworen – in verschiedene Richtungen verbannen. Es waren jene Kaufleute aus den Patrizierfamilien, die zuvor geherrscht hatten. 20 der 22 Verbannten kamen aus ihren Kreisen.
Aber wie konnte all dies Rudolf Brun gelingen, der weder über Einfluss noch über Erfahrung verfügte? Die Antwort ist einfach. Er dürfte sich an Mülner angehängt haben. Und als dieser starb – zur Zeit der Ständerevolution war Mülner schon fast 70 Jahre alt –, nahm Brun geschickt und schnell das Heft in die Hand. Es schien, als habe er das Hinscheiden Mülners geradezu erwartet, denn es war Brun, der die Aufständischen beim Sturm auf das Rathaus anführte.
Nicht nur die Verfassung und das neue Amt des Bürgermeisters waren auf ihn zugeschnitten. Auch die Verfolgungswelle, die seiner Usurpation folgte, offenbarte seinen ungestümen Willen zur Macht. Die Zahl der Hinrichtungen stieg nach dem »Umsturz« rapide an. Schließlich gab er sogar einen Erlass heraus, nach dem die ehemaligen Räte und ihre Anhänger sich nicht zu Gesellschaften mit mehr als drei Personen zusammenfinden durften.
Die Verbannten flüchteten, aber nicht weit. Sie setzten sich ab nach Rapperswil, ein Stück weit den See hinunter. Dort bildeten sie – unter dem Schutz des in Rapperswil residierenden Grafen Johann I. von Habsburg-Laufenburg, der aus einer Seitenlinie der mächtigen, in Wien residierenden Habsburger kam – eine Gegenregierung zu Brun.
Dieser Graf zog seinerseits einen Vorteil aus der Protektion. Er war nämlich bei der Stadt Zürich und bei vielen der Verbannten hoch verschuldet. Er konnte hoffen, dass ihm die Protektion – oder soll man sagen: das Erpressen von Schutzgeld? – einen Schuldenerlass einbrachte. So betrachtet wird das Bild von Brun wieder sympathischer. Die Exilierten im »äußeren Zürich« überfielen mithilfe der Habsburger das Gebiet der Stadt Zürich. Der Bürgermeister schützte seine Stadt gegen den Feudalherren und dessen aus Zürich entkommenen zahlungskräftigen Entourage.
Tatsächlich zog Brun mit einem Heer – sehr groß kann es nicht gewesen sein – gegen den Grafen Johann ins Feld. Allerdings sicherte er sich, auch das spricht für sein taktisches Geschick, zuvor die Unterstützung des Grafen Kraft III. von Toggenburg aus der namensgleichen Ostschweizer Dynastie, die sich schon seit Langem der Habsburger erwehren musste. Brun gewann die Schlacht bei Grynau, und Graf Johann kam dabei um. Das aber rief die Hauptlinie der Habsburger auf den Plan, die den Bürgermeister nun ihrerseits zwangen, auf alle Eroberungen zu verzichten und den Verbannten ihre Vermögen zurückzugeben.
1348 brach die Pest aus. Da zeigte sich ein anderer Brun. Er machte die Juden für die Krankheit verantwortlich und ließ viele von ihnen bei lebendigem Leib verbrennen. Diejenigen, die mit dem Leben davonkamen, wurden verbannt. Ihr Eigentum wurde auf die Christen Zürichs verteilt, allen voran auf den ersten Bürgermeister Brun, der so endlich zu großem Reichtum kam. Er ließ auch die Synagoge zerstören. Heute steht an ihrer Stelle die Gartenwirtschaft des Restaurants Neumarkt22( ▶ G 2).
Das Pogrom war sicher auch ein Ablenkungsmanöver. Denn das »äußere Zürich«, die Regierung der Exilanten in Rapperswil, erstarkte bald wieder; sie konnten sogar Söldner anheuern. In der Nacht vom 23. zum 24. Februar 1350 wollten sie Zürich zurück erobern. Doch Brun hatte erneut Glück: Ein Verräter brachte ihm Nachricht vom Plan der Verbannten. Diesen gelang es zwar, in die Stadt einzudringen, dort wurden sie aber von Bruns Leuten empfangen. Es kam zum heftigen Kampf mit vielen Toten auf beiden Seiten. Bruns Partei behielt die Oberhand. Die meisten der Eindringlinge wurden sofort gefangen genommen, 18 von ihnen anderntags gerädert, 17 geköpft.
Wer heute auf der beide Seiten der Altstadt verbindenden Rudolf-Brun-Brücke17( ▶ E 1) steht, sieht Zürich gar nicht so viel anders als damals sein erster Bürgermeister. Wer aber die paar Schritte hinauf zum Schiffländle am Bürkliplatz( ▶ D/E 7) geht und einen Dampfer nach Rapperswil besteigt, wird dort sehen, dass auch diese Stadt sich längst von der »Mordnacht« erholt hat, nach der Brun die Mauern und Burg von Rapperswil hatte schleifen lassen.
▶ZVV Haltestelle: Rapperswil SG
Quartier City
▶ Tram: Rudolf-Brun-Brücke
St. Peterhofstatt, Quartier Rathaus
www.st-peter-zh.ch
▶ Tram: Rathaus
Neumarkt 5, Quartier City
www.wirtschaft-neumarkt.ch
▶ Tram: Neumarkt
ULRICH ZWINGLI
1484–1531
Er war ein ehrgeiziger junger Priester, ein papsttreuer Mann des Schwertes. Dann vollzog er eine Kehrtwende, sprach sich gegen den Krieg aus, reformierte die Kirche – und nahm ein grausames Ende.
Da steht es, sein Denkmal26( ▶ F 4), am Limmatquai, vor der Wasserkirche, die ein Ensemble mit dem Helm- und dem Wasserhaus bildet. Huldrych – oder Ulrich, wie man heute schreibt – Zwingli schaut in die Ferne und stützt sich auf sein mächtiges Schwert. Ein Reformator mit Waffe? Zwingli ist in einem Atemzug zu nennen mit Martin Luther und Johannes Calvin, auch diese beiden hatten zu kämpfen. Luther musste sich bei Androhung des Todes rechtfertigen; Calvin verhängte zur Durchsetzung der Reformation drakonische Strafen. Und Zwingli erfocht die Erneuerung mit dem Schwert. So sollte er Recht behalten, als er sagte: »Den Leib können sie töten, die Seele nicht.«
Er wurde am 1. Januar 1484 in Wildhaus im Toggenburg in der Ostschweiz geboren. Das alte Holzhaus seiner Eltern steht noch. Der Vater war ein reicher Bauer und Kirchenvorsteher, beides war von großem Nutzen. Seine Eltern konnten es sich leisten, ihm die beste Ausbildung zu finanzieren. Und sie gaben ihm das politische Bewusstsein, ein Eidgenosse zu sein, mit auf den Lebensweg.
Ulrich Zwingli lernte Latein bei einem Onkel, der Dekan war und am Walensee lebte. Er war zehn Jahre alt, als er das Elternhaus verließ und in Basel und Bern die Lateinschule absolvierte. Er war nun 14 und wollte Dominikaner werden. Nicht, weil er ein Frömmler war. Er liebte Musik, war ein begabter Sänger. Solche Leute suchte das Kloster. »Du bist Gottes Werkzeug. Er verlangt deinen Dienst, nicht deine Ruhe. Tue um Gottes Willen etwas Tapferes.« Das sollte Zwingli später sagen. Doch der Vater war dagegen, dass sich der junge Mann in die Stille des Dominikanerklosters zurückzog. Er zwang den Sohn, nach Wien zu gehen und dort sein Studium aufzunehmen, das er später in Basel mit dem Magister Artium abschloss. Erst dieser Titel befähigte ihn zum Theologiestudium, das er aber nicht aufnahm.
Stattdessen wurde er im Sommer 1506 als Kirchherr im Ort Glarus im gleichnamigen Ostschweizer Kanton zum leitenden Pfarrer gewählt. Als er am 21. September desselben Jahres mit einem Festmahl ins Amt eingeführt wurde, war er gerade mal 22 Jahre alt. Warum ein so junger Geistlicher ausgesucht wurde? Die Glarner wollten ihren Pfarrer selber wählen und nicht den vom Bischof von Konstanz vorgeschlagenen Züricher Pfarrer Heinrich Göldi hinnehmen. Zehn Jahre blieb Zwingli auf seiner ersten Pfarrstelle.
Von Glarus aus begleitete er zweimal als Feldprediger Schweizer Söldner nach Italien. In der glarnerischen wie überhaupt in der eidgenössischen Politik wurde seinerzeit heftig gestritten, auf wessen Seite man sich schlagen sollte, auf die des Papstes, des Kaisers oder die Frankreichs. Den Glarnern ging es vor allem darum, wem sie ihre Söhne als Söldner anbieten sollten. Zwingli stellte sich stets aus prinzipiellen Gründen auf die Seite des Papstes. Dafür zeigte sich dieser auch dankbar. Er lobte Zwingli eine Pension von 50 Gulden aus, ein stattlicher Betrag.
Die Glarner akzeptierten allerdings auch rasch den für sie unvorteilhaften Friedensschluss, den die Franzosen anboten, nachdem sie im Herbst 1515 aus der Schlacht von Marignano als Sieger hervorgegangen waren. Die Stimmung in Glarus schlug um zugunsten der Franzosen. Zwingli, der weiterhin den Papst unterstützte, musste 1516 gehen, was ihm aber nicht schadete.
Am 14. April 1516 trat er im Kloster Maria-Einsiedeln als Leutpriester an, der seine Pfarrstelle tatsächlich besetzte, nicht nur die Pfründe für sich reklamierte. Nun ging er seine ersten Schritte als Reformator. Er wetterte gegen die »Wallfahrten und andre Missbräuche«, also gegen das Ausnützen der Volksfrömmigkeit, was er im eigenen Kloster beobachten konnte. Er predigte gegen den vom Papst entsandten Ablassprediger Bernhardin Sanson. Und er forderte die Bischöfe von Konstanz und Sitten auf, die Kirche nach Maßgabe von Gottes Wort zu verbessern.
Schließlich sprach er sich gegen das »Reislaufen« aus, wie der Kriegsdienst der Schweizer im Sold anderer Fürsten genannt wurde. Zwingli sagte es mit Erasmus von Rotterdam: »Der Krieg erscheint den Unkundigen als süss.«
Drei Jahre später hätte Ulrich Zwingli nach Glarus zurückkehren können, der alte Streit war beigelegt. Aber nun hatte sich Zwingli zum scharfen Kirchenkritiker gewandelt. Seine Haltung als Gegner des Söldnerwesens verhalf ihm in Zürich, das selber das »Reislaufen« nicht tolerieren mochte, zu Einfluss. Zwingli wurde Leutpriester am Grossmünsterstift7( ▶ F 4). Er trat die Stelle am Neujahrstag 1519, seinem 35. Geburtstag, an – und legte nun in seinen Predigten die Evangelien aus. Bald darauf wurden sämtliche Prediger in Zürich und Umgebung angewiesen, das Evangelium so auszulegen, wie Zwingli es vormachte.
Seine erste reformatorische Schrift veröffentlichte er im Jahre 1522. Es ging um das öffentliche »Wurstessen«; in seiner Streitschrift »Von erkiesen und freyhait der spysen« wetterte er gegen das Fastengebot. Das war der Bruch mit der katholischen Kirche. Die Schrift erregte den Zorn des Papstes Hadrian VI. Er erteilte Zwingli Kanzelverbot. Und er beschied dem Rat der Stadt Zürich, Zwingli als Ketzer zu ächten.
Auf Einladung des Rats kam es am 29. Januar 1523 zur »Ersten Zürcher Disputation«, zu der 600 Zeugen erschienen und bei der Zwingli 67 Artikel seiner reformatorischen Erkenntnisse vortrug. Entgegen dem Wunsch des Papstes machte sich der Rat von Zürich Zwinglis Haltung zu eigen – und übernahm damit die Funktion der Kirche. Zwingli, der sich streng an den Wortlaut der Bibel hielt, konnte triumphieren. Es war der Bruch mit allen Traditionen der Kirche, die nicht in den Evangelien begründet waren. Fortan war in Zürich Schluss mit der Beichte, Schluss mit der Firmung, den Heiligenbildern, den Klöstern, der Krankensalbung, den Prozessionen und schließlich auch mit dem Zölibat.
»Lüge ist der Anfang zu allem Bösen«, hatte Zwingli gesagt. Und er sollte noch sagen: »Was Gott an für sich ist, wissen wir so wenig, als ein Käfer weiß, was ein Mensch ist.«
Die Veränderungen kamen nicht über Nacht. Vom 26. bis 28. Oktober 1523 wurde die »Zweite Zürcher Disputation« angehalten, diesmal mit 900 Zeugen, geistlichen und weltlichen Personen aus eidgenössischen Orten, die nun über Zwinglis Predigt gegen die Bilderverehrung und den darauf folgenden Bildersturm zu befinden hatten. Ergebnis: Die Bilder sollten binnen eines halben Jahres entfernt werden; das Volk sollte durch weitere Predigten auf diese Veränderung vorbereitet werden.
Und es kam noch zu einer »Dritten Zürcher Disputation«, drei Monate später. Sie beseitigte die Heilige Messe – und wohl auch das Zölibat, denn noch im selben Jahr, am 19. April 1524, heiratete Zwingli die Witwe Anna Reinhart, mit der er schon vorher zusammengelebt hatte.
Zwinglis Thesen beeinflussten auch die weltliche Gesetzgebung. Der Rat der Stadt Zürich, der auf Zwingli hörte und der wusste, dass das Volk dessen Predigten verinnerlichte, dieser Rat erließ Sittengesetze im Sinne des Reformators: Er verordnete die Bestimmungen für Ehe, Kirche und Schule neu – ein revolutionärer Vorgang.
Von 1524 bis 1529 übersetzte Zwingli, inzwischen Antistes, also Vorsteher der reformierten Zürcher Kirche, gemeinsam mit dem Elsässer Reformator Leo Jud die Bibel aus dem Griechischen und dem Hebräischen in die eidgenössische Kanzleisprache. Diese »Zürcher Bibel«, die 1531 reich illustriert herauskam, ist somit die älteste protestantische Bibel. Sie war fünf Jahre vor Martin Luthers Bibelübersetzung abgeschlossen.
Noch im selben Jahr kam es zu einem Religionskrieg in der Eidgenossenschaft. Zwingli, der so heftig gegen das Söldnerwesen gewettert hatte, drängte darauf, die Reformation notfalls auch mit Feuer und Schwert in die Innerschweiz zu tragen. Im Zweiten Kappelerkrieg zwischen Zürich und den Kantonen Luzern, Schwyz, Unterwalden, Uri und Zug, den die Züricher verloren, geriet er am 11. Oktober 1531 in die Hände der katholischen Innerschweizer.