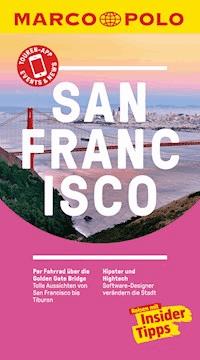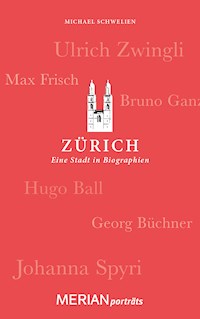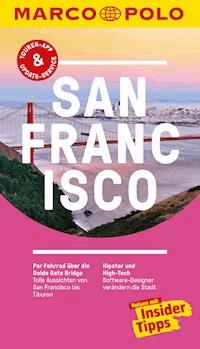7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Am 26. Dezember 2004 ereignete sich mit dem Tsunami im Indischen Ozean eine Weltkatastrophe. Der renommierte Buchautor und Journalist Michael Schwelien war als einer der ersten Berichterstatter vor Ort. In seinem 2005 erstmals erschienenen Buch beleuchtet er die politischen und sozialen Folgen einer Katastrophe, die der Frage nach dem richtigen Umgang mit den Kräften der Natur eine neue, dramatische Brisanz verliehen hat. Mit einem umfangreichen Anhang, zahlreichen Karten und fundierten Zahlen, Daten, Fakten zu den betroffenen Staaten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Ähnliche
Michael Schwelien
Tsunami. Die Schicksalsflut
Die Katastrophe und die Folgen für die Welt
FISCHER Digital
Inhalt
Kapitel 1 Die Katastrophe
DER ZWEITE WEIHNACHTSTAG ist kein besonderer Tag für die Buddhisten, Hindus und Muslime in Asien, und nur wenige der dort lebenden Christen begehen ihn als Feiertag. Der 26. Dezember 2004 fiel auf einen Sonntag, doch auch dies unterschied ihn kaum von anderen Tagen. Die Armen haben auch am Sonntag keine Muße, und für Touristen ist jeder Tag ein Mußetag. So taten die Menschen an den Küsten des Indischen Ozeans an diesem Tag das, was sie immer tun: Die Fischer fuhren aus, die Hafenarbeiter machten sich an die Arbeit, Touristen und besser gestellte Einheimische, die den Sonntag freimachen können, gingen, wenn sie sich nicht noch in den Betten räkelten, an den Strand, denn die Sonne schien, der Himmel war in weiten Regionen wolkenlos, das Meer lockte.
Von jeher zieht das Meer die Menschen an. Die Ozeane ernähren uns, von ihnen steigt das Wasser auf, das als Regen wieder zur Erde fällt, unsere wichtigsten Transportwege verlaufen über die Meere, und ihre Küsten sind unsere bevorzugten Lebensräume. Die Mehrzahl der Menschen wohnt heute in küstennahen Regionen. Für reiche Touristen sind Urlaub und Strand fast schon zu Synonymen geworden.
Das Meer besitzt in vielerlei Hinsicht mythische Qualitäten. Das Leben ist in den Ozeanen entstanden, und die Weite des Horizonts vermittelt uns einen Eindruck von Unendlichkeit. Aber das Meer ist auch gefahrvoll und todbringend. In der Überlieferung vieler Völker ist die Rede von einer Sintflut, mit der den Menschen auf fürchterliche Weise gerade die Endlichkeit alles Irdischen vor Augen geführt wird. Das dürfte der amerikanische Philosoph und Kulturhistoriker William James Durant im Sinn gehabt haben, als er schrieb: »Die Zivilisation besteht nur mit der geologischen Einwilligung unseres Planeten. Diese Einwilligung kann er jederzeit und ohne Vorwarnung widerrufen.«
An diesem zweiten Weihnachtstag des Jahres 2004 schien es, als ob der Planet seinen Kontrakt mit der Zivilisation aufkündigen wollte. Doch ohne Vorwarnungen geschah dies nicht. Indes konnten oder wollten die Menschen diese Vorwarnungen nicht beherzigen.
In der Nacht zum 26. Dezember bebt der Meeresboden entlang der Kontinentalplatte vor Sumatra mehrere Male. Die Beben bleiben zunächst folgenlos. Indonesien wird alle paar Tage von Erdstößen erschüttert. Sie gehören zum Alltag und werden von der Bevölkerung als Gott gegeben hingenommen. Wissenschaftler nehmen in dieser Nacht höchst unterschiedliche Messungen vor.
Es ist 0:58UTC, der Universal Coordinated Time, der Zeitmessung, die früher Greenwich Mean Time, GMT, genannt wurde. Auf Sumatra ist es also 7:58 Uhr, und vom Institut für Wetterkunde und Geophysik in der auf der Nachbarinsel Java liegenden indonesischen Hauptstadt Jakarta werden die Erdstöße mit einer Stärke von 6,4 auf der Richterskala registriert. Ein nicht sonderlich beunruhigender Wert in dieser Region. Auf den Philippinen, die ebenfalls in der Vergangenheit häufig von Erdstößen und Tsunamis heimgesucht worden sind, wird an diesem Sonntagmorgen gar nicht gemessen, obwohl das Land sich mit internationalen Verträgen verpflichtet hat, Erdbeben zu registrieren und die Daten ins Internet zu stellen. In Singapur dagegen, Sumatra gegenüber an der Straße von Malakka, wird ein Wert von 8,5 ermittelt. In der US-amerikanischen Erdbebenwarte im Bundesstaat Colorado stellen die Experten ein Beben von einer Stärke von 8,9 fest. Und in Malaysia, ebenfalls Sumatra östlich gegenüber, registrieren Seismologen in diesem Moment ein Seebeben der Stärke 9. Mit 9 Punkten auf der Richterskala wäre dies das weltweit gewaltigste Beben seit vierzig Jahren und das fünftstärkste, das überhaupt je gemessen wurde.
Von den amerikanischen Forschern wird eine Warnung ausgegeben, dass auf die Erdstöße ein Tsunami folgen könnte. Eine entsprechende Meldung wird wenige Minuten nach dem Beben auf die Internetseite des Geologischen Dienstes der USA gestellt. Wer sie lesen will, muss allerdings ein wenig suchen, sich über fünf Links weiterklicken. Zunächst ist nur die Entwarnung für die Anrainer eines anderen Ozeans zu lesen: »Keine Tsunami-Gefahr für die Pazifik-Region.« Darunter der lapidare Hinweis: »Möglichkeit eines Tsunami im Erdbebengebiet.« Die Warnung verpufft, wer von ihr erfuhr, nahm sie nicht ernst. Das »Erdbebengebiet« liegt irgendwo auf hoher See. Tsunamis im Indischen Ozean – lang ist es her, dass jemand von diesen Wellen gehört hätte, zu lang. Und die bloße »Möglichkeit« eines Tsunami besteht in dieser Region praktisch jeden Tag.
Ein direkter Kontakt zwischen den amerikanischen Experten und den Behörden in der Region kommt nicht zustande. Es gab keine Adresse, keine Telefonnummern – die Amerikaner erklärten später, sie hätten schlicht nicht gewusst, wen sie auf die drohende Gefahr hätten aufmerksam machen können. Immerhin wurden E-Mails an die amerikanischen Botschaften und andere Außenstellen rund um den Indischen Ozean verschickt und Anrufe getätigt. Es bleibt ungeklärt, ob dabei von der »Wahrscheinlichkeit« (»probability«) oder nach wie vor lediglich von der »Möglichkeit« (»possibility«) eines Tsunami die Rede war.
Das Epizentrum, der genau senkrecht über dem Erdbebenherd liegende Punkt, befindet sich vor der Küste Sumatras, bei 3,3° nördlicher Breite und 95,8° östlicher Länge, rund dreihundert Kilometer von der Nordspitze der Insel und rund tausendfünfhundert Kilometer von Jakarta entfernt (siehe Karte). Auf einer bogenförmigen Strecke von rund tausend Kilometer lösen sich zwei Platten aus ihrer Verkantung, die westlich gelegene Indische Platte schiebt sich unter die der Eurasischen Platte vorgelagere kleinere Burma-Platte. Der Meeresboden sinkt plötzlich um zehn Meter. Dann federt er wieder hoch. Ein Sog nach unten entsteht. An der Meeresoberfläche bilden sich Flutwellen. Sie breiten sich aus, rasen mit ungeheurer Geschwindigkeit in alle Richtungen. Aber nicht so kreisförmig wie die Wellen, die entstehen, wenn man einen Stein in ruhiges Wasser wirft. Da suggerieren die Grafiken, die bald darauf publiziert werden, etwas Falsches. Die Wellen des Tsunami im Indischen Ozean rollen wie zielgerichtet voran. Ihr Lauf wird bestimmt von der Struktur des Meeresbodens, von Inseln und am Ende von der Beschaffenheit der Küste, auf die sie treffen. Thailand, Indien, Indonesien und Sri Lanka liegen gewissermaßen in den Brennpunkten, die Hauptwellen kommen dort mit gebündelter Kraft an. Bangladesch hingegen bleibt verschont, die Sedimentablagerungen im Ganges-Delta können die Wasserwalze bremsen. Auch die Insel Diego Garcia mit dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt kommt davon. Die Malediven, die bekanntlich nur zwei Meter über den Meeresspiegel ragen, werden zwar nicht von der konzentrierten Hauptwelle getroffen, trotzdem aber überflutet.
Ein gewaltiges Faltengebirge erstreckt sich im Westen der Insel und fällt zur Küste hin steil ab. Viele Orte liegen hier in den ungeschützten flachen Buchten. Sie werden vom Tsunami fast vollständig ausgelöscht. Nur die eine oder andere Moschee bleibt stehen, die Gotteshäuser wurden eindeutig stabiler als die Wohnungen der Menschen gebaut.
Unvorstellbare Szenen ereignen sich. Vor der Küste von Aceh, der Provinz im Norden Sumatras, die dem Epizentrum am nächsten liegt, hebt die Welle ein Fischerboot an und schleudert es an Land. Das Boot landet auf dem Dach einer Moschee. Die Fischer steigen unversehrt aus. Sie klettern hinunter, schauen in das Gebetshaus. Sie sehen Dutzende von Leichen. Die Gläubigen sind beim Gebet von der Flut überrascht worden und ertrunken.
In Banda Aceh, der 400000 Einwohner zählenden Provinzhauptstadt von Aceh, wälzt sich urplötzlich ein schwarzer schlammiger Strom durch die Einkaufsstraßen des Zentrums. Es ist, als würde ein Fluss rückwärts fließen, den Berghang hinauf. In ihm treiben Hunderte, ja Tausende von Toten. Baumstämme, Überreste von Häusern und Bretterbuden, Mopeds und Autos, Tierkadaver und Marktgüter, alles verhakt und verkantet sich ineinander, zerschmettert die Knochen derer, die, im Wasser treibend, vielleicht noch am Leben sind, reißt Wunden in die Körper derer, die sich verzweifelt irgendwo festzuhalten versuchen, Wunden, die sich bald infizieren werden und deren Brand sich nur durch Amputationen noch wird aufhalten lassen. Achtzehn Stunden lang ist die Stadt von der Welt völlig abgeschnitten. Nach dem Rückzug der Wassermassen bedeckt eine dicke Schlammschicht die Straßen und Plätze. Die Leichen beginnen in der tropischen Hitze bereits zu verwesen, als die ersten Helfer eintreffen. Die Flutwellen haben in die Küste neue Buchten gegraben. Eine der Stadt vorgelagerte kleine Insel ist vollständig verschwunden. Und die Verwüstungen reichen weit bis ins Landesinnere hinein. Die Todeszone von Banda Aceh wird auf über vierzig Quadratkilometer geschätzt.
Siedlungen, Dörfer, Städte wie Banda Aceh, die mehr oder weniger nah an der Küste erbaut sind, konnten den Menschen so gut wie keinen Schutz bieten. Und die natürlichen Schutzwälle, die einst an vielen Küsten des tropischen Asien anzufinden waren, die Dreifachwellenbrecher aus Riffen, Dünen und Mangrovenwäldern, die dem Wasser einen großen Teil der Wucht nehmen können, sind der modernen Zivilisation schon vor Jahren zum Opfer gefallen.
Indonesiens Präsident Susilo Bambang Yudhoyono weilte an diesem Morgen des 26. Dezember 2004 im Osten Sumatras und zwar ausgerechnet bei einer Trauerfeier zu Ehren von elf Opfern eines vergleichsweise harmlosen Bebens, das wenige Wochen zuvor die Region erschüttert hatte. Er überfliegt, wie es heißt, noch am selben Tage Aceh und nimmt das Katastrophengebiet von der Luft aus in Augenschein. Es soll noch eine ganze Woche dauern, bis er die Stadt des Todes und die gemarterte Region aus direkter Nähe inspiziert.
In der Provinz Aceh herrschte – auch das eine Ironie des Schicksals – bereits vor dem Tsunami der Ausnahmezustand. 20000 indonesische Soldaten sollten hier »kurzen Prozess machen« mit den Kämpfern für ein unabhängiges Aceh. Jetzt, nach der Flut, appelliert der Präsident an die »nationale Solidarität«. Die Militärs werden beordert, erste Hilfe zu leisten. Allem Anschein nach leisten sie sich aber vor allem selbst Hilfe. Immer wieder wird berichtet, Soldaten hätten sich und ihre Angehörigen zuerst in Sicherheit gebracht, hätten dafür sämtliche Fahrzeuge eingesetzt, selbst das schwere Gerät, das nun fehlt, um wenigstens die Hauptstraßen und den Flughafen von Banda Aceh für Hilfslieferungen freizuräumen.
Der Befehlshaber für die Provinz, Generalmajor Endang Suwarya, unternimmt erst am dritten Tag nach der Flut einen Erkundungsflug im Hubschrauber. Dem hartgesottenen Soldaten fehlen die Worte. »Die Zerstörung ist niederschmetternd«, sagt er, um dann militärisch knapp zu quantifizieren: »Fünfundsiebzig Prozent der Westküste und in manchen Orten hundert Prozent. Die Menschen sind isoliert, und wir werden versuchen ihnen zu helfen.« »Versuchen«: ein kaum verhohlenes Eingeständnis der eigenen Hilflosigkeit angesichts der Dimension der Verwüstung.
Schlimmer noch als über Banda Aceh war die Flutwelle über die weiter südlich gelegene Stadt Meulaboh gekommen. Innerhalb der Provinz Aceh liegt sie dem Epizentrum am nächsten, rund 150 Kilometer vom Ursprungsort der Katastrophe entfernt. Meulaboh blieb tagelang unerreichbar. Aus der Luft ließ sich der Ort erst nach langem Suchen ausmachen, von den Häusern waren allenfalls die Grundmauern zu sehen. Und auch hier war es nur die weiße Moschee mit ihrer grünen Kuppel, die der Flut getrotzt hatte. Meulaboh liegt, genau wie Banda Aceh, an einer flachen Bucht, von der Moschee ist es nur einen Steinwurf bis zum Meer. Keine Frage: In den Tropen ist es angenehmer in Küstennähe zu wohnen. Hier weht häufig eine kühlende Brise, es gibt weniger Insekten und andere Plagen, das flache Land ist leichter zu bebauen. Aber offensichtlich hat das kollektive Gedächtnis bei der Städteplanung nicht weit genug zurückgereicht, um sich daran zu erinnern, was geschehen kann, wenn der Ozean in Aufruhr gerät.
Die in den Nachrichten genannten Opferzahlen überschlugen sich stündlich: 10000, dann 20000, dann 30000 – zwei Tage nach Weihnachten war bereits die Rede von über 50000 Toten, über ein Drittel der Opfer Kinder.
Als sich die Zahlen unaufhörlich erhöhten und bald – drei Tage nach Weihnachten – allein aus der Provinz Aceh 40000 Tote gemeldet wurden, kam die berechtigte Frage auf, wie denn die Zählungen überhaupt vorgenommen wurden. Beobachtern zufolge telefonierten die Zentralregierungen der betroffenen Staaten mit den örtlichen Polizeidienststellen, den Krankenhäusern, den Moscheen und Tempeln und addierten einfach deren völlig vage Zahlen. In Indonesien aber, das am schlimmsten betroffen war, waren selbst solche Auskünfte nicht zu haben. Das Telefonnetz brach zusammen. Staatliche und religiöse Verwaltungseinrichtungen waren zerstört. Auf einer Insel vor der Westküste, die erst Tage nach der Katastrophe erreicht wurde, fanden Helfer den Dorfvorsteher. Er hatte seine gesamte Familie verloren und stand unter Schock, sodass er keinerlei verständliche Angaben machen konnte. In anderen Fällen zählten die Behörden, so gut es ging, die Überlebenden und meldeten den Rest der Bevölkerung als tot. Die Identifizierung der Toten war in Aceh praktisch nicht möglich. In der Provinzhauptstadt sah man, wie Bulldozer mehrmals Tausende von Leichen in Massengräber schoben. Und irgendwo im fernen Jakarta multiplizierte jemand die Zahl der gemeldeten Massengräber mit der Zahl der in ihnen vermuteten Leichen. Das Grauen wird nie genau zu beziffern sein. Lange bevor es hieß, der Tsunami habe rund 300000 Menschen das Leben gekostet, war dies dem Hilfskoordinator der Vereinten Nationen, Jan Egeland, bereits bewusst: »Wir werden es nie genau wissen.«
Eine Naturkatastrophe, die so viele Todesopfer forderte, hat es auf dem Archipel seit Menschengedenken nicht gegeben. Bei Ausbruch des Vulkans Krakatau in der Sundastraße zwischen Sumatra und Java erfuhr man im Jahr 1883 zum Beispiel durch den kühlen, fünfzeiligen Bericht des englischen Konsuls Alexander Cameron, dass 35000 Menschen dahingerafft worden seien – was die westliche Welt nicht sonderlich erregte, denn es waren nahezu ausschließlich »Eingeborene«, die ihr Leben verloren hatten. Erst seit neuerem wird erforscht, was 1883 wirklich geschah. Aber das heutige Wissen von dem zerstörerischen Potenzial der Naturgewalt eines Seebebens ist nicht zu den Küstenstädten Sumatras vorgedrungen. Und seit dem Ausbruch des Krakataus hat die Natur hier nicht mehr so schrecklich gewütet. Es leben keine Alten mehr, die von der Bedrohung durch Vulkanausbrüche und Erdstöße, die durch die aufgeputschte See bis in weite Ferne wirken, erzählen könnten. Altes Menschheitswissen ist auch hier verloren gegangen. Niemand auf Sumatra war auf eine Katastrophe von diesen Ausmaßen vorbereitet – und auch sonst niemand in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans.
Das zeigte sich auch in den Reaktionen der Beobachter unmittelbar nach der Katastrophe, Regierungen, Wissenschaftler, Touristikunternehmen, Analysten, Hilfsorganisationen – sie alle verloren wertvolle Stunden, wenn nicht Tage, weil sie zunächst glauben wollten, es handele sich um ein lokal begrenztes Ereignis, ein schlimmes zwar, aber doch nicht um eins von solch weltumspannender Dimension. Das Bewusstsein für die Globalität des Desasters stellte sich erst nach Tagen ein, und dies obwohl die ersten Bilder, Amateurvideos zumeist, praktisch zeitgleich mit den Ereignissen von CNN und BBC ausgestrahlt wurden.
Nur wenige Minuten nachdem die Flut Sumatra erreicht hat, brechen die Wellen über die Küsten der Nikobaren herein. Die Inseln gehören, wie die nördlich gelegenen Andamanen, zu den Regionen der Welt, die nicht nur unter einer geologischen Verwerfung zu leiden haben, sondern auch unter einer politischen. Die Kette der 572 Inseln, von denen nur 36 von Menschen bewohnt sind, liegt, von Indien aus betrachtet, jenseits der Indischen Platte, schon auf dem Gebiet der Eurasischen Platte. Politisch aber sind die Inseln indisches Bundesterritorium. Sie haben nicht die Rechte indischer Bundesstaaten, sondern stehen unter der direkten Verwaltung von Neu-Delhi. Das ist nichts anderes als eine Fortsetzung des Kolonialzustandes mit anderen Mitteln. Hier leben keineswegs nur »Eingeborene«, die Stämme von Naturvölkern aus Afrika und Asien, welche die indische Regierung respektlos als »Primitive« bezeichnet. Hier wohnen vor allem Siedler, Zuwanderer aus allen Teilen Indiens, die hoffen, auf diese Weise der Armut zu entkommen, hier, fern der Heimat, in die Mittelschicht aufsteigen zu können. Und wenn, wie immer wieder berichtet wurde, die »Naturvölker« auf den Inseln die Zeichen deuten und sich bei einer drohenden Flut in Sicherheit bringen konnten – die vom Festland stammenden Kolonisten vermochten es nicht. Auch sie traf der Tsunami ohne Vorwarnung.
Die Atommacht Indien will sich auch von der See her gegen die anderen Mächte in der Region, China und Pakistan, schützen. So wurden elektronische Horch- und Überwachungsposten auf den Inseln installiert, und auf Car Nicobar unterhält die indische Luftwaffe einen wichtigen Stützpunkt.
Von dort geht eine Warnung ein. Es ist 7:30 Uhr indischer Zeit, also gerade etwas mehr als eine Stunde nach dem Beben, da meldet der Außenposten auf Car Nicobar dem für die Inseln zuständigen militärischen Hauptquartier in Chennai, dem vormaligen Madras, es müsse sich ein »massives Beben« in der Nähe ereignet haben. Das bestätigte der Kommandeur der Luftwaffe S. Krishnaswami später der Zeitung Indian Express. Der General ergänzte: »Aber die Kommunikation brach zusammen … die letzte Meldung vom Stützpunkt auf Car Nicobar besagte, die Insel sinke, überall stehe das Wasser.«
Man hätte sich leicht zusammenreimen können, dass die Wellen in weniger als einer Stunde auf das indische Festland treffen mussten. Aber die indische Bürokratie versagt. Es wird kein Alarm geschlagen, die Küsten zu räumen wird nicht einmal in Erwägung gezogen. Nach eigener Darstellung ordnet General Krishnaswami um 8:15 Uhr, also 45 Minuten später an, das Verteidigungsministerium zu informieren. Warum dort nichts geschieht, vermag hinterher niemand zu sagen.
Wiederum 39 Minuten später, um 8:54 Uhr setzt der indische Meteorologische Dienst ein Fax ab. Diese zivile Dienststelle hat keinerlei Kontakt zum Militär – und das Fax geht unbegreiflicherweise an Murli Manohar, den ehemaligen Wissenschaftsminister, statt an den Amtsinhaber Kapil Sibal. Die Amtsübergabe von Monahar am Sibal hatte bereits im Mai stattgefunden, sieben Monate zuvor.
Ohne den Fehler zu bemerken, schickt das Meteorological Department ein weiteres Fax los. Dieses geht an das Home Ministry, das Innenministerium, angeblich direkt an den Disaster Control Room. Uhrzeit: 9:14.
Um 10:30 Uhr schließlich informiert der Disaster Control Room das Sekretariat des Kabinetts, vier Stunden nach dem Beben und drei Stunden nachdem die Flutwelle über Car Nicobar hinweggerollt ist.
Wie die indonesischen Städte Banda Aceh und Meulaboh, so liegt auch der Stützpunkt der indischen Luftwaffe auf Car Nicobar direkt an der Küste. Die Unterkünfte der Offiziere stehen nahe am Strand, was als Auszeichnung gedacht ist; die Baracken der einfachen Soldaten befinden sich weiter landeinwärts. Ähnliches gilt für die zivile Bevölkerung. Je höher einer gestellt ist, desto näher wohnt er am Meer. Die einheimische Bevölkerung wurde verdrängt, ins Innere, auf andere Inseln. Ein Umstand, der manchen von ihnen vielleicht das Leben gerettet hat.
Es ist nur schwer zu begreifen, dass Indien, eine Atommacht, ein Staat, der zu den Globalisierungsgewinnern zählen wird, dessen Computerexperten die Software für die Spitzenunternehmen der Welt entwickeln, dass dieser Staat offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Bürgern eine Katastrophenwarnung zukommen zu lassen.
Als der Cabinet Secretary, die eigentlich handelnde Exekutive, informiert ist, liegen bereits die Leichen tausender Inder an den geschundenen Küsten im Südosten des Subkontinents. Und es dauert noch einmal zweieinhalb Stunden, bis, um 13:00 Uhr, eine Crisis Management Group zusammentritt – die nur noch reagieren und nichts mehr verhindern kann.
Zunächst aber verkündet der Krisenstab, man werde keine fremde staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, Indien könne sich selber helfen. Dies ist einerseits eine verständliche Haltung: Indien will nicht länger als das Armenhaus der Welt gesehen werden. Andererseits verrät diese Großspurigkeit jedoch auch, dass noch immer nicht das Ausmaß der Katastrophe ins Bewusstsein der Menschen gedrungen ist. Die Regierung schickt Hilfe nach Sri Lanka, vergisst aber die Andamanen und Nicobaren. Sie kündigt an, schnellstens ein eigenes Tsunami-Warnsystem zu installieren, muss indes zugeben, dass indische Wissenschaftler das Beben vor Sumatra registriert hatten, es aber ignorierten – weil es sich nicht im eigenen Land ereignet hatte.
Für Indien spielt der internationale Tourismus nur eine unwesentliche Rolle. Anders Thailand, wo er von zentraler Bedeutung ist. Indien wollte sein Image als der zweite aufstrebende Gigant Asiens – nach China – schützen; Thailand wollte seinen Ruf als sicheres Reiseziel wahren. Auch dies Gründe, warum nicht rechtzeitig vor der unmittelbar bevorstehenden Katastrophe gewarnt wurde.
Minuten nach dem Seebeben ist der Meteorologische Dienst Thailands über die gigantische seismische Erschütterung informiert. Noch knapp eine Stunde wird vergehen, bis die Wellen auf die Urlauberparadiese im Süden des Landes treffen. Im Königreich Thailand herrscht keine träge Bürokratie, sondern ein ziemlich effizienter, moderner Staatsapparat. »Tsunami« ist hier zudem kein Fremdwort. Schon vor Jahren sind in den Strandorten des Südens Broschüren verteilt worden, welche die Gefahren schildern, die von diesen Wellen ausgehen. Das bloße Wissen um Tsunamis ist ein Schutz, der Leben retten kann. So war später zu erfahren, dass auf Phuket ein englisches Mädchen mehrere Urlauber warnen und somit retten konnte. Es hatte im Unterricht aufgepasst, als das Naturphänomen durchgenommen wurde, und ahnte, was passieren würde, als sich an dem Morgen das Meer weit zurückzog, ahnte, dass es sich aufbäumen und in kurzer Zeit als eine bis zu dreißig Meter hohe Welle zurückkehren würde.
Thailands Meteorologischer Dienst dürfte die notwendigen Maßnahmen für einen solchen Fall gekannt haben, und es existiert in Thailand die Infrastruktur für Katastrophenwarnungen – besonders in den Touristenzentren. Doch niemand wollte der Warner sein, niemand wollte eine Panik auslösen. Der Meteorologische Dienst wartete auf den letzten unumstößlichen Beweis für einen Tsunami. Als dieser kam, war es bereits zu spät.
Zwar gibt es ein sehr gut funktionierendes länderübergreifendes Warnsystem im Pazifischen Raum, ein Warnsystem, dem Thailand im übrigen längst angeschlossen ist. Aber immer wieder kommt es zu Fehlalarmen. Ein Alarm ist teuer, er ist zeitaufwändig, und wenn zu häufig grundlos evakuiert wird, führt dies zu einem Ermüdungseffekt, die Küstenbewohner nehmen die Warnungen irgendwann nicht mehr ernst. Es muss also in der Tat sehr genau abgewogen werden, ob unmittelbare Gefahr droht oder nicht. So ist es schwer zu sagen, was die Meteorologen in Bangkok daran hinderte, die notwendigen Schritte einzuleiten: Leichtfertigkeit oder übermäßige Vorsicht?
Sumalee Prachuab, eine Seismologin im thailändischen Meteorologischen Dienst, äußerte sich nach der Katastrophe in verschiedenen Interviews genau zu dieser Frage: »Nicht jedes Erdeben in der See löst einen Tsunami aus«, sagte sie, und, »wenn wir eine Warnung über die Möglichkeit eines Tsunami ausgeben, werden die Menschen in große Panik geraten.« An anderer Stelle gab sie einen noch deutlicheren Hinweis auf das Dilemma: »Vor fünf Jahren gab das Meteorological Department eine Warnung vor einer möglichen Flutwelle aus, nachdem sich ein Erdbeben in Papua-Neuguinea ereignet hatte. Aber die Tourismusbehörde beschwerte sich, solch eine Warnung würde dem Tourismus schaden.« Damals habe man dann gleichwohl Flugblätter verteilt, für spätere Gelegenheiten. »Wir haben ihnen erklärt, wenn sie beim Schwimmen im Meer ein Beben spüren, sollen sie schnell an Land gehen. Aber vielleicht haben die Thais das vergessen.«
Vergessen, verdrängt, einfach nicht für möglich gehalten? Wahrscheinlich sind alle drei Aspekte zusammengekommen. Den Opfern ist nicht damit geholfen, Schuld bei jenen zu suchen, die vielleicht hätten warnen können. Aber wie sieht es mit den Überlebenden aus?
Kann die Menschheit überhaupt aus solchen Katastrophen lernen? Liegt nicht gerade in der Singularität und in der Dimension einer Katastrophe wie der vom 26. Dezember die Schwierigkeit begründet, allgemeingültige Lehren aus ihr zu ziehen? Die Singularität der Ereignisse veranlasste die Menschen immerhin weltweit zu einer Spendenbereitschaft von bis dahin nicht gekanntem Ausmaß, und Jan Egeland fasste bei einer UN-Konferenz zum Katastrophenschutz im japanischen Kobe drei Wochen nach dem Desaster im Indischen Ozean in Worte, was all die Millionen Spender bewegt haben mochte: »Die beste Ehrung der Toten ist der Schutz der Lebenden.«
Es ist gegen 9:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also gegen 16:15 Uhr auf Sumatra, gut acht Stunden nach dem Beben, als der Notdienst des deutschen Auswärtigen Amts den Minister in seiner Berliner Privatwohnung anruft. Das Wort »Tsunami« fällt, und Joschka Fischer ahnt Schlimmes, befürchtet nach der ersten Unterrichtung, es könnten am Ende mehr als 10000 Opfer zu beklagen sein. Das volle Ausmaß des Desasters ist auch für Fischer zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen. Es steht zu vermuten, dass auch deutsche Urlauber der Flutwelle zum Opfer gefallen sind.
Fast zur selben Zeit rollt die Wasserwalze ein letztes Mal auf eine Küste zu, eine lange Küste, die vom Horn von Afrika bis hinunter nach Tansania reicht. In über 5000 Kilometer Entfernung vom Epizentrum tötet sie abermals. Es sind hier einige hundert Opfer, die meisten von ihnen Fischer aus Somalia. Sie kehrten gerade von ihren Fanggründen zurück, als ihre Boote in den flachen Küstengewässern zerschellten. Es war selbst vielen Experten nicht bewusst: Ein Tsunami kann ein ganzes Weltmeer durchpflügen, ohne an Wucht zu verlieren.
Auch Sri Lanka hat dies einige Stunden zuvor auf schreckliche Weise zu spüren bekommen. An der Südwestküste verläuft eine Eisenbahnlinie, die Gleise liegen streckenweise nur dreißig Meter vom Meer entfernt. Dort fährt der Zug Queen of the Sea. Er ist, wie immer, hoffnungslos überladen, mehr als tausend Reisende drängen sich in den Waggons. Die Welle hebt den Zug wie eine Spielzeugbahn aus den Gleisen, schleudert die Waggons auf die Felder. Wer nicht zerquetscht oder erschlagen wird, kommt in einer zweiten Welle um, ertrinkt, als die Waggons, aus denen es kein Entrinnen gibt, von den Wassermassen begraben werden.
Joschka Fischer betritt erst gegen 17:00 Uhr MEZ das Krisenreaktionszentrum im Keller des Auswärtigen Amts am Werderschen Markt. Das Team dort ist katastrophenerprobt, es hat Entführungen deutscher Urlauber auf den Philippinen und in der Sahara gemeistert. Doch das »Seebeben Asien 26. 12. 2004« – so die offizielle Bezeichnung im Amt – übertrifft auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums alles bisher Dagewesene. Sie sitzen an zusammengestellten Schreibtischen und in kleinen Telefonboxen. Auf mehreren Dutzend Leitungen kommen Anrufe herein. Die Menschen wollen wissen, ob es ein Lebenszeichen von ihren Verwandten gibt, ob ein Bruder, eine Schwester, die Eltern, die Kinder wohlauf sind. Doch selbst wenn die Beamten zu diesem Zeitpunkt schon bestätigte Todesnachrichten gehabt hätten, sie hätten sie nicht herausgeben dürfen. Es ist Sache der Landeskriminalämter, diese Nachrichten zu überbringen.
Es vergehen drei Tage, bis Außenminister Joschka Fischer sich am Mittwoch, dem 29. Dezember, genötigt sieht, von einer »nationalen Katastrophe« zu sprechen. Er meint damit Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt sind erst 26 deutsche Todesopfer identifiziert, etwa tausend Deutsche werden vermisst. Gerhard Schröder wird geahnt haben, dass für die meisten keine Hoffnung mehr besteht. Der Bundeskanzler sagt, es stehe zu befürchten, die Zahl der deutschen Todesopfer werde »deutlich dreistellig« ausfallen und spricht von »einer der schlimmsten und verheerendsten Naturkatastrophen seit Menschengedenken«.