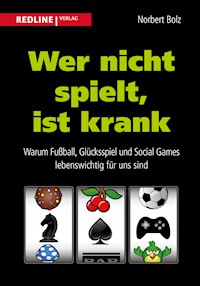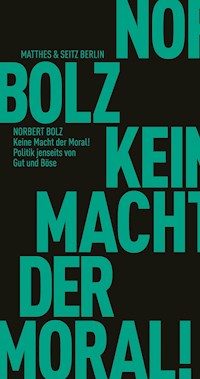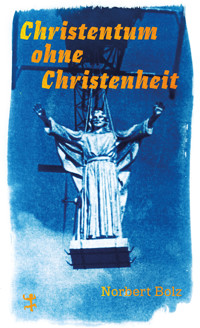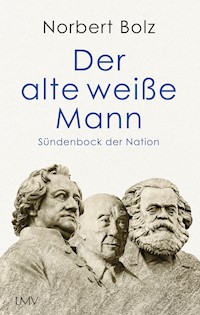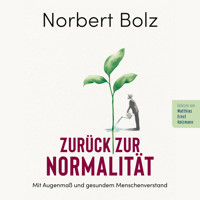
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: isid.de - media production
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere bürgerliche Gesellschaft ist einem Zangenangriff auf die Normalität ausgesetzt – nämlich einmal durch die "Wokeness" der Kulturrevolutionäre und zum andern durch den Alarmismus der politisch-medialen Elite. Die Wokeness stellt das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf. Der Alarmismus stellt das Verhältnis von normal und extrem auf den Kopf. Das, was früher als Neurose betrachtet wurde, soll jetzt als selbstbestimmter Lebensentwurf anerkannt werden. So ist ein kulturelles Klima absoluter Toleranz entstanden, die sich aber als absolute Intoleranz gegenüber den traditionellen Lebensformen äußert. Damit wird der Normalität der Krieg erklärt. Genauso pervertiert ist das Verhältnis von Normalität und Ausnahmezustand in der Welt von Medien und Politik. Hier herrscht ein Alarmismus, der überall nur Katastrophen sieht. Das ist der gemeinsame Nenner von Sensationsjournalismus, Gefälligkeitswissenschaft und einer Politik der Angst, wie wir sie in der Corona-Zeit kennengelernt haben. Es gibt heute aber Anzeichen dafür, dass nach der politischen Generation der Weltverbesserer wieder eine skeptische Generation kommt, die mit dem woken Spuk aufräumt. Das nährt die Hoffnung auf eine Rückkehr aus den moralischen Exzessen und dem nihilistischen Selbstzweifel des Westens zur moralischen Normalität, die sich von selbst versteht. Im Augenblick sehen viele nur die Zeichen der Dekadenz, aber am Ende wird die Wokeness die Provokation gewesen sein, die zu einer Wiedergeburt der Bürgerlichkeit geführt hat.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Bolz
Zurück zur Normalität
Mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand
Distanzierungserklärung:
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2025 LMV, ein Imprint der Langen Müller Verlag GmbH, Thomas-Wimmer-Ring 11, 80539 München
Alle Rechte vorbehalten
Wir behalten uns auch die Nutzung von uns veröffentlichter Werke
für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlaggestaltung: Sabine Schröder
Umschlagmotiv: © fran_kie / Shutterstock.com
Satz und E Book Konvertierung: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-7844-8522-5
www.langenmueller.de
Inhalt
Die These
Wokeness und Fundamentalismus
Was ist normal?
Unsere Lebenswelt
Starke und schwache Bindungen
Moderner Konservativismus
Die gesellschaftliche Form der Normalität: Bürgerlichkeit
Die Produktivkraft Freiheit
Die Normalität der technischen Welt
Warum wir nicht der Wissenschaft folgen können
Die gut informierte Weltfremdheit
Die zwei Gesichter der Politik
Literatur
1. Die These
Unsere bürgerliche Gesellschaft ist einem Zangenangriff auf die Normalität ausgesetzt – einmal durch die »Wokeness« der Kulturrevolutionäre und zum anderen durch den Alarmismus der politisch-medialen Elite. Die Wokeness stellt das Verhältnis von normal und pathologisch auf den Kopf. Der Alarmismus stellt das Verhältnis von normal und extrem auf den Kopf.
Wokeness ist das letzte Asyl der geistig obdachlosen Linken. Sie ist einerseits durch eine Hypersensibilität und andererseits durch eine Hypermoralität gekennzeichnet. Wenn man sich um eine Erklärung dieses eigenartigen, in der ganzen westlichen Welt verbreiteten Phänomens bemüht, kommt man zu dem Ergebnis: Wir leben in der anstrengendsten Kultur aller Zeiten. Und das überfordert und frustriert sehr viele Menschen. Deshalb beherrschen die Barbaren, nämlich die »postkolonialistischen« Taliban des Westens, und die Mimosen der Wokeness die Öffentlichkeit. Ich komme gleich darauf zurück.
Betrachten wir zunächst die woke Normalisierung des Pathologischen. Das, was früher als Neurose betrachtet wurde – zum Beispiel Hysterie, Zwangsneurose oder Verfolgungswahn –, soll jetzt als selbstbestimmter Lebensentwurf anerkannt werden. Indem sie eine statistische Normalität des moralisch Abnormen behauptet, errichtet die Wokeness ein Tabu über die Unterscheidung von normal und abnormal. Die woken Normalisierungen des Pathologischen zeigen längst auch eine aggressive politische Seite, nämlich in Form einer Reeducation der weißen, heterosexuellen Männer. Sie sollen »queer« denken lernen, und das heißt letztlich, die Unterscheidung von Mann und Frau durch ein Kontinuum unendlich vieler Geschlechter zu ersetzen. Das bedeutet, dass nun alles akzeptiert wird – nur nicht die bürgerliche Normalität.
So ist ein kulturelles Klima absoluter Toleranz entstanden, das sich aber als absolute Intoleranz gegenüber den traditionellen Lebensformen, vor allem gegenüber den traditionellen Geschlechterrollen, äußert. Damit wird der Normalität der Krieg erklärt. Normal und pathologisch tauschen die Plätze. Als krank gilt jetzt derjenige, der etwas für normal, also für natürlich gegeben hält – wie etwa die Tatsache, dass jemand ein Mann oder eine Frau ist. Das funktioniert aber nur deshalb, weil den meisten normalen Menschen der Mut fehlt, die lautstarken Verrückten verrückt zu nennen. Sie haben nämlich Angst, als »rechtsextrem« zu gelten.
Genauso pervertiert ist das Verhältnis von Normalität und Ausnahmezustand in der Welt von Medien und Politik. Es gibt hier eine wahre Katastropheninflation, deren bekanntester Vertreter die sogenannten »Wetterextreme« sind. Aus den Medien ist uns der Alarmismus natürlich schon lange bekannt, denn der Journalist sucht die Sensation, das extrem Neue. Doch heute ist der Alarmismus, der überall nur Katastrophen sieht, der gemeinsame Nenner von Sensationsjournalismus, Gefälligkeitswissenschaft und einer Politik der Angst, wie wir sie in der Corona-Zeit kennengelernt haben.
Die unbestreitbare Tatsache, dass es das Unerwartete, also schwarze Schwäne gibt, hat die politisch-mediale Elite zu einer Katastropheninflation gesteigert. Und in der Angst vor der Katastrophe treffen sich die Neurose der Woken und das Extrem der Alarmisten. Ein noch vergleichsweise harmloses Beispiel sind die gerade erwähnten »Wetterextreme«. So lautete die Wettervorhersage von wetter.com für April 2024: »Von extrem warm zu extrem normal«.
Es stimmt natürlich, dass die Normalität langweilig und oft auch fortschrittsfeindlich ist. Dieses Unbehagen an der Normalität ist so alt wie die bürgerliche Gesellschaft selbst. Aber es ist heute in einen Angriff auf die Normalität umgeschlagen. Vor allem die Grünen verkünden das Ende der bürgerlichen Normalität, die als »zerstörerisch« denunziert wird. Im Klartext heißt das aber: Die notwendige Anpassung an die Dynamik und Mobilität der modernen Gesellschaft ist pervertiert worden zu einem Stellentausch von normal und pathologisch und von normal und extrem.
Spätestens jetzt wird der geneigte Leser fragen, was Normalität denn sei. Eine Definition ist schwierig, aber es gibt eine gut erkennbare Begriffsfamilie, die sich um den Begriff der Normalität gruppiert: Gewohnheit, Institution, Selbstverständlichkeit, Üblichkeit, Erwartung, Tradition, Vorurteil, Vertrauen, Erfahrung, Bürgerlichkeit. Normal ist, was sich von selbst versteht und nicht erst ausgehandelt oder gerechtfertigt werden muss. Normalität ist wie Gesundheit – man bemerkt sie nicht, wenn sie statt hat. Und sie ist genauso schwer zu definieren, eigentlich nur durch die Verneinung ihrer Verneinungen; nicht pathologisch, keine Ausnahme, nicht exzessiv, nicht abnorm.
Normalität ist die größte zivilisatorische Errungenschaft. Sie ist dem Schrecken der urzeitlichen menschlichen Existenz abgetrotzt und hat die Selbsterhaltung des Menschen auf Dauer gestellt. Was geschieht aber, sobald die Selbsterhaltung selbstverständlich geworden ist – und das ist in unserer zivilisatorischen Anti-Darwin-Welt der Fall? In der so gewonnenen bürgerlichen Normalität kann das Selbstverständnis zum Problem werden – bis hin zur Identitätskrise. Man kann es auch so sagen: Wenn man sich nicht mehr selbst um Selbsterhaltung kümmern muss, entsteht für viele Menschen ein Bedarf an Selbstverständnis: Wer bin ich? Was ist normal?
Ein normaler Mensch weiß, wer er ist, und muss sich nicht auf die Suche nach seiner Identität begeben. Normalität ist der Standard, der definiert, wie viel Variabilität in den Lebensformen akzeptabel ist. Normal ist nicht das Optimale, sondern das, was gut genug, also zufriedenstellend ist. Politisch ist das die Position des Konservativismus. Und der heute so beliebte »Kampf gegen rechts« ist in Wahrheit ein Kampf gegen den Glauben an die Normalität, den man Konservativismus nennt.
Die Grünen und die Woken verkünden nun das Ende der Normalität, also des Lebens, wie wir es bisher kannten. Was sie nicht verstehen, ist, dass man zwar fast alles ändern kann, aber nicht alles auf einmal. Um klar über eine Sache zu denken, muss man vieles als selbstverständlich akzeptieren. Man kann nicht ganz neu anfangen. Tabula rasa ist ein utopistischer Wahn. Es gibt immer nur das Anknüpfen und die Innovation. Dabei ist es wichtig, einzusehen, dass Veränderung nicht gleich Verbesserung ist und dass die Beweislast beim Veränderer liegt. Wir brauchen die Innovation als schöpferische Zerstörung – ja, aber immer nur unter Bewahrung der Normalität. Und es ist die Fähigkeit zur Rückkehr in die Normalität, die den Aktivisten heute fehlt.
Wie gesagt: Die Normalität des Alltagslebens, des Funktionierens und die Hintergrunderfüllungen des Alltags können langweilen. Der Alltag bedrückt dann als ewige Wiederkehr des Gleichen. Davon will man sich hin und wieder entlasten, also Distanz zum Alltag schaffen. Deshalb gibt es Sonntage, Spieltage und Festtage. Aber nur in einem normalen Leben kann man Rekorde, Exzellenzen und Feste feiern. Die Perversion dieser Entlastung ist der große Ausnahmezustand des Krieges, des Bürgerkrieges und der Kulturrevolution, wie wir sie heute erleben.
Die Krise der Normalität ist so alt wie die Moderne; doch heute hat sie eine perverse Form angenommen. Die Moderne wurde erst radikalisiert und nannte sich dann Postmoderne. In den letzten Jahrzehnten aber wurde sie pervertiert und nannte sich dann Wokeness. Sie hat eine ultrabrutale und eine hypersensible Seite. Die woken Taliban des Westens kämpfen gegen die abendländische Tradition. Sie zerstören Denkmäler, schreiben Geschichte um und feiern wahre Orgien der Umbenennung. Wokeness ist das Krankheitsbild der zerstörten Normalität. Wenn die verbindlichen Identifikationsstrukturen einer vertrauten Lebenswelt fehlen, wirken die Möglichkeiten freien Entscheidens auf viele verunsichernd, ja bedrohlich. Das äußert sich in politischem Infantilismus, aber zum Beispiel auch als Angst vor der Optionsvielfalt einer Speisekarte.
Ein radikaler Bruch mit dem 19. Jahrhundert hatte sich in der Kunst schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgezeichnet. So konstatiert der Sozialphilosoph und Kulturanthropologe Arnold Gehlen in seinem bedeutenden Werk »Zeit-Bilder«: »Während der Jahre 1905 bis 1910 hat man die künstlerischen Überlieferungen von 600 Jahren zerrissen und abgestreift, wie es scheint, für immer.« Was diesen radikalen Zeitbruch aber für alle Menschen zum einschneidenden Erlebnis machte, war das Trauma der Weltkriege. Gehlen meint zurecht, dass man die beiden Weltkriege »als einen einzigen Vorgang von dreißigjähriger Dauer sehen muss, und von diesem Vorgang müssen wir annehmen, dass er nie Vergangenheit, nie wirklich überlebt und überstanden werden wird. Sondern er hat sich unauslöschlich in das Bewusstsein der Menschen eingebrannt«. In die Alltagsroutinen jedes Einzelnen brachen Weltkrieg, Inflation und große Depression wie Naturkatastrophen ein.
Im Ersten Weltkrieg zerbrach der Stolz auf unsere europäische Kultur. Die kulturellen Sublimierungen bekamen Risse, und jeder erfuhr am eigenen Leib, dass Nietzsche recht hatte mit seinem Satz, Kultur sei nur das dünne Apfelhäutchen über glühendem Chaos. Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg war die bürgerliche Welt noch in Ordnung. Diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war die letzte, in der es noch generationenübergreifende Erfahrungszusammenhänge gab. Mit dem Ersten Weltkrieg endete die Zeit des ungebrochenen, selbstbewussten Bürgertums.
Der Verlust der Normalität hat also ein Datum: der Erste Weltkrieg. Er entwertete alle Erfahrungen. Die Basis der Gewissheiten brach zusammen, und man musste nun »leben, als ob nichts mehr selbstverständlich wäre; wer die Selbstverständlichkeit verloren hat, ist dazu verurteilt, sein Leben zu improvisieren«, so der Sozialpsychologe Manès Sperber in seinen Lebenserinnerungen. Der Philosoph Georg Simmel erlebte den Kriegsausbruch wie einen Weltuntergang und bemerkte, »dass das Deutschland, in dem wir geworden sind, was wir sind, versunken ist wie ein ausgeträumter Traum«.
Dieser Zeitbruch ist bekanntlich auch das Thema von Thomas Manns Roman »Der Zauberberg« – dargestellt am Schicksal eines bürgerlichen Anti-Helden. Zurecht bezeichnet man ja den Menschen als Gewohnheitstier. Und jede Gewohnheit wäre auch anders möglich, nicht aber die Gewohnheit, Gewohnheiten anzunehmen. Seit dem Ersten Weltkrieg verschärft sich nun aber der Verlust der Selbstverständlichkeiten, und die Gewohnheit, Gewohnheiten anzunehmen, spitzt sich zur Paradoxie zu. Hans Castorp, dieser Anti-Held aus Thomas Manns »Zauberberg«, muss sich daran gewöhnen, dass er sich nicht gewöhnt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann die skeptische Generation. Skepsis als Normalität – das hieß seither Tüchtigkeit aus Ernüchterung und Desillusionierung, Unverführbarkeit und Verblüffungsfestigkeit. Und der Begriff der Offenen Gesellschaft ist eng mit dieser Skepsis verknüpft, nämlich im Verzicht auf absolute Wahrheiten.
Man kann sich die Entwicklung der letzten hundert Jahre mit einem Schema verdeutlichen, das der amerikanische Sozialwissenschaftler Albert O. Hirschman entwickelt hat: Shifting Involvements. Die deutsche Übersetzung des gleichnamigen Buches trägt den Titel: Engagement und Enttäuschung. Das bringt ganz gut zum Ausdruck, dass die Menschen zwischen privaten Interessen und öffentlichem, politischem Handeln hin und her schwanken. Enttäuschungserfahrungen führen zum Wechsel zwischen Konsum und Protest. Hirschman geht dabei von der Normalität der Unzufriedenheit aus – deshalb konsumieren die Menschen, wenn sie ihr politisches Engagement enttäuscht, und sie protestieren, wenn sie der Konsum enttäuscht.
Konsumismus und Aktivismus sind demnach Lebensformen, die sich wie in einer Art Pendelbewegung historisch abwechseln. Auf die politisierte Jugend des Nationalsozialismus folgte die Ernüchterung durch den Zweiten Weltkrieg, nach dem eine skeptische Generation sich wieder auf die privaten Interessen besann und das Wirtschaftswunder schuf. Auf die politisierte Jugend der Achtundsechziger folgte die Ernüchterung durch den Terror der RAF. Das Pendel schlug nun wieder zum Konsumismus aus –Stichwort: Postmoderne. Und heute haben wir es erneut mit einer politisierten Jugend zu tun, die sich selbst als »woke« bezeichnet.
Uns bleibt die Hoffnung, dass nach der politischen Generation der Weltverbesserer wieder eine skeptische Generation kommt, die mit dem woken Spuk aufräumt. Das ist die Hoffnung auf eine Rückkehr aus den moralischen Exzessen und dem nihilistischen Selbstzweifel des Westens zur moralischen Normalität, die sich von selbst versteht.
Normalität ist eine Frage der Distanz, und zwar der richtigen Entfernung zur Wirklichkeit. Gerade dabei helfen uns weder die Medien noch die Wissenschaft. Denn die Wissenschaft arbeitet im Medium der Abstraktion – und deshalb bleibt sie unserer Lebenswirklichkeit zu fern; man spricht ja dann gerne vom »Elfenbeinturm«. Und die Medien arbeiten im Medium der Emotion – und damit sind sie unserer Lebenswirklichkeit zu nah; sie rücken uns buchstäblich auf den Leib. Nur durch die richtige Distanz kann man aber beurteilen, was wirklich wichtig ist. Die Medienwirklichkeit zwingt uns ständig zum Meinen und Urteilen, während Skepsis ja die Zurückhaltung des Urteils meint.
Die richtige Entfernung der Normalität erreicht man geistig durch Skepsis und seelisch durch Humor. Im Gegensatz zu allen Formen der Unterwerfung unter den Zeitgeist ist die skeptische Haltung charakterisiert durch Unverführbarkeit und Verblüffungsfestigkeit. Sie verfällt nicht dem Größenwahn des Absoluten und Prinzipiellen, sondern sorgt für Ernüchterung. Diese Haltung führt aber weder zu einem heillosen Relativismus, noch zu einer Nostalgie nach dem Absoluten, sondern zu einer skeptischen Philosophie der Endlichkeit. Dazu hat Thomas Mann eine gute Begriffsfamilie gebildet: »Freiheit, Gerechtigkeit, Behutsamkeit, Wissen, Güte und Form.« Und über den Zusammenhang von Skepsis und Bürgerlichkeit schreibt er einmal: »Der Zweifel steht am Ausgange des kulturell geschlossenen und geborgenen, autoritär christlichen Mittelalters; er steht am Eingange der Neuen Zeit, der Zeit der Aufklärung, die ein humanes Ideal, den anti-fanatischen und duldsamen, aber auch nicht mehr geistig geborgenen und gebundenen, sondern gelösten und individualistisch vereinzelten Menschen konzipierte. Dieser lockere, tolerante, zweiflerische und vereinzelte Mensch ist der Bürger«.
In der skeptischen Generation, die sich nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges herausbildete, hat der Soziologe Helmut Schelsky die Träger einer neuen Normalität des Alltags erkannt: »Diese Generation ist in ihrem sozialen Bewusstsein und Selbstbewusstsein kritischer, skeptischer, misstrauischer, glaubens- oder wenigstens illusionsloser als alle Jugendgenerationen vorher, sie ist tolerant, wenn man die Voraussetzung und Hinnahme eigener und fremder Schwächen als Toleranz bezeichnen will, sie ist ohne Pathos, Programme und Parolen. Diese geistige Ernüchterung macht frei zu einer für die Jugend ungewöhnlichen Lebenstüchtigkeit. Die Generation ist im privaten und sozialen Verhalten angepasster, wirklichkeitsnäher, zugriffsbereiter und erfolgssicherer als je eine Jugend vorher. Sie meistert das Leben in der Banalität, in der es sich dem Menschen stellt, und ist darauf stolz.«
Lass’ dich nicht verführen und verblüffen, bleibe nüchtern – das ist also der Rat des Skeptikers. Sehr gut passt hierzu auch ein Begriff des Philosophen Odo Marquard: Die merkende Vernunft ist die Fortsetzung des Lachens mit anderen Mitteln. Ähnlich wie die Ironie ist sie eine subversive Kraft, die offiziell Geltendes in seiner Nichtigkeit zeigt, und umgekehrt das, was offiziell als nichtig gilt, gelten lässt.
Humor ist die Distanz zu sich selbst – man kann über sich selbst lachen. Dazu gehört ein pessimistisch-realistisches Menschenbild, das das Menschlich-Allzumenschliche lachend akzeptiert. Skepsis und Humor schaffen Distanz und ermöglichen es, Spannungen zu ertragen, Widersprüche auszuhalten und Fragen offenzulassen. Der Humorist hat ein analytisches Vergnügen daran, beide Seiten des Streits zu sehen – fröhlich und ernsthaft zugleich. Der Philosoph Hans Blumenberg hat dazu einmal sehr schön gesagt: »Ein Kriterium für intellektuelle Gesundheit ist die Spannweite von Unvereinbarkeiten im Hinblick auf ein und dieselbe Sache, die ausgehalten wird und dazu noch Anreiz bietet, Gewinn aus der Beirrung zu ziehen.« Das ist die Befähigung des Skeptikers und Humoristen. Sie weist den Weg zurück zur Normalität.
Woran wird man also die neue skeptische Generation erkennen? Vor allem daran, dass sie wieder ein Maß für die Lebensführung gefunden hat. Ein Maß ist uns ja schicksalhaft vorgegeben: die eigene Endlichkeit. Und ein Maß müssen wir uns durch Lebenserfahrung erarbeiten: das Augenmaß. Normale Menschen sind kurzsichtig, was die Zukunft betrifft. An dem, was mit der Erde in ein paar hundert Jahren geschieht, hat man vielleicht ein intellektuelles Interesse, aber kein emotionales. Ganz anders steht es mit der eigenen Sterblichkeit. Ein endliches Wesen kann nur handeln, wenn es die Zukunft radikal »diskontiert«; das heißt, je weiter etwas in der Zukunft liegt, desto unwichtiger ist es – für einen selber. Meine Endlichkeit verpflichtet mich auf das, was Goethe die »Forderung des Tages« genannt hat: das Begrenzte, das Eingehegte, die Familie, die Freunde, die Heimat und nicht zuletzt den Beruf, der ja nach Nietzsche »das Rückgrat des Lebens« ist.
Der Endlichkeit und Vergänglichkeit verdankt das Leben seine Intensität. Alles wird nämlich durch Knappheit wertvoll – auch die eigene Lebenszeit. Es gibt also ein natürliches Maß, eben die Endlichkeit des eigenen Lebens. Daran bemisst sich, was wirklich wichtig ist. Man kann Kinder, Enkel und Urenkel haben – das ist die konkrete Grenze der Endlichkeit. Aber die Solidarität in der Zeit kann weit zurückreichen – in der Pietät gegenüber Eltern und Großeltern, aber auch in der geistigen Verbundenheit der Bildung mit Jerusalem, Athen und Rom. Zwischen dem zu Großen der Astronomie und dem zu Kleinen der Atomistik fand Sokrates das Maß des Menschen auf dem Marktplatz. In unserer Lebenswelt bleiben wir alle Ptolemäer.
Das Maß, das uns fehlt, ist das Augenmaß. Es ist konservativ und, wie Arnold Gehlen einmal so schön gesagt hat, »der einfachste Intelligenztest«. Eine prominente Stelle nimmt der Begriff in der Soziologie Max Webers ein. In seinem berühmten Vortrag über Politik als Beruf definiert er Augenmaß als »Fähigkeit, die Realitäten mit innerer Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu lassen« – und das bedeutet: Distanz zu den Dingen und Menschen, aber auch Distanz sich selbst gegenüber. Man könnte das Augenmaß auch einen durch Lebenserfahrung erarbeiteten gesunden Menschenverstand nennen. Entsprechend kann man Wokeness als eine Virusinfektion des gesunden Menschenverstandes definieren. Der derart erkrankte Menschenverstand ist dann immun gegen die Erfahrungen der Normalität unserer Alltagswelt. Denn nur Erfahrungen machen Erwartungen realistisch; und zwar die Erfahrungen des Einzelnen. Denn man muss dem eigenen gesunden Menschenverstand vertrauen, gerade um ihn dann im Detail in Frage stellen zu können. Dazu gehört mehr als alles andere der Mut zur Normalität.
Augenmaß war für Max Weber das entscheidende Kriterium für politische Urteilskraft. Und die kann nicht gelernt, sondern nur geübt werden. Im Kern geht es um Lebenserfahrung, und zwar in genauem Gegensatz zur planenden Vernunft der politisch-medialen Eliten. Das Politische ist auf den gesunden Menschenverstand bezogen, also auf die Perspektive des Bürgers, nicht die der Wissenschaftler oder gar der Journalisten. Mit anderen Worten: Der gesunde Menschenverstand hält die Welt zusammen. Die politisch-mediale Elite dagegen ist ein Produkt der Ausdifferenzierung und Autonomie des Politischen. Deshalb wird sie von den Bürgern als Parallelwelt erlebt – in Deutschland erstmals als »Raumschiff Bonn«.
Man muss zugeben: Im Augenblick spricht nicht viel für die Rückkehr aus den moralischen Exzessen und nihilistischen Selbstzweifeln des Westens zur moralischen Normalität, die sich von selbst versteht. Aber die große Versuchung besteht darin, die Partie verloren zu geben. Dieses Buch hat nicht den Titel »Verlust der Normalität«; es signalisiert also keinen Kulturpessimismus. Die Idee der Freiheit befreit aus der Lähmung der Resignation. Aber dazu muss man an sich selbst glauben.
Die Phänomene, die ich im Folgenden beschreibe, und die Sachverhalte, die ich analysiere, lassen sich überall in der westlichen Welt beobachten. Aber wir in Deutschland haben eine besonders günstige Beobachtungsposition. Warum ist das so? Um sich das klarzumachen, muss man sich vergegenwärtigen, dass die moderne Welt die Unterscheidung von gut und böse durch die Unterscheidung von fortschrittlich und reaktionär ersetzt hat. Seit aber Zweifel am Fortschritt aufgekommen sind, weiß der Westen nicht mehr, was er will, und er glaubt nicht mehr daran, zwischen richtig und falsch unterscheiden zu können. Diese Krise des Fortschrittsgedankens haben die Weltkriege ausgelöst. Und hier ist nun natürlich Deutschland als der Hauptverantwortliche idealtypisch.
Wir haben seither eine rein negative Identität. Und wir haben versucht, das als Befreiung zu interpretieren. Heute zeigt sich aber, dass es auf einzelmenschlicher Ebene die Befreiung zu einer Individualisierung ohne Maßstab war. Sie produziert Konformisten des Andersseins, die sich nicht an einem Maß und Standard, sondern lediglich am Zeitgeist orientieren. Und auch gesellschaftlich war es nach dem Zweiten Weltkrieg die Befreiung zu einer negativen Identität, d. h. zu einer Negation der nationalen Identität. So ist Deutschland heute eine Nichtnation im Kreis der Vereinten Nationen – die abnormale Nation.
Was sich unter Parolen wie »Diversity« und »Identitätspolitik« tatsächlich ereignet, ist eine Wiederkehr des Tribalismus. Nicht mehr das Individuum und die Familie stehen im Zentrum der Gesellschaft, sondern die Gruppe und der Stamm. Diese große tribalistische Spaltung zeigt sich am deutlichsten an der Vielfalt der »Echokammern«, in denen man nur noch Informationen und Meinungen aus der eigenen Gruppe erhält. »Diversity« ist also gerade nicht Diversität des Denkens, der Erfahrungen und Meinungen, sondern antipatriotische Propaganda. Vor allem wir in Deutschland haben längst unsere nationalen Identität preisgegeben und nehmen die Spaltung der Bevölkerung in Gruppen hin, die eine paternalistische Regierung dann besser kontrollieren kann.
Dabei hätte es durchaus Gründe für ein neues nationales Selbstbewusstsein gegeben. Man erinnere sich nur an das »Wirtschaftswunder« der 1950er- und 1960er-Jahre; im Fußball an das »Wunder von Bern«, das 1954 einer deutschen Nationalmannschaft gelang, die jetzt nur noch »Die Mannschaft« heißen darf. Man erinnere sich an die weltweit starke D-Mark, aber auch an die von den meisten kaum noch erhoffte, doch von mutigen Ostdeutschen erkämpfte Wiedervereinigung.
All das ging aber unter in Umerziehungsprogrammen, die mit der amerikanischen Re-education begannen und die jedes Nationalgefühl durch einen sterilen »Verfassungspatriotismus« ersetzen wollten. Wer fragt: »Was ist deutsch?«, bekommt seither die Antwort: »Nie wieder«. Alles politisch Gute ist »Anti«, vor allem natürlich der nachträgliche Antifaschismus, der gegen die Reinkarnationen Hitlers Widerstand leisten will. Er heißt jetzt »Kampf gegen rechts« und arbeitet vor allem an der »Brandmauer« gegen die AfD.
Psychologisch gestützt wird das durch einen Krisenstolz und Schuldkult, der sich bei vielen Deutschen bis zum Selbsthass gesteigert hat. Die ganze Welt wird zum Zeugen, wie sich die deutsche Politik an einer Wiedergutmachung des absolut Bösen durch das absolut Gute versucht. »No borders« ist die kindliche Utopie einer »Willkommenskultur«, die von der CDU-Kanzlerin Angela Merkel und der Bild-Zeitung ausgerufen und von der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP nahtlos fortgesetzt wurde. Von der verantwortlichen Ministerin Nancy Faeser stammt das Credo dieser deutschen Weltmeister des Guten: »Menschlichkeit kennt keine Obergrenze«.
Für den Bürger gibt es also keine Helden, keinen Stolz und keine Identifikation mit Deutschland mehr; und letztlich auch keine Möglichkeit mehr der Identifikation mit sich selbst. Dafür hat Thilo Sarrazin den schlagenden Buchtitel gefunden: »Deutschland schafft sich ab«. Das heißt im Klartext: Es gibt keinen Willen zur Selbstbehauptung mehr. Denn Selbstbehauptung hieße: Fortschritt, Wachstum, Technisierung, Industrialisierung, Maschinenbau.
Stattdessen stehen die Zeichen auf »Degrowth« und Desindustrialisierung. Man schaltet die Atomkraftwerke ab, erzwingt eine absurde »Energiewende« und überzieht unsere alltägliche Lebenswelt mit Verboten und Tabus. Mit dem Thema dieses Buches sind wir also am richtigen Ort. Nirgendwo auf der Welt braucht man mehr Mut zur Normalität als in Deutschland.
»Auch in der intellektuellen Entwicklung war Zerstörung vielleicht das wichtigste Kapital – Zerstörung im Sinne der Unnennbarkeit spezifisch deutscher Traditionen.« Dieser Satz findet sich in einem Nachruf auf die Bundesrepublik, den der Soziologe Niklas Luhmann am 22. August 1990 in der FAZ veröffentlicht hat. Zerstörung als Kapital – damit ist zunächst einmal natürlich das »Wirtschaftswunder« gemeint, der phönixhafte Aufstieg der Wirtschaftsmacht Deutschland aus der Asche des Zweiten Weltkriegs. Luhmann überträgt dieses Bild nun auf die geistige Entwicklung der Bundesrepublik. Auch intellektuell liege in der Zerstörung die große Chance der historischen Diskontinuität, aus den Stereotypen des Denkens auszubrechen und etwas anderes anzufangen.
Diese Chance ist bekanntlich nicht genutzt worden. Das hätte nämlich vorausgesetzt, dass man sich auf die konkrete Lage hier und jetzt konzentriert. Stattdessen hat die geistige Orientierungslosigkeit zu einem Zerfall der intellektuellen Szene in Utopie und Nostalgie geführt. Zum einen die sehnsuchtsvolle Rückerinnerung an die scheinbar heile Zeit zwischen 1850 und 1914 bei den Traditionalisten – politisch völlig folgenlos. Zum anderen die Füllung des ideologischen Vakuums nach dem Untergang des Marxismus durch Ersatzreligionen. Denn wohlgemerkt: Für eine Gesellschaft gibt es keinen Religionsersatz, sondern immer nur Ersatzreligionen – für uns heute: die Grünen und die Woken. Dass die Wokeness ähnlich wie der grüne Fundamentalismus als Ersatzreligion funktioniert, erkennt man daran, dass es wieder Inquisitoren und Sünder, Beichten und Bußrituale gibt – und natürlich harte Strafen für die Ungläubigen und Häretiker. Auch eine neue Erbsünde hat man an den Universitäten der westlichen Welt erfunden: den strukturellen, systemischen Rassismus des weißen Mannes.
Die moderne Gesellschaft produziert immer weniger bürgerliche Normalität und immer mehr freischwebende Intellektualität. Tendenziell geht heute jeder Schüler aufs Gymnasium und jeder Abiturient auf die Universität. So entstehen Intellektuelle als Massenware. Und da man nicht alle in den Bildungsanstalten und Akademien brauchen kann, entsteht auch ein geistiges Proletariat. Gleichzeitig wird das Gehirn durch Computer, Internet und Künstliche Intelligenz immer mehr von realen Aufgaben entlastet und kann »luxurieren«. Deshalb ist es nicht erstaunlich, dass sich die akademischen Freizeitgehirne vom Realitätsprinzip gelöst haben. Sie werden für den realen Lebensprozess genauso wenig gebraucht wie die Langzeitarbeitslosen. Politisch aber ist diese akademische Weltfremdheit folgenreich, nämlich in den Formen des Protests, der immer wieder neue Varianten des berühmten Spruchs der Pariser Achtundsechziger hervorbringt: »Die Phantasie an die Macht«.
Jeder normale Mensch, der sich seinen gesunden Menschenverstand und einen nüchternen Blick auf die Wirklichkeit bewahrt hat, wird diese Beobachtungen bestätigen. Aber sie sollten uns nicht zum Pessimismus im Stile des »Untergangs des Abendlandes« verführen. Im Augenblick sehen wir nur die Zeichen der Dekadenz, aber am Ende wird die Wokeness die Provokation gewesen sein, die zu einer Wiedergeburt der Bürgerlichkeit geführt hat. Dazu brauchen wir eigentlich nur den Mut zur Normalität.
***
Die Anregung, ein Buch zum Lob der Normalität zu schreiben, verdanke ich Gesprächen mit Herrn Raap vom Langen Müller Verlag. Herr Raap war der Meinung, ein solches Buch könnte konsequent die Argumentation von »Der alte weiße Mann« fortführen. Natürlich bin ich auf das Thema Normalität schon früher gestoßen, zuletzt durch Hans Martin Essers »Die große Klammer. Eine Theorie der Normalität« und Birgit Kelles »Noch normal – das lässt sich gendern«. Während Herr Esser das Thema philosophisch anspruchsvoll abstrahiert und Frau Kelle mit wunderbar humorvoller, leichter Feder ein Zeitgeistportrait skizziert, hält sich das vorliegende Buch in der Mitte – in der Mitte der Normalität. Es soll Mut zur Normalität machen – im Sinne von Gilbert Keith Chestertons »ecstasy of being ordinary«, also dem Hochgefühl, ein ganz normaler Mensch zu sein. Und es ist getragen von der Hoffnung auf eine neue skeptische Generation, die mit dem woken Spuk aufräumt.
2. Wokeness und Fundamentalismus
Unsere Welt dröhnt von Alarmsignalen, Hilferufen und Wutschreien. Da ist der Terror des islamischen Fundamentalismus, den einige Zeitgeistexperten als die Rache Gottes an der atheistischen Wohlstandsgesellschaft deuten. Da ist die Klimakrise, die vom grünen Gaia-Kult als Rache der Natur am Kapitalismus interpretiert wird. Da ist die Massenmigration, bei der sich Asylsuchende und Wirtschaftsflüchtlinge nicht mehr unterscheiden lassen und die jetzt auch als politische Waffe genutzt wird.
Gleichzeitig tobt der Wahnsinn von innen. Unsere Gesellschaft ist toleranter, frauen- und minderheitenfreundlicher denn je. Aber fanatische Aktivisten werfen ihr Sexismus und Rassismus vor. So zerstört sich die Aufklärung selbst. Auf ihrem Höhepunkt, in der Vorrede zur »Morgenröte«, gab Nietzsche die Parole aus, »das alte Vertrauen« zur Moral »zu untersuchen und anzugraben«. Und dabei sollte der Aufklärer keine Angst haben, »sich selbst zu verneinen«. Doch diese große europäische Tugend der Selbstkritik ist bei den Woken zu einem Bußkrampf pervertiert.
Wokeness ist der aktuelle polemische Gegenbegriff zu bürgerlicher Normalität. Er harmoniert sehr gut mit Sozialismus und Umweltbewusstsein. Sozialistisch, grün und woke sind die drei Varianten der westlichen Ersatzreligion, die das Vakuum ausfüllen, das der Niedergang des Christentums und der Untergang des Marxismus hinterlassen haben. Sie sind sich gleich in ihrer fanatischen Gewissheit gegen den Augenschein. Und es ist dieser religiöse Fanatismus, der erklärt, warum Wokeness und rot-grüner Menschenrechtsfundamentalismus sich dem islamischen Fundamentalismus anbiedern – trotz schärfster inhaltlicher Unvereinbarkeiten. Man denke nur an die Demonstrationsparole »Queers for Palestine« oder an Greta Thunberg, die Ikone der Klima-Apokalyptiker, die sich als glühende Antisemitin entpuppt hat.
Wir befinden uns damit im Endstadium des europäischen Nihilismus. Die rot-grün-woke Welt des Westens betreibt ihren Verrat an der Moderne mit einer klaren Agenda. Zunächst geht es um die Zerstörung der Geschlechtsrollen der klassischen Familie. Dazu dient vor allem auch die Dämonisierung der Männlichkeit als »toxisch«. Die schon vor hundert Jahren von Oswald Spengler diagnostizierte Unfruchtbarkeit des Westens fügt sich fatal zur Massenmigration außerordentlich fruchtbarer Muslime – und das wird hierzulande von vielen »Progressiven« als Ausdünnung der Deutschen gefeiert. Dem entspricht präzise die Aushöhlung der christlichen Kultur zu einer Zivilreligion ohne Glauben, gewissermaßen zu einem Christentum ohne Christenheit. Man muss hier aber erkennen, dass dies in der Logik der Moderne selbst liegt. Denn Freiheit als europäischer Lebensstil setzt das Ende der Großideologien und damit eben auch das Schrumpfen des Christentums zur Zivilreligion voraus. Doch religiös würde Normalität eben immer noch bedeuten: christliche Leitkultur. Dass wir uns dazu unter dem Druck der woken Kulturrevolutionäre nicht mehr offen zu bekennen wagen, fügt sich wiederum fatal zu politischen Tendenzen einer fortschreitenden Unterwerfung unter den Islam.
Besonders krass ist die woke Indoktrination in den Bildungsanstalten, die den »alten weißen Mann« auf die Anklagebank der Weltgeschichte setzen. Zum einen geht es hier um einen wütenden Kampf gegen die westliche Tradition. Arnold Gehlen hat schon vor 50 Jahren vom »rasenden Potlatsch der Selbstzerstörung des Bewährten und Leistungsfähigen« gesprochen. Heute schreiben die woken Taliban des Westens Geschichte und Geschichten um, sie feiern wahre Orgien der Umbenennung und schrecken selbst vor der Zerstörung von Denkmälern nicht zurück. Mit ihrer sogenannten »Identitätspolitik« ersetzen sie Selbstbewusstsein durch ein aggressives Selbstmitleid. Man schmückt sich jetzt mit dem Satz: Ich bin ein Opfer. Die Wokeness hat aus dem Opferstatus eine Auszeichnung gemacht.
Woke ist ein Kürzel für »stay awake«. Er bedeutet also ursprünglich »wachsam sein«, nämlich angesichts scheinbar wachsender Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Sehr rasch hat sich dann aber herausgestellt, welches Potential an Aggressivität in der Opferrolle steckt. Mit pseudoakademischen Begriffen wie »Mikroaggression« und »Intersektionalität« hat man kleinste Taktlosigkeiten zu unerträglichen Verletzungen aufgebauscht und einen Wettbewerb der unterdrückten Minderheiten inszeniert. Was sie eint, ist die Unterdrückung durch das »Patriarchat« und das »weiße Privileg«.
Der wichtigste Hebel dieser Kulturrevolution ist eine Sprachpolitik, die die Politische Korrektheit ja schon früh als Waffe gegen die Normalität eingesetzt hat. Mit dem »Gendern« macht man die Muttersprache unsprechbar, und mit dem Vorwurf »Hassrede« macht man jede abweichende Meinung zum Skandal. Das soll in jedem Fall den Effekt haben, dass normale Menschen nicht mehr wissen, wie man richtig spricht. Und damit wird auch das ästhetische Urteil über schön und hässlich unmöglich gemacht. Dafür gibt es das woke Zauberwort »body positive«. Zu Deutsch: Fett sein wird normalisiert.
Die entscheidenden Glaubensartikel dieser Kulturrevolution lassen sich sehr genau definieren: Alle Lebensstile sind gleichrangig. Einen alternativen Lebensstil zu diskriminieren, ist ein Verbrechen. Wer gegen die Gleichstellungspolitik ist, ist ein Rassist, Fremdenfeind und Sexist. Und vor allem: Keine Kultur ist einer anderen überlegen. In Wahrheit weiß aber jeder: Es gibt Dinge, die besser sind als andere. Es gibt Kulturen, die fortschrittlicher und humaner sind als andere. Und es gibt Menschen, die anderen überlegen sind. Für die Wokeness ist das ein Skandal, auf den sie mit einem scharfen Ressentiment zunächst gegen Meisterschaft und Autorität, dann gegen Kanon und Elite und schließlich gegen Erfolg und Leistung reagiert.
Man muss sich fragen, was an diesem Angebot vor allem für junge Leute attraktiv ist. Offenbar hängt es damit zusammen, dass die Komplexität und die Veränderungsgeschwindigkeit der modernen Gesellschaft Ungewissheit und Unsicherheit erzeugen. Und darauf reagieren unreife junge Menschen mit einer emotionalen Hypersensibilität. Man könnte auch sagen: Sie lernen es, sich hilflos zu fühlen; sie erliegen der Versuchung der Hilflosigkeit. Und die Betreuer nehmen sich dieser empfindsamen Seelen gerne an.
So ist allmählich eine Art sanfter Wahnsinn gesellschaftsfähig geworden. Man denke nur an die Tabus und Verbote der Politischen Korrektheit, an die gepflegte Hysterie in allen Umweltfragen und an die Überempfindlichkeit der Schneeflocken-Generation. Dass bei den Veganern Essen zur Religion geworden ist, oder dass man den Frauen der westlichen Welt nahelegt, weniger Kinder zu bekommen, um den »ökologischen Fußabdruck« zu vermindern, erstaunt heute kaum mehr jemanden. Im Klartext bedeutet das, dass Hysteriker nicht mehr psychoanalytisch behandelt, sondern politisch geadelt werden. So verlangt jeder Wahn heute Respekt. Und deshalb sind Panik und Hysterie die Charakteristika unserer Zeit – ein extremes Übermaß an Ängstlichkeit und Empfindlichkeit.
Das 21. Jahrhundert hat also als Zeitalter der emotionalen Inkontinenz begonnen: Die Wahrheit muss verletzten Gefühlen weichen. Die Welt dreht sich nun um winzige Minderheiten. Die Veganer bilden in unserer Gesellschaft eine Minderheit; die überempfindlichen »Schneeflocken« an den Universitäten sind eine sehr kleine Minderheit. Und diejenigen, die tatsächlich meinen, dass man viele Geschlechter anerkennen muss, weil sie sich weder als Mann noch als Frau fühlen, bilden eine verschwindend kleine Minderheit. Aber ihre Stärke liegt darin, dass sie lautstark, aggressiv und intolerant sind, während die Mehrheit der normalen Bürger die Ansprüche dieser Minderheiten toleriert oder schweigt.
Der größtmögliche Gegensatz zur bürgerlichen Lebensführung besteht in der Form von Selbstverwirklichung, die jetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz der Ampel-Regierung zur neuen Normalität erklärt worden ist. Sie schließt an jene Glücksrezepte an, die der österreichisch-amerikanische Psychotherapeut Paul Watzlawick »Anleitungen zum Unglücklichsein« genannt hat. Ob Tierschützer, Zeuge Jehovas, Vegetarier, Streetworker oder Transfrau – unsere westliche Zivilisation darf sich deshalb freie Welt nennen, weil hier jeder seines eigenen Unglücks Schmied sein darf.
Unsere Kultur ermöglicht also jedem die Wahl seiner Eigenformel in einer Art spirituellem Selbstbedienungsladen. Jede Identität hat ja die Form einer Geschichte, und da liegt es auf der Hand, die Geschichte nicht nur nachzuerzählen, sondern gleich zu erfinden. Was die Amerikaner »self-fashioning« nennen, meint diese Ästhetik der Existenz. Das Leben inszeniert sich selbst und erfindet seine Identität neu. Ich bin, aber ich will nicht so sein wie ich bin – deshalb erfinde ich mich. Ich bin, aber ich will mich loswerden – deshalb inszeniere ich mich anders. Das passt natürlich sehr gut in eine Medienwirklichkeit, die uns an virtuelle Realitäten gewöhnt hat. Sie suggerieren uns eben: Wir haben mehr als eine Welt und mehr als eine Identität. Fiktionen werden bewohnbar. Insofern ist das Selbstbestimmungsgesetz virtuelle Realität als Politik.
Man könnte von einer Theatralisierung des Alltags sprechen – die geringste Verrichtung wird zum Schauplatz der Selbstdarstellung. Und ich vermute, dass diese Theatralisierung die bisherige Ideologisierung des Alltags ablöst. Nach dem endgültigen Schiffbruch der politischen Utopien setzt unsere Kultur resolut auf Ästhetik. Hier gilt der Satz des Philosophen Hans Blumenberg: »Nur ästhetisch lässt sich der Wunsch erfüllen, nicht so zu sein, wie man ist.« Man kann es auch so sagen: Nach der marxistischen »Erlösung durch Gesellschaft« kommt jetzt die woke Selbsterlösung durch Self-Fashioning.
Den Verantwortlichen wird gar nicht klar gewesen sein, dass sie mit dem Selbstbestimmungsgesetz eine bestimmte Philosophie in Politik umgesetzt haben. Und zwar handelt es sich um Jean-Paul Sartres Existenzialismus. Er trägt deutlich die Spuren der Null-Punkt-Situation nach dem Zweiten Weltkrieg: Der Mensch ist in eine ihm fremde Welt geworfen und dazu verurteilt, frei zu sein. Er bricht mit der Welt und mit sich selbst, um sich auf eigene Möglichkeiten zu entwerfen. Und das ist der entscheidende Punkt in dieser Tabula-rasa-Philosophie: Freiheit wird verstanden als absolute Wahl der Selbstbestimmung.
Konkret handelt es sich dann im Selbstbestimmungsgesetz um die absolute Geschlechtswahl. Das lässt sich aber nur ästhetisch realisieren, nämlich in theatralischen Selbstinszenierungen. Das Selbstbestimmungsgesetz ist eine politische Ästhetisierung der Wirklichkeit. Aber wenn der Theatervorhang fällt, bleibt von der woken Selbstbestimmung nur die verzweifelte Revolte gegen sich selbst. Man kann nicht einfach abwählen, was man zufällig ist. Die Geschichte, die man hat, und die Welt, in die man geworfen ist, kann man sich nicht aussuchen. Wokeness aber kennt nur den Entwurf, die freie Wahl, nicht die Geworfenheit. Ihre Selbstbestimmung ist nur eine theatralische Selbstdarstellung, die die Biologie als Schicksal leugnet.
Die wohl allgemein geteilte Kritik am Selbstbestimmungsgesetz ist aber keine Kritik der Idee der Selbstbestimmung. Das bürgerliche Individuum des 18. und 19. Jahrhunderts stand nicht im Gegensatz zum gesellschaftlichen Allgemeinen, sondern verwirklichte in sich das individuelle Allgemeine; es gab sich selbst das Gesetz. Das ist der größtmögliche Gegensatz zur heutigen Individualisierung ohne Maßstab, die gerade in dem Versuch, anders zu sein als die anderen, einen öden Konformismus des Andersseins produziert. Die alltagssprachliche Formel, in der sich dieser naive Positivismus der kriterienlosen Selbstbestimmung ausspricht, lautet: Das ist nicht so mein Ding. Diese Eigenrichtigkeit des woken Individuums ist die des Idioten im Wortsinne.
Bürgerliche Selbstbestimmung dagegen ist untrennbar vom Begriff der Lebensführung. In der Entscheidung, wie man sein Leben führt, sind alle anderen Entscheidungen schon eingeschlossen. Das setzt aber eine Kultur der Innensteuerung in einer außengesteuerten Welt voraus. Das sind alte, aber immer noch unübertroffene Begriffe des amerikanischen Soziologen David Riesman. Mit »inner-directed« meinte er Selbstdisziplin und Selbstmotivation. Ein solcher innengesteuerter Bürger ist kein Traditionalist mehr, aber er lässt sich eben auch nicht mehr von den Peer-Groups und den Massenmedien manipulieren. Für die Woken dagegen sind diese Signale der anderen das Maß aller Dinge.
Ich habe gerade von der rot-grün-woken Welt des Westens gesprochen. Damit ist auch gemeint, dass die Wokeness nicht aus dem Nichts entsprungen ist. Wie man vor allem an Bewegungen wie Fridays for Future und Letzte Generation sehen kann, haben die Woken eine grüne Vorgeschichte. Und die Grünen ihrerseits haben ja die Lücke gefüllt, die der Untergang des Marxismus gerissen hat.
Auch hier haben wir als Deutsche eine besonders gute Beobachtungsposition. Denn jede vernünftige Diskussion müsste mit der Sonderstellung der deutschen Angst beginnen. Erinnern wir uns an den bösen Unfall Tschernobyl. In Deutschland herrschte Panik, während dieser Fast-GAU für unsere unmittelbaren Nachbarn fast nicht stattgefunden hat. Deutschland hat als Katastrophe definiert, was die anderen eher als Betriebsunfall betrachtet haben. Nach Tschernobyl ging in Freiburg die Welt unter, während wenige Kilometer weiter, hinter der französischen Grenze, das Leben seinen gewohnten Lauf nahm. Und auch die deutsche Reaktion auf Fukushima war singulär.
So wie in den 1960er- und 1970er-Jahren revolutionäres Klassenbewusstsein produziert wurde, wurde seither apokalyptisches Umweltbewusstsein produziert – die Bewusstseinsindustrie hat von Rot auf Grün umgestellt. Statt das Heil der klassenlosen Gesellschaft erwartet man nun das Unheil der Klimakatastrophe. Was die alte rote Utopie und die neue grüne Dystopie jedoch miteinander verbindet, ist das, was der Philosoph Odo Marquard den »Heißhunger nach dem Ausnahmezustand« genannt hat.
Die apokalyptische Drohung produziert die Sorge um das Heil. Deshalb tritt man der Sekte bei, klebt sich an Straßen, um die Menschen zur Umkehr zu zwingen, befreit die Hühner aus den Legebatterien, schwänzt die Schule, um die Erde zu retten, oder trennt doch wenigstens den Hausmüll. Vor allem Deutschland ist dem Taumel einer grünen Bußbewegung verfallen. Das Unheil kann ja jederzeit hereinbrechen, und weil es absolut aktuell ist, muss sich jeder fragen, was jetzt zu tun ist, um es abzuwenden. Wenn aber das Ende unmittelbar bevorsteht, ist alles andere gleichgültig.
Die Theologie des Weltuntergangs ist durch die Ökologie des Weltuntergangsersetzt worden. Statt »Was darf ich hoffen?« fragt die heutige Religiosität »Was muss ich fürchten?« So hat sich in der westlichen Welt eine Ökumene der Ängstlichen formiert, die Schützenhilfe von Gefälligkeitswissenschaftlern bekommt. Das läuft dann so: Am Anfang steht die Erfindung einer Krise; die Krise begründet die Notwendigkeit der Forschung; die Bedeutsamkeit dieser Forschung legitimiert ihre staatliche Finanzierung; die Forschung im »öffentlichen Interesse« braucht eine politische Organisation – und dort findet man immer, was man erwartet. Und immer ist es fünf vor zwölf.
Seit dem Fall der Berliner Mauer beobachten Medienwissenschaftler eine Inflation der Katastrophenrhetorik. Offenbar hat das Ende des Kalten Krieges ein Vakuum der Angst geschaffen, das seither professionell aufgefüllt wird. Man könnte geradezu von einer Industrie der Angst sprechen. Politiker, Anwälte und Medien leben ja sehr gut von der Angst. Und eine ständig wachsende Anzahl von Gefälligkeitswissenschaftlern nutzt die Universitäten als eine Art Zulieferindustrie. Im Klartext: Gefälligkeitswissenschaftler produzieren Gefahrenszenarios. Diese wiederum befeuern die Angstindustrie der Medien. Und das gibt den Politikern die Gelegenheit, zu warnen, zu mahnen und zu retten.
Wenn es nach den Alarmisten von heute geht, ist es längst nicht mehr nur fünf vor zwölf. Die seit 1947 von Atomwissenschaftlern immer wieder neu eingestellte »Weltuntergangsuhr«, die der Weltöffentlichkeit das Risiko einer globalen Katastrophe verdeutlichen soll, steht jetzt auf 90 Sekunden vor Mitternacht. Auch die Nobelpreisreputation einiger Wissenschaftler ändert nichts an der Albernheit dieser Veranstaltung. Es handelt sich hier um eine Verschmutzung der Wissenschaft durch Politik. Und die macht eine vernünftige Debatte über die großen Angstthemen wie Klimawandel und Massenmigration, Corona und Atomkrieg unmöglich. Man könnte von einer globalen Erwärmung des Meinungsklimas reden. Sie fördert Irrationalismen und Panikreaktionen.