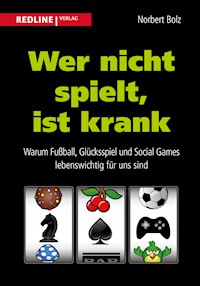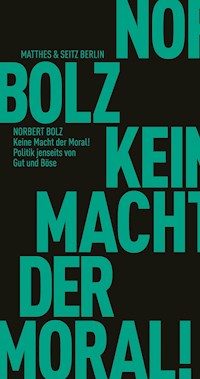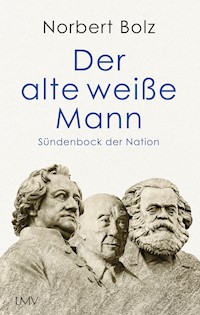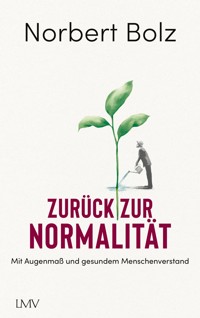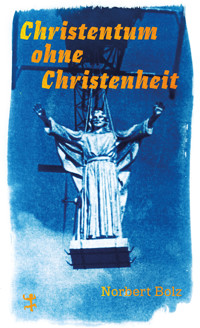
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Gottestod als Ärgernis: In einem tiefgründigen Essay geht Norbert Bolz der »Erfindung« des Christentums nach, das erst durch Paulus und dessen radikalem »Wort vom Kreuz« seine weltgeschichtliche Gestalt gefunden hat. Dieser paulinischen Erfindung verdankt die moderne Gesellschaft ihre Entstehung, das Christentum hat die Säkularisationsgeschichte selbst in Gang gesetzt – und damit die eigene Dekonstruktion. Norbert Bolz folgt der Entzauberung der Welt durch die Wissenschaften und die Verweltlichung der christlichen Glaubensüberzeugungen, um schließlich die »Pervertierung des Christentums« zu konstatieren: Dessen Niedergang wird durch den Versuch besiegelt, sich an den Zeitgeist anzupassen, indem Dogma und Orthodoxie preisgegeben und auf naive Weise theologische Politik betrieben wird. Doch »wer das Christentum glaubt, verteidigen zu müssen, hat nie an Jesus Christus geglaubt«. Folgerichtig verteidigt Bolz das Christentum nicht gegen die Lebenspraxis der Christenheit, sein theologisches Nachdenken über das Christentum rehabilitiert zuallererst dessen ursprüngliche Kraft, die jedes Wertesystem herausfordert – und umkehrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Theologische Brocken 006
Norbert Bolz
Christentumohne Christenheit
Inhalt
Einleitung
Die Erfindung des Christentums
Der Probelauf der Moderne
Spekulativer Karfreitag – Exkurs über ein Christentum ohne Happy End
Die Säkularisierung des Christentums
Die Pervertierung des Christentums
Die Aufklärung der Aufklärung
Literatur
Die Grundsätze der Philosophie zu überschreiten heißt glauben; demnach ist die Philosophie, als Denken über die Kultur, mit der Sorge um die Untersuchung des Sinns eines jeden Glaubens beauftragt.
Leszek Kołakowski
Jedes neue Durchdenken des Christentums muss davon ausgehen, dass es als »absolute Religion« der modernen Zivilisation fremd, von ihr nicht assimilierbar ist. Aber gerade deshalb hat die moderne Welt es nötig.
Robert Spaemann
Wenn wir im Westen noch nicht einmal die moralischen Tiefen unserer eigenen Tradition verstehen, wie sollen wir dann Einfluss auf den Diskurs der Menschheit nehmen können?
Larry Siedentop
Könnte es aber nicht sein, dass in der Theologie eine gewisse Vereinfachung längst überfällig wäre?
Peter L. Berger
Einleitung
Bücher haben ihr eigenes Schicksal, lautet ein Satz der Spätantike. Gemeint war damit, dass ihre Wirkung vor allem von der Rezeptionsfähigkeit der Leser abhängt. Heute würde man eher an Marketing und Werbung denken. Aber natürlich hat auch der Autor die Chance, dem Erfolg seines Buches auf die Sprünge zu helfen. Schon der erste Satz kann entscheiden. Eine wesentliche Rolle spielen der prägnante Titel und Kapitelüberschriften wie diese: »Die Erfindung des Christentums«, »Die Säkularisierung des Christentums«, »Die Pervertierung des Christentums«. Sie stellen die Kurzform von Thesen dar, die hoch kontrovers sind. Allen drei Thesen wird natürlich heftig widersprochen werden. Dieses Buch bietet ihre Verteidigung.
Das Kapitel »Die Erfindung des Christentums« entwickelt die These, dass man den Geist des Christentums nicht aus dem »Leben Jesu« und den Evangelien heraus verstehen kann, sondern dass er die Leistung des Juden Saulus aus Tarsus war, der sich dann Paulus nannte. Dieser These werden nicht nur die Theologen widersprechen, sondern vor allem auch die Gläubigen, die mit dem guten Menschen Jesus sehr viel mehr anfangen können als mit dem »Wort vom Kreuz«.
Das Kapitel »Die Säkularisierung des Christentums« entwickelt die These, dass das, was die westliche Welt auch heute noch im Innersten zusammenhält, Verweltlichungen christlicher Glaubensüberzeugungen sind. Der letzte bedeutende deutsche Philosoph, Hans Blumenberg, hat dieser These scharf widersprochen, weil er durch sie die »Legitimität der Neuzeit« und ihre Kraft zur Selbstbehauptung und Selbstbegründung infrage gestellt sah. Der Begriff der Säkularisierung, den wir im Folgenden verwenden, ist dagegen unpolemisch und rein deskriptiv. Er liegt sehr nahe an Max Webers romantischem Begriff der Entzauberung der Welt, der im spröden Jargon der Soziologen heute funktionale Ausdifferenzierung heißt.
Das Kapitel »Die Pervertierung des Christentums« entwickelt schließlich die These, dass der Niedergang der christlichen Kirchen in der westlichen Welt seinen wesentlichen Grund darin hat, dass sie verzweifelt versuchen, sich an den Zeitgeist anzupassen, indem sie einerseits Dogma und Orthodoxie preisgeben und andererseits auf naivste Weise theologische Politik betreiben. An dieser These halten wir fest, obwohl der bedeutende Sozialwissenschaftler Albert O. Hirschman »Perversität« als einen der Grundbegriffe reaktionärer Rhetorik entlarvt hat. Denn in der Frage nach dem modernen Schicksal des Christentums behalten die »Reaktionäre« gegen die »Progressiven« recht. Den Zusammenhang zwischen jener Säkularisierung und dieser Pervertierung des Christentums hat der stolze Reaktionär Nicolás Gómez Dávila auf eine einfache Formel gebracht: »Es ist heute leichter, christliche Verhaltensweisen zu finden als christliche Seelen.« Das hat man bereits vor über 200 Jahren bemerkt, aber weniger zynisch akzentuiert. In seinen Vorlesungen über die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters unterscheidet schon Johann Gottlieb Fichte zwischen allgemein anerkannter Religion und lebensweltlicher Religiosität. Und die Charakterisierung seiner Gegenwart durch drei Merkmale klingt außerordentlich aktuell: Die christlichen Kirchen sind in der Krise, der Aberglaube ist durch die Aufklärung erledigt, doch zugleich sind die Bürger auch des freigeisterischen Geschwätzes müde. Gerade vor diesem Hintergrund aber hebt sich der religiöse Kernbestand des bürgerlichen Lebens ab: »Es lässt sich als unwidersprechlicher Grundsatz aufstellen; wo noch gute Sitten sind, und Tugenden, Verträglichkeit, Menschenliebe, Mitleid, Wohltätigkeit, häusliche Zucht und Ordnung, Treue und sich aufopfernde Anhänglichkeit der Gatten gegeneinander, und der Eltern und Kinder, – da ist noch Religion, ob man es nun wisse, oder nicht.«
Dass die moderne Gesellschaft ihre Entstehung vor allem auch der christlichen Religion verdankt, ja dass der Zivilisationsprozess insgesamt religiöse Wurzeln hat, ist im Anschluss an Max Weber vielfach diskutiert worden. Und tatsächlich drängt sich dem unbefangenen Beobachter der Zusammenhang von Mission, Kolonisation und Zivilisation immer wieder auf, wenn man von den Grenzbegriffen der Wirklichkeitserfahrung ausgeht, die der polnische Philosoph Leszek KoBakowski und Hans Blumenberg so eindrucksvoll herausgearbeitet haben: die »Gleichgültigkeit der Welt« und der »Absolutismus der Wirklichkeit«. Gemeint ist jeweils, dass der Mensch die Welt ursprünglich als fremd und feindselig erfährt – als etwas, das er auf Distanz halten und mit dem er unter größten Anstrengungen fertig werden muss. Das zwingt ihn zu zwei fundamentalen Leistungen, nämlich einmal zum Mythos, der Werte kreiert, mit denen sich die Welt verstehen lässt, und zum anderen zur Technik, die ihm zur Herrschaft über die Welt verhilft.
Diese beiden Ur-Leistungen des Menschen, der Mythos und die Technik, treten dann allmählich auseinander und schließlich zueinander in Gegensatz. Hier liegt der Ursprung dessen, was wir Aufklärung nennen. Ihre Ultrakurzgeschichte lautet: Es sind gerade die monotheistischen Religionen, die in ihrem Kampf gegen Magie und Animismus den ersten entscheidenden Schritt tun. Doch nach der Konsolidierung der Religion zum gesellschaftlichen System wird sie selbst Gegenstand der Aufklärung, welche das Wissen gegen den Glauben setzt. Ein Säkularisierungstheoretiker könnte sagen: Wissenschaft ersetzt die potestas spiritualis des christlichen Mittelalters. Da ist es nur konsequent, dass schließlich die Wissenschaft, die die Welt entzaubert und die Religion entthront hat, selbst entzaubert wird – das modische Stichwort dafür lautet: Dekonstruktion.
Und nun? Wird die offenbar unaufhebbare Ungewissheit in der Wissenschaft zu einer Renaissance des Glaubens führen? Behält der Kulturphilosoph Oswald Spengler mit seiner Prognose einer »zweiten Religiosität« recht? Wir können zunächst einmal nur festhalten, dass das Christentum als historische Offenbarungsreligion im Spannungsfeld von Wissenschaft, Philosophie und Politik, Atheismus und anderen Religionen steht. Als Zivilreligion ist sie nur noch eine Religion ohne Glauben. In den zahlreichen Formen einer Ersatzreligion, die das Heilige als freischwebenden Gefühlswert kultivieren, haben wir es mit zahlreichen anderen religiösen Erfahrungen ohne religiösen Glauben zu tun. Und in unseren obersten Kulturwerten, aber auch in der Esoterik einer Intellektuellentheologie tritt uns ein Christentum ohne Christenheit gegenüber.
Es gibt aber ein starkes Argument gegen die These, dass die christlichen Kirchen vor dem Untergang stehen. Es ist ein Argument aus der Geschichte, das der britische Schriftsteller Gilbert Keith Chesterton am prägnantesten formuliert hat. Das Christentum ist nämlich auch eine Geschichte der unerwarteten Wiedergeburten. Es hat den Untergang Roms, die Herausforderung durch den Islam, die Krise der Reformation, die Aufklärung und den Darwinismus überlebt – oder genauer, christlicher und wiederum mit Chesterton gesagt: Das Christentum ist fünf Mal gestorben, und fünf Mal hat es wieder seinen Weg aus dem Grab heraus gefunden. Nicht nur Christus, sondern auch das Christentum ist wiederauferstanden von den Toten. In diesem Sinne ist die These, die im Folgenden entwickelt werden soll, keine Untergangsthese. Sie lautet: Die Kultur der Moderne ist säkularisiertes und zugleich pervertiertes Christentum. Auch dazu gibt es eine prägnante Formulierung Chestertons: »Die moderne Welt ist voll von verrückt gewordenen christlichen Tugenden.« Die Säkularisierung des Christentums zeigt sich in den Rechten, Werten und Institutionen der modernen Welt, die Pervertierung des Christentums zeigt sich in den grotesken Anpassungsversuchen der Kirchen an den Zeitgeist und in den hysterischen Formen des Protests.
Das Kapitel »Der Probelauf der Moderne« entwickelt die These, dass die christliche Entgöttlichung der Welt als entscheidende Vorarbeit für die wissenschaftliche Entzauberung der Welt begriffen werden kann. Gerade diese Entzauberung der Welt durch Wissenschaft hat dann überhaupt erst die Unvermeidlichkeit der Religion evident gemacht. Das abschließende Kapitel »Die Aufklärung der Aufklärung« zeigt, welche Impulse gerade das Christentum der modernen Aufklärung beim Unternehmen ihrer Selbstaufklärung geben kann. Wie die Soziologie ist nämlich auch die Theologie unverzichtbar, wenn es darum geht, die Grenzen des wissenschaftlich-technischen Weltbildes zu markieren.
Das Kapitel »Spekulativer Karfreitag« ist ein Exkurs in die intellektuelle Esoterik des Karfreitagschristentums, also eines Christentums ohne Auferstehung. Es liegt in der Natur der Sache, dass es Nichtphilosophen (und das sind ja wohl fast alle Leser dieses Buches) gewisse Lektüreschwierigkeiten bereiten wird. Wer sich daran stößt, kann das Kapitel aber auch ignorieren, ohne den roten Faden der Gesamtargumentation zu verlieren.
Schließlich noch ein Wort zum Titel dieses Buches. Christentum ohne Christenheit soll nicht besagen, dass es darum geht, das Christentum gegen die Lebenspraxis der Christenheit zu verteidigen. Der evangelische Schriftsteller und Theologe Søren Kierkegaard hat sehr gut gesehen, dass das Christentum zu verteidigen heißt, es zu verraten. Denn eine Verteidigung unterstellt ja die Rettungsbedürftigkeit des Christentums. Werbung für das Christentum wäre ein zweiter Judaskuss. Es geht vielmehr darum, seine Kraft des Ärgernisses herauszuarbeiten. Denn, so Kierkegaards Einsicht, das »Ärgernis ist unglückliche Bewunderung«. Deshalb ist die Missgunst der Atheisten näher an der Wahrheit als die humanistischen Worte zum Sonntag. Und wer das Christentum glaubt verteidigen zu müssen, hat nie an Jesus Christus geglaubt.
Die Erfindung des Christentums
Paulus hat Jesus nicht gekannt und musste ihn auch nicht kennen. Er richtet seinen Blick nur auf das Kreuz und sieht dort alles, was er für seine Lehre braucht. Um das zu verstehen, muss man sich immer wieder klarmachen, dass der Tod am Kreuz damals die schändlichste Form des Todes war. Wir haben in der Golgatha-Szene also einmal die Hoffnung auf den Messias, aber zum andern die Enttäuschung durch seinen jammervollen Tod. Das Kreuz, das ist der Galgen, der schmählichste Tod. Und bis zu diesem Kreuzestod haben die Jünger Jesu noch ganz jüdisch an den Messias geglaubt. Nach diesem Tod trotzdem noch daran zu glauben, dass Jesus der Messias ist, war für die Griechen eine Torheit. Ein Gott, der stirbt! Und für die Juden, die ja auf den Messias warten, war es ein Ärgernis. Ein Messias, der scheitert!
Und genau hier setzt nun Paulus an. Er wertet die antiken Werte um, indem er das Kreuz umwertet. Das ist sein großer rhetorischer Coup. Denn sein Wort vom Kreuz ist ja nicht nur den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, sondern soll es auch sein. Nietzsche hat das am klarsten gesehen. Im § 46 von Jenseits von Gut und Böse heißt es: »Die modernen Menschen, mit ihrer Abstumpfung gegen alle christliche Nomenklatur, fühlen das Schauerlich-Superlativische nicht mehr nach, das für einen antiken Geschmack in der Paradoxie der Formel ›Gott am Kreuze‹ lag. Es hat bisher noch niemals und nirgendswo eine gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich Furchtbares, Fragendes und Fragwürdiges gegeben wie diese Formel: sie verhieß eine Umwertung aller antiken Werte.«
In der Tat gibt es keinen größeren Gegensatz zum antiken Ideal der Perfektion als den Kult der christlichen Sündhaftigkeit. Und Nietzsche hat eben auch schon gesehen, worauf wir im Laufe dieser Untersuchung immer wieder stoßen werden: dass sich nämlich die daraus entstandenen christlichen Werturteile durchhalten, auch wenn die moderne Gesellschaft mit »Sünde« nichts mehr anzufangen weiß. Ein nachgelassenes Fragment vom Frühjahr 1886 lautet: »›Christus am Kreuze‹ ist das erhabenste Symbol – immer noch.«
Man muss sich klarmachen, dass Nietzsche damit die Größe seiner Aufgabe bestimmt hat, nämlich die Überbietung des Wortes vom Kreuz durch die These vom Gottesmord – was allerdings bedeuten sollte: die Umwertung der christlichen Werte, die eben ihrerseits aus der Umwertung der antiken Werte entstanden sind. Oder in der berühmten Formulierung des deutschen Philosophen Karl Löwith: die antichristliche Wiederholung der Antike auf der Spitze der Modernität. Die große rhetorische Geste »Gott ist tot« wird dann bei Sigmund Freud zum schlichten analytischen Befund. Im Jargon der Psychoanalyse kann man dann sagen: Das Christentum ist im Verhältnis zum Judentum zwar ein Rückschritt in der Vergeistigung, aber ein Fortschritt in der Wiederkehr des Verdrängten. Unbewusst kommen die Christen der Wahrheit nahe, denn sie gestehen den Gottesmord. So hat Freud die Evangelien als »wahnhafte Einkleidungen« des Bekenntnisses zum Gottesmord gedeutet. Doch damit ist der absolute Vater nicht abgetan, sondern er gewinnt sogar an Macht – das ist ein dialektisches Meisterstück, das wir dem Apostel Paulus verdanken. Der christliche Gott der Liebe ist für die Menschen erfahrbar in Jesus Christus, der aber selbst nur seine Beziehung zum Vatergott ist. In der Relation Gott-Mensch ist nur der Mensch ein Relatum; Gott ist ein Absolutum. Aber durch Jesus Christus ist Gott auf beiden Seiten des Verhältnisses – als Allmacht und Ohnmacht.
Auch diejenigen, die Paulus gehasst haben, mussten doch anerkennen, dass seine Umwertung des Kreuzes der großartigste rhetorische Coup der Weltgeschichte war. Das Wort vom Kreuz richtete sich gegen die Griechen, deren logischem Empfinden es eine Torheit war; gegen die Juden, denen es, wie der ehemalige Zelot nur zu genau wusste, ein unerträgliches Ärgernis sein musste; gegen die Gnostiker, von denen denn auch der Bannfluch »Verflucht sei Jesus« überliefert ist. Aber das Wort vom Kreuz richtete sich letztlich auch gegen das Leben des Lehrers und Magiers Jesus, von dem die Evangelien berichten.
Paulus macht aus Jesus Christus. Es geht ihm nicht mehr um den großen Lehrer Jesus, sondern um die Geschichte seines Todes. Wie gesagt: Paulus hat Jesus nicht gekannt und musste ihn auch nicht kennen. Es geht ihm ja nur um das Kreuz. Die paulinische Ironie der Torheit des Kreuzes liegt eben darin, dass der schmählich Gekreuzigte der König Israels ist. Die Passion nimmt dem Messias seine Aura. Seither kommt das Heil aus der Hinfälligkeit. Der Sohn Gottes stirbt wie ein Verbrecher. Aber wir wissen ja, dass er unschuldig ist. Und das bedeutet, dass der Messias als unschuldiges Opfer, das heißt als Sündenbock, stirbt. Und das wiederum bedeutet in der Dialektik des Paulus, dass der Messias als Sündenbock das Gesetz aufhebt. Der französische Kulturanthropologe René Girard hat daraus sein Lebensthema gemacht.
Aus dem gerade angeführten Nietzsche-Zitat geht noch ein Weiteres hervor: Wer die Schmach des Kreuzes nicht mehr fühlt, kann seine Symbolik nicht verstehen. Das Kreuz ist der Galgen für Schwerverbrecher. Die Kreuzigung ist also eine rituelle Erniedrigung. Die Aufgabe des Paulus bestand nun darin, dem Schrecken der Kreuzigung eine Heilsbedeutung zu geben. Der Anti-Erfolg, das Scheitern wird als spirituelle Exzellenz gedeutet.
Alle Kritiker von Rang haben diesen rhetorischen Coup als genialen Ausdruck von Ressentiment gedeutet. Vor allem Nietzsche kann sich nicht genugtun, Paulus als Ressentiment-Typus par excellence zu präsentieren. Der amerikanische Journalist Robert Sheaffer hat Paulus gar den Lenin des ersten Jahrhunderts genannt, der die Welt durchreiste, um das Ressentiment zu verbreiten. Man kann das ruhig zugeben. Der Mensch Paulus war wohl so, wie ihn Nietzsche beschrieben hat – aber nicht der Apostel Paulus.
Diese Unterscheidung des Menschen Paulus vom Apostel Paulus macht den Kern seines Selbstverständnisses aus. Deutlich am Anfang des Galater-Briefs, den Oswald Spengler als die peinlichste Stelle des Neuen Testaments bezeichnete: Paulus, der Apostel, der nicht von Menschen und nicht durch einen Menschen berufen ist, sondern durch Jesus Christus, den er ja gar nicht kannte, und durch Gott selbst. Dieser Apostel der Ausnahme ist der Künstler des Skandals. Das heißt, Paulus stellt rhetorisch auf Unruhe um. Was der Apostel verbreitet, sind Ärgernisse, Torheiten und Paradoxien. Was Nietzsche den Sklavenaufstand in der Moral nannte, zeigt bei näherer Betrachtung des Apostels Paulus ein ganz anderes Gesicht: Das Ressentiment wird kreativ und setzt neue Werte. Das Nichts vor Gott vernichtet den Stolz der Korrekten, die sich selbst rühmen. »Das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt: das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten.« (1. Kor 1,28). Gegen das Establishment die Parias! Im 1. Korintherbrief 4,13 heißt es: »Wir sind sozusagen der Unrat der Welt geworden, der Abschaum von allen bis heute.« Daran wird einmal die Ästhetik des Hässlichen anschließen.
Die Predigt vom gekreuzigten Christus ist den Juden ein Ärgernis (skandalon) und den Griechen, den Heiden eine Torheit (moria) ist. Das Wort vom Kreuz ist ein Skandal. Skandalon heißt aber nicht nur Ärgernis, sondern auch Falle. Gemeint ist der Fallstrick, der die Juden zu Fall bringt. Moria