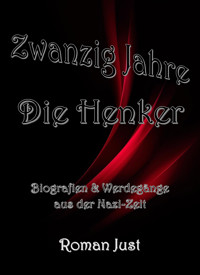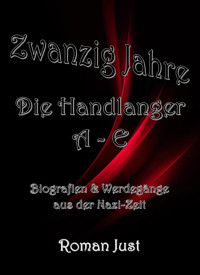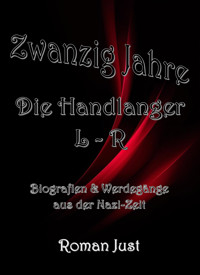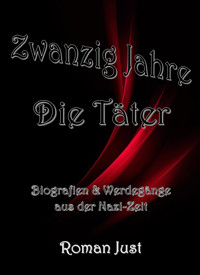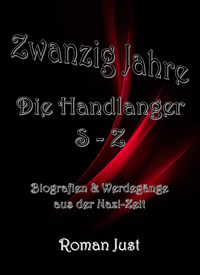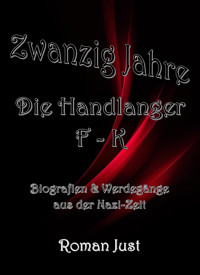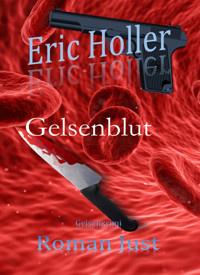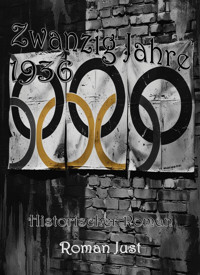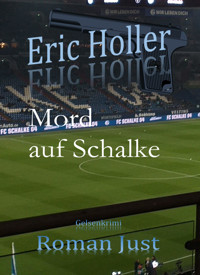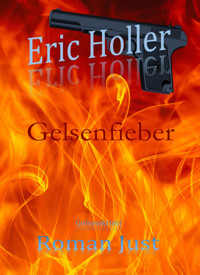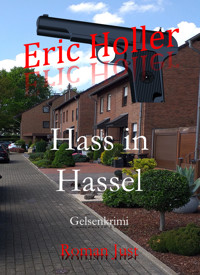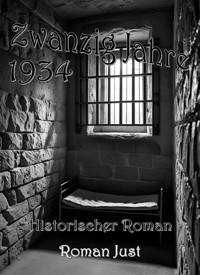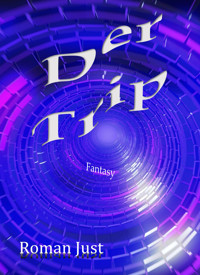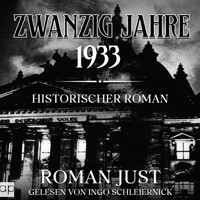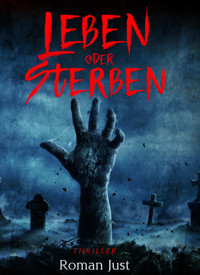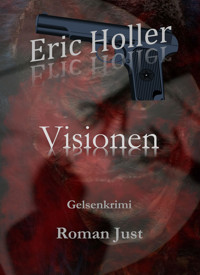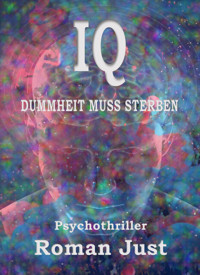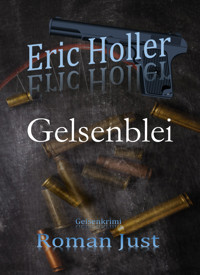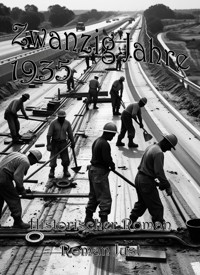
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gelsenecke
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Folgen des Jahres 1934 und die neu geschlossenen Bekanntschaften oder die gegebenen Umstände beziehungsweise das erlangte Wissen, lasten auf den befreundeten Mitgliedern der Familien "McKenzie" in Amerika und "von Dannenburg" im Deutschen Reich. Nach dem Motto, "das Leben muss weitergehen", wollen alle Familienangehörigen das Beste aus den gegebenen Situationen machen, doch das Dasein entwickelt sich immer mehr zu einem Lotteriespiel. Noch ahnt niemand, dass es nur noch vier Schritte bis zur Pforte der Hölle sind, allerdings deutet sich immer mehr an, was auf die Welt zukommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über den Autor
Zur Person:
Mitwirkende im Buch:
Januar
Der Vertrag von Versailles
Februar
Der politische Aufstieg Adolf Hitlers
März
Geschichte der Wehrmacht
April
Theodor Eicke
Mai
Graf von Stauffenberg
Juni
Legenden um die Reichsautobahn
Juli
Kurfürstendamm-Krawall
August
Der Reichsarbeitsdienst
September
Nürnberger Gesetze
Oktober
Von der Reichswehr zur Wehrmacht
November
Paul Joseph Goebbels
Dezember
Eisenbahnunfall von Großheringen
Hinweise
Impressum
Zwanzig Jahre
1935
Historischer Roman
Band 3
Über den Autor
Roman Just ist in der Welt der Literatur in verschiedenen Genres unterwegs. Mit den Thrillern der "Tatort-Boston-Reihe" hat er den Einstieg in die Literaturwelt begonnen, sie dann mit den "Gelsenkrimis" fortgesetzt. Neben den Thrillern und Krimis arbeitet er an einer mehrteiligen Dystopie und einer historischen Familiensaga, hinzu kommen Ausflüge in andere Genres.
Der Autor und bekennender Selfpublisher ist Jahrgang 1961, lebt in Gelsenkirchen, leidet mit dem vor Ort ansässigen Fußballclub seit 1971 zu allen Zeiten mit, spielt außerdem gerne mit Mitmenschen Schach und beschäftigt sich leider nur noch gelegentlich mit der Astronomie.
Der Selfpublisher betreibt auf seiner Homepage zu allen seinen veröffentlichten Titeln Leserunden, außerdem bietet er einen Leserkreis, an dem ebenfalls aktiv teilgenommen werden kann.
Mehr über den Autor und seine Titel gibt es hier:
https://www.gelsenkrimi.de
https://www.gelsenkrimi.de/ueber-mich
https://www.gelsenkrimi.de/leserkreis
https://www.gelsenkrimi.de/gelsenshop
Zur Person:
Sternzeichen: Jungfrau
Gewicht: Im Moment viel zu viel
Erlernter Beruf: Kellner
Derzeit tätig als: Autor/Selfpublisher
Charaktereigenschaften: Impulsiv/Hilfsbereit
Laster: Nie zufrieden mit einem Ergebnis
Vorteil: Meistens sehr geduldig
Er mag: Klare Aussagen
Er mag nicht: Gier und Neid
Er kann nicht: Den Mund halten
Er kann: Zuhören
Er verachtet: Tyrannen und selbstverliebte Subjekte
Er liebt: Das Leben
Er will: Ziele erreichen
Er will nicht: Unterordnen
Er steht für: Menschlichkeit
Er verurteilt: Hass, Mobbing, Eitelkeit
Er denkt: Auch Einfaches ist nicht einfach zu erledigen
Er meint: Die Achtung und der Respekt vor der Würde eines Menschen werden durch das Gendern nicht gestärkt.
Mitwirkende im Buch:
Familie von Dannenburg:
Hermine von Dannenburg, Mutter
Otto von Dannenburg, Sohn
Walter von Dannenburg, Sohn
Hildegard, Ottos Frau,
Luise, Walters Frau, geborene Fahrenbrecht,
Peter von Dannenburg, Ottos und Hildegards Sohn
Familie McKenzie:John James McKenzie, Rancher
Patricia, seine Frau
Amanda und Susan, deren Töchter
Peter Dannenberg ist Peter von Dannenburg
Maureen Bell, Schwester von Patricia
Familie Rothenbaum:
Gottlieb Rothenbaum, Schneider
Maria, seine Frau
Jakob und Sarah, deren Kinder,
Judith, Jakobs Frau,
Zum Teil Haupt- und Nebendarsteller
Paul Bruchthaler, seine Familie, Verwalter auf Ottos Gut
Henry Chester, Rechtsanwalt, Privatdetektiv
Charles Chester, Henrys Bruder und Ehemann Amandas
Miranda, Chefsekretärin bei Chester & Chester
Emily, ehemalige Zimmerfreundin Amandas an der Uni
Hans Speck, ältester Sohn der verstorbenen Eheleute Speck
Nelson Durringham, Freund Amandas
Historische Figuren:
Adolf Hitler, Reichskanzler,
Rudolf Heß, Vizekanzler
Theodor Eicke, Kommandant KZ Dachau und mehr
General Freiherr Karl von Plettenberg, Freund Ottos
Magnus von Levetzow, Polizeipräsident Berlin
Igor Iwanowitsch Sikorski, Flugzeugkonstrukteur
Paul Joseph Goebbels
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
u. v. m.
Akteure, die in den nächsten Bänden eine immer größere Rolle erhalten werden:
Familie Wiemers
Familie Müller
Ehepaar Martha und Helmut Grosch
Miranda, degradierte Chefsekretärin bei Chester & Chester
Information zu historischen Figuren:
Alle in dem Buch beschriebenen Werdegänge und Handlungen der Personen sind nachweislich belegt. Davon ausgeschlossen sind die Begegnungen mit den fiktiven Romanfiguren. Auf Abweichungen, die der Dramaturgie des Inhalts dienen sollen, wird am Ende des Inhalts hingewiesen.
Januar
D
as alte Jahr war vorbei, aber insbesondere für Walter von Dannenburg galt, den Dezember des vergangenen Jahres zu verarbeiten. Er hatte Theodor Eicke kennengelernt, war erneut Gast im Konzentrationslager Dachau, diesmal nicht allein, sondern mit seiner Frau Luise. Darüber hinaus konnten die beiden auf Einladung der Parteiführung einige Tage in Garmisch-Partenkirchen verbringen, wo im kommenden Jahr die Olympischen Winterspiele stattfinden sollten.
Walter, der sich im statistischen Amt in Greifswald bewährt hatte, wurde ein Posten im Organisationskomitee angeboten, der ihn jedoch nicht reizen konnte. Für die von ihm betriebene Auflistung von Juden, geeigneten Leuten für die Hitlerjugend, verschiedene Verbände und die Reichswehr war er mehrfach gelobt worden und vielleicht hätte er das Angebot angenommen, wenn ihm ein anderes in Bezug auf seine Karriere nicht erfolgsversprechender erschienen wäre.
Im Konzentrationslager Dachau war er zuvor Theodor Eicke vorgestellt worden und ihm wurde die Ehre zuteil, mit diesem ein Vieraugengespräch führen zu dürfen. Walter von Dannenburg hatte keine Ahnung, dass er dem Mörder von Ernst Röhm gegenübersaß, ohnehin hätte ihn diese Tatsache nicht dazu veranlasst, auf die Unterhaltung zu verzichten. Theodor Eicke sorgte dafür, dass Walters Frau, Luise, ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt bekam, für ihr leibliches Wohl gesorgt wurde, führte Walter in einen Raum, der so gar nicht auf das Gelände eines Konzentrationslager passen mochte. Für einen Moment glaubte Walter sich im Wohnzimmer seiner ermordeten Schwiegereltern zu befinden, so antik und monarchistisch war die Räumlichkeit eingerichtet. Nicht irgendeine Ordonanz, sondern Theodor Eicke persönlich servierte ihm einen Kaffee und Cognac, der Gastgeber gab sich mit einem Tee zufrieden.
Nachdem Theodor-Eicke-Platz genommen hatte, musterte er Walter, von dem er durch einen länglichen Tisch getrennt wurde. Es war offensichtlich, das Zimmer diente gemeinsamen Essen und Besprechungen und nur der Satan wusste, wie viel Todesurteile in den vier Wänden bis dahin bereits gefällt worden waren. Der Gastgeber nippte an seinem Tee, rutschte mit dem Stuhl etwas weg vom Tisch und schlug die Beine übereinander. »Mir wurde von der Parteizentrale mitgeteilt, dass Sie uns beehren werden. Daraufhin habe ich mich natürlich über Sie erkundigt, nur Gutes gehört.«
»Vielen Dank, Herr Eicke, oder wie soll ich Sie ansprechen?«, fragte Walter unterwürfig, da sein gegenüber keine Uniform mit Abzeichen trug, stattdessen in einem grauen Anzug steckte.
»Verzichten wir zumindest hier und jetzt, da wir unter vier Augen sind, auf sämtliche Förmlichkeiten«, antwortete der Gefragte, meinte: »Können Sie sich vorstellen, weshalb ich Sie um ein Gespräch gebeten habe?« Walter schüttelte verneinend den Kopf. »Nun, es war mir möglich, mich über Ihre Arbeit und Verdienste zu informieren. Beachtlich, wirklich beeindruckend.«
»Danke, vielen Dank, Herr Eicke«, warf Walter gemäßigt ein, um nicht zu stolz zu wirken.
Eicke fuhr fort: »Meine Tätigkeit kann in gewisser Weise mit der Ihren verglichen werden. Ich bin dabei, die Strukturen der Konzentrationslager zu reorganisieren. Einige Lager werden komplett neu besetzt, auch ausgebaut, zudem müssen neue entstehen. Die sogenannten "wilden" Lager, meist sehr klein, gehören schon bald der Vergangenheit an, jedenfalls bin ich ziemlich ausgelastet.«
»Verstehe«, sagte Walter, obwohl er bisher nichts begriffen hatte, der Sinn des Gesprächs ihm unbekannt geblieben war.
Theodor Eicke nippte erneut an seinem heißen Getränk, er vollzog den Akt wie ein Adliger. »Sie kennen die Leute, denen ich unterstehe?«, erkundigte er sich im Anschluss.
»Nicht wirklich«, gab Walter zu, fühlte sich plötzlich sehr klein, weshalb er hinzufügte: »Bestimmt werden mir einige Leute vom Namen her bekannt sein, aber bisher durfte ich innerhalb der Partei nur unseren Vizekanzler Rudolf Heß kennenlernen.«
Theodor Eicke lächelte milde. »Ich höre es heraus, sie wären sicher gern schon anderen Parteigrößen begegnet. Nun, wenn Sie wollen, verschaffe ich Ihnen über kurz oder lang die Möglichkeit dazu. Es kommt darauf an, ob Sie an einer Zusammenarbeit interessiert sind, ebenso auf den Punkt, wie Sie die Ihnen offerierte Aufgabe zeitlich erledigen.«
Walter beging nicht den Fehler sich anzubiedern, er blieb sachlich und kühl, auch wenn es ihm schwerfiel. »Was hätte ich zu tun«, fragte er in einem Ton, der vorgab, dass er mit seinem Posten im statistischem Amt in Greifswald zufrieden zu sein schien.
»Schon mal von den Wachverbänden der "SS" gehört?«
Walter nickte. »Selbstverständlich.«
Theodor Eicke setzte sich aufrecht hin, verschränkte seine Arme auf der Tischplatte. »Ihnen sind auch die "Totenkopfverbände der SS" ein Begriff?«
Kurzzeitig dachte Walter an seine in Greifswald von ihm aufgestellte Schlägertruppe, von denen die meisten Mitglieder im statistischem Amt der Stadt hinter Schreibtischen saßen. »Natürlich, allerdings ist in dieser Hinsicht mein Wissen eingeschränkt.«
Eicke, der im Konzentrationslager Dachau nach wie vor das Sagen hatte, lächelte. »Sehr diplomatisch ausgedrückt«, meinte er, kam auf vergangenes zu sprechen: »Entspricht es nicht der Wahrheit, dass Sie gewisse Leute unter sich haben, die keine Skrupel kennen? Ich rede von Mord, Brandstiftung und Sachbeschädigung in hohem Maß. Walter von Dannenburg wurde blass, doch der Lagerkommandant nahm ihm jegliche Befürchtungen. »Die Partei braucht Leute wie Sie. Der engste Kreis des Führers, zu dem ich mich in bescheidener Weise dazu zählen kann, benötigt entschlossene Männer, die fähig sind zu handeln. Himmler, Göring, Göbbels und viele weitere, alle vertreten diese Meinung. Es ist keine Schande, wenn Leute wie Sie erfolgshungrig sind, Karriere machen wollen. Ohne zu übertreiben, ich biete Ihnen hier und jetzt die Gelegenheit dazu, in Ihrem Umfeld für die Partei unentbehrlich zu werden. Was das bedeuten könnte, dürfte nicht schwer sein es sich auszumalen. Erledigen Sie Ihre Aufgaben zu unserer Zufriedenheit, wird es für Sie zu einer Tagesordnung, regelmäßig mit den Parteispitzen zusammenzutreffen. Interessiert?«
Walters Blässe war verschwunden, stattdessen hatte eine sanfte Röte seine Wangen erobert. Dennoch hielt er sich im Zaum, verstand es einigermaßen, seine Gier nach Erfolg zu bremsen. »Ich gebe zu, innerhalb der Partei mehr erreichen zu wollen, bin bereit, es mir zu erarbeiten.«
Eicke nickte. »Davon sind einige Herren über mir überzeugt, deswegen sitzen wir hier an einem Tisch. In Absprache mit Heinrich Himmler bin ich befugt Ihnen die Aufgabe zu erteilen, in Greifswald einen "Totenkopfverband" aufzustellen. Durch Ihre Arbeit bisher, sprich diverse Namenslisten erstellt zu haben, damit über den Zugriff auf geeignete Leute zu verfügen, gibt es niemanden da oben hoch im Nordosten, der dieses Ziel besser und schneller auszuführen imstande wäre als Sie.«
Walter schluckte schwer, mit der Chance auf einen derartig gewaltigen Karrieresprung hatte er nicht gerechnet. »Wenn man es mir zutraut, bin ich Ihr Mann«, sagte er.
»Sie erhalten den Auftrag, müssten aber eine Bedingung unbedingt befolgen.«
»Welche?«
»Es ist im Interesse der Partei, insbesondere ihrem unmittelbaren Vorgesetzten, damit meine ich keinen anderen als Herrn Heinrich Himmler, dass der "SS Totenkopfverband Pommern" still und leise, wenn Sie so wollen, klammheimlich aufgebaut wird. Zur Erklärung: Die bisher existierenden Einheiten an Totenkopfverbänden sind ausschließlich für die Bewachung der Konzentrationslager zuständig, mitunter werden sie bei der Verfolgung von politischen Gegnern eingesetzt. Ihre Truppe soll ausschließlich politische Feinde identifizieren und in Gewahrsam nehmen. Sie wären somit der Kommandeur einer Spezialeinheit, die, wenn erforderlich, auch zur Begleitung als Personenschutz etwaiger Führungskräfte der Partei eingesetzt werden würde. Ihren Posten als Leiter des statistischen Amts in Greifswald könnten Sie darüber hinaus bis auf weiteres behalten«, machte Theodor Eicke das Angebot für Walter noch schmackhafter.
Walter von Dannenburg vermied es, seine Begeisterung zu zeigen. Insgeheim sah er sich bereits in einer hochdekorierten Uniform neben Adolf Hitler stehen. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll«, gab er sich zurückhaltend.
»Sie haben die Namen, die Kompetenz, den Willen etwas zu erreichen. Damit bleibt Ihnen nur eine Antwort.«
Ottos Bruder verstand den Hinweis. Für Theodor Eicke war das Gespräch beendet, er wartete nur noch auf Walters Reaktion. »Es wird mir eine Ehre sein, dem Führer, der Partei und Ihnen zu dienen. Ich werde Sie und niemanden sonst enttäuschen«, nahm er die Aufgabe an.
Später, da im Beisein von anderen Leuten und auch Walters Gattin verabschiedeten sich die Männer mit dem Hitlergruß, ohne zu ahnen, dass sie sich öfter und vor allem eines Tages unter völlig anderen Umständen wiedersehen würden.
Ω
D
ie SS-Totenkopfverbände, kurz SS-TV, waren die für die Bewachung der Konzentrationslager, abgekürzt KZ, zuständigen Einheiten der SS. In dieser Funktion waren sie eine zentrale Exekutivinstitution der NSDAP zur Unterdrückung und Beseitigung politischer Gegner, zur Ausbeutung durch Zwangsarbeit und medizinische Menschenversuche sowie zur Internierung von Kriegsgefangenen.
In den Vernichtungslagern im besetzten Polen und Weißrussland waren die SS-Totenkopfverbände im Rahmen der sogenannten "Aktion Reinhardt" speziell für den Massenmord an Juden aus ganz Europa und weiteren von den Nationalsozialisten verfolgten Personengruppen verantwortlich.
Anfangs spielte das KZ Dachau unter dem Kommandanten Theodor Eicke eine wichtige Rolle als Ausbildungsstätte. Das SS-Personal war in einer SS-Kaserne im Übungslager Dachau untergebracht. Am 10. Dezember 1934 wurde die Inspektion der Konzentrationslager, kurz IKL, gebildet. Als Dienststelle der "Geheimen Staatspolizei", der "Gestapo", wurde sie eine staatliche Einrichtung, die zur Zentrale aller KZ-Verbände wurde. Eicke entwickelte in kurzer Zeit das "Dachauer Modell": Es lässt sich "als Versuch beschreiben, den Terror zu systematisieren und zu zentralisieren". Die frühen Konzentrationslager waren regional sehr unterschiedlich, von einem großen Maß an Improvisation geprägt, und die Öffentlichkeit war durch Presseberichte zumindest teilweise über die Zustände in den Lagern informiert. Somit konnte zum Teil von einem "Nichtwissen" zu keiner Zeit gesprochen werden. Eicke erließ im Oktober 1933 die "Disziplinar- und Strafordnung für das Gefangenenlager" und eine Dienstvorschrift für Wachposten. Diesen wurde Straffreiheit zugesichert, wenn sie einen Häftling bei einem Fluchtversuch erschossen. Durch die strikte Unterbindung von Fluchten schottete Eicke das Lager nach außen gleichermaßen gegen die Justiz wie gegen die Öffentlichkeit ab.
Zwischen 1935 und 1937 reorganisierte Eicke im Auftrag Heinrich Himmlers die der IKL unterstellten Konzentrationslager. Alle vorhandenen kleineren Lager wurden aufgelöst. Einzige Ausnahme war das KZ Dachau, das im Sommer 1937 erheblich erweitert wurde. Anstelle der aufgelösten, in vorhandenen Gebäuden untergebrachten Lager entstanden zwei große Neubauten, denen Kasernen der SS-Wachverbände angegliedert waren. Im Sommer 1936 wurde das KZ Sachsenhausen bei Oranienburg eröffnet. Im Sommer 1937 entstand das KZ Buchenwald in der Nähe von Weimar. Mit Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald gab es Ende 1937 drei große Lager für insgesamt 15.000 bis 20.000 Häftlinge.
Ab 1937 konzentrierte sich Eicke auf seine Funktion als Führer der SS-Totenkopfverbände, seine Aufgaben in der IKL übernahm schrittweise Richard Glücks. Die SS-Totenkopfverbände wurden neu in SS-Totenkopf-Wachsturmbanne und SS-Totenkopf-Standarten organisiert.
Ω
E
s war schon manchmal beängstigend, welche Parallelen das Leben zwischen den Familien "von Dannenburg" in Pommern und "McKenzie" in den Vereinigten Staaten von Amerika zu bieten hatte. Während Walter von Dannenburg "das schwarze Schaf" der einen war, traf das gleiche auf Amanda Chester, geborene McKenzie in New York zu.
Nur Amanda selbst wusste, welche Ziele sie verfolgte. Seit sie das Studium hingeworfen hatte, unter falschen Vorwänden Charles heiratete und ein von ihr ausgedachter Mordanschlag gescheitert war, stand sie unter dem Zepter ihres Mannes, der ihren Liebhaber mit ihrem Vater zusammen erschossen hatte, wobei der Getötete nichts anderes war als ein Mittel zum Zweck. Trotzdem hegte Amanda Rachegefühle, nicht wegen einer verlorenen Liebe, sondern aus Wut, die sich insbesondere auf vier Leute in ihrem Umfeld richtete. Da waren zunächst ihr Mann und ihr Vater, ihnen folgte Susan, ihre Schwester und deren Verlobter, Peter, der als ein geborener "von Dannenburg" in Amerika unter dem Namen Dannenberg lebte. Amanda hatte nicht vor, ihrer Schwester etwas anzutun, sie wollte sie nur leiden sehen, so wie sie einst gelitten hatte, als sie von Peter mehr oder weniger wie Luft behandelt worden war. Ihr Vater war ihr zu rechthaberisch, zu fordernd und befehlend, außerdem hatte er sich geweigert, ihr ihren Erbanteil vorzeitig auszuzahlen.
Ihren Mann, der sie aufgrund von ihren Lügen geehelicht und der sie im Anschluss an den fehlgeschlagenen Mordkomplott wie eine Sklavin zu dressieren begonnen hatte, wollte Amanda anders begegnen, nämlich ihn quälen, so wie er dies in Bezug auf ihre Bewegungsfreiheit monatelang tat. Worauf sie warten musste, war die passende Gelegenheit und die dazu erforderlichen Möglichkeiten. Der Zufall, der es mit bösen oder fragwürdigen Menschen zu oft viel zu gut meinte, half ihr, dass sie eine solche Chance erhielt.
Wie auf der Ranch ihres Vater und auf dem Gut in Pommern, wo Peter eigentlich herkam, was sie noch nicht beweisen konnte, aber für wahrscheinlich hielt, waren die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel in einem kleinen harmonischen Kreis an Amanda vorbeigegangen. Den Weihnachtsabend hatte sie mit Charles verbracht, die nachfolgenden Feiertage waren sie ausgegangen, auch am Silvester, da sogar mit dem Bruder ihres Ehemannes. Wie es Amanda gelang, ihrem in sie verliebten Gatten eine brave und folgsame Frau vorzuspielen, es konnte als eine schauspielerische Glanzleistung bezeichnet werden. Es lag an Amandas Geduld, aber auch an ihrer Unschlüssigkeit, ihre Rolle in Perfektion auszuüben. Mittlerweile besaß sie ein gewaltiges Druckmittel gegen den Bruder ihres Mannes, doch merkwürdigerweise hatte sie diesen Trumpf noch nicht aus dem Ärmel gezogen. Sicher, sie träumte von einem eigenständigen und glücklichen Leben in Paris oder London, auch ein Dasein im Süden oder Westen der Staaten konnte sie sich vorstellen, wenn ihre eigenen Lebensumstände dazu geeignet wären. Das hieß: Geld, einen reichen Mann, ebenso einen großzügigen Liebhaber. Durch ihre Kindheit auf der Ranch ihres Vaters wusste sie, dass es zwischen Gaul und Ross vehemente Unterschiede gab. Wie auch immer, Amanda befand sich in einer Situation, die zwar viele Sehnsüchte enthielt, zugleich jedoch dadurch dafür sorgten, dass sie sich noch nicht im Klaren darüber war, was sie eigentlich wollte, sah man von Reichtum und Männern ab. Mit dem Neujahrstag änderte sich daran nichts schlagartig, eines jedoch sofort, als die erste Sekunde des neuen Jahres angebrochen war.
In einem günstigen Augenblick zog sie Henry, den Bruder ihres Gatten zur Seite, dessen ausgezeichneten Ruf sie durch ein zufällig angeeignetes Wissen ruinieren konnte, damit auch die Kanzlei der Brüder Chester & Chester. So kam es, dass sie am frühen Nachmittag im Büro von Henry saß, der Charles gebeten hatte, ihm Amanda wegen eines wichtigen Schreibens als Sekretärin zur Verfügung zu stellen. Amanda betrat die Büroräume erst, nachdem sie sah, wie Henry das Gebäude betrat, in dem sie lagen. Die Bürotür zu Henrys Arbeitsplatz stand offen, rotzfrech schritt sie in das Zimmer und auf den Bruder ihres Mannes zu, der hinter seinem Schreibtisch saß, dort vielleicht Schutz suchte.
»Du sitzt auf dem falschen Platz«, meinte Amanda, deutete auf den Stuhl vor dem Schreibtisch. »Heute sitzt du hier«, sagte sie, umkurvte den Tisch und setzte sich in Henrys Bürosessel, nachdem er ihn widerwillig gegen den Sitzplatz seiner Klienten getauscht hatte.
Ein Aufbegehren Henrys war ausgeblieben, ihm erschien es zunächst wichtiger, zu erfahren, was Amanda von ihm verlangen würde. »Ich habe mich schon gewundert, dass du unser Geheimnis so lange für dich behältst, ohne dafür etwas zu verlangen. Ich schätze, die Zeiten sind vorbei, also was willst du?«, fragte Henry Chester relativ ruhig und gefasst.
Amanda ließ ihre Augen durch das Büro gleiten, so oft hatte sie es bisher nicht von innen gesehen. Sie rümpfte ihre Nase, ihr Schwager besaß einen ähnlich altmodischen Geschmack wie ihr Gatte. »Wie geht es deinem Liebesleben?«, erkundigte sie sich schließlich, als sie Henry ins Visier nahm. Henry sagte nichts, woraufhin Amanda erneut das Wort ergriff: »Hör zu, Henry. Es ist mir egal, wann und mit welchen Jungs oder Männern du Sex hast. Ich finde es zwar widerlich, aber es ist dein und nicht mein Leben. Die Sache kann unter uns bleiben, allerdings musst du dich dann kooperativer zeigen. Wenn ich etwas frage, erwarte ich eine Antwort, falls ich etwas will oder benötige, solltest du handeln. Mir liegt nichts daran, dich zu vernichten, obwohl ich weiß, dass du mich eine Zeit lang überhaupt nicht leiden konntest. Deine kurz ersichtliche Sympathie für mich wird inzwischen sicher wieder verflogen sein, nur solltest du es mir nicht zu deutlich zeigen. Also, fangen wir von vorne an: Was macht dein Liebesleben?«
»Amanda, ich frage dich auch nicht, ob du mit Charles schläfst oder ihm fremd gehst. Du hast mich in der Hand, ich bin bereit, dir den einen oder anderen Gefallen zu tun, über mein Liebesleben werde ich dich jedoch nicht auf dem Laufenden halten.«
»Also gut, ich akzeptiere es. Dachte nur, wir kämen uns auf diese Weise wieder näher.«
»Ich befürchte, dieser Zug ist endgültig abgefahren. Was willst du?«
»Du hast dich sehr geärgert, als mich Charles geheiratet hat, nicht wahr?«, stellte Amanda fragend fest.
»Kann man so sagen«, entgegnete Henry.
»Wie ist sonst euer Verhältnis? Seid Ihr ein Herz und eine Seele?«
Henry Chester verzog das Gesicht, die Neugier und das Verhalten Amandas ging ihm auf die Nerven. »Was soll das? Möchtest du eine Familienkonversation halten?«
»Lieber Schwager, jetzt stell dich nicht so an. Meine Fragen könnten am Ende auch für dich von Bedeutung sein. Bitte, sage es mir, wie versteht Ihr euch? In dieser Hinsicht bekomme ich ja fast nichts mit.«
Der Rechtsanwalt, wie sein Bruder, aber seltener, ab und zu als Privatdetektiv tätig, gab nach. »Meinungsverschiedenheiten und Streit gibt es hin und wieder überall. Ansonsten ist unser Verhältnis ungetrübt.«
»Aha, das wundert mich aber.«
»Inwiefern?«
»Ich habe den Eindruck, dass Charles über deine Homosexualität Bescheid weiß, dich aus diesem Grund über kurz und lang in "Gentleman Manier" aus der Kanzlei drängen möchte«, log Amanda Henry in unverschämter Art an, mit dem Ziel, die Brüder gegeneinander auszuspielen. Tatsächlich besaß Charles absolut keine Ahnung von der Neigung seines Blutsverwandten.
»Unsinn! Charles wäre nie fähig, mich zu hintergehen, darüber hinaus überhaupt nicht in der Lage, die Kanzlei in Eigenverantwortung zu führen. Er ist ein sehr guter Rechtsanwalt, ein gewiefter Privatdetektiv, für seine Körperfülle sogar sportlicher als ich, doch geschäftlich es er eine Null, und das ist noch untertrieben«, entgegnete Henry.
»Da will ich dir deinen Stuhl retten und du fährst mich an«, erwiderte Amanda gespielt leicht verschnupft, sprach nach einer kurzen scheinbar wehleidigen Pause weiter: »Angenommen ich hätte recht, was wäre dann?«
Henry Chester überlegte, sagte: »Logischerweise würde ich mich zur Wehr setzen.«
Amanda lächelte. »Ups, wie denn?«, hielt sie Henry vor. »Du hättest keine Chance ab dem Zeitpunkt, in dem Charles dein Sexleben öffentlich macht. Ja, dein Bruder, mein Mann, zugegeben, er hat einige gute Seiten, aber er ist ein Mensch wie du und ich, wird mit Sicherheit irgendwann nur noch an sich denken.«
Henrys Stirn zeigte erste Falten. »Wie meinst du das?«
»Jeder ist sich selbst der nächste, Henry. Ich glaube, dieser Punkt sollte gerade dir bewusst sein. Wie oft hast du so etwas schon vor Gericht erlebt? Ich will es nicht wissen«, winkte Amanda ab, wechselte das Thema: »Ich möchte, dass du Charles aus der Kanzlei ausbootest, wie du es anstellst, ist mir egal. Ich meinerseits bin bereit, mich irgendwann während dieser Prozedur vor dich zu stellen, werde mich bei Bedarf als deine Geliebte ausgeben. Eventuelle Vorwürfe bezüglich deiner sexuellen Vorlieben werden dadurch keinen Nährboden finden. Was hältst du davon?«, erkundigte sich Amanda, sah, wie es in Henrys Kopf arbeitete.
Nach einer Schweigeminute fand Henry seine Stimme wieder. »Es hört sich alles so an, als wolltest du mir ersparen, von meinem Bruder hintergangen zu werden. Schon deshalb klingst du ziemlich unglaubwürdig. Andererseits, falls du nicht lügst, wieso stellst du dich auf meine Seite und gegen deinen Mann? Sollte er das Ziel verfolgen, mich auszubooten, wärst du so oder so auf der Gewinnerseite. Amanda, ich habe keinen Grund, dir auch nur ein bisschen zu vertrauen, deshalb bitte ich dich zumindest jetzt, sei es nur dieses eine mal, wahrheitsmäßig zu antworten.«
Amanda setzte eine traurige Miene auf. »Mir kann man nicht vertrauen? Das sagst ausgerechnet du! Wie lange weiß ich von deiner Neigung? Wie versprochen, ist bisher kein Wort darüber über meine Lippen gekommen.«
»Das stimmt«, gab Henry zu. »Trotzdem verstehe ich dein Verhalten und deine Position nicht. Es leuchtet mir auch keineswegs ein, warum du dich gegenüber Charles feindselig benimmst, immerhin war er es einst, der zu dir hielt«, offenbarte er die Unwissenheit, die bei ihm Bedenken hervorrief. Plötzlich fing Amanda zu weinen an, nicht laut und hysterisch, stattdessen ließ sie ihre Tränen leise über ihre Wangen rollen. Henry nahm es wahr, reichte ihr ein Stofftaschentuch, schüttelte den Kopf: »Das glaube ich niemals«, sagte er energisch, doch seinen Worten fehlte die letzte Überzeugung.
Amanda wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, tupfte ihre Augen ab. »Doch, mehrmals hat er mich mit Gewalt genommen, seitdem gebe ich mich ihm freiwillig hin, ertrage ihn, um nicht erneut vergewaltigt zu werden. Im nächsten Jahr werde ich volljährig, bis dahin will ich ihn zur Strafe in einer Gosse liegen sehen. Danach will ich seinen Anteil, an der Kanzlei, anschließend verlasse ich die Stadt. Ist es geschehen, wirst du mich niemals wiedersehen oder von mir etwas hören. Unser Geheimnis verschwindet mit mir«, bot Amanda dem Bruder ihres Mannes einen Deal an.
Henry Chester, der nicht wissen konnte, dass sein Bruder Amanda vor Monaten ein Ende ihrer Umtriebigkeit in einem Slum angedroht hatte, war sprach- und fassungslos. »Ich muss das Gehörte verarbeiten, mir alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.«
Amanda erhob sich. »Mach es, aber lass dir damit nicht zu viel Zeit. Bevor Charles dich an den Pranger stellt, werde ich es tun. Mit leeren Händen gehe ich nicht aus der Geschichte hervor«, kündigte sie an und ließ Henry allein. Kaum hatte sie die Tür der Kanzlei hinter sich geschlossen, fing sie selbstzufrieden zu lächeln an.
Ω
I
m Gegensatz zu den Jahren 33/34 sollte das Jahr 1935 politisch fast langweilig werden. Im Laufe des Jahres sollte es zwar zu Entscheidungen kommen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen konnten, doch auf dem Gut der Familie von Dannenburg zählte im Moment nur der Augenblick.
Gleich am ersten Januartag war es fast überall untergegangen, dass Duisburg-Hamborn ab sofort nur noch Duisburg hieß. Die Augsburger und Münchner Börse fusionierten zur Bayerischen Börse, doch für das Leben in Pommern und den Alltag auf dem Gestüt Ottos waren diese Ereignisse unbedeutend. Wie stets wurden die Pferde gepflegt und gefüttert, die Ställe ausgemistet, zu tun gab es immer etwas. Otto von Dannenburg sprach nicht davon, aber er war stolz, was aus seinem Anwesen in den letzten Monaten geworden war. Vor genau zwei Jahren gab es das Wohnhaus, dazu ein damals eher heruntergekommenes Gästehaus, ergänzt wurde es durch Ställe und Weiden, im groben war das alles. Inzwischen bot das Gästehaus zwei Familien Unterkunft, nämlich den Rothenbaums und dem Verwalter des Gutsbesitzers sowie dessen Familie. Darüber hinaus stellte das Erdgeschoss des Gebäudes die Verwaltung der "DRS" dar. Die drei Buchstaben standen offiziell für die "Deutsche Reitsportschneiderei", der Firma, die Otto von Dannenburg gegründet hatte. Insgeheim versteckten sich hinter dem "D" der Name Dannenburg und hinter dem "R", der Familienname von Maria und Gottlieb Rothenbaum.
Mitbeteiligt an dem Unternehmen waren außerdem sein Freund John James McKenzie in Amerika, der mit einer hohen Summe in das Projekt eingestiegen war, damit die Firma überhaupt entstehen und zu produzieren beginnen konnte. Aber auch Paul Bruchthaler, der Verwalter auf dem Gestüt, nahm Otto prozentual mit ins Boot. Der Mann hatte unglaubliches geleistet, einen Stall zu einer Produktionshalle umfunktionieren lassen, täglich auf der Baustelle mitgearbeitet. Gleiches traf auf einen Wohnblock neben der Halle zu, in dem sechs Parteien Platz fanden und die mittlerweile eingezogen waren. Zwei ledige Männer und vier Ehepaare mit einer unterschiedlichen Anzahl von Kindern bewohnten nun das Haus, insbesondere die Männer umgab ein kleines Geheimnis. Sie alle waren frühere Weggefährten Pauls bei der Gendarmerie, wie er verloren sie ihre Anstellung, da sie sich nicht bereit erklärten, der NSDAP beizutreten. Kurze Zeit danach wurden sie auf dem Gut zu wertvollen Helfern auf den Baustellen. Schließlich nahmen sich Gottlieb und Maria ihrer an, um sie samt ihren Ehefrauen mit den Maschinen vertraut zu machen, mit denen Stoffe bearbeitet werden konnten. Pauls Leute, wie sie Otto von Dannenburg immer nannte, besaßen jedoch noch ein weiteres Aufgabengebiet, es war ausschließlich den Männern vorbehalten: Sie sollten in Zukunft das Anwesen vor unbefugtem Zutritt schützen, damit waren vor allem die Schergen der Partei gemeint.
Noch etwas wurde umgesetzt und abgeschlossen: Ottos Areal umspannten, dort wo es sich bewerkstelligen ließ, elektrische Zäune. Nur entlang der natürlichen Grenze des Flusses Ryck, der das Grundstück des Pferdezüchters von der Umgebung in Richtung Greifswald trennte, war darauf verzichtet worden. Alles in allem hatte das Anwesen des Gutsbesitzers eine enorme Wertsteigerung durch die baulichen Maßnahmen erfahren, zudem vermittelten die neu entstandenen Objekt und Sicherheitseinrichtungen das Gefühl, sich in einer heilen Welt zu befinden. Doch letzteres war eine Momentaufnahme, dessen war sich vor allem Otto von Dannenburg bewusst. Sein Pessimismus in Hinblick auf die Zukunft wollte ihn nicht verlassen, obwohl er durchaus Grund zur Freude hatte. Sein kühnes Vorhaben mit der "Deutschen Reitersportschneiderei" schien aufzugehen, wenn auch langsam. Die Nachfrage stieg von Monat zu Monat, sogar jetzt im Winter.
Das Wetter ließ allerdings viele Wünsche offen. Der Winter war kalt, oft zudem nass, damit noch häufiger glatt. Eiszapfen bildeten sich, schmolzen, ein paar Tage später hingen solche erneut an den Dachrinnen. Die Farben des Himmels wechselten sich in einer Eintönigkeit ab, die jedes Gemüt in eine depressive Stimmung versetzen konnten. Mal war es grau, dann dunkelgrau, nur gelegentlich wurde die Wolkendecke ein wenig heller. Von Schnee war weit und breit nichts zu sehen, falls doch, handelte es sich um Schneematsch, der nicht lange liegen blieb. Mitunter passierte es, dass eine Weide unter Wasser stand und schon am nächsten Tag zu einer Eisfläche geworden war. Gegen die Launen des Wetters konnte niemand etwas machen, dafür war es ab und zu möglich, die Stimmungen von Menschen positiv oder negative zu beeinflussen. Wenige Tage vor der nächsten Volksabstimmung, die am 13. Januar stattfinden sollte und bei der es um die Rückgliederung des Saargebiets ging. Kam Hildegard auf ihren Mann zu.
»Otto, du musst mit Gottlieb sprechen, er wirkt in letzter Zeit ziemlich niedergeschlagen. Ich habe mich mit Maria unterhalten, sie sagt auch, er ist komisch geworden, kennt jedoch die Gründe nicht.«
»Ich weiß, was ihn umtreibt und ehrlich gesagt, mir gefällt es ebenso wenig wie ihm«, erwiderte Otto, der im Wohnzimmer vor dem lodernden Kamin stand und eine Pfeife in der Hand hielt.
»Ach, habt Ihr euch schon ausgetauscht?« Otto winkte ab, während sich Hildegard in einen Sessel setzte, sich umsah, fragte: »Wo ist Mutter?«
»Ich habe sie nach oben gebracht, sie war müde, wollte früh zu Bett«, klärte der Gutsbesitzer seine Frau auf, nahm ebenfalls in einem Sessel Platz. Natürlich nicht in irgendeinem, sondern in seinem Lieblingssessel, in den sich ansonsten niemand zu setzen traute.
»Gut, sie sagte heute Morgen schon, dass Wetter setzt ihr zu. Nun, welches Geheimnis teilst du mit Gottlieb?«
»Gottlieb macht sich Sorgen wegen seinem Sohn. Jakob hat in Greifswald eine Art Widerstandbewegung gegründet, er will sich bei Bedarf so gegen den braunen Mob wehren.«
»Mein Gott, ist der Junge verrückt geworden?«
Otto lächelte. »Der Junge ist inzwischen Vater von zwei Kindern und wird bald neununddreißig Jahre alt«, bemerkte der Pferdezüchter, ergänzte: »Er ist also mittlerweile so klug, dass er seine Organisation unter einem falschen Deckmantel betreibt, in erster Linie will er Ausreisewilligen Juden dabei helfen, dass Deutsche Reich verlassen zu können. Dass er auch deswegen eines Tages Probleme bekommen kann, liegt auf der Hand. Gottlieb hat mich erst vorgestern in die Sache eingeweiht, mich gebeten, Jakob ins Gewissen zu reden. Unbestritten, er ist drauf und dran seine Frau und Kinder in Gefahr zu bringen. Die Feindseligkeit gegen jüdische Mitbürger ist da, köchelt vor sich hin. Es kommt der Tag, an dem der Hass erneut in vollem Umfang ausbricht, den Topf zum Überlaufen bringen wird. Ich werde mit ihm reden, aber wenn er schon nicht auf seinen Vater hört, werden meine Worte kaum helfen.«
»Versuch es trotzdem«, meinte Hildegard besorgt. »Ist ihm nicht klar, dass er nicht nur seine Familie, sondern auch die seiner Schwester einer Gefahr aussetzt?«
Der Gutsbesitzer zuckte mit den Schultern. »Bestimmt hat er sich darüber den Kopf zerbrochen, so wie ich ihn kenne, ist es ihm auch bewusst. Nur stecken wir nicht in seiner Haut, ich kann ihn einerseits verstehen«, meinte er.
»Hier geht es nicht um ihn allein, mach ihm das klar. Bekommt er Schwierigkeiten, hängen wir zum Teil mit drin, schließlich leben seine Eltern auf unserem Grund und Boden. Wir haben es doch schon erlebt: Gerät ein Jude ins Visier, werden alle seine Angehörigen und Freunde drangsaliert«, erinnerte sich Hildegard an die Vorgänge am Februar/März 1933.
»Mal sehen, ob ich etwas erreichen kann«, gab Otto von sich, sein Zweifel schwang in seiner Stimme mit.
Hildegard erhob sich. »Mich ruft das Bett, ich bin müde. Kommst du auch?«
»Bald, Schatz. Ich rauche die Pfeife zu Ende«, sagte Otto, woraufhin er einen Kuss erhielt und seiner Frau noch nachsah. Der Pferdezüchter fühlte sich nicht ganz wohl in seiner Haut, denn er war weder zu seinem Freund und "Ersatzvater" Gottlieb Rothenbaum noch zu seiner Frau komplett ehrlich gewesen. Beide hatte er nicht angelogen, ihnen jedoch verheimlicht, dass Jakob Rothenbaum ihn vor ihren Gesprächen bereits kontaktiert und um ein Treffen ersucht hatte.
Otto hätte dem Sohn seines Freundes niemals eine Absage erteilt, nur verlief die Kontaktaufnahme Jakobs völlig anders als eine normale Unterhaltung. Jakob hatte einen Boten mit einigen Zeilen auf das Gestüt geschickt, wahrscheinlich deshalb, um nicht in die Arme seines Vaters Gottlieb zu laufen. Der Junge mit der Botschaft gab an, auf eine Antwort seitens des Gutsbesitzers warten zu müssen, woraufhin Otto sich das Schreiben sofort durchlas. Mit den Worten, "Ich werde da sein", entließ er den Botenjungen, wunderte sich über die Geheimnistuerei. Durch das Gespräch mit Gottlieb erfuhr er kurz darauf den Grund für das Verhalten Jakobs, doch bei dem Wortwechsel mit dessen Vater verschwieg Otto die geplante Zusammenkunft mit Jakob, die erst im Februar stattfinden sollte. Dass der Termin erst im kommenden Monat auf dem Kalender stand, lag nicht an dem Pferdezüchter, sondern an Jakob, der dieses Datum, aus welchen Gründen auch immer, vorgeschlagen und gewählt hatte.
Ω
W
alter von Dannenburg bemerkte im neuen Jahr schnell, dass sich einiges geändert hatte. Seine Frau Luise war zugänglicher geworden, was er auf seine Zukunftsperspektiven schob. Ihm war das weshalb und wieso ohnehin egal, was in dieser Hinsicht für ihn zählte, bestand aus drei Orten: Schlafzimmer, berufliches und privates Umfeld. Im Bett war Luise endlich wieder willig. Wo er auf über ihm stehende Parteimitglieder traf, zeigte sie sich ihm treu ergeben und wurde einer Einladung gefolgt oder waren solche verschickt worden, benahm sich Luise bei entsprechenden Diners oder Partys wie eine Frau, die ihren Mann liebte und bewunderte.
Das Leben schien wunderbar, eine erfolgreiche Karriere lag in greifbarer Nähe, doch einen Makel gab es: In der Greifswalder Öffentlichkeit spürte Walter wegen seines Gebarens eine deutliche Abneigung, da und dort auch vorwurfsvolle Blicke aufgrund von Siglindes spurlosen Verschwindens. Unabhängig davon, welche Fehler Walter besaß, in einem boshaften charakterlichen Wesenszug hatte er dazugelernt: Er war undurchschaubarer geworden, ließ sich nicht anmerken, dass er wusste, was mit Siglinde geschehen war und wo sie sich befand. Dabei hätten es ihm seine Kontakte und Möglichkeiten inzwischen erlaubt, eine Intrige zu spinnen, aus der er als unschuldig hervorgegangen wäre, die jedoch dazu führen konnte, den Leichnam der jungen Frau an ihre Eltern zu übergeben. Daran oder an ähnliches hatte Walter bisher keinen Gedanken verschwendet. Obwohl es niemand ahnte oder gar wusste, fast schien es, als ob Walter Siglinde für sich behalten wollte.
Manchmal träumte er von ihr, wenn es sich dabei um einen Albtraum handelte und er schweißgebadet wach geworden war, fiel er aus Lust über Luise her, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie schlief oder es wollte. Ansonsten bereitete sich Walter von Dannenburg auf seine künftige Aufgabe vor, auf die er sehr stolz war. Einen "Totenkopfverband" in Pommern mit dem Hauptsitz in Greifswald aufzustellen, für ihn war es eine Ehre. Er hatte mit dieser Aufgabe noch gar nicht begonnen, trotzdem war er innerhalb der Partei schon dort angekommen, was er als Sprungbrett dafür ansah, eines Tages neben Adolf Hitler stehen zu dürfen. Natürlich besetzte Walter noch nicht die Position, durch die ihm eine Sonderbehandlung zuteilgeworden wäre, doch immerhin, auch wenn er nicht immer durchgestellt wurde, er besaß mittlerweile einen Draht zu Rudolf Heß, Heinrich Himmler und anderen Größen der Partei. Bewusst vermied es Walter voreilig oder aufdringlich zu handeln, aber allein die Tatsache, dass er über die Kontakte verfügte, machte ihn so glücklich wie ein kleines Kind, dem während einer Hungersnot eine Tafel Schokolade gegeben wurde.
Ω
E
r kam, der 13. Januar: Bei der im Friedensvertrag von Versailles vorgesehenen und vom Völkerbund durchgeführten Volksabstimmung im Saargebiet waren 90,8 % für die Rückgliederung an das Deutsche Reich, 8,8 % für die Selbständigkeit des Saargebietes und 0,4 % für den Anschluss an Frankreich. Nach dem deutlichen Mehrheitsergebnis flohen vier- bis achttausend Hitlergegner nach Frankreich oder in andere Länder. Das Saargebiet gehörte in der Folge ab dem 1. März wieder uneingeschränkt zum Deutschen Reich. Es wurde jedoch nicht wieder an Preußen oder Bayern zurückgegliedert, sondern blieb als politische Einheit unter dem neuen Namen Saarland erhalten. Die Verwaltung übernahm Josef Bürckel bereits am 11. Februar, als Reichskommissar hatte er seinen Sitz in Saarbrücken.
So lauteten die Abstimmungszahlen damals, doch die Rückgliederung des Saarlandes besaß eine Vorgeschichte, die zu der Zeit in vielen Augen eine Demütigung des Deutschen Reiches darstellte. Nicht nur, aber auch Adolf Hitler wollte diese Schmach aus den Geschichtsbüchern tilgen, wobei sich einst bis in die Gegenwart über seine Motive diskutieren lässt.
Otto von Dannenburg kannte den Prolog, der die Volksabstimmung einläutete, nicht bis ins kleinste Detail, aber General Freiherr Karl von Plettenberg nahm sich die Zeit, um seine Wissenslücken zu füllen. Es geschah jedoch erst im Februar, als der ehemalige Kommandeur seines im Ersten Weltkrieg gefallenen Vaters die Einladung zur Geburtstagsfeier seiner Mutter wahrnahm.
Ω
B
evor die letzte Woche des Januars anbrach und der Monat zu Ende ging, wurde es turbulent. Während Peter von Dannenberg, geborener Dannenburg, in Boston eifrig seinem Studium nachging und auf der Ranch von John James McKenzie der Alltag arbeitsmäßig dem auf dem Gut von Otto ähnlich war, zog Amanda in New York die Strippen. Wie Marionetten hingen Charles und Henry Chester an ihren Fäden.
Nachdem Amanda seit geraumer Zeit wusste, dass Henry homosexuell war, musste sie nicht lange darüber nachdenken, wie sie die Neigung des Bruders ihres Mannes zu ihrem Vorteil ausnutzen konnte. Dabei ging sie nicht überhastet vor, sondern legte eine Geduld an den Tag, die ihre ohnehin vorhandene Ausdauer in den Schatten stellte. Über mehrere Wochen behielt sie das brisante Geheimnis für sich, absichtlich schlug sie erst im neuen Jahr zu. Sie hatte bei Henry eine Audienz eingefordert, während der Unterhaltung ihm die Wahl gelassen: Entweder er würde seinen Bruder aus der gemeinsamen Rechtsanwalt- und Detektivkanzlei ausbooten oder sie wäre gezwungen, seine sexuellen Vorlieben öffentlich machen.
Der unter Druck gesetzte Henry war nicht so gutmütig und blauäugig wie sein Bruder. Obwohl Amanda ihm sagte, sie würde nach der Erfüllung ihrer Forderungen die Stadt verlassen und Henry für immer in Ruhe lassen, hegte er keine Zweifel, dass Amanda ihn mit ihrem Wissen immer wieder zu erpressen imstande war. Henry mochte seinen Bruder, die Kanzlei war von ihnen beiden aufgebaut worden, besaß einen sehr guten Ruf, auch eine hohe Zahl an Klienten, die sich regelmäßig in verschiedenen Rechtsfragen beraten oder bei Vertragsabschlüssen beraten sowie begleiten ließen. Nun verhielt es sich so, auch Henry Chester war nur ein Mensch, weshalb ihm die Forderung Amandas immer sympathischer wurde. Tatsache war nämlich, so dachte er, wenn sein Bruder von seiner Homosexualität erfahren sollte, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis Charles versuchen könnte, die Kanzlei an sich zu reißen. Henry konnte zwar nicht in die Zukunft sehen, doch seine Erfahrung besagte, dass diese Möglichkeit sehr nahe an der Wahrheit und Realität lag. Der Gedanke, Alleininhaber von Chester & Chester zu sein, damit der Ausbootung seines Bruders zuvorzukommen, erschien ihm somit logisch. Henrys Überlegungen beinhalteten zudem die Konsequenzen: Jeder Satz und alle Handlungen die Charles ihm hinterher zum Vorwurf machen würde, die Öffentlichkeit und Kunden der Kanzlei bekämen den Eindruck, es wären dessen Rachegelüste.
Henry Chester war sich sicher, dass er diesen Kampf mit einem lachenden und weinenden Auge gewinnen konnte, sogar eine Wiedergutmachung an Charles war später denkbar, allerdings erst, wenn er das Problem namens Amanda gelöst hätte. Henry, Rechtsanwalt und zugelassener Privatdetektiv fing somit an, vom rechten Weg abzukommen. Die Zukunft musste zeigen, ob er Amanda gewachsen war.
Ω
C
harles Chester war es keineswegs, ihm standen die Gefühle zu Amanda im Weg. Außerdem kannte er das Geheimnis seines Bruders nicht, wofür sein Gemüt verantwortlich war. Charles war in gewissen Dingen und Handlungsweisen härter konstruiert als sein Bruder, seine Korpulenz trug ab und zu dazu bei, dass er bei der Ausübung der Tätigkeit als Privatdetektivs von seinen Kontrahenten unterschätzt wurde.
Charles reagierte oft schneller als es ihm zugetraut wurde, auch hatte er keine Probleme damit, im Notfall eine Waffe einzusetzen, was in New York häufiger der Fall war als von ihm gewünscht. Nicht immer musste er den Abzug betätigen, nur hatte es sich in einigen Fällen nicht vermeiden lassen. Ansonsten gab sich Charles in der Regel friedfertig, zumeist gut gelaunt, schon diese Wesenszüge trugen dazu bei, dass er Amanda in gewisser Weise unterlegen war und sie ihn als ihr nächstes Opfer ausgewählt hatte.
Nachdem die ersten Wochen im Januar zwischen Charles und Amanda mehr oder weniger monoton abgelaufen waren, setzte Amanda ihren still und heimlich begonnenen Kreuzzug fort. Nach wie vor war sie in der Kanzlei Chester & Chester beschäftigt, bekam inzwischen sogar mehr Gehalt, konnte sich zudem als die Vertreterin der Chefsekretärin bezeichnen. Sie hatte sich gegen ihren Willen mit Charles arrangieren müssen, damit sollte nun Schluss sein. Keiner, auch ihr Vater, John James McKenzie nicht, wäre in der Lage gewesen, Amandas Intrigenspiel zu durchschauen. Zugetraut hätte man ihr jedwede Bosheit, doch sie schlug eine andere Vorgehensweise ein.
Die letzte Januarwoche brach an als Amanda unerwartet zu Charles ins Schlafzimmer kam. Nach wie vor wurde meist in getrennten Räumen geschlafen und obwohl verheiratet, war Charles so anständig geblieben und nie aufdringlich geworden. Er lag im Bett, das Licht einer Öllampe ermöglichte es ihm, sich in ein Buch zu vertiefen. Als die Tür aufging, sah er Amanda überrascht an, ließ sich von ihr die Lektüre aus den Händen nehmen. Perplex verfolgte er ihre nächste Handlung, die darin bestand, sich vor seinen Augen auszuziehen und zu ihm unter die Decke zu kriechen. Zum ersten mal erfüllte Amanda sozusagen ihre Ehepflichten, wobei Charles sich zumindest an diesem Abend als ein sekundenschneller Liebhaber erwies. Aus Scham rollte er sich von Amanda auf den Rücken, blickte wortlos zur Decke.
»Liebling, dass macht doch nichts. Es war trotzdem schön, dich zu spüren«, sagte Amanda, schmiegte sich an ihn, legte ihren Kopf auf seine Schulter und begann mit ihren Fingern mit seinen Brusthaaren zu spielen.
»Es tut mir leid«, erwiderte Charles peinlich berührt, auch ein wenig liebestrunken, da er nicht fassen konnte, was ihm soeben widerfahren war.
Amanda fuhr mit ihrer verständnisvollen Taktik fort, baute Charles auf, indem sie sich überzeugt zeigte, dass die nächsten Liebesnächte noch schöner werden würden. So ging es minutenlang dahin, bis Amanda raffiniert das Thema wechselte, zuerst auf einem anstrengenden Tag in der Kanzlei zu sprechen kam. Anschließend äußerte sie sich lobend oder abfällig über Kollegen, je nach deren Wert in ihrer Beliebtheitsskala, schließlich trat das ein, worauf sie hingearbeitet hatte. Charles fing über die Gründung der Kanzlei zu reden an, glorifizierte seinen Bruder über den grünen Klee, stellte auch fest, dass es die Firma ohne Henry nicht geben würde. Amanda hörte interessiert nach dem Motto zu, "Wer weiß, welche Informationen eines Tages nützlich sein können", im Anschluss richtete sie sich auf und stützte ihren Kopf an ihrem Arm ab.
Charles bemerkte ihre plötzlich traurig wirkende Wesensveränderung, legte sich ebenfalls auf die Seite. »Was ist, habe ich etwas falsches gesagt?«
»Nein, nein, Darling, alles gut. Es ist nur so, dass ich mir Sorgen um dich mache.«
Charles lächelte erfreut. »Musst du nicht, weshalb solltest du?«
Amanda bekam auf einmal feuchte Augen. »Es geht um deinen Bruder, ich glaube, er will dich aus der Kanzlei drängen«, behauptete sie weinerlich.
»Mich? Wieso? Warum sollte er das tun?«
»Er hat Angst, dass du hinter sein Geheimnis kommt«, erwiderte sie.
»Welches Geheimnis?«, zeigte sich Charles überrascht und unwissend.
»Henry ist homosexuell, Charles. Er denkt, wenn du dahinterkommst, wirst du ihn loswerden wollen.«
Der Rechtsanwalt wirkte schockiert. »Er ist was?«
»Du hast mich schon verstanden«, entgegnete Amanda, gab sich so, als ob sie die sexuelle Neigung nicht erneut aussprechen könnte. Sie sah, wie chaotisch es im Kopf ihres Mannes zuging.
Charles stieg aus dem Bett, zog sich einen Bademantel an, fragte: Woher weißt du es?«
Wie es Amanda schaffte, auf einmal rot zu werden, blieb ein Rätsel. »Es tut mir leid, Charles. Ich kam zufällig dahinter, befürchte, dass es auch die Chefsekretärin mitbekommen hat.«
»Kannst du deutlicher werden?«
Amanda setzte sich im Bett hin. »Ich habe vor kurzem meinen Hausschlüssel in der Firma vergessen, musste zurück, um ihn zu holen. Als ich das Büro betrat, verließ es Miranda fluchtartig. Bei der Suche nach dem Schlüsselbund hörte ich Geräusche, versteckte mich. Ich sah einen jungen Mann aus Henrys Büro herauskommen, es geschah in einer eindeutigen Pose. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, ich war natürlich entsetzt. Als der junge Mann weg war und Henry die Tür zu seinem Arbeitsraum hinter sich geschlossen hatte, verschwand ich so schnell und leise wie ich konnte.«
»Wann war das?«, erkundigte sich Charles ungläubig.
»Ende des vergangenen Jahres«, log Amanda wie zuvor in Bezug auf die Chefsekretärin erneut.
»Trotzdem sagst du es mir erst jetzt?«, stellte Charles verärgert fest.
Amandas Gesichtsröte war schon bei der ersten Lüge verschwunden, nun fielen ein paar Tränen auf ihre Wangen. »Ich dachte, du würdest mir nicht glauben, auch wollte ich mich nicht zwischen euch stellen«, sagte sie entschuldigend, perfekt jammernd. Sie ließ sich von Charles aus dem Bett ziehen, umarmen und konnte sicher sein, ein Chaos angerichtet zu haben.
A
m gleichen Tag, dem 24. Januar 1935 setzte sich im deutschen Reich die Gleichschaltung der Justiz fort. Demokratische Elemente wie die Bürgermeisterwahl oder Abstimmungen im Ratsgremium wurden abgeschafft, die maßgebliche Stellung der NSDAP fest verankert.
Das Führerprinzip war ein fundamentales Prinzip des Faschismus der Zwischenkriegszeit und seiner Führerparteien. In der sozialen Verfassung einer Gesellschaft stellte es sich grundsätzlich gegen Demokratie und Parlamentarismus. In Deutschland war der Kern des Übergangs vom vor dem Nationalsozialismus herrschenden Parlamentarismus der Weimarer Republik zum in der Diktatur Hitlers bestehenden Führerprinzip im Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933 zu sehen, in dem der Reichstag der Reichsregierung die Möglichkeit überließ, Beschlüsse des Diktators und seiner Regierung in Form von Gesetzen und Verordnungen ohne jede Kontrolle für alle verbindlich zu machen. Dieses ungewöhnliche Gesetz, vorher waren Ermächtigungsgesetze nur für den äußersten Notfall gedacht, zum Beispiel für kriegerische Auseinandersetzungen, wurde zum Prinzip des nationalsozialistischen Staates: Grundsätzlich sollte es zwar noch Beratungen, aber keinerlei Abstimmungen mehr geben, sondern Entscheidungen ganz oben oder an der obersten Stelle der jeweiligen Hierarchie getroffen werden. Diese Entscheidungen wurden entweder geheim gehalten oder in Form von Gesetzen, Verordnungen und schriftlichen Anweisungen von oben nach unten "durchgereicht". Nach der in der Zeit des Nationalsozialismus gültigen Definition des einflussreichen Verfassungsjuristen Ernst Rudolf Huber war die Führergewalt nicht durch Kontrollen gehemmt, sondern ausschließlich und unbeschränkt: "Die Führergewalt ist umfassend und total, sie vereinigt in sich alle Mittel der politischen Gestaltung. Sie erstreckt sich auf alle Sachgebiete des völkischen Lebens, erfasst alle Volksgenossen, die dem Führer zu Treue und Gehorsam verpflichtet sind".
Das Führerideal sollte dabei auch auf die jeweils tiefere Ebene in der Hierarchie ausstrahlen. In diesem Sinne wurde das diktatorische Führerprinzip bei der Reorganisierung von Unternehmen im Laufe der nationalsozialistischen Gleichschaltung angewendet, zum Beispiel in den Betrieben, deren Leiter zu "Betriebsführern" umbenannt und mitsamt den Arbeitnehmern als "Gefolgschaft" in Massenorganisationen eingegliedert worden waren. So wurde versucht, den ideologisch unerwünschten Gegensatz in den Produktionsverhältnissen, zwischen den Inhabern der Produktionsmittel und den Arbeitern, sprachlich aufzulösen.
In der Praxis der Wirtschaft jedoch trat das Führerprinzip nur als Formel in Erscheinung, während die tatsächlichen Strukturen, Regeln und Verfahren etwa für Aufgabenverteilung und Informationsfluss nicht geändert wurden. Organisationstheoretisch blieb das Führerprinzip damit in der Regel eine leere Hülse ohne eigene Form. Psychologisch war der Führergedanke eng verwoben mit der nationalsozialistischen Massenideologie und dem Bedürfnis von Führer und Masse nach wechselseitiger Bestätigung. Die Masse konnte demnach ihre entpersönlichten Bedürfnisse in der Person des Führers verwirklichen, der seinerseits volkstribunhafte Akzeptanz in einer korporatistischen Gesellschaftsordnung, der "Volksgemeinschaft", genoss und durch Akklamation bestätigte.
In Vereinen wurde das Führerprinzip Mitte des Jahres 1933 umgesetzt. Der Vorsitzende des Vereins wurde "entsprechend der Gleichschaltung neugewählt". Seine Vertreter ernannte er dann, was "der Genehmigung der höheren Stellen unterlag". Danach nannte er sich nicht mehr "Vorsitzender", sondern "Führer". Dies funktionierte auch auf mehreren Ebenen, so ernannte der Führer den Reichssportführer, dieser den Verbandsführer, dieser den Vereinsführer. Hierbei konnte es durchaus zu Konflikten und nachträglichen Korrekturen kommen, da beim Zusammenschluss von Verbänden im Zuge der Gleichschaltung verdiente Nationalsozialisten gegenüber anderen Parteigenossen oft zurückstehen mussten und sie sich dies häufig nicht gefallen ließen. Mit dem Führerprinzip wurde gewissermaßen das militärische Prinzip von Befehl und Gehorsam durch unbedingten Gehorsam verengt, der auch in der Zivilgesellschaft verlangt wurde. Es war deshalb nur konsequent, dass Hitler nach dem Tod des Reichspräsidenten von Hindenburg ab Sommer 1934 als "Führer und Reichskanzler" den Eid der Wehrmacht auf sich als Führer des Deutschen Reiches und Volkes und später als Obersten Befehlshaber der Streitkräfte formulieren ließ. Ab 1935 galt für die Gemeinden des Dritten Reiches die Deutsche Gemeindeordnung, wonach sie in der "gelenkten Selbstverwaltung" in die mittelbare Staatsverwaltung eingebunden werden sollten und die Bürgermeister nicht mehr gewählt, sondern auf Parteivorschlag ernannt wurden. Hierzu hatte der jeweilige Kreisleiter der NSDAP, im Sinne der "Einheit von Partei und Staat", der zuständigen Behörde drei Bewerber vorzuschlagen.
Der Würgegriff des Führers wurde immer fester und im Umfeld von Otto von Dannenburg gab es Leute, die meinten, dass der Erste Weltkrieg und die Konsequenzen aus ihm vor allem durch Adolf Hitler dazu beitrugen. Wieso sich der "Schluchtenscheißer" einerseits dermaßen für das deutsche Volk einsetzte, es andererseits ausnutzte und blendete, die Freiheit im Deutschen Reich ausschaltete, vermochte jedoch niemand zu sagen. Einige Freunde des Gutsbesitzers vertraten die Auffassung, der Führer wäre durch den Ersten Weltkrieg traumatisiert, deswegen hasserfüllt und voller Rachegelüste. Andere hingegen, ihre Ansicht vertrat auch der Pferdezüchter, glaubten, dass Hitler seinen bis dahin ruhmlosen und fast schon peinlichen Werdegang mit Gewalt umschreiben wollte.
Das Führerprinzip! In gewisser Weise kam es auch Walter von Dannenburg entgegen. Spätestens nach der Gründung eines "Totenkopfverbandes" würde es ihm noch mehr Macht verleihen, sein Wort ein deutlich größeres Gewicht haben.
Der Vertrag von Versailles
Der Vertrag war das Ergebnis der Pariser Friedenskonferenz 1919, die im Schloss Versailles vom 18. Januar 1919 bis zum 21. Januar 1920 tagte. Ort und Eröffnungsdatum waren nicht zufällig gewählt worden: 1871 hatten deutsche Würdenträger während der Belagerung von Paris die Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles vorgenommen. Dies verstärkte, neben anderen Faktoren, zum Beispiel den hohen Reparationen Frankreichs an Deutschland, die deutsch-französische Erbfeindschaft und den französischen Revanchismus. Frankreichs Regierungschef Georges Clemenceau erhoffte sich durch die Wahl des Ortes die Heilung eines nationalen Traumas. Das gleiche Motiv sollte Adolf Hitler später auch verfolgen.
Vorangegangen war am 8. Januar 1918 das 14-Punkte-Programm von US-Präsident Woodrow Wilson, das aus deutscher Sicht Grundlage für den zunächst auf 36 Tage befristeten Waffenstillstand von Compiègne am 11. November 1918 war. Vorab tagte ein engerer Ausschuss des Kongresses, der sogenannte Rat der Vier, dem US-Präsident Woodrow Wilson, der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau, der britische Premierminister David Lloyd George und der italienische Minister Vittorio Emanuele Orlando angehörten. Der Rat legte die wesentlichen Eckpunkte des Vertrags fest. An den mündlichen Verhandlungen nahmen nur die Siegermächte teil, mit der deutschen Delegation wurden lediglich Memoranden ausgetauscht. Das Ergebnis der Verhandlungen wurde der deutschen Delegation schließlich als Vertragsentwurf am 7. Mai 1919 vorgelegt, nicht zufällig am Jahrestag der Versenkung der Lusitania. Die deutsche Delegation, zu der auch die Professoren Max Weber, Albrecht Mendelssohn Bartholdy, Walther Schücking und Hans Delbrück sowie der General Max Graf Montgelas gehörten, weigerte sich zu unterschreiben und drängte auf Milderung der Bestimmungen, wobei die deutsche Delegation zu den mündlichen Verhandlungen nicht zugelassen wurde. Stattdessen waren nur schriftliche Noten ausgetauscht worden. Zu den wenigen Nachbesserungen in der am 16. Juni von den Alliierten vorgelegten Mantelnote gehörte die Volksabstimmung in Oberschlesien. Die Siegermächte ließen weitere Nachbesserungen nicht zu und verlangten ultimativ die Unterschrift. Andernfalls würden sie ihre Truppen nach Deutschland einrücken lassen. Hierfür hatte der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte, Marschall Ferdinand Foch, einen Plan ausgearbeitet: Vom bereits besetzten Rheinland aus sollten die Truppen der Entente entlang des Mains nach Osten vorrücken, um auf kürzestem Wege die tschechische Grenze zu erreichen und so Nord- und Süddeutschland voneinander zu trennen.
In Deutschland war die Empörung über die Friedensbedingungen einhellig groß. Ministerpräsident Philipp Scheidemann stellte am 12. Mai 1919 in der Weimarer Nationalversammlung die rhetorische Frage, die später zum geflügelten Wort wurde: "Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte?" Der spätere preußische Ministerpräsident Otto Braun erklärte am 21. Mai, es sei "noch nie in der Weltgeschichte ein so schamloser Betrug an einem Volke verübt" worden. Der Vertrag ziele darauf, "das deutsche Volk in dauernde Sklaverei zu führen", daher sei er vollständig unannehmbar und dürfe nicht unterzeichnet werden. In Kreisen um den Oberpräsidenten von Ostpreußen, Adolf von Batocki, den Sozialdemokraten August Winnig und General Otto von Below wurden Pläne entwickelt, die Friedensbedingungen rundweg abzulehnen und Westdeutschland den einrückenden Truppen der Siegermächte kampflos zu überlassen. In den preußischen Ostprovinzen, wo die Reichswehr noch verhältnismäßig stark war, sollte dann ein Oststaat als Widerstandszentrum gegen die Entente gegründet werden.
Am 20. Juni 1919 trat das Kabinett Scheidemann zurück. Denn unter dem Druck des drohenden Einmarsches und der trotz Waffenstillstand fortbestehenden britischen Seeblockade, die eine dramatische Zuspitzung der Ernährungslage befürchten ließ, führte an einer Ratifizierung des Versailler Vertrags kein Weg vorbei.