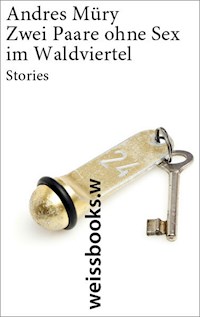
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weissbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Ins Land von Milchrahmstrudel und "Felix"-Ketchup reist man nicht risikolos. Hier erfand Freud bekanntlich auch die Wiederkehr des Verdrängten. Die vier narzisstischen Exemplare, die der Schweizer Erzähler Andres Müry in seine Wahlheimat Österreich schickt, erfahren es je auf ihre Weise. Volker, der Modefotograf aus Paris, begegnet im Waldviertel den eigenen sexbesessenen Siebzigerjahren. Für Harry, den deutschen Fernsehkommissar, wird der Besuch eines Wiener Massagestudios zum blutigen Albtraum. Im Salzkammergut stößt Felix, der Zürcher Lifestyle-Reporter, auf die Leiche einer begeisterten Leserin. Und Max, den schwulen Schweizer Diplomaten, macht eine schicksalhafte Begegnung vor der Wiener Albertina zum unfreiwilligen Vaterschaftsexperten. Mit rasanten Twists erzählt, balancieren die vier Stories souverän zwischen Komik und Tragik, Unterhaltung und Tiefsinn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Andres Müry
Zwei Paare ohne Sex im Waldviertel
Stories
© Weissbooks GMBH Frankfurt am Main 2016
Alle Rechte vorbehalten
Konzept Design
Gottschalk+Ash Int’l
Satz
Publikations Atelier, Dreieich
Umschlaggestaltung
Julia Borgwardt, borgwardt design
Foto Andres Müry
© Michael Utz
Erste Auflage 2016
ISBN 978-3-86337-095-4
Dieses E-Book ist auch als Printversion erhältlich
ISBN 978-3-86337-101-2
weissbooks.com
Andres MüryZwei Paare ohne Sexim WaldviertelStories
Zwei Paare ohne Sexim Waldviertel
Die Liebe mit der Sexualität zu verbinden,war einer der bizarrsten Einfälle des Schöpfers.
Milan KunderaDie unerträgliche Leichtigkeit des Seins
Zwei Paare ohne Sex im Waldviertel
Alte Liebe
Gmundner Glück
Eine Art Familie
Zwei Paare ohne Sex im Waldviertel
Der Name stand groß und deutlich am Schaufenster der Galerie: Rebekka Jakobson. Zwei Tage war ich schon daran vorbeigegangen, jedes Mal wenn ich aus dem Nebenhaus kam oder es betrat, aber ich hatte offenbar keine Augen dafür gehabt, sondern nur für Sophie, mit der ich eng umschlungen ging. Besser gesagt: ich war blind auch für uns beide. Wie sonst hätte ich mich als Fotograf auf ein Model einlassen können, das gerade neunzehn war, so alt wie meine Enkeltochter? Sophie hatte ich in Paris bei einem Shooting kennengelernt und nach drei Sommernächten war ich töricht genug gewesen, ihrer Einladung nach Wien zu folgen. Am Opernring teilte sie mit zwei anderen Nachwuchsmodels eine Dachwohnung. Statt in einem charmanten Hotel fanden wir uns nach Sophies Willen in ihrer WG – und Ende August war es unter dem Dach auch noch stickig und heiß.
Am dritten Morgen, nachdem wir uns erstmals gestritten hatten – über mein Pinkeln im Stehen –, ging ich allein voraus, um drunten auf der Straße Luft zu schnappen. Da fiel es mir endlich ins Auge: Rebekka Jakobson. Es traf mich wie ein Schlag. Eine Rebekka dieses Namens hatte ich vor bald vierzig Jahren in Salzburg gekannt und seitdem nie wiedergesehen. Allerdings hatte sie damals am Mozarteum nicht wie ich Kunst studiert, sondern Gesang. Für Malerei hatte sie sich, soviel ich wusste, nicht interessiert. Später wurde sie eine bekannte Opernsängerin, das war mir in der Ferne nicht entgangen, mit Auftritten in Bayreuth, an der Met in New York, vermutlich auch in Wien.
Sophie kam in ihrem zerfetzten Jeansanzug und den bänderlosen Converse daher, die Louis-Vuitton-Tasche über der Schulter. Das Schönste an ihr, die verschieden großen braunen Augen mit dem grünlichen Schimmer, war hinter der Sonnenbrille verborgen. Ich zeigte auf das Schaufenster: »Die Malerin kenn ich.« Sie zog eine Schnute und folgte mir hinein.
Gleich im ersten Raum hing ein großes Tafelbild, circa eins fünfzig auf zwei Meter. Vom Stil her erinnerte es an Hodler, an den Symbolismus um 1900. Eine Landschaft in der Abenddämmerung, über einem Fichtenwald ging am violetten Himmel ein oranger Mond auf. Im Hof eines hufeisenförmigen, nach vorn offenen Anwesens sah man eine Pietà aus vier Personen, wie auf einer Bühne. Im Zentrum saß die Madonna mit dichtem schwarzen Haar, breitbeinig wie eine Bäuerin, auf dem Schoß einen nackten Jüngling, dessen Haupt nach hinten hing. Sie blickte starr geradeaus, eine Brust lag frei. Links neben ihr ein Mann im langen Jüngerhemd, ebenfalls frontal, aber das Gesicht abgewandt, als wolle er aus Scham nicht hinsehen. Rechts kniete eine Magd mit Kopftuch, vor ihr im Gras eine flache Schale. Sie wusch dem Liegenden mit einem Schwamm das Geschlecht. Dunkles Blut quoll heraus, lief über die Beine und färbte das Gewand der Frau rot.
Am unteren Rand stand in krakeliger weißer Schrift Zwei Paare ohne Sex im Waldviertel, in Klammern Sommer 1973.
Das Bild war von meiner Rebekka, kein Zweifel.
Ich löste mich aus dem Bann, in den es mich versetzt hatte, trat ein paar Schritte zurück und machte mit dem Handy ein Foto.
»Muss ja ein echtes Problem haben, die Frau«, kam es von hinter mir. Sophie hatte mich, ihre Einsfünfundachtzig in einen verchromten Sessel gefläzt, die ganze Zeit beobachtet.
Der Satz war der zweite Schlag, der mich an diesem Morgen traf. In diesem Augenblick wusste ich, dass ich mich zwischen Rebekka und Sophie entscheiden musste. Und dass es zwecklos wäre, es der Jüngeren zu erklären.
Stracks ging ich in den hinteren Raum zu einer Angestellten, die an einem Glastisch saß. Laut Preisliste kostete das Bild 12 000 Euro und war verkauft. Ob sie wisse, an wen? Pikierter Blick. Nein, das könne sie nicht sagen. Ich insistierte nicht, sondern steckte den Prospekt zur Ausstellung ein. Im Umdrehen nahm ich flüchtig eine Serie mit Frauenköpfen wahr, die Münder in verschieden verzerrten Grimassen zum Schrei aufgerissen.
In der Zwischenzeit war Sophie in ihr Handy versunken.
»Ich habe droben etwas vergessen«, sagte ich, um einen leichten Ton bemüht. Sie zog wieder ihre Schnute und erhob sich. Draußen kramte sie die Schlüssel aus der Tasche und ließ sie mit nonchalanter Geste in meine Hand fallen. Der Rest ging schnell. Nach ein paar Minuten war ich mit meinem Trolley wieder unten und gab ihr die Schlüssel zurück.
Ich räusperte mich. »Ich muss allein sein, ich geh ins Hotel.«
Es überraschte sie nicht mehr, der Trolley war ja nicht zu übersehen. Was in ihrem Gesicht vorging, verbarg die Sonnenbrille. Ich setzte zu einer Umarmung an. Sie wich aus.
»Bitte, dann geh halt.«
Es klang wie: Geh, du alter Mann, in deine Hölle zurück. Sie machte auf dem Absatz kehrt und schritt mit ihrem kerzengeraden Modelgang davon. Ich rief ihr ein Danke nach, auch noch ein zweites, lauteres. Ohne zu reagieren, verschwand sie zwischen den Passanten.
Ich kannte ein kleines Hotel nicht allzu weit weg, in der Weihburggasse. Sie hatten noch ein einziges Zimmer, eine Mansarde, an der jede Renovierung vorübergegangen war. Ich landete also wieder unter dem Dach, und wieder gab es kaum Kühlung. Durchs Fenster schwappte eine Welle warmer Luft herein. Im Stehen schrieb ich Sophie eine SMS: Sorry, irgendwann kann ich es dir erklären, Volker.
Ich installierte mich an dem wackligen Biedermeiertischchen und überspielte das Bild vom Handy auf den Laptop. Laut Prospekt hatte Rebekka 1999 mit Singen aufgehört. Seit 2003 stellte sie in Galerien aus, Düsseldorf, München, Berlin, Wien. Seit 2000 lebte sie hier und im Burgenland. In Wien war sie ja auch aufgewachsen, erinnerte ich mich, als Fünfjährige war sie mit den Eltern aus England gekommen. Ohne Mühe fand ich sie mit Google: Walfischgasse, eine Adresse im 1. Bezirk ganz in meiner Nähe, sogar mit Telefonnummer.
Ich holte das Bild auf den Schirm. Rebekka musste nach Fotos gearbeitet haben. Die Madonna trug ihre eigenen Züge, das Gesicht mit den hohen Wangenknochen noch quadratischer als in Wirklichkeit. Der schamhafte Jünger, das Gesicht gelb und durch eine Rainer-Langhans-Brille verunstaltet, das war ich. Die hingegossene Leidensfigur mit den wirren blonden Locken, das war Beat, der Schweizer, der am Mozarteum Bühnenbild studierte und Tag und Nacht Take a Walk on the Wild Side von Lou Reed hörte; erst jetzt fiel mir auf dem Oberarm der kleine Davidstern auf. Die Vierte im Bunde, Klara, meine Klara, war die einzige Österreicherin unter uns und hatte schon das Diplom für klassische Gitarre.
Es war eine religiöse Travestie, die einem Uneingeweihten Rätsel aufgeben musste. Der Titel Zwei Paare ohne Sex im Waldviertel trug nichts zur Klärung bei – im Gegenteil. Er lenkte auf triviale Art von dem Drama ab, das in dem Bild verarbeitet war. Genauso gut hätte man über ein Bild mit dem geblendeten Ödipus Folgen eines Verkehrsunfalls zwischen Vater und Sohn schreiben können.
Tatsache war: Rebekka und Beat, Klara und ich waren damals zwei mehr oder minder lose liierte studentische Paare, alle Mitte zwanzig, und machten Ferien in dem Waldviertler Vierkanthof, der auf dem Bild zu sehen war. Klara hatte uns ins ländliche Waldviertel nordöstlich von Linz gelockt, der Hof lag in der Nähe des Städtchens, aus dem sie stammte. Ihr Vater, der Gemeindearzt, hieß Alois Weixlbaum, ihre Mutter, Marili, hatte dreizehn Kinder geboren und der Ort war Arbesbach, das alles wusste ich noch, als wäre es gestern gewesen.
Klara, eine Teaserin, ließ mich mit ihrem knochigen Körper alles machen, nur das Letzte nicht. Das verteidigte sie wie eine Jeanne d’Arc. Eine Begründung bekam ich dafür nicht, nur ein bockiges Einfach so. Da sie mir gefiel, nahm ich es hin, ich hatte ja auch keinen Notstand: Jedes Wochenende fuhr ich zu Friederike, meinem unkomplizierten Fickverhältnis in München. Dass es bei Rebekka und Beat auf ganz andere Weise im Argen lag, wusste ich anfangs nicht so genau. Auffällig war nur die zur Schau gestellte elegische Zärtlichkeit, mit Händchenhalten und langen Blicken.
Am Ende gab es zwei Tote: Klara und Beat. Sie waren nicht weit von Arbesbach mit dem Motorrad bei einem Wolkenbruch auf kurvenreicher Straße unter einen entgegenkommenden Schwerlaster geschlittert und überrollt worden. Und es gab zwei Überlebende: Rebekka und mich. Wir hatten hinter dem Rücken der beiden anderen eine Affäre angefangen – es war darauf zugelaufen. Zur Zeit des Unglücks lagen wir zusammen in einer Linzer Pension im Bett. Erklärt hatten wir den Ausflug damit, dass sich Rebekka von mir mit ihrem Auto zur Bahn bringen ließ, um nach Wien zu einem Vorsingen zu fahren. Ich selber wollte zur VOEST, zu den Stahlwerken, um für einen Wettbewerb die Industrieanlagen zu fotografieren. Beides stimmte, und die Aktion schien nicht weiter verdächtig.
Die Absteige, die wir fanden, war grindig, in dem Bett unter dem Kruzifix klappte plötzlich nichts mehr, und statt über Nacht zu bleiben, packte Rebekka schon nach zwei Stunden ihre Sachen und stieg in den Zug. Als ich sie, wie verabredet, am übernächsten Vormittag wieder von der Bahn abholte, war sie noch distanzierter. Keine Intimität mehr, als wolle sie alles ungeschehen machen. Ja, das Vorsingen sei gut gewesen, aber sie sei todmüde. Schweigend fuhren wir zurück.
An den Rest erinnerte ich mich nur fetzenhaft. Unser Hof bei der Rückkehr: leer, niemand. Nur Ameisen an einem offengelassenen Honigglas, verklumpt zu einer noch schwach zuckenden Masse. Es sah nach einem überstürzten Aufbruch aus. Wir fuhren zu Schweiger, dem Nachbarbauern, der wusste schon alles. Die aufgelösten Eltern Weixlbaum, mit denen wir stumm in ihrer Zirbenstube saßen. Der Medizinalrat, der immerzu den Kopf schüttelte, besonders untröstlich, denn er hatte Beat seine alte Puch geliehen, mit der er früher über die Dörfer zu den Patienten gefahren war. Nun lag sie als Schrotthaufen in der Garage der Gendarmerie und von den Leichen hieß es, ihr Anblick sei niemandem zuzumuten. Nur die Schuhe und die Helme hatte man einigermaßen heil ausgehändigt.
Das Begräbnis auf dem Arbesbacher Friedhof verpassten Rebekka und ich. Der R4 wollte an dem Morgen nicht anspringen, es hatte die Nacht geregnet und regnete immer noch, und so hasteten wir in der schlecht sitzenden, am Abend vorher ausgeliehenen Trauerkleidung unter einem zu kleinen Schirm den ganzen Weg zu Fuß. Den Anblick von nassen, zerzausten Krähen müssen wir geboten haben, als wir uns im Gasthaus zum Leichenmahl dazu drückten. Die Gespräche verstummten für einen Augenblick, einige guckten, als hätten die insgeheim Schuldigen an dem Unglück den Raum betreten. Dann ging es wieder laut durcheinander: Das Unwetter sei es gewesen, die rutschige Fahrbahn, und Beat habe die Maschine wahrscheinlich doch nicht so gut beherrscht, wie er behauptet hatte. Ja, da konnten wir mitnicken. Von Beats Familie war niemand angereist. Rebekka hatte nur die Nummer seines älteren Bruders, der war aber nicht zu erreichen gewesen.
Die Sonne war hervorgekommen, als wir auf dem Rückweg allein am Grab standen: ein Hügel aus frisch aufgeworfener Erde, zwei namenlose Holzkreuze, ein Strauß mit Astern. Rebekka nahm sich eine ihrer bernsteinfarbenen Spangen aus dem Haar und drückte sie in die Erde. Ich überlegte kurz, holte ein Tütchen Gras heraus und drückte es dazu. Tauschten wir ein komplizenhaftes Lächeln? Jedenfalls standen wir noch eine Weile da, wie man es an einem Grab eben tut.
Vor der letzten Nacht auf dem Hof graute uns beiden, wir brauchten es nicht auszusprechen. Es graute uns vor den Paarbetten und den Laken mit dem ranzigen Geruch ungestillter Nächte. Es graute uns vor dem Geruch des Todes. So tranken wir uns vor dem Haus mit den letzten Flaschen Rotwein und dem Obstler in die Abenddämmerung. Worüber redeten wir? Keine Erinnerung. Irgendwann verschwand Rebekka dann doch auf ihren Dachboden, und ich legte mich in den Kleidern in der Stube auf das Sofa.
Am Morgen testete ich als Erstes den R4: Er sprang ohne Weiteres an. Wir packten zusammen. Die Siebensachen von Beat gingen in einen Seemannssack. Die Bücher, das Rauchbesteck, das Malzeug, die Naturstudien mit Kohlestift. Klaras Gitarre und den Rest holte ihre jüngste Schwester mit dem Rad ab. Einen Gruß von den Eltern richtete sie aus, wir sollten bittschön nicht drauf vergessen, den Schlüssel nach dem Zusperren bei den Schweigers abzugeben. Was wir taten.
Salzburg war für Rebekka und für mich abgetan. Ein letztes Zusammensein im Café Bazar, auf der Terrasse unter den Kastanien, nicht einmal geplant. Ich hatte sie zufällig auf dem Postamt am Makartplatz getroffen, als sie das Paket mit Beats Sachen nach Bern aufgab – der Bruder hatte sich schließlich gemeldet. Der Schock saß uns immer noch in den Knochen. Wir müssen wie ein Pärchen gewirkt haben, dass das Leben früh alt und stumm gemacht hat. Unsere Zukunft stand fest: Sie ging nach Wien, um dort weiterzustudieren. Ich hatte bei dem Fotowettbewerb einen Preis gewonnen, 600 Mark, damals nicht wenig, und ging nach Paris.
Ich klappte den Laptop zu. Rebekka, die ich vier Jahrzehnte nicht mehr gesehen hatte, saß jetzt vielleicht ein paar hundert Meter von hier in ihrer Wohnung. Ein Leichtes, sie anzurufen – ich hätte sofort ihre Stimme am Ohr. Musste sie nicht, während sie das Bild malte, im Zwiegespräch mit mir gewesen sein? Mit den beiden Toten, vor allem mit Beat, sowieso. Sie hatte nie Anstalten gemacht, Kontakt mit mir aufzunehmen, ebenso wenig ich mit ihr. Wir hatten unsere Gründe gehabt. Aber nun hatte sie den Schritt getan und eine Flaschenpost losgeschickt. Sie hatte damit rechnen müssen oder es zumindest nicht ausschließen können, dass ich das Bild zu Gesicht bekam.
Es blieben noch vier Tage, bis mein Flugzeug zurück nach Paris ging. Am Graben fand ich eine Buchhandlung und kaufte mir eine Landkarte von Niederösterreich. Ein paar Häuser weiter hatte ein Musikladen das Transformer-Album von Lou Reed. Für den nächsten Tag buchte ich einen Mietwagen.
Zwischen Sankt Pölten und Melk, je näher die Donau kam, verschwand die Sonne hinter Morgennebel. Lou Reeds entspannte Stimme trieb den kleinen Kia auf der A1 voran, von Vicious bis Goodnight Ladies und wieder von vorn, genau auf der Donaubrücke bei Grein blies der Saxophonist sein Solo am Ende von Take A Walk on the Wild Side zum dritten Mal. Auf der Bundesstraße in den Norden durchs Mühlviertel riss der Nebel auf, ein blauer Himmel, satte grüne Wiesen und Wälder, viele neue Häuser, wie Spielzeugklötze in die Landschaft gewürfelt. Ab Königswiesen kam mir die Straße wieder bekannt vor. In einer dieser Kurven musste es passiert sein.
Und dann kam Arbesbach, unverkennbar mit seiner Burgruine, dem Stiftzahn des Waldviertels, und der Kirche mit dem Zwiebelturm, die in frischem Gelb und Weiß leuchtete. Am Ortsanfang bog ich nach rechts ein zum Friedhof. Da ging es weiter nach Altmelon – was für ein seltsamer Name –, wo wir das Nötige zum Leben besorgt hatten. Um die Mittagszeit briet das Dorf in der Sonne, kein Mensch war draußen. Das Kaufhaus Wagner wirkte, als läge es seit damals im Dornröschenschlaf. War das nicht noch dasselbe Stillleben in der Auslage: Emailletöpfe, Kristallvasen, Gaskocher und geblümte Wasserkessel? Gegenüber, in neuem Glanz, der Gasthof Lichtenwallner, wo es die himmlische Leber mit Majoran gegeben hatte, frisch vom geschlachteten Schwein. Auch hier niemand, es war Ruhetag.
Am Ortsausgang begann der Güterweg zu unserem Hof nach rechts hinunter in die Senke. Früher war es ein Feldweg gewesen, nun war er asphaltiert. Lou Reed fing zum siebten Mal mit Vicious an, genau wie damals, als wir zu viert in Rebekkas blauem R4 in den Wald hineinfuhren, die Musik aufgedreht, Beat und ich auf der Rückbank, der Joint und die Dopplerflasche gingen zwischen uns hin und her. Eine Weile durch das grüne, dämmrige Dunkel, der Weg fiel steil ab, die kleine Brücke über den Bach, und mit dem Saxophonsolo schossen wir hinaus in die Helle des frühen Sommerabends. Nach einer Kurve tauchte er unversehens auf, unser Hof, linkerhand am Hang inmitten ungemähter, blühender Wiesen.
Ich trat in die Bremse, wie es Rebekka damals im R4 getan hatte. Aber nicht, weil ich das Haus erblickt hätte. Es war weg, verschluckt von einem Wald von Fichten, dicht und dunkelgrün, als wäre hier nie etwas anderes gewesen. Hatte ich mich im Weg geirrt? Nein, rechterhand war immer noch die Wiese, die zum Tal abfiel, mit dem Bach zwischen schimmernden Sandbänken. Jenseits zog sich Buschwerk steil bergan, ein frisch gepflügter Acker bildete den Horizont, da oben musste der Hof vom Bauern Schweiger sein.
Ich ließ den Film weiterlaufen: Wir stiegen aus und schwärmten um das verwitterte, offenbar verlassene Anwesen. Wir versuchten durch die Fenster zu schauen – die verblichenen Gardinen waren zugezogen –, drückten probeweise Türklinken, rüttelten an Scheunenriegeln, stiegen hinter dem Stall über den großblättrig überwachsenen Komposthügel, der der Misthaufen gewesen war, und trafen uns schließlich im Innenhof wieder.
Das ist es, sagte Rebekka.
Das ist es, sagte Klara.
Das ist es, sagte Beat.
Das ist es, sagte ich.
So viel Einigkeit war selten bei uns. Reihum nahmen wir einen Schluck aus der Dopplerflasche, als wären wir eine verschworene terroristische Gruppe, die den idealen Unterschlupf gefunden hatte.
Kurz darauf saßen wir in der Stube beim Bauern Schweiger, einem stattlichen Mann mit wettergegerbtem Gesicht; der eine Ärmel war leer, den Arm hatte er im Krieg gelassen. Dank Klara ging alles sehr rasch. Schweiger erzählte, dass er den Hof und den Grund vor einem halben Jahr dem Bauern Hölzl abgekauft hatte, der in die Stadt gezogen war, um in der Fabrik zu arbeiten. Die Gstätten könnten wir über den Sommer haben, es sei noch das ganze Klumpert vom Hölzl drin. Allerdings, der Strom sei abgestellt, aber kaltes Wasser gebe es. Toilette hätten sie nie gehabt, die Hölzls, dafür sei die Sickergrube im Stall da. Ach, das macht uns nichts aus!, riefen wir im Chor. Wir tranken ein Stamperl Obstler drauf und Klara bekam den Schlüssel.
Ich fuhr hinauf zum Schweiger-Hof und es war schon keine Überraschung mehr: Aus dem Anwesen war eine Pferde-Ranch geworden, mit einem Portal wie bei Bonanza. Auf der Koppel weideten ein halbes Dutzend Tiere, in der Manege ließ ein Trainer ein behelmtes Mädchen auf einer Stute an der Longe kreisen. Es war Mittagszeit, High Noon, die leere Bar im Innenhof beschallten Lautsprecher mit den Nachrichten. Hier hielt mich nichts.
Ich fuhr an die Geisterstelle zurück, parkte den Wagen, hängte meine Nikon um und zog, geduckt unter der Heckklappe sitzend, meine Reeboks an. Ich hatte die fixe Idee, nach vierzig Jahren noch Reste von uns zu finden. Ein Feuerzeug. Eine Schillingmünze. Eine Haarspange. Einen verrosteten Löffel. Ich pflügte mich durch den Neuwald, lockerte mit der Fußspitze da und dort probehalber das weiche Erdreich, stieß aber nur auf ein Stück Zementboden, wo vielleicht der Stall und die Sickergrube gewesen waren. Dort unten in der Tiefe hätte man womöglich noch winzige organische Spurenelemente von uns finden können. Eine gruslige Vorstellung.
Ich drang weiter in den Wald vor, in den ursprünglichen Teil, wo ich damals, bei gutem Licht, mit der Kamera herumgestreift war. Die mächtigen, in der Eiszeit rundgeschliffenen Findlinge, die ich fotografiert hatte, lagen noch immer da – wer hätte sie auch wegtragen sollen? Und wie damals fiel Sonnenlicht in schrägen Bahnen zwischen den hohen Stämmen durch und verfing sich im hellgrünen Farn. In einer Lichtung fand ich sogar meinen Lieblingsfelsen. Wie der Rücken eines Walfischs ragte er aus der Erde und immer noch gab es die vermooste Einbuchtung, in der man bequem sitzen konnte.
Wie war das bei unserem Einzug in den Hof gewesen? Die Tage davor hatten wir in dem Biedermeierhaus der Weixlbaums gewohnt, an der engen Straße unterhalb der Arbesbacher Kirche, wo die schweren Laster vorbeifuhren, sodass jedes Mal das ganze Haus erbebte. Zimmer standen dort einige leer, die meisten Kinder waren ja schon ausgeflogen. Rebekka und Beat bekamen eins zusammen. Klara bezog ihr Mädchenzimmer, mich schubste sie in die Wäschekammer, wo normalerweise gebügelt wurde. Den Eltern hatte sie mich demonstrativ nur als Mitstudenten vorgestellt. Was sie nicht hinderte, nachts kurz zu mir zu schlüpfen.
Am ersten Sonntag waren wir zum Mittagessen geladen, die Tafel in der Zirbenstube weiß gedeckt, ein halbes Dutzend der Kinder, zum Teil mit Partnern, hatte sich eingefunden. Eine Riesenschüssel mit dampfender Frittatensuppe. Zwei Platten mit Schweinsbraten, Knödeln und Kraut. Und am Ende die von der Hausherrin persönlich zubereiteten Marillenknödel – wie hätte diese kleine, kugelige und doch zarte Person auch anders heißen können als Marili? –, in Brösel gewälzt und mit brauner Butter übergossen, gefolgt von mehreren Obstlern.
In unserem Hof gab es tatsächlich viel Klumpert, aber auch viel Brauchbares: schönes Holzmobiliar, passable Matratzen, Geschirr, Gläser, Kochtöpfe, einen funktionierenden Holzherd und Petroleumlampen. Familie Hölzl war offensichtlich entschlossen gewesen, ein ganz neues Leben anzufangen.
Die Schlafzimmerzuteilung war einfach. Rebekka, die ungekrönte Königin, beanspruchte für sich und Beat den hellen Dachboden, wo früher das Getreide getrocknet worden war, mit Blick über das Tal. Für Klara und mich blieb die Kammer hinter der Küche. Trafen wir uns am Morgen nach und nach beim Herd – Rebekka war immer die Letzte –, so vertrieben die gemeinsamen Arbeiten, das Ofenanheizen und Wasserkochen, schnell den Trübsinn der Nacht. Das war ja auch der unausgesprochene Sinn unserer Sommerkommune: dass sie uns zwischendurch vom unerquicklichen Paarsein erlöste.
In der Erinnerung floss alles zusammen: die Ausflüge zum nahen Waldteich, das Schwimmen im Moorwasser, das Pilzesuchen – Schwammerl gab es in Hülle und Fülle –, das Rüsten und Kochen, das Kartenspielen und Rauchen. Klara brachte Rebekka auf der Gitarre Volkslieder bei und Rebekka, die auf dem Joan-Baez-Trip war, schmetterte The Night They Drove Old Dixie Down oder die deutsche Coverversion Am Tag, als Conny Kramer starb durch unser Tal.
Ehrlich gesagt: Beat und ich wurden nie richtig warm miteinander. Ich war für ihn der typische Deutsche, das Großmaul aus Bielefeld, auch noch mit dem germanischen Namen Volker, während er der sprichwörtliche langsame Berner war und mit seiner schweren Dialektzunge umständlich formulierte, wenn er denn überhaupt sprach. Eines betonte er öfter: Für die Schweizer seien wir Deutsche nach dem Krieg immer die Sauschwobe





























