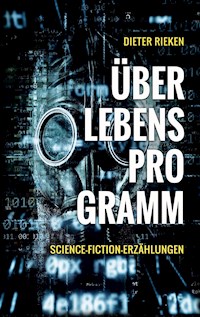4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In der Titelgeschichte dieser Sammlung flieht Kirstin Tammen nach Italien, weil sie es nicht mehr erträgt, zu Hause in Deutschland jeden Tag mit neuen Tragödien konfrontiert zu sein. Doch auch in dem Ferienhaus ihrer Kindheit gelingt es ihr nicht, die brutalen Folgen des fortschreitenden Klimawandels zu ignorieren – und die nächste Katastrophe kündigt sich schon an. »Jonas und der Held Terranovas« überträgt die Motive der biblischen Geschichte des Propheten Jona auf eine ferne Koloniewelt. Über die Frage, wie die kleine Gemeinschaft ihre internen Konflikte um das Verbot des Reisanbaus lösen soll, gerät der allseits verehrte »Captain« mit den Autoritäten seiner Welt in Streit. Als er kurz vor dem Gründungsfest das Weite sucht, beauftragt der Rat Terranovas seine beste Ermittlerin, ihn zurückzubringen. Doch nach einem Sturm auf hoher See gilt der alte Mann als vermisst. In »Die Schneekönigin« muss Linnea, die mitten in einer Eiswüste lebt, sich und ihren kranken Freund gegen marodierende Banden verteidigen. Dieter Rieken zählt in der deutschen Science-Fiction ohne Zweifel zu den sprachlich und stilistisch anspruchsvollsten Autoren. Darüber hinaus versteht er es, brennende Themen unserer Zeit in ansprechende Geschichten zu verpacken. Das beweisen einmal mehr die drei Erzählungen in diesem Band. (Der schräge Titel ist übrigens ein Zitat. Umgangssprache. Der vermeintliche Fehler erklärt sich bei der Lektüre.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dieter Rieken
»Zweimal langsamer wie du …«
Erzählungen
AndroSF 100
Dieter Rieken
»ZWEIMAL LANGSAMER WIE DU …«
Erzählungen
AndroSF 100
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
©dieser Ausgabe: März 2024
p.machinery Michael Haitel
Titelbild & Illustrationen: Dieter Rieken, Collagen aus Fotos des Autors und lizenzfreien Bildern von Pixabay
Layout: global:epropaganda
Umschlaggestaltung: Dieter Rieken, global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 379 6
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 730 5
Die Realität ist für diejenigen,
die ihre Träume nicht aushalten.
Residenztheater München, Spielzeitspruch 2014
(frei nach Slavoj Žižek)
Und die Zukunft ist das,
was wir daraus machen.
John Connor in »Terminator: Die Erlösung«
»Zweimal langsamer wie du …«
1
Holgers Silhouette am Fenster. Er steht exponiert, wirkt hilflos, verloren.
Flackernde Lichter hinter dem Buntglas. Flammen im Hochchor, Feuer im Heaven!
In der Finsternis auf dem Wasser: Grölen. Gekeife.
Und plötzlich Schüsse. Das schrille Klirren der Scheiben, zwei Sterne aus Rissen im Glas; Splitter wie winzige Schrapnelle, die glitzernde Tropfen auf seine Wangen zeichnen.
Sein leerer Blick, ganz nah. So nah …
Mit einem Aufschrei schreckte sie hoch. Als sie die Augen öffnete, war sie desorientiert. Wie nach einem Sprung durch Zeit und Raum. Sie sah ein Fensterkreuz in der schwarzen Wand gegenüber. Es kam ihr fremd vor – genauso wie die Matratze, auf der sie saß. Unwillkürlich zog sie sich die dünne Decke bis zum Hals.
Dann besann sie sich. Durch die verzogenen Läden drang etwas Helligkeit in den Raum, gerade genug, dass sie ihn als eines der Schlafzimmer in ihrem Ferienhaus erkannte. Die dünnen Lichtspeere, die durch die Spalten im Holz stachen, waren klar konturiert, aber noch so schwach, dass ihre Spitzen kaum den Boden erreichten. Sie kündigten den Beginn ihres ersten Urlaubstages an.
Tine schüttelte sich. Sie hatte einen Angsttraum gehabt. Es war derselbe gewesen wie immer: von der Nacht auf dem Ausflugsboot, auf dem sie früher gelebt hatten, in den überschwemmten Gebieten weit draußen vor der Nordseeküste; als zwei Nazis in die Ludgerikirche eingedrungen waren, um Holgers Club, das Heaven, in Brand zu setzen. Und dann hatten diese Micks auf sie geschossen! Um sie am Löschen zu hindern!
Der Polizei war es gelungen, die Männer auf dem Rückweg zum Festland zu fassen. Es hätten sich aber weder Waffen noch Beweise für Brandstiftung in ihrem Boot gefunden; man sei also gezwungen gewesen, sie laufen zu lassen. Das hatte man ihnen zumindest weismachen wollen. »Braunes Pack! Daar holt doch een sien Hand vör de Mors van de annern«, hatte Holger damals geschimpft. Er war über den Ausgang der Ermittlung noch aufgebrachter gewesen als sie.
Der Ärger verdrängte ihre Angst. Er war intensiv und frisch, als hätte der Anschlag erst gestern stattgefunden. Dabei war er mittlerweile zwanzig Jahre her. Trotzdem: Die Bilder und Emotionen dieser Nacht verfolgten sie bis heute – und sie erwischten sie zumeist im Schlaf.
Sie machte eine wegwerfende Geste. Stell dich nicht so an, es gibt Schlimmeres. Oder wie hatte es Warner ausgedrückt? »Deine Albträume möcht ich haben, Tine.« Das war erst vorgestern gewesen; ein Besuch bei einem Geist aus ihrem früheren Leben …
Ein lautes Knallen ließ sie zusammenzucken – zwei harte, trockene Detonationen, die direkt unter ihrem Fenster aufzubellen schienen. Auf die ersten folgten weitere, ganz in der Nähe der kleinen Villa. Das Echo hallte von den umliegenden Hügeln wider.
Jetzt wusste sie, was sie geweckt hatte: nicht der Traum, sondern echte Schüsse.
Sie vernahm noch drei leisere, die klangen, als kämen sie von weit her. Kein Grund zur Panik. Wahrscheinlich Jäger. Das kannte sie schon.
Das Gewehrfeuer stachelte die Hunde dazu auf, laut anzuschlagen. Nicht schon wieder, stöhnte sie im Stillen. Nach der langen Anreise gestern war sie früh ins Bett gegangen, hatte aber nicht einschlafen können. Der Grund war das nicht enden wollende Gebell gewesen. Alle Nachbarn, deren Höfe und Häuser jeweils ein paar Hundert Meter entfernt lagen, schienen Hunde zu halten – leider nicht drinnen, sondern in Zwingern auf dem Gelände. Ob als Wach- oder Jagdhunde wusste sie nicht. Erst weit nach Mitternacht waren die Tiere endlich zur Ruhe gekommen. Das konnte noch nicht länger als fünf oder sechs Stunden her sein.
Worauf schossen diese Idioten bloß? Diese Frage hatte sie sich schon oft gestellt. Rings um das Haus lagen Äcker, hier und dort standen Obst- und Olivenbäume. Wenn es in dieser ländlichen Gegend Hasen oder Rehe geben würde, hätten Holger und sie die Tiere bei einem ihrer früheren Aufenthalte sicher bemerkt. Wahrscheinlich Vögel, vermutete sie. Viele gab es ja nicht mehr. Doch es war schon vorgekommen, dass sie auf ihren Spaziergängen eine Ente, eine Ringeltaube oder sogar Singvögel gesehen hatten.
Die italienischen Nachbarn nahmen es mit dem strikten Jagdverbot nicht so genau. »Verkappte Anarchisten« war Holgers übliche Erklärung. »Die halten es damit ähnlich wie früher mit den Verkehrsregeln.« Das hatte ihr immer eingeleuchtet. Sie kannte das »Schieben« und die waghalsigen Überholmanöver noch aus eigener Erfahrung. Der »sportliche Fahrstil« hatte auch in Italien erst mit dem autonomen Fahren ein Ende gefunden. Ein glückliches, wie sie fand.
Aber es gab noch einen anderen möglichen Grund für die Jäger da draußen. Italien war ein armes Land, das die Folgen der Klimaänderung hart getroffen hatte. Vielleicht hatten die Leute, die trotz des Verbots auf die Jagd gingen, einfach nur Hunger. Das war ein viel naheliegender Gedanke. Sie schämte sich, darauf nicht schon früher gekommen zu sein.
Während das Kläffen unvermindert weiterging, ermunterte das erste Tageslicht nun auch die Hähne vor dem Haus zum Krähen – der eine verhalten und heiser, der andere umso kraftvoller. Sein Rufen kam Tine schrill und nachdrücklich vor. Als sie dann spürte, wie ein Insekt auf zarten Beinen über ihre Wimpern balancierte, hatte sie genug. Sie streifte das winzige Tier hinunter und setzte sich erneut auf. Entschlossen schlug sie die Decke zurück, schwang die Beine aus dem Bett und stellte die Füße auf den Boden.
Mit den Zehen spürte sie der Maserung der Dielen nach. Dabei fiel ihr wieder ein, dass sie gestern von den drei Schlafzimmern im ersten Stock das nach Südosten gelegene gewählt hatte, um den Sonnenaufgang nicht zu verpassen. Sie ging zum Fenster hinüber, rollte das Fliegengitter nach oben und drückte die Flügel und Läden weit auf.
Zu ihrer Rechten bellte erneut ein Schuss. Nach dem ersten Schreck wurde sie wieder zornig. Als hätte der Jäger vor dem Haus auf sie gewartet! Sie nahm die Zufahrt in den Blick, die an den Olivenbäumen vorbei auf die Straße führte, konnte den Schützen aber nirgendwo entdecken. Leider kannte sie keine italienischen Flüche. Andernfalls hätte sie jetzt laut geschimpft.
Es wurde schnell heller. Doch kam es ihr so vor, als stimmte mit dem Licht etwas nicht; als hätte jemand eine Milchglasglocke über die umliegenden Hügel, Häuser und Höfe gestülpt. Die aufgehende Sonne war hinter einem Wolkenband verborgen. Es erstreckte sich von Süden bis Osten und hing schwer unter dem Himmel. Wo die Wolken die größte Dichte erreichten, verlief ihr milchiges Weiß in schmutzige Grautöne.
Der Anblick gefiel ihr nicht. Er erinnerte sie an ihren Traum, an die Rauchschwaden über der Kirche. Missmutig schloss sie die Läden und Fenster, um die Hitze auszusperren, die in den nächsten Stunden unweigerlich einsetzen würde.
Dann hielt sie inne. War in den News nicht von einem Brand die Rede gewesen? Konnte es sein, dass er ein solches Ausmaß erreicht hatte, dass der Qualm bis hier zu sehen war?
Mit einer trotzigen Geste wischte sie diesen Gedanken beiseite wie zuvor das lästige Insekt.
Sie schlüpfte in die Sandalen und ging leise summend über den Flur ins Badezimmer. Die Verwalterin hatte einen guten Job gemacht. Bei Tageslicht bestätigte sich der Eindruck, den sie am Sonntagabend gewonnen hatte. Alles sah sehr sauber aus. Neben dem Waschbecken, auf dem Rand der Badewanne, warteten frische Handtücher darauf, benutzt zu werden. In der Luft lag ein Hauch von Reinigungsmitteln. Auch die Trockentoilette glänzte, und unter der Schüssel war ein neuer Tank platziert.
Nachdem sie sich erleichtert hatte, spritzte sie sich am Waschbecken etwas Wasser in die Augen, danach zwei Hände voll auf die Wangen und die Stirn. Am liebsten hätte sie geduscht, aber das traute sie sich nicht. Sie musste erst den Füllstand des Wassertanks im Garten überprüfen. Schließlich war das Haus über Wochen bewohnt gewesen.
»Zwei Familien aus den Abruzzen«, hatte die Verwalterin sie über Videochat informiert. »Es tut mir sehr leid, Frau Tammen. Die Behörden nehmen keinerlei Rücksicht mehr auf Privatbesitz. Sie bringen die Flüchtlinge unter, wo immer das möglich ist.«
Vor dem Spiegel fuhr sie sich mit den nassen Händen durch die Haare. Ihre Mähne war grauer geworden, aber kaum schütterer. Die silbernen Strähnen trug sie mit Fassung, an manchen Tagen sogar mit Stolz.
Ein kurzer Blick auf den Rest genügte ihr. Sie hatte sich abgewöhnt, allzu viel Zeit mit ihrem Spiegelbild zu verbringen. Ihr Körper mochte alt geworden sein, sie fand ihn jedoch immer noch ansehnlich. »Zustand zwei bis drei: sichtbare Gebrauchsspuren, aber gänzlich befriedigend«, pflegte Holger zu sagen, wenn sie über das Älterwerden sprachen. Über das Älter-Geworden-Sein. Er spielte damit auf die Bewertungskriterien an, die Sammler antiquarischer Comichefte benutzten. Holgers scherzhafte Bemerkung schloss natürlich seine eigenen Unzulänglichkeiten mit ein, darunter die Stirnglatze, die sich unaufhaltsam nach oben fraß, und sein Bauch, der zuletzt an Profil gewonnen hatte.
Sie lächelte milde. Die Scherze ihres Mannes waren schon mal besser gewesen. Doch die Beschreibung ihrer äußeren Erscheinung erschien ihr passend. »Gänzlich befriedigend«, wiederholte sie halblaut, bevor sie das Bad verließ. Und das mit über fünfzig. Damit konnte sie leben.
Ihre Kleidung, die sie gestern durchgeschwitzt hatte, war im Schlafzimmer über die Stuhllehne drapiert. Da hing sie gut. Sie reiste zwar »mit leichtem Gepäck«, hatte aber genug andere Sachen zum Anziehen dabei.
Nackt, nur mit Sandalen an den Füßen, lief sie die Treppe hinunter und durch die Diele in die Küche. Ihr Personal Universal Communicator lag auf dem Esstisch in der Mitte des Raums. Sie hatte den PUC vor dem Zubettgehen ausgeschaltet. Die Reisetasche stand da, wo sie sie bei der Ankunft abgestellt hatte: neben dem Kühlschrank auf den Terrakottafliesen. Sie ging in die Hocke, zog den Reißverschluss auf und nahm ein paar Kleidungsstücke heraus: schwarze Unterwäsche, ein grasgrünes, weit geschnittenes Shirt und eine halblange, schwarze Baumwollhose – in der sie sich beim Einsteigen mit den Sandalen zweimal verhakte.
Unter der Spüle fand sie den Hahn für den Gasherd und drehte ihn auf. Dann nahm sie eine Mokkakanne und die Kaffeedose vom Regal und bereitete sich einen Espresso zu. Während sie auf das Aufkochen wartete, checkte sie die Kochutensilien, die an einer Hakenleiste über der Spüle hingen, und die auf dem Brett darüber aufgereihten Tees, Gewürze, Tassen und Gläser. Alles sah aus wie immer. Nichts wies darauf hin, dass sich ihre von den Behörden hier einquartierten Gäste an dem Vorgefundenen bedient hätten. Die Verwalterin, die im Nachbarort Piagge lebte, war wirklich bemüht gewesen, jede Spur zu beseitigen, die auf die Anwesenheit der Flüchtlinge hätte hindeuten können.
Als die Kanne auf dem blauen Flammenkranz zu röcheln und zu spucken begann, drehte sie das Gas ab. Die Kaffeetasse in der einen Hand fischte sie mit der anderen eine Papiertüte aus der Tasche. Darin befanden sich zwei Milchbrötchen – der Rest des Reiseproviants, den sie gestern am Münchner Hauptbahnhof gekauft hatte.
Sie öffnete die Tür, die auf die Terrasse hinter dem Haus führte, und ließ sich zum Frühstücken auf einem der Klappsessel nieder. Der Großteil der Sitzgruppe war hochkant an die Mauer gelehnt. Den konnte sie später noch aufbauen. Unter dem vorstehenden Dach war es zu dieser Tageszeit angenehm kühl. Ende September herrschte hier häufig ein leichter Windzug, auch später noch, wenn die Sonne über den Dachfirst und die Temperatur auf vierzig Grad kletterte. Heute Morgen stand die Luft allerdings ganz still.
Nachdem sie die Brötchen gegessen und die Tasse geleert hatte, drehte sie wie immer, wenn sie hier war, eine Runde um das Gebäude. Abgesehen von der gekiesten Zufahrt und dem Olivenhain Richtung Straße war das Grundstück von einem mehrere Meter breiten Grasstreifen umgeben. Dahinter fiel es auf drei Seiten jäh zu den Äckern der Nachbarn ab. Die Grundstücksgrenze bildeten alte, hochgewachsene Zypressen und Pinien, die am späten Nachmittag für Schatten sorgten.
Die kleine Villa war ein Erbe ihrer Mutter. Ende der Vierzigerjahre hatten ihre Eltern sie ein paarmal als Ferienhaus gemietet und 2052 gekauft. Zwischen den Stämmen der Bäume hatten sie Himbeerbüsche gepflanzt, einmal weil Tine die roten Früchte liebte, vor allem aber weil das Rosengewächs den umlaufenden Zaun verdeckte.
Heute sah sie, während sie das Gebäude umrundete, das grüne Gittermuster jedoch überall, weil die Büsche infolge der anhaltenden Dürre weder Blätter noch Früchte trugen. Das Gras war ebenfalls sehr trocken – und dort, wo tagsüber kein Schatten fiel, völlig ausgeblichen. Ein Blick auf die Tankuhr bestätigte ihre Befürchtung, dass ans Gießen nicht zu denken war: Der Füllstand betrug weniger als zehn Prozent. Wenn sie keinen Tankwagen kommen lassen wollte, konnte sie nur Wasser sparen und hoffen, dass es bald regnen würde.
Sie sah nach dem Federvieh – zwei Hähne und sechs Hühner –, dem es gut zu gehen schien, und schloss ihren Rundgang an der nordöstlichen Ecke des Grundstücks ab. Bei gutem Wetter konnte man von hier aus bis nach Fano sehen, wo der Fluss Metauro früher ins Meer gemündet hatte. Heute war die Küste verhangen, sodass ihr der Blick auf die Ortschaft und den verlockenden blauen Streifen dahinter leider verwehrt blieb.
2
Ihre Entscheidung, nach Italien, in ihr Ferienhaus zu fahren, war recht spontan gewesen.
Sie arbeitete als Sprecherin. Kommentare, Werbespots, Dokus. Hörbücher hatte sie auch schon gemacht. Das meiste Geld verdiente sie jedoch als Synchronschauspielerin. Zwar bezahlte Hilke sie und Holger dafür, dass sie auf dem Hühnerhof in Sandhorst mit anpackten, aber sie waren auf den Zuverdienst angewiesen. Insofern konnte Tine sich glücklich schätzen, dass einige Schauspielerinnen, die sie schon lange synchronisierte, weiterhin im Geschäft waren.
Meistens hatte sie in Hannover zu tun, manchmal auch in Berlin oder München – einige Tage hier, ein paar Wochen da. Zuletzt war sie für einen Spielfilm in einem Studio in der Isarvorstadt gebucht gewesen. Eigentlich hatte sie vorgehabt, nach Abschluss der Aufnahmen sofort nach Sandhorst zurückzukehren, auf »ihre« Insel in den überschwemmten Gebieten Norddeutschlands. Doch es war anders gekommen. Sie hatte feststellen müssen, dass sie nicht weitermachen konnte. Nicht weiter wie bisher jedenfalls. Dass sie den Kopf freibekommen musste – und dafür unbedingt Abstand brauchte. Abstand zu allem und jedem.
Nun war sie hier, sie hatte Urlaub, und ein graues Wolkenband am Himmel würde sie nicht davon abhalten, ihre freien Tage zu genießen. Sie wollte ins Naturschutzgebiet bei Bellocchi, um an der Adria-Mündung des Metauro zu wandern. Aber das hatte noch Zeit, entschied sie. Zuerst musste sie nach Fano. Denn die quirlige Stadt mit ihrem historischen Zentrum, den vielen Straßencafés und kleinen Kunstgalerien gehörte zu den schönsten, die sie kannte.
Sie nahm eine Umhängetasche aus dem Dielenschrank, die sie schon bei anderen Gelegenheiten benutzt hatte, und legte ein großes Handtuch, ihre Haarbürste und eine Tube Sonnencreme hinein. Es folgten der Geldbeutel, den sie erst einmal hatte suchen müssen, eine Sonnenbrille und die Fernbedienung, die sie für die Torausfahrt zur Straße brauchte.
Den PUC ließ sie in der Küche. Obwohl Holger und sie das immer so machten, wenn sie gemeinsam im Urlaub waren, fand sie es ungewohnt, das Haus ohne Communicator zu verlassen. Es fühlte sich geradezu seltsam an. Während sie die Tür hinter sich abschloss, den Kiesweg hinabschritt und das Doppeltor öffnete, bekräftigte sie sich selbst, dass es zu einem echten Urlaub dazugehörte, mal nicht erreichbar zu sein und nicht ständig von Video- oder Sprachnachrichten abgelenkt zu werden.
Sie folgte der Straße bis Montemaggiore al Metauro. Dort erklomm sie die Treppe, die zum Stadtturm führte, und machte in einer mobilen Bar eine Pause. Sie trank einen Espresso Macchiato, der hervorragend schmeckte, und genoss, die Pfarrkirche im Rücken, den Blick auf das historische Burgdorf.
Doch die Ruhe währte nur kurz. Kaum dass sie die Tasse geleert hatte, tauchten Busse auf, zwei schmale chinesische Hy-Liner und ein alter einstöckiger Buzz; und plötzlich strömten Menschen auf den Platz, beladen mit Koffern und Taschen, die in den Fahrzeugen verstaut werden wollten, bevor die Besitzerinnen und Besitzer selbst einsteigen konnten. Die Männer und Frauen waren älter als sie und auffallend formell gekleidet. Das Einräumen des Gepäcks gestaltete sich entsprechend würdevoll, ruhig und geordnet. Als den Leuten jedoch klar wurde, dass der Stauraum nicht ausreichte, entbrannte unvermittelt eine lebhafte Diskussion. Sie wurde schnell laut und leidenschaftlich, begleitet von theatralisch wirkenden Gesten, die den eigenen Standpunkt unterstreichen sollten.
Die Szene wirkte auf Tine wie eine Parlamentsdebatte, in der allerdings ständig mehrere Parteienvertreter gleichzeitig sprachen, jeder eine andere Vorstellung vertrat, wie das Problem am besten zu lösen sei, und vermeintliche Bündnispartner, die gerade noch am selben Strang gezogen hatten, unvermittelt die Seite wechselten. Währenddessen wurden die Gepäckstücke mehrmals aus- und wieder eingeladen, ohne dass die Anzahl derer, die vor den Bussen standen, merklich kleiner zu werden schien.
Anfangs war sie amüsiert gewesen. Doch bald herrschte ein solcher Lärm und so ein Gedränge auf dem Platz, dass sie entnervt die Flucht ergriff.
Sie folgte der Strada Provinciale Orcianese weiter hinab. Das lange Laufen machte ihr nichts aus. Die Arbeit auf dem Hühnerhof hielt sie fit. Dennoch versuchte sie, jetzt, wo die Sonne höher stand, im Schatten der Bäume zu bleiben. An einigen Stämmen erinnerten verblichen blaue Plaketten an die Zeit, als die EU das Pflanzen von Alleebäumen, die gegen lange Trockenphasen resistent waren, mit Milliarden subventioniert hatte. Sie wusste noch, wie dicht die Allee gestanden hatte, als sie mit ihren Eltern das erste Mal in der Villa gewesen war. Nach den großen Stürmen der Siebzigerjahre, die mehr als die Hälfte der Bäume gefällt hatten, sah es so aus, als gäben die Hitze und die Dürre den verbliebenen allmählich den Rest.
In Villanova fand sie den Autoverleih, den sie gesucht hatte. Selbst ohne das Firmenlogo, das am Fenster zur Straße klebte, wäre er an seiner honiggelben Innenausstattung leicht zu erkennen gewesen. Die Italiener bezeichneten die Shops dieser Kette als l’alveare – Bienenstock –, weil sie fast ausschließlich elektrisch betriebene Bees vermieten. Das war scherzhaft gemeint, hatte aber auch einen herablassenden Beiklang. Entsprechend hießen die Franchisenehmer im Volksmund »Imker«.
Der hiesige apicoltore, der sie bediente, war eine junge PoC mit arabischem oder nordafrikanischem Hintergrund. Sie begegnete ihrer Kundin ungewöhnlich wortkarg. Die wiederholten Blicke auf Tines Unterarme ließen darauf schließen, dass sie Besuchern ohne Communicator grundsätzlich nicht traute. Außerdem missfiel es ihr offensichtlich, die für den Vertrag benötigten Daten per Hand aufnehmen zu müssen. Zum Glück verlief der Netzhautscan ohne Probleme. Kirstin Tammen befand sich im System.
Als sie ein paar Scheine aus dem Geldbeutel zog und den verlangten Betrag auf den Tresen blätterte, war der Argwohn der »Imkerin« verflogen. Bevor Tine in das Fahrzeug stieg, das an der Straße auf sie wartete, machte sich die junge Frau sogar die Mühe, ihrer Kundin die Tür zu öffnen, ihr beim Anschnallen zu helfen und das sprachgesteuerte Assistenzsystem des Zweisitzers auf tedesco zu stellen.
Tine fuhr nicht gerne selbst. Sie wusste, was zu tun war, hatte das Fahren früh gelernt, ihr Wissen in der Praxis jedoch nur selten gebraucht. Sie bevorzugte den öffentlichen Nah- und Fernverkehr, und fast alle Fahrzeuge, die sie darüber hinaus benutzte, erreichten ihr Ziel auch ohne menschliches Zutun. Mit diesem Mietwagen war das nicht anders: Sie sagte dem Assi, wo sie hinwollte, und während der Bee die Klimaanlage hochfuhr und summend in Bewegung geriet, konnte sie sich zurücklehnen und die Fahrt genießen.
Am Ortsausgang kam sie an einem Weingut vorbei, das Holger und sie schon oft besucht hatten – einmal wegen des Weins, aber auch weil hier gelegentlich lokale Bands aufgetreten waren. Dann kam die Metaurobrücke, und sie sah fast gar nichts mehr, denn die Scheiben verdunkelten sich automatisch.
Als der Wagen kurz vor Calcinelli auf die Staatsstraße abbog, fragte sie den Assi nach italienischer Musik. »Am liebsten etwas aus der Region«, fügte sie hinzu.
Sie war überrascht, dass er Der Barbier von Sevilla vorschlug.
»Gioachino Rossini stammte aus Pesaro«, erklärte die KI. »Ich habe Zugriff auf zweiunddreißig seiner Opern.«
»Bitte keine Opern«, erwiderte sie, »und auch nichts Religiöses.«
»Sie meinen: nichts Geistliches«, sagte die Maschine.