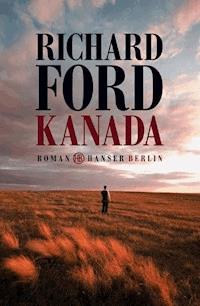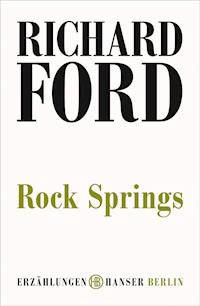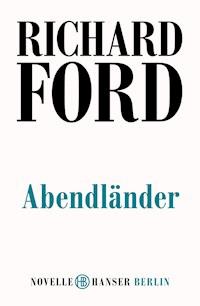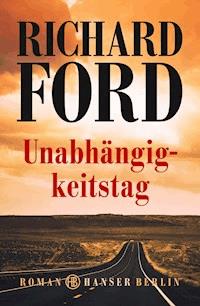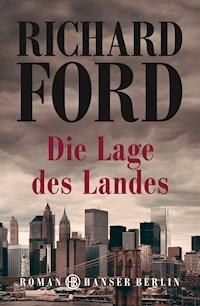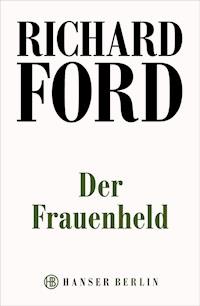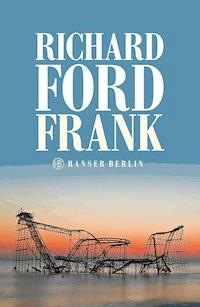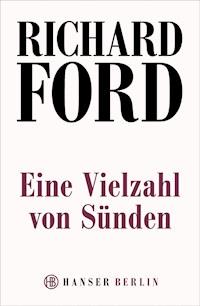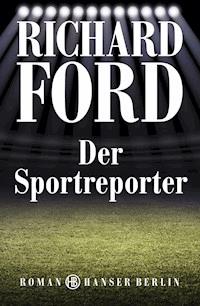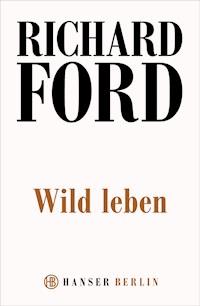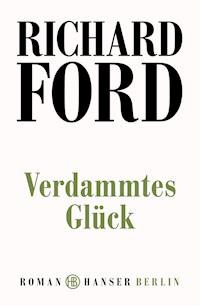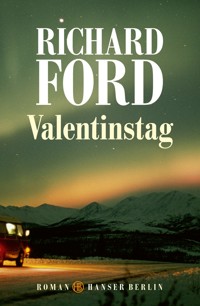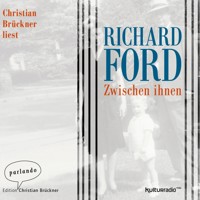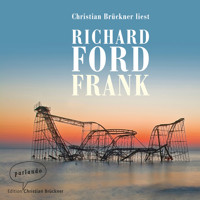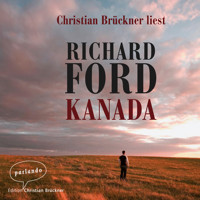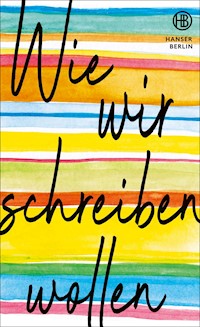Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit siebzehn verliebt sich Edna Akin aus Arkansas in Parker Ford, einen Jungen vom Land mit den durchscheinend hellblauen Ford-Augen. Sie heiraten und beginnen ein Nomadenleben in den Südstaaten der USA – Parker arbeitet als Handlungsreisender. Die 30er Jahre ziehen vorbei wie ein langes Wochenende, ungezählte Meilen, Cocktails, Hotelzimmer: New Orleans, Texarcana, Memphis. Die Geborgenheit, die es in ihrer Welt, dem Amerika der frühen Ford-Romane, nicht gibt, finden sie beieinander. Dann kommt ein einziges spätes Kind zur Welt – und alles ändert sich. "Zwischen ihnen" ist Richard Fords intimstes Buch: ein literarisches Memoir über seine Eltern und ein atmosphärisches Porträt des Lebens in den USA Mitte des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mit siebzehn verliebt sich Edna Akin aus Arkansas in Parker Ford, einen Jungen vom Land mit den durchscheinend hellblauen Ford-Augen. Sie heiraten und beginnen ein Nomadenleben in den Südstaaten Amerikas – Parker arbeitet als Handlungsreisender. Die 30er Jahre ziehen vorbei wie ein langes Wochenende, gemeinsam legen sie ungezählte Meilen zurück, trinken Cocktails und bewohnen ein Hotelzimmer nach dem anderen: New Orleans, Texarkana, Memphis. Die Geborgenheit, die es in ihrer Welt, dem Amerika der Ford- Romane, nicht gibt, finden sie bei einander. Dann kommt ein einziges spätes Kind zur Welt – und alles ändert sich.
In Zwischen ihnen ergründet Richard Ford ein zugleich innig vertrautes und geheimnisvolles Terrain: das Leben der eigenen Eltern. Erzählend und erinnernd lotet er aus, wie sich die Sicht eines Kindes auf die Eltern verändert, welche Rolle Verlust und Hingabe dabei spielen. Ein kluges Buch, geschrieben mit der sprachlichen Präzision und der Menschlichkeit, für die Ford bekannt ist.
Hanser Berlin E-Book
Richard Ford
Zwischen ihnen
Aus dem Englischen von Frank Heibert
Hanser Berlin
Kristina
Vorbemerkung des Autors
Beim Schreiben dieser Erinnerungen – mit dreißig Jahren Abstand – habe ich einige Unstimmigkeiten zwischen beiden Teilen bestehen lassen und mir auch erlaubt, einige Ereignisse erneut zu erzählen. Damit hoffe ich den Lesern zu zeigen, dass ich von zwei sehr unterschiedlichen Menschen erzogen wurde, deren verschiedene Perspektiven mich prägten, die sich bemühten, ihr Handeln aufeinander abzustimmen, und durch deren Augen, seine wie ihre, ich die Welt zu sehen versuchte. Einen Sohn lebendig bis ins Erwachsenenalter zu bringen muss Eltern manchmal vorkommen wie ein zähes Wiederholungstraining, ein oftmals vergebliches, aber liebevolles Bemühen um Beständigkeit. Das Eindringen in die Vergangenheit aber ist in jedem Fall eine heikle Sache, weil die Erinnerung uns zu den Menschen machen will, die wir sind, und immer wieder halb daran scheitert.
RF
Teil 1
WEG
Erinnerungen an meinen Vater
Irgendwo tief in meiner Kindheit kommt mein Vater an einem Freitagabend von seiner Tour nach Hause. Er ist ein Handlungsreisender. Es ist 1951 oder 52. Er hat unförmige Pakete in weißem Metzgerpapier dabei, gekochte Shrimps oder Tamales oder eine Pinte Austern, die er aus Louisiana mitgebracht hat. Als er das speckige Papier aufschlägt, steigt von den Shrimps und Tamales heißer Dampf empor. In unserer kleinen Doppelhaushälfte in der Congress Street in Jackson strahlen alle Lichter hell. Mein Vater, Parker Ford, ist ein großer Mann – weich, wuchtiges Aussehen, breit lächelnd, als hätte er gerade einen guten Witz im Sinn. Er ist freudig erregt darüber, zu Hause zu sein, und schnuppert voller Vorfreude. Seine blauen Augen funkeln. Meine Mutter steht neben ihm, erleichtert, dass er wieder da ist, beschwingt und glücklich. Er breitet die Pakete auf der metallenen Tischplatte in der Küche aus, damit wir schon mal sehen, was wir gleich essen werden. Festlicher kann das Leben nicht sein. Mein Vater ist wieder zu Hause.
Meine Mutter und ich haben uns die ganze Woche auf seine Ankunft gefreut. »Edna, würdest du …?« »Edna, hast du …?« »Mein Sohn, mein Sohn …« Und ich mittendrin. Das normale Leben – zwischen seinen Aufbrüchen am Montag und den Freitagabenden, wenn er zurückkehrt –, das normale Leben ist die Zeit dazwischen. Eine Zeit, von der er nichts zu wissen braucht und die meine Mutter ihm erspart. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn sie und ich uns gestritten haben (immer möglich), wenn ich Probleme in der Schule hatte (auch möglich), werden diese Nachrichten übertüncht, für seinen Seelenfrieden manikürt. Ich kann mich an kein einziges Mal erinnern, dass meine Mutter gesagt hätte: »Das muss ich deinem Vater sagen.« Oder: »Wart nur, bis Vater heimkommt.« Oder »Das wird deinem Vater aber nicht gefallen …« Er legt – sie legen – die Organisation der Woche, meine Betreuung eingeschlossen, in ihre Hände. Wenn er bei der Heimkehr, gutgelaunt lächelnd mit seinen Paketen, nichts zu hören bekommt, kann er davon ausgehen, dass nichts besonders Schlimmes vorgefallen ist. Was den Tatsachen entspricht, insofern ist es mir recht.
Sein großes, geschmeidiges, fleischiges Gesicht neigte zum Lächeln. Seine erste Miene war immer die lächelnde. Die lange, irische Lippe. Die durchscheinenden blauen Augen – meine Augen. Das muss meiner Mutter aufgefallen sein, als sie ihn kennenlernte – wo immer das war. In Hot Springs oder Little Rock, irgendwann vor 1928. Aufgefallen sein und gefallen haben. Ein Mann, der gern glücklich war. Sie war nie so ganz glücklich gewesen – nur teilweise, bei den Nonnen, die sie in St. Anne’s in Fort Smith unterrichteten, ihre Mutter hatte sie da hingegeben, um sie aus dem Weg zu haben.
Das Glücklichsein hatte aber einen Preis. Seine Mutter Minnie, eine unnachgiebige Einwanderin aus County Cavan, Kleinstadtwitwe und Presbyterianerin, war unbeirrbar der Ansicht, meine Mutter sei Katholikin. Warum wäre sie sonst auf diese Nonnenschule gegangen? Katholisch hieß »offen« statt misstrauisch und eng. Parker Carrol war das jüngste ihrer drei Kinder. Ihr Baby. Der Vater meines Vaters, ihr Mann – L. D. jr. –, hatte sich damals schon das Leben genommen. Ein zum Dandy gewordener Farmer mit Goldknauf-Spazierstock in einer kleinen Stadt in Arkansas. Und sie saß nun da mit seinen Schulden und seinem Skandal. Sie wollte ihren kostbaren Jüngsten beschützen. Vor den Katholiken, keine Frage. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätte ihn meine Mutter niemals ganz gekriegt. Und dabei blieb sie.
Selbst als junger Mann verströmte mein Vater keine »Stärke«. Sondern vielmehr etwas noch nicht auf die Probe Gestelltes, was sympathisch war, und eine Tendenz dazu, übersehen zu werden. Hintergangen. Außer von meiner Mutter. Ich habe im Gedächtnis, dass er sich in Gruppen eher zurückhielt, aber wenn er sprach, beugte er sich vor, als erwartete er, gleich etwas zu erfahren, das er unbedingt wissen musste. Er hatte sein stattliches Format; sein warmes, zögerndes Lächeln. Eine Frau, der das gefiel – wie meine Mutter –, mochte das als schüchtern auffassen, als eine Zerbrechlichkeit, mit der sie als Ehefrau arbeiten konnte. Wahrscheinlich würde er nichts falsch darstellen, auch nicht sich selbst: Er war kein Bescheidwisser, der sich schwer handhaben ließ. Allerdings konnte er furchtbar aufbrausend sein, nicht so sehr wütend, sondern eher eruptiv und impulsiv, aus Enttäuschung, weil ihm etwas nicht gelang oder nicht gut genug gelang oder er etwas nicht wusste – aus Momenten tiefer Unzufriedenheit heraus, ähnlich vielleicht wie bei seinem jungen Vater, der sich in einer sommerlichen Mondnacht im Jahre 1916 auf die Verandastufen setzte, nachdem er durch falsche Geldanlagen die Farm verloren hatte, und sich vor lauter Verzweiflung vergiftete. So waren die Stimmungen meines Vaters nicht. Das Liebevolle, das große, vorgebeugte Sonnige und die Unsicherheit standen dagegen, eröffneten ein mögliches Leben, das meine Mutter vor sich sehen, in das sie mit dem Klang ihres Namens einziehen konnte. Edna.
Als sie ihm begegnete, war sie siebzehn. Er war ungefähr vierundzwanzig – ein »Obst-und-Gemüse-Mann« im Lebensmittelladen von Hot Springs, wo sie mit ihren Eltern lebte. Der Laden gehörte zu Clarence Saunders, einer kleinen, heute untergegangenen Kette. Ich besitze ein Foto: mein Vater, der mit den anderen Angestellten im Laden steht – ringsherum Holzkisten, übervoll mit Zwiebeln, Kartoffeln, Möhren, Äpfeln. Alt sieht es dort aus. Er trägt seine weiße Latzschürze und sieht mit schwachem Lächeln starr in die Kamera. Seine dunklen Haare sind ordentlich gekämmt. Er ist durchschnittlich gutaussehend, wirkt kompetent und wach – ein junger Mann auf dem Weg zu etwas Besserem – zu einer Berufslaufbahn, mehr als bloße Arbeit. Es sind die zwanziger Jahre. Er ist vom Land in die Stadt gekommen, er kennt sich mit Landwirtschaft aus. War er auf diesem Bild nervös? Aufgeregt? Hatte er Angst, er könnte scheitern? Warum, fragt man sich, hatte er das winzige Atkins, woher er stammte, hinter sich gelassen? Die Welthauptstadt des sauer eingelegten Gemüses. Von alldem weiß ich nichts. Sein Bruder Elmo – wegen der irischen Herkunft »Pat« gerufen – lebte in Little Rock, ging aber früh zur Marine. Seine Schwester saß mit einer schnell ins Kraut schießenden Familie zu Haus. Wahrscheinlich hatte er zum Zeitpunkt dieses Fotos meine Mutter schon kennengelernt und sich in sie verliebt. Die Daten sind kein bisschen klarer als die Gründe.
Nicht lange danach nahm er einen besseren Job an, als Manager der Liberty Stores in Little Rock – einer weiteren Lebensmittelkette. Er trat den Freimaurern bei. Bald jedoch wurde eines seiner Geschäfte überfallen, die Täter schwangen Waffen, raubten Geld, schlugen meinem Vater auf den Kopf und flohen. Er wurde entlassen und erfuhr nie so recht, warum. Vielleicht hatte er etwas gesagt, was er besser unterlassen hätte. Ich weiß nicht, wie er eingeschätzt wurde. Als Bauerntölpel? Landei? Muttersöhnchen? Nicht mutig genug? Vielleicht als eine Figur, der der große Tschechow ein starkes, wenn auch nicht unbedingt reiches Seelenleben zugeschrieben hätte. Ein junger Mann, der innerhalb seiner Umstände ins Trudeln geriet.
Zeit, und dann wieder Arbeit – ebenfalls in Hot Springs. Jetzt war er mit meiner Mutter verheiratet. Es war Anfang der Dreißiger. Dann ergab sich etwas Neues, Besseres – Wäschestärke verkaufen, für die Firma Faultless aus Kansas City. Ich weiß nicht, wie er an diesen Job kam. Die Firma gibt es in KC immer noch. Bis heute hängen in den Büros Fotos meines Vaters an den Wänden, auf denen er mit weiteren Vertretern zu sehen ist. 1938. Diese Stelle behielt er bis zu seinem Tod.
Die Arbeit brachte ein zu bereisendes Revier mit sich – sieben südliche Staaten – und einen Firmenwagen. Einen schlichten zweitürigen Ford Tudor (»two-door«). Er musste Arkansas, Louisiana, Alabama und einen kleinen Teil von Tennessee abdecken, ein Stückchen Florida, eine Ecke Texas und das komplette Mississippi. Er musste die Lebensmittelgroßhändler besuchen, die im ländlichen Süden die kleinen Läden belieferten. Er fuhr bei allen vor und notierte ihre Stärke-Bestellungen. Es gab nur das eine Produkt. Seine Kunden saßen in den Seitengassen in trüben Lagerhäusern mit hölzernen Laderampen und kleinen, stickigen Büros, die nach scheffelweise Viehfutter rochen. Die großen Kunden waren Piggly Wiggly und Sunflower und Schwegmann’s. Seine kleinen Kunden mochte er aber lieber, bei ihnen vorzufahren und etwas in Gang zu setzen. Eine Bestellung. Viele – einige in Louisiana, jenseits des Atchafalaya-Sumpfes – sprachen Französisch, was es schwieriger machte, aber nicht unmöglich. Auf den Kopf schlug ihm keiner.
Jetzt war er die ganze Zeit unterwegs, und meine Mutter kam einfach mit. Little Rock – eine kleine Zweizimmerwohnung in der Center Street – war ihr Zuhause. Aber eigentlich lebten sie on the road. In Hotels. In Memphis im Chief Chisca und im King Cotton. In Pensacola im San Carlos. In Birmingham im Tutwiler. In Mobile im Battle House. Und in New Orleans im Monteleone – diese Stadt war neu für sie, ganz anders als das, was sie aus Arkansas kannten. Sie liebten das French Quarter – das Lachen und Tanzen und Trinken. Sie lernten Leute aus Gentilly kennen. Barney Rozier, der auf Ölbohrtürmen arbeitete, und seine Frau Marie.
Zum Reisejob gehörte auch die Aufgabe, in den kleinen Städten an »Kochschulen« Kurse zu geben. Junge Mädchen kamen aus der hintersten Provinz, um sich zu richtigen Hausfrauen anlernen zu lassen – Kochen, Putzen, Bügeln, Haushalt. Diese Kurse fanden in Trainingshallen der Nationalgarde, Highschool-Turnhallen, Kirchenkellern oder Elks Clubs statt. Meine Mutter und er arbeiteten Hand in Hand und zeigten den Mädchen, wie man die Wäschestärke richtig anrührte und verwendete. Es war nicht schwer. Das Emblem von Faultless war ein hellroter Stern auf einer kleinen weißen Pappschachtel. »Kochen nicht nötig«, lautete das Firmenmotto. Es gab einen Song, in dem dieser Satz vorkam. Mein Vater hatte eine erträgliche Tenorstimme und trug das Lied, wenn er etwas getrunken hatte, gern vor. Das brachte meine Mutter zum Lachen. Er und sie – gerade mal aus ihren Zwanzigern raus und im Übermaß glücklich – überreichten den Landpomeranzen kleine Schachteln mit Stärkepröbchen und Wärmekissen aus Baumwolle, und die fühlten sich geschmeichelt, solche Geschenke zu bekommen, in einer Zeit, wo niemand etwas hatte, in der Großen Depression. Das reichte für den Anfang schon, so konnten sie, wenn sie ins Piggly Wiggly gingen, ordentlich Eindruck machen. Der ganze Rücksitz des Wagens lag voller Wärmekissen und Pröbchen.
Man muss sich das mal vorstellen. Ja, anders geht es nicht: Das war ihr ganzes Leben. Auf Tour, ohne große Sorgen. Keine Kinder. Die Familie weit weg. Mein Vater trug im Winter einen Filzhut, im Sommer einen Strohhut. Er rauchte – das taten sie beide. Sein Gesicht nahm mit der Zeit einen reiferen Ausdruck an – die irische Lippe, klar, der dünne Mund, das schütter werdende Haar. Er gewann an Selbstgefühl. Er wurde – fast schlagartig – zu dem Mann, der er später sein würde. Zahnprobleme machten eine Brücke erforderlich. Partiellen Zahnersatz. Er war 1,89 groß und hatte angefangen zuzulegen. Er brachte es inzwischen auf mehr als 100 Kilo. Er besaß zwei Anzüge, einen braunen und einen blauen, und liebte seine Arbeit, die zu seinem entgegenkommenden Wesen passte. Sich selbst bezeichnete er als »Geschäftsmann«. Sein Chef, ein Mr. Hoyt, vertraute ihm, genau wie seine Kunden in all den Miniaturstädten. Viel verdiente er nicht, unter zweihundert im Monat, inklusive Spesen. Aber sie gaben auch nicht viel aus. Und er hatte etwas gefunden, das er gerne machte. Verkaufen. Beliebt sein. Freundschaften schließen. Das Militär würde ihn nicht behelligen. Ein Herzgeräusch war entdeckt worden, und er hatte Plattfüße. Dazu kam sein Alter – für den Ersten Weltkrieg zu jung gewesen, und zu alt, falls es einen zweiten geben würde, der dann ja auch kam.
Die beiden lernten allmählich immer mehr Leute kennen – unterwegs, andere Vertreter, auf den Tagungen der Lebensmittelgroßhändler oder in den Kochschulen oder in Hotelfoyers. In der Carousel Bar im Monteleone. Am Ententeich des Peabody in Memphis. Ed Manny. Rex Best. Dee Walker. So hießen diese Männer. Sie reisten für Nabisco und General Mills und Procter & Gamble oder für seine »Konkurrenten« Argo und Niagara. Man war kollegial, mehr oder weniger.
Gelesen wurde ganz sicher nicht. Fernsehen gab es noch nicht, aber Autoradio. Weder im Auto noch in den Zimmern gab es eine Klimaanlage. Nur Deckenventilatoren und die Fenster, sofern es Mückengitter gab. Kino gab es durchaus, meine Mutter mochte Filme, aber ihm sagte das nichts. Sie aßen in Supper Clubs und Bars und Kaschemmen an der Straße, gefrühstückt wurde in den Hotelcafés und Diners. Für meinen Vater liefen Lebensführung und Lebensgefühl auf ein und demselben Gleis. Es gab nur einen Blickwinkel. Das sorgte für eine Gegenwart, die ihm gefiel.
Für Faultless war er immer der Mann mit dem geringsten Spritverbrauch und den niedrigsten Spesenabrechnungen. Er fuhr stetige sechzig Meilen pro Stunde – sparsamer geht’s nicht. Er hatte keine Eile. Er wollte seinen Job nicht verlieren, es gab ja kaum welche. Sie waren die ganze Zeit zusammen, überall. Jeden Sonntagmorgen, egal wo sie waren – in irgendeinem Hotel –, erstellte er seine Ausgabenberichte im Zimmer oder an dem kleinen Sekretär im Foyer, füllte mit seinem winzigen, kaum entzifferbaren Füllfedergekrakel die Firmenformulare aus. Dann ging er zum Postamt und schickte einen dicken Umschlag nach Kansas City. Per Eilboten.
Von Anfang an wünschten sie sich Kinder. Ganz normal. Aber es hatte einfach nie geklappt. Sie wussten nicht recht, warum. Allerdings brachte es sie einander nur näher – es sperrte Vergangenheit und Zukunft zugleich aus. Ein Selbstmörder als Vater und eine strenge irische Mutter können eine Menge verhindern. Außerdem hatte es meine Mutter, bevor sie zu den Nonnen ging, alles andere als leicht gehabt. Für sie beide war die Vergangenheit kein gemütlicher Ort. Was die Zukunft und ihre Vertrautheit betraf, waren sie einander gewiss und würden es bleiben. Er hatte seine Arbeit und verließ sich ansonsten auf sie. Sie konnte rechnen, Pläne entwickeln, auf Gedanken kommen, die ihm nicht eingefallen wären. Sie war lebhaft und aufmerksam. Wenn sie über ihre Träume sprachen, was sie tun oder versuchen wollten, was unerreichbar war, was sie in Erinnerung hatten oder bedauerten, was sie fürchteten, was sie begeisterte – und das taten sie natürlich –, dann wurde darüber nicht Buch geführt, es gab keine Briefe, Tagebücher, keine auf der Rückseite beschrifteten Fotos. Das hielten sie nicht für nötig.
Irgendwo hinter ihnen lagen natürlich schon seine schwierige Familie und ihre. Meine Mutter war hübsch, schwarzhaarig, klein, kurvig, humorvoll, scharfsinnig, gesprächig – und daher in Atkins schwer vermittelbar, obwohl das niemand so deutlich aussprach. Zu seiner Mutter hielten sie Abstand, auch wenn sie sie besuchten, sogar wenn sie in ihrem Haus schliefen, dem Erbe des skandalösen Vaters auf dem Hügel über Atkins, mit Aussicht auf den Highway runter und zum Crow Mountain hoch. Seine Mutter dachte jetzt anders über ihren Sohn – als wäre er mit seiner neuen, womöglich katholischen Frau hochnäsig geworden; hätte Ehrgeiz entwickelt; hätte Leute kennengelernt, die man nicht kennenlernte, wenn man da herkam, wo er herkam. Vom Lande. Sie hatten vor dem Friedensrichter geheiratet, nicht in der Kirche. Alles war akzeptabel, aber nichts so richtig. Seine Schwester liebte ihn, ihre zahlreichen Kinder vergötterten ihn und riefen ihn – Parker Carrol – »Onkel Par’Carrol«. Aber all das fand unter dem stets wachsamen Auge der Mutter statt. Sie behielt ihre Meinung für sich, wartete ab, bestimmte, was sie bestimmen konnte, hatte aber nicht vor, die neue »Tochter« willkommen zu heißen.
Meine Mutter musste noch mit einigem anderen klarkommen – ihr Leben wurde schließlich von ihren schäbigen Eltern aus Missouri beeinflusst. Ihre Leute kamen vom Arsch der Welt, eindeutig schlimmer als »vom Lande«. North Arkansas. Tontitown. Hiwasse. Gravette. Ganz da oben. Mein Vater war zuvor nie mit solchen Leuten in Berührung gekommen. Die Mutter meiner Mutter war nur vierzehn Jahre älter als ihre Tochter und ein strafender, eifersüchtiger Mensch. Sie hatte sich vom Vater scheiden lassen. Der war weg. Der zweite Mann/Stiefvater Bennie Shelley, ein hübscher Blondschopf, war ein schlagfertiger Gigolo – ein Schwätzer, ein Hobby-Boxer für Geld, ein Eisenbahner, ein Angeber –, aber er hatte eine Zukunft, und die Mutter meiner Mutter, Essie Lucille, hatte nicht vor, sich die entgehen zu lassen, auch wenn das bedeutete, ihre lebhafte, lächelnde Tochter auf die Nonnenschule in Fort Smith zu schicken, falls die Dinge mit Benny unhandlich wurden. Und das wurden sie. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als ihnen die hübsche Tochter gelegen kam, um Geld nach Hause zu bringen, da nahmen sie sie schnell wieder von der Schule, damit sie, mit sechzehn, also zu jung, im Arlington Hotel in Hot Springs am Zigarrenstand arbeitete, wo Bennie mittlerweile die Catering-Abteilung leitete. Wie gesagt, die Große Depression. Sie mussten an Geld kommen. Nichts durfte sie aufhalten.
Für sie aber, für Edna, hätte die Familie meines Vaters durchaus eine echte Familie sein können. Irisch oder nicht, vom Lande oder nicht, engstirnig durch Frömmelei, Misstrauen und Pech – all das hätte sie problemlos beiseitegeschoben. Wäre seine Mutter ihr auch nur minimal herzlich entgegengekommen, hätte meine Mutter mehr als genug Ansatzpunkte finden können, um sich einzufügen. Schließlich war sie sympathisch – und wusste das auch. Den Schwestern gefiel sie – insgeheim. Den Vettern auch. Meine Mutter konnte einen zum Lachen bringen. Sie wusste interessante Dinge, die sie bei den Nonnen gelernt hatte. Außerdem liebte mein Vater sie. Was sollte falsch sein an ihr? Es wurde doch nicht viel verlangt. Es hätte besser laufen müssen. Sie war keine Katholikin. Aber es gab kein Entgegenkommen.
Also schmiedeten sie und mein Vater mit ihrer Familie, der meiner Mutter, einen Bund. Die kannte sie zumindest. Und es gab Reizvolles. Sie tranken – was illegal war. Bennie rauchte Zigarren, spielte Golf, trug zweifarbige Spectator-Schuhe, ging mit reichen Männern auf Gänsejagd, erzählte Witze, kannte sich mit Frauen aus, machte einen drauf, bis zu einem gewissen Maße – er passte immer auf, dass er dabei nicht seinen gesellschaftlichen Stand überschritt. Er war Arkie. Das waren sie alle drei: waschecht aus Arkansas. Seinen Platz zu kennen – über wem man stand und unter wem – war hier zweite Natur. Er nannte Essie »Mrs.Shelley«, weil sich das in den Hotels, wo sie arbeiteten – dem Huckins in Oklahoma City, dem Muehlebach in KC, dem Manning in Little Rock, dem Arlington –, nun mal so gehörte, egal ob man verheiratet war.
Sie waren ihre Eltern, aber es gab nur einen geringen Altersunterschied, zwischen allen vieren. 1895 war Essies Geburtsjahr. 1910 das meiner Mutter. Bennie und mein Vater lagen dazwischen –