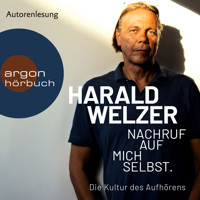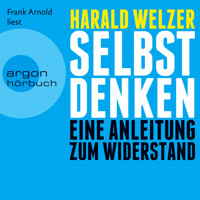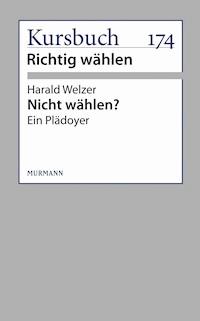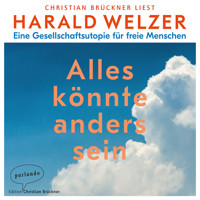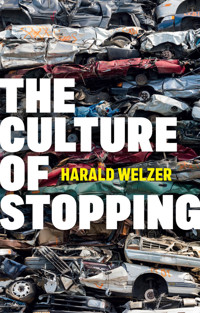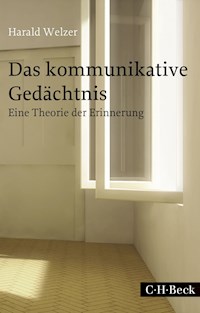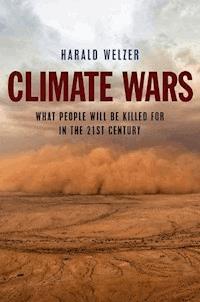9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Heute glaubt niemand mehr, dass es unseren Kindern mal besser gehen wird. Muss das so sein? Muss es nicht! Der Soziologe und erprobte Zukunftsarchitekt Harald Welzer entwirft uns eine gute, eine mögliche Zukunft. Anstatt nur zu kritisieren oder zu lamentieren, macht er sich Gedanken, wie eine gute Zukunft aussehen könnte: In realistischen Szenarien skizziert er konkrete Zukunftsbilder u.a. in den Bereichen Arbeit, Mobilität, Digitalisierung, Leben in der Stadt, Wirtschaften, Umgang mit Migration usw. Erfrischend und Mut machend zeigt Welzer: Die vielbeschworene »Alternativlosigkeit« ist in Wahrheit nur Phantasielosigkeit. Wir haben auch schon viel erreicht, auf das man aufbauen kann. Es ist nur vergessen worden beziehungsweise von andere Prioritäten verdrängt. Es kann tatsächlich alles anders sein. Man braucht nur eine Vorstellung davon, wie es sein sollte. Und man muss es machen. Die Belohnung: eine lebenswerte Zukunft, auf die wir uns freuen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 354
Ähnliche
Harald Welzer
Alles könnte anders sein
Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen
FISCHER E-Books
Inhalt
AlsStoffwechsel oderMetabolismus bezeichnet man die gesamten chemischen und physikalischen Vorgänge der Umwandlung chemischer Stoffe bzw. Substrate (z.B. Nahrungsmittel und Sauerstoff) in Zwischenprodukte und Endprodukte im Organismus von Lebewesen. Diese biochemischen Vorgänge dienen dem Aufbau, Abbau und Ersatz bzw. Erhalt der Körpersubstanz sowie der Energiegewinnung für energieverbrauchende Aktivitäten und damit der Aufrechterhaltung der Körperfunktionen und damit des Lebens. (Wikipedia)
Man muss tatsächlich erst mal daran erinnern: Menschen sind Lebewesen, daher brauchen sie trinkbare Flüssigkeiten, essbare Substanzen und Sauerstoff, um ihre Überlebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Der Stoffwechsel erfordert Böden und Gewässer und Atemluft. Daten, Autos und Kreuzfahrten kann man weder essen noch trinken, sie produzieren auch keinen Sauerstoff.
Jede Gesellschaftsutopie muss davon ausgehen, dass das Überleben aller Menschen sichergestellt ist. Das ist nicht trivial. Erstens: Weil das in der Gegenwart keineswegs für alle Menschen schon so ist. Zweitens: Weil in hochgradig fremdversorgten Gesellschaften vergessen wird, dass Leben Voraussetzungen hat, die nicht künstlich sind. Drittens: Weil der gesellschaftliche Stoffwechsel heute durch eine Wirtschaft organisiert wird, die an den grundlegenden Voraussetzungen des Lebens nicht interessiert ist. Was viertens anders werden muss.
I.Wiedergutmachen
Vor einigen Jahren hatte ich das große Vergnügen, eine traumhafte Flussfahrt zu machen, geführt von einem Fischer in seinem kleinen Boot, auf das gerade mal acht Passagiere passten. Das Licht war großartig an diesem frühen Tag, und wir sahen Scharen von Seeschwalben und Bekassinen auf dem Wasser, Milane und Fischadler hoch am Himmel, Biber am Ufer und sonst noch alles Mögliche. Zwischendurch picknickten wir, und der Fischer holte Räucherfisch, Hechtsalat und Bier aus seinen Kühltaschen. Ich dachte: Das Leben kann schon sehr gelungen sein!
Der Fluss, den wir herabfuhren, war nicht der Amazonas, es war auch nicht der Mississippi, obwohl das Grundgefühl schon sehr Mark-Twain-mäßig war. Es war: die Havel, und wir fuhren von Havelberg (wo Elbe und Havel zusammenfließen) in Richtung Berlin. Die Havel wird gerade renaturiert, das heißt: Uferbefestigungen werden beseitigt, abgeschnittene Flussarme wieder angeschlossen, Überflutungswiesen wieder mit dem Fluss verbunden. Daher diese beeindruckende Landschaft; irgendwann einmal, wenn dieses größte Flussrenaturierungsprojekt Europas abgeschlossen ist, wird man einen Eindruck bekommen können, wie so ein Fluss aussieht, wenn er nicht industriell genutzt wird. Aber auch jetzt schon war die Natur überwältigend.
Als wir gegen Nachmittag zurückfuhren, fragte ich meine Mitreisenden, allesamt ökobewegt und beim NABU oder beim WWF oder so, was sie denn im tiefsten Innersten antreibe, sich für die Umwelt zu engagieren (und, wie wir alle, tief berührt von so einem Ausflug zu sein). Die Antwort, die mich am nachhaltigsten beeindruckt hat, war die von Rocco Buchta, der für den NABU das Projekt der Renaturierung leitet und der uns auf unserer kleinen Reise auch am meisten über die Havel erzählt hatte.
Rocco stammt nämlich aus der Gegend. Sein Großvater war ein Kind dieser Region, kräftig, vital – eine Art Traumopa für kleine Jungs, die zu so einem Großvater aufschauen. Der kannte die Havel noch im ursprünglichen Zustand, aber dieser Fluss, sein Fluss, war immer weiter verschwunden. Mit ihrer zunehmenden Nutzung als Wasserstraße in DDR-Zeiten, ihrer Begradigung und Vertiefung und auch ihrer Verschmutzung wurde die Havel immer trüber und armseliger, und genauso erging es, wie Rocco erzählte, auch seinem Großvater. Der wurde immer verdrießlicher und trauriger, und die Veränderung betraf nicht nur die Stimmung. Auch körperlich baute der gewaltige Mann stark ab, wurde »immer weniger«, und Rocco litt mit ihm, aber natürlich konnte er ihm nicht im Geringsten aus seiner Misere helfen. Der Mann ging mit seiner Landschaft zugrunde. Und der Zwölfjährige, der den Zusammenhang klar verstand, sagte dem verzweifelten Großvater: »Opa, ich verspreche dir: Ich mach das wieder gut!«
Und tatsächlich: Da saß er nun, Rocco, und machte die Havel wieder gut.
Mir scheint, das ist eine gute Geschichte, um dieses Buch zu beginnen. Das ist nämlich ein positives Buch. Was nicht gleichbedeutend ist mit: ein optimistisches Buch. Es geht nur, wie Rocco, davon aus, dass ziemlich viel falsch gelaufen ist in der Vergangenheit, was aber nicht heißt, dass man das Falsche nicht korrigieren, wiedergutmachen kann. Und es bedeutet auch nicht, die Vergangenheit als so etwas wie einen Irrtum zu betrachten; denn wirtschaftlich machte die Nutzung der Havel zu jener Zeit, als ihr Ökosystem angegriffen wurde, Sinn. Auch das DDR-Regime war ja interessiert daran, den Wohlstand seiner Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.
Das alles war übrigens nicht anders als im Westen in der Nachkriegszeit, auch nicht, was den brutalen Umgang mit den natürlichen Gegebenheiten anging: Dort verwandelte man buchstäblich Flüsse in Abwasserkanäle, wie die Emscher im Ruhrgebiet, und als sie zu sehr stank, packte man Betondeckel drauf; da ist die Havel sogar noch gut weggekommen. Die Wirtschaftswunder beiderseits des Eisernen Vorhangs, versinnbildlicht in Wachstumskennziffern und Neubauten, in Autobahnen und Schulgebäuden, machten das Leben und dessen Standard für die Menschen besser, ob sie nun aufstrebende Mittelschichtler im Westen waren oder verdiente Genossen im Osten.
Die Natur war lediglich Mittel zum Zweck ihrer maximalen und oft gnadenlos rücksichtslosen Ausbeutung. Aber eben: Genau diese Ausbeutung hob die Lebensqualität, auch wenn Roccos Großvater und gewiss nicht wenige andere darunter litten wie die Hunde.
Wir befinden uns heute in viel größerem Maßstab in Roccos Situation: Denn was »wiedergutzumachen« ist, das ist ja wahnsinnig viel. Mehr noch: Der besinnungslose Raubbau, der die europäische und US-amerikanische Nachkriegszeit prägte, findet heute global, also in noch viel größerem Maßstab statt. Aber trotzdem: In Roccos Lebenszeit hat sich so viel zum Positiven verändert, dass sein eigentlich ganz unmögliches Versprechen schließlich doch einlösbar wurde.
Man könnte auch sagen: Aus etwas ganz und gar Unrealistischem wurde eine Wirklichkeit. Und die konnte es nur werden, weil sich zwischenzeitlich die Gesellschaft so entwickelt hatte, dass sie andere Prioritäten zu setzen in der Lage war: Die Verfechter eines durch nichts gebremsten Wirtschaftswachstums waren angesichts offensichtlicher ökologischer Desaster in die Defensive geraten, und nur Illusionisten wie FDP-Politiker und manche Wirtschaftswissenschaftler träumen heute noch von Märkten, deren Wachstumsdrang durch nichts beschränkt wird. Das ist wahrlich unrealistisch. Ganz im Gegensatz zu Roccos Realismus der Hoffnung. Der hat viel mehr Wirklichkeit auf seiner Seite.
Denn die Zeiten haben sich geändert. Aber natürlich nicht genug. Im Gegenteil: Die Veränderungsdynamik, die mit der Ökologiebewegung der 1970er aufgekommen ist, ist längst abgeebbt, ja, der modernen Gesellschaft insgesamt scheint jegliche Vorstellung abhandengekommen zu sein, dass sie anders, besser sein könnte, als sie ist. Sie hat keinen Wunschhorizont mehr, sondern ihre Zukunft offenbar schon hinter sich. (Die Einzigen, die Zukunft anzubieten haben, und dafür ordentlich Reklame machen, sind die digitalen Konzerne, aber deren Zukunft ist total von gestern – sie dynamisieren nur das gestrige fossile Konsumverhalten.)
Keine Zukunft zu haben ist kein Zustand, der gute Laune macht. Und genau deshalb ist unsere Gegenwart vor allem durch schlechte Laune gekennzeichnet, was ein bisschen absurd ist: Warum ist man denn so furchtbar reich geworden, wenn man am Ende doch nur so mies drauf ist wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr? Oder man, wie die Glücksforschung zeigt, etwa in den USA heute, trotz vervierfachtem Bruttoinlandsprodukt unglücklicher ist als vor einem Vierteljahrhundert. Oder wo die digitale Gesellschaft Nr. 1, nämlich Singapur, hinsichtlich des empfundenen Lebensglücks nur einen traurigen 26. Platz belegt. Wozu der ganze Aufwand, wenn er das Glück nicht hebt? Oder sogar noch Angst vor allem Möglichen gebiert, obwohl man zum Beispiel in Deutschland (Glücksindex Platz 14) in der sichersten Gesellschaft lebt, die es menschheitsgeschichtlich jemals gegeben hat.
»Vor der Finanzkrise und der Bankenkrise. Dem Euro. Griechenland. Überhaupt vor Europa. Vor dem Klimawandel. Dem Ökofaschismus. Überschwemmung. Wassermangel. Vor Überfluss. Vor Knappheit. Vor Terroristen. Fundamentalisten. Idealisten. Kommunisten. Kapitalisten. Dem Antichristen. Christen. Moslems. Juden. Hindus. Sekten. Insekten. Langeweile. Amerikanern. Chinesen. Indern. Pakistanis. Polen. Negern. Überhaupt Ausländern. Nachbarn. Männern mit Bart. Frauen mit Bart. Der Wissenschaft. Verblödung. Vor Gutmenschen. Vor bösen Menschen. Unmenschen. Übermenschen. Untermenschen. Überhaupt vor Menschen. Vor Bakterien und Viren. Vor der Zerstörung der Umwelt. Vor Staus. Vor der Kernkraft. Davor, dass der Strom ausfällt. Vor Windrädern. Monokultur. Vielfalt. … Vor Armut. Demütigung. Dem Teufel. Gott. Der Jugend. Dem Erwachsenwerden. Dem Alter. Vor Giften. Medikamenten. Peinlichkeit. Kleinlichkeit. Heimlichkeit. Engen Räumen. Weiten Plätzen. Zu fett werden. Anorexie. Alzheimer. Nicht vergessen können. Liebe. Einsamkeit. Vor dem Chef. Den Kollegen. Vor Mobbing. Teilnahmslosigkeit. Vor Isolation. Vor Sattheit. Vor dem Hunger. Dekadenz. Askese. Vor dem Internet. Davor, kein Netz zu haben. Vor Arbeitslosigkeit. Stress. Burn-out. Langeweile. Der Zukunft. Der Vergangenheit.« Usw.[1]
Ängste treiben die Menschen in einer Welt um, in der die Lebenserwartung so hoch und die Gewaltkriminalität so niedrig ist wie niemals zuvor. Der Prozess der Zivilisierung ist, wie Steven Pinker (2012) einerseits und Yuval Noah Harari (2015) andererseits gezeigt haben, dadurch charakterisiert, dass das Niveau der körperlichen Gewalt, die Menschen gegenüber anderen Menschen ausüben, beständig absinkt. Nie war es, besonders in funktionierenden Rechtsstaaten, so unwahrscheinlich wie heute, Opfer einer Gewalttat zu werden. In modernen Gesellschaften liegt das insbesondere daran, dass der Staat das Gewaltmonopol hat, weshalb jede Form der willkürlichen und nicht gesetzlich legitimierten Gewalt verfolgt und bestraft wird. Im Ergebnis hat das zu einer drastisch gesunkenen Gewaltrate geführt. Aber nicht nur statistisch leben wir heute in der friedlichsten aller Zeiten, auch ein kurzer Blick auf das, was wir für normal und was wir für kriminell halten, hat sich allein im letzten halben Jahrhundert radikal verändert.
Ich bin wie viele Altersgenossen zum Beispiel in der Schule bis in die 1970er Jahre hinein noch von Lehrern geschlagen worden – wobei übrigens die politische Einstellung keine Rolle spielte: Ein späteres Gründungsmitglied der GRÜNEN und Anhänger der antiautoritären Erziehung schlug damals ebenso schmerzhaft zu wie ein beliebiger Altnazi. Auch in den Familien wurden Kinder noch verprügelt, ebenso wie das Verhältnis zwischen den Geschlechtern nicht selten von körperlicher Gewalt geprägt war. Die Vergewaltigung in der Ehe gilt in der Bundesrepublik erst seit 1997 als Straftat, und die #metoo-Debatte, die gerade auf Hochtouren lief, als ich dieses Buch schrieb, dreht sich vor allem um Fälle, die drei, vier Jahrzehnte zurückliegen – was nichts anderes heißt, als dass damals Gewalt weit alltäglicher und somit akzeptierter war als heute.
Der Skandal kommt in diesem Licht genauso verspätet wie umgekehrt die Vorstellung, dass Gewalt ständig zunehme. Das Gegenteil ist der Fall. Jedes einzelne Gewaltdelikt fällt gerade darum besonders auf, weil die direkte Gewalt aus unserem Alltag so weitgehend verschwunden ist.
Die Berechnungen, die Steven Pinker akribisch durch die Menschheitsgeschichte hindurch anstellt, weisen mit Nachdruck darauf hin, dass selbst im berüchtigten 20. Jahrhundert mit zwei Weltkriegen, einem Holocaust und mehreren anderen Völkermorden relativ weniger Menschen eines gewaltsamen Todes gestorben sind als in den Jahrhunderten davor. Es gibt heute auch in globaler Perspektive weniger Gewalt als je zuvor. Dasselbe gilt für die medial hyperpräsente und geradezu hyperventilierende Terrorgefahr: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Opfer eines Terroranschlags zu werden? Jährlich gibt es weltweit etwa 25000 Terroropfer, die allermeisten in armen islamischen Ländern, nur gerade ein Prozent davon im reichen Westen. Jedes Jahr sterben in Deutschland fast 10000 Menschen an Haushaltsunfällen, über 3000 im Straßenverkehr (das sind neun jeden Tag), 400000 werden durch Verkehrsunfälle verletzt, bis zu 6000 sterben infolge von Feinstaubemissionen. Das Auto tötet massenhaft, dem Terror hingegen fielen in der Bundesrepublik im Jahr 2016 vierzehn Menschen zum Opfer, in den Jahren 2017 und 2018 kein einziger. Trotzdem geben in Umfragen zwei Drittel der Deutschen die Angst vor dem Terrorismus als ihre größte Angst an (und die Politik instrumentalisiert diese Angst, womit sie den Terrorismus über jedes von ihm selbst erreichbare Maß hinaus erfolgreich macht).
Überall dort, wo keine funktionierende Staatlichkeit herrscht, wo die Behörden und die Polizei korrupt sind, hat man es mit alltäglicher Gewalt zu tun. Und in Diktaturen sowieso: Dort schützt kein Recht vor willkürlicher Gewalt durch die staatlichen Organe; die Bürgerinnen und Bürger sind ihr in jeder Form ausgeliefert: als permanente Drohung, als sexuelle Gewalt, als Entführung, als Verhaftung, als Folter, als Totschlag. Schauen Sie in die Türkei und überlegen Sie, was Ihnen als unbescholtener Bürgerin dort passieren kann, wenn es jemandem einfällt, Sie als Anhängerin der Gülen-Bewegung, der PKK oder auch nur als Gegnerin der Regierung zu denunzieren. Von dem Augenblick an haben Sie keine Kontrolle mehr über Ihr Leben. Ebenso wie im Mittelalter die meisten Frauen und Männer keine Kontrolle über ihr Leben hatten: Der Gutsherr vergewaltigte nach Lust und Laune, Armeen hoben Rekruten aus, Gewalt war ein alltägliches Geschehen. Fragen Sie in der eigenen Familie, wie das früher war. Mein Großvater zum Beispiel war ein uneheliches Kind, und niemand weiß bis heute, wer seine extrem junge Mutter (also meine Urgroßmutter) geschwängert hatte. Das Baby wurde als »Wechselbalg« auf einen anderen Hof gegeben und wuchs dort auf, verhasst und ganz unten in der sozialen Hackordnung. Das war nicht im Mittelalter und auch nicht in Afghanistan. Das war im protestantischen Norddeutschland, vor gerade mal drei Generationen.
Was für ein unglaublicher Fortschritt also: Sie leben heute in einem modernen liberalen Rechtsstaat sicherer an Leib und Leben als je ein Mensch vor Ihnen. Deshalb ist übrigens auch Ihre Chance, länger zu leben als ihre Vorfahren, erheblich größer. Es ist ja ein weitverbreiteter Irrtum, die heute gegenüber dem 19. Jahrhundert verdoppelte Lebenserwartung hauptsächlich auf die Segnungen der Medizin, des iPhone-überwachten Morgensports und die bessere Ernährung zurückzuführen. Früher wurden einzelne Menschen genauso alt wie heute. Es kamen nur weniger dahin; die meisten wurden vor dem Erreichen ihres natürlichen Lebensendes totgeschlagen, verhungerten oder starben im Kindbett. Und natürlich war die im Vergleich zu heute exorbitant hohe Kindersterblichkeit ein wesentlicher statistischer Grund für die durchschnittlich geringe Lebenserwartung – noch vor einem halben Jahrhundert starb jedes fünfte Kind vor seinem fünften Geburtstag.[2] Ein wesentlicher Grund ist auch der Rückgang der Armut: Vor 200 Jahren lebten 84 Prozent aller Menschen in extremer Armut, heute sind es etwa 10 Prozent.[3]
Dass man heute mehrheitlich ein hohes Lebensalter erreicht, hat primär eine gesellschaftliche Ursache: Mit dem modernen Rechtsstaat ist eine Form von Gesellschaft geschaffen worden, die ein weitgehend sicheres und unbeschädigtes Leben für alle ermöglicht. Das ist, man muss es deutlich sagen, nicht Nichts.
Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus
Nicht Nichts ist übrigens auch der Sachverhalt, dass ein Land wie Deutschland seit mehr als 70 Jahren mit seinen Nachbarn in Frieden lebt. Ein Blick auf die simple Animation »Europe in the last thousand years« auf Youtube zeigt eindrücklich, was das heißt: Dieser kleine Kontinent befand sich mehr als 900 Jahre lang in beständiger Veränderung, weil andauernd ein Reich ein anderes bekämpfte, weil Herrschaft mit Eroberungen ausgebaut und gesichert wurde. Zwei Drittel eines Jahrhunderts Frieden wäre den Menschen ganz undenkbar erschienen, ein Drittel eines Jahrhunderts Krieg hatte es dagegen durchaus schon gegeben. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit seinen Millionen Toten, Ermordeten, Deportierten und Vertriebenen ist hierzulande – nichts mehr passiert. Das ist historisch betrachtet eine Sensation. Es ist historisch betrachtet auch die einsame Ausnahme. Zwar gibt es Länder, die – wie zum Beispiel Schweden – noch viel länger an keinem Krieg mehr beteiligt waren. Aber auf der Ebene eines ganzen, national und regional höchst diversen Kontinents ist eine Friedenszeit, die mehr als zwei Generationen umspannt, einzigartig.
Jaja, ich weiß natürlich, dass das nur ein Teil der ganzen Geschichte ist – dass europäische Länder viele Stellvertreterkriege und Gewaltregime in Afrika oder Südamerika mit zu verantworten haben, dass deutsche Unternehmen wie die Volkswagen AG Diktatoren unterstützt und Zwangsarbeiter beschäftigt haben und dies bei sich bietender Gelegenheit vermutlich auch heute tun würden. Aber Kritik können wir alle sehr routiniert. Weniger geübt sind wir im Aufzählen dessen, was positiv zu Buche schlägt. Oder anders gesagt: bei dem, was es Rocco ermöglicht hat, sein Versprechen wahr zu machen.
Ist Ihnen, um gleich weiterzumachen, eigentlich klar, dass Ihr persönlicher Lebensstandard weit besser ist als der von Ludwig dem XIV.? Okay, Sie haben keinen Hermelinmantel und nicht so schicke Schühchen. Aber Sie haben: fließend Wasser, warm und kalt, Heizung, ein dichtes Dach, Fenster, durch die es nicht zieht, regendichte Kleidung, Schuhe für jede Jahreszeit, Fortbewegungsmittel aller Art, einen Zahnarzt, Betäubungsspritzen, minimalinvasive Chirurgie, Gleitsichtgläser, Zahnspangen, Schulen, Universitäten, Vereine, Schwimmbäder, Urlaubsreisen und insgesamt so viel mehr, dass die Aufzählung dessen, was Ihnen ganz allein und ganz persönlich verfügbar ist, den Umfang dieses Buches sprengen würde. Jedenfalls hungern Sie nicht, und Ihre Wohnung ist komfortabel geheizt, was man vom Versailler Schloss nicht sagen kann.
Und: Sie durften in die Schule gehen, eine Ausbildung machen, vielleicht studieren. Ihr Studium abbrechen. Ein anderes beginnen. Unglaublich: Wir leben in einer Gesellschaft, die Menschen – nach einer Drogenkarriere, nach einer lebensgeschichtlichen Verwirrung – zweite und dritte Chancen gibt. Wir hatten einen ehemals Molotowcocktails werfenden Außenminister, der hohes internationales Ansehen genoss. Einem ansonsten erfolglosen Kanzlerkandidaten wurde zugutegehalten, dass er seine Alkoholsucht überwunden hatte. Wir leben in einer Gesellschaft, die Fehler verzeiht. Das ist historisch neu. Einzigartig.
Und diese Form von Gesellschaft – die offene moderne Gesellschaft – eröffnet ihren einzelnen Mitgliedern die größtmögliche Freiheit, über die Menschen je verfügen durften. Sie können tun und lassen, denken und sagen, was sie wollen, und um es mal ganz deutlich festzuhalten: In solch einer Gesellschaft braucht es überhaupt keinen Mut, seine Meinung zu äußern, für andere einzutreten, eine Bürgerinitiative zu gründen oder was auch immer. Mut braucht man in Diktaturen. Hier ist Mut ersetzt durch ein Gesetzbuch und Institutionen, die Ihre Freiheit schützen.
Da ist es kein Wunder, dass die Oma einer Mitarbeiterin von mir jedes Jahr den Tag ihrer Ankunft in Deutschland feiert. Sie war vor mehr als einem halben Jahrhundert aus Rumänien geflohen und lebt seither in diesem Land. Sie ist sehr glücklich darüber. Merkwürdigerweise feiern die restlichen 80 Millionen Deutschen nie, dass sie in diesem Land leben. Im Gegenteil: Wie verwöhnte zu groß geratene Kinder sind sie chronisch unzufrieden und machen irgendwen – Angela Merkel, das Großkapital, die Flüchtlinge, die Vogonen – dafür verantwortlich.
Und dabei habe ich vom unglaublichen Reichtum, von der Kaufkraft, von allem, was man an Produkten und Dienstleistungen konsumieren kann, noch gar nicht gesprochen. Das will ich auch gar nicht, Sie wissen selbst, dass Sie von allem zu viel haben und dass das meiste davon nichts taugt. Ich habe genug dazu geschrieben und gesagt, Wiederholungen sind langweilig. Nur eins noch: Die Welt beginnt sich im globalen Maßstab gerade erst in eine Konsumhölle zu verwandeln und soll bald überall genauso aussehen wie Oberhausen oder der zum Konsumgulag degradierte Alexanderplatz in Berlin. In diesem Prozess wird sie, wie Roccos Großvater, zugrunde gehen. Wenn nichts dagegen unternommen wird. Nein, falsch: Wenn Sie und ich nichts dagegen unternehmen.
Gelebte Illusionen
Das Problem ist: Alles, was die unglaublichen zivilisatorischen Fortschritte möglich gemacht hat, die ich eben aufgezählt habe, basiert auf der Vorstellung, dass die Naturressourcen, aus denen wir Autos, Häuser, Nahrungsmittel, Smartphones, Kleider, Alexanderplätze und Raketen machen, unbegrenzt vorhanden sind. Diese Vorstellung ist sogar so irre, dass die meisten Ökonomen und Politiker glauben, dass die Materialmenge, die für die Verwandlung in Produkte jeder Art nötig ist, immer noch anwachsen kann, genauso wie die Menge der Energie, die für die Umwandlung gebraucht wird. Das widerspricht, so hat es der Historiker Yuval Noah Harari formuliert, so ziemlich allem, was wir über das Universum wissen. Ja, es widerspricht dem, was Kinder in der Schule lernen und damit auch der allgegenwärtigen Reklame, wir lebten in einer »Wissensgesellschaft«. Nichts könnte falscher sein: Wir leben in einer Gesellschaft, in der Wissen gelehrt und Unwissen praktiziert wird, ja, in der Tag für Tag gelernt wird, wie man systematisch ignorieren kann, was man weiß. So wird in den Tagen, da ich dieses Kapitel schreibe, unter zähem Ringen ein Koalitionsvertrag – das ist ein Regierungsprogramm – verabschiedet, der ohne jede Rechenschaft gegenüber den naturalen Bedingungen unserer wirtschaftlichen Existenz auskommt – und zwar der gegenwärtigen wie der zukünftigen.
Und dabei sind es gerade die Bedingungen einer künftigen Wirtschaft, die neu entwickelt werden müssen: Denn all die großartigen Errungenschaften, auf die man zurückblicken kann, sind nur um den Preis zu haben gewesen, dass man weder auf die natürlichen Gegebenheiten noch auf die Lebenssituationen von Menschen in anderen Teilen der Welt Rücksicht genommen hat. Ulrich Brand und Markus Wissen haben das zutreffend als »imperiale Lebensweise« bezeichnet; Stephan Lessenich nennt unsere Gesellschaft die »Externalisierungsgesellschaft«: Wir holen alles, was wir zur Erzeugung unseres Wohlstands brauchen, von außen, und genau dorthin schaffen wir auch das meiste weg, was nach dem Gebrauch der Dinge übrig bleibt: Schrott, Abfall, Emissionen.
Die paradoxe Lage, in der wir uns befinden und über die ich mir seit Jahren den Kopf zerbreche, sieht so aus: Wir können als Bewohnerinnen und Bewohner der Moderne auf eine – vielfältig gebrochene und oft ambivalente, aber doch – atemberaubende Geschichte humanen Fortschritts zurückblicken und einen zivilisatorischen Standard in Sachen Freiheit, Teilhabe, Sicherheit und Wohlstand genießen, der historisch beispiellos ist. Aber der Stoffwechsel, auf dem dieser Fortschritt beruht, ist nicht fortsetzbar im 21. Jahrhundert, dazu ist er – für das Erdsystem, das Klima, die Biosphäre, die Meere, viele Menschen – zu zerstörerisch. Darüber gibt es eine Unmenge von Studien, Büchern, Filmen. Wir haben keinen Mangel an Wissen über den Zustand der Welt, aber Mangel an Willen, diesen Zustand zu verbessern. Aus meiner Sicht gibt es eine Verantwortung, die idealistisch betrachtet für alle Mitglieder einer solchen Gesellschaft gilt, eine Art minimalistischer kategorischer Imperativ:
Du musst helfen, diesen zivilisatorischen Standard zu bewahren.
Es ist klar, dass mit »zivilisatorischem Standard« nicht der materielle Überfluss gemeint ist, sondern die immateriellen Güter: Freiheit, Sicherheit, Recht, Institutionen der Bildung, Gesundheit, Versorgung. Wenn wir das alles erhalten und – weil die Welt sich verändert – modernisieren wollen, dann müssen wir unseren materiellen Stoffumsatz verändern. Man könnte in Abwandlung eines berühmten literarischen Zitates auch sagen: Wir müssen alles verändern, damit vieles bleiben kann, wie es ist.
Eines der größten Probleme beim Suchen nach einem Ausweg aus dieser paradoxen Lage besteht darin, dass die wenigsten Menschen sie als paradox empfinden. Denn die komfortablen Lebensverhältnisse haben sich so sehr in uns eingelebt, dass sie gar keine Voraussetzungen zu haben scheinen. Als ich etwa bei einer Führung durch ein Hightech-Unternehmen, das ganz vorn in der Robotik ist, den Geschäftsführer fragte, wo denn die Rohstoffe für seine Geräte herkämen, schaute er mich irritiert an und antwortete: »Die werden hier angeliefert!« Solches bewusstes Unwissen ist unter den gesellschaftlichen Eliten – also den sogenannten Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Verwaltung, Medien und Bildung – weit verbreitet. Die allermeisten bevorzugen den Aberglauben, dass alles irgendwie schon so weitergehen wird, wenn man nur regelmäßig Glaubenssätze (»Ohne Wachstum ist alles nichts«) wiederholt, Rituale befolgt (»Wir haben hochkarätige Speaker eingeladen«) und bloß niemals über Gründe spricht (»Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen«).
Wirtschaftsmagazine sind die Pornoheftchen von heute. Auf jeder dritten Seite gibt es das Porträt eines Mannes (seltener einer Frau), der oder die mit irgendetwas besonders erfolgreich sein soll. Sehr hoch gehandelte Pornostars sind im Augenblick Männer wie Elon Musk oder Peter Thiel, Sie wissen schon, venture capital, paypal, Tesla usw. Der bundesdeutsche Entscheidungsträger sieht nicht so gut aus, sondern mehr wie Joe Kaeser, der Siemens-Chef, der sich gelegentlich durch scham- und haltlose Anschleimerei an noch größere Entscheidungsträger auszeichnet. Super sind auch die Vorstände von Daimler, die kollektiv seit einem Besuch im Silicon Valley, wo man ja bekanntlich keine Schlipse trägt, keine Schlipse mehr tragen.
Abb. 1: Schlipslos nach Führerbefehl: Daimler-Vorstand.
Sind Menschen Entscheidungsträger, wenn sie sich nicht mal alleine anziehen können? Warum sprechen wir eigentlich nicht darüber, dass wir in einer Welt mit einer Wirtschaft, die sich in Richtung Nachhaltigkeit transformieren muss, diese Sorte Leute mit einem komplett anachronistischen Selbstbild und einer ganz und gar veralteten Berufsauffassung nicht gebrauchen können? Wir brauchen Menschen, die nicht Idealen des bedingungslosen Funktionierens, der Effizienz und der Optimierung huldigen, sondern solche, die in hohem Maß wertschätzende Sorgfalt gegenüber materiellen Dingen und soziale und kulturelle Kompetenz haben. Und autonom denken, sprechen, analysieren und handeln können. Mit den heutigen Typen kann man praktisch nichts Zukunftsfähiges anfangen.
Unter Federführung solcher Leute findet gegenwärtig ein globales Experiment statt: Es wird in allen Daseinsbereichen ausprobiert, ob man klar definierte Grenzen der Nutzung naturaler Gegebenheiten überschreiten kann, ob man, einfacher gesagt, in einer endlichen Welt unendlich wachsen kann. Das ist der weltweite Versuchsaufbau. Und obwohl diese Grenzen mit zunehmender Übernutzung immer deutlicher zutage treten, entscheiden sich täglich weltweit mehr Menschen dafür, an diesem Experiment teilzunehmen. Obwohl sein Ergebnis – nämlich Kollaps – klar absehbar ist, gibt es keine Mehrheit, die für einen Abbruch stimmen würde. Alle Vernunft und alles Wissen sprechen für einen Abbruch und für das Experimentieren mit Alternativen, aber nirgendwo findet sich eine Mehrheit, die von ihrer Vernunft und ihrem Wissen Gebrauch machen würde. Ganz im Gegenteil: Diejenigen, die andere Formen des Wirtschaftens und Lebens ausprobieren, müssen sich ständig dafür rechtfertigen, da das alles ja nie funktionieren könne. Seltsam: Das Experiment mit dem absehbar negativen Ergebnis steht nie unter Rechtfertigungsdruck, aber die, die andere Wege ausprobieren, müssen sich ständig dafür rechtfertigen. Warum? Weil sie als lebendige Beispiele dafür, dass die Sache mit der Alternativlosigkeit nicht stimmt, kleine, aber lästige Systemstörungen darstellen.
Das ist zwar idiotisch, aber psychologisch nicht verwunderlich, denn wachstumswirtschaftlicher Kapitalismus erlaubt Menschen, die von ihm profitieren können, die Aussicht auf ein besseres Leben. In den Schwellenländern entstehen Mittelklassen, Bildungs- und Gesundheitsstandards steigen – und vor allem: Die, die noch arm sind, können hoffen, dass es ihren Kindern und Enkeln einmal bessergehen wird. Hungersnöte, noch vor wenigen Jahrzehnten eine häufige Katastrophe, sind nahezu abgeschafft, die Kindersterblichkeit ist, wie gesagt, radikal zurückgegangen; Schulbildung hat sich global verbreitet. Und mit den von der UNO verabschiedeten »Sustainable Development Goals« (SDGs) werden diese Entwicklungen fortgeführt. Es ist also keineswegs alles schlecht im Kapitalismus.
Das Problem ist nur: Alle diese begrüßenswerten Fortschritte finden bislang eben auf der Grundlage eines zerstörerischen Naturverhältnisses statt. Wir folgen einer Ökonomie, die ihre eigenen Voraussetzungen konsumiert. Dass das nicht lange gutgehen kann, ist trivial. Die Folgen zeigen sich denn auch allenthalben: Am dramatischsten in den rasant wachsenden Zahlen von Menschen, die auf der Flucht sind. Heute sind das rund 69 Millionen Menschen, das UNHCR (das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen) prognostiziert eine Steigerung auf etwa 250 Millionen in den nächsten drei Jahrzehnten. Dabei ist die sich zeigende wachsende Dynamik des Klimawandels noch gar nicht eingerechnet, genauso wenig wie die voraussehbaren Ernährungs- und Wasserprobleme. Kapstadt zum Beispiel erlebt gerade eine noch nie dagewesene Wasserknappheit, Kalifornien ist von nie gesehenen Bränden geplagt, die Karibik von stärkeren Hurrikans denn je. Tornados und Starkregen treten auf, wo es sie zuvor nie gegeben hat, in Deutschland gibt es neuerdings verheerende Winterstürme, in Schweden tropische Temperaturen und unkontrollierbare Waldbrände.
Und so weiter: Die Wetterstatistik verzeichnet fast jedes Jahr einen neuen Rekord in der Höhe der durchschnittlichen Temperatur, es ist unabsehbar, wie sich das Insektensterben und dessen Konsequenzen für Flora und Fauna entwickeln werden. Kurz und sehr einfach: Mehr Gegenden der Welt werden in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar, gefährlich, ungeeignet für sicheres Leben.
Gesellschaften für freie Menschen sind widersprüchlich
Der Flüchtling ist die säkulare Figur des 21. Jahrhunderts. Das 20. Jahrhundert war von sozialen Bewegungen geprägt: Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Ökologiebewegung. Ja, und auch der faschistischen Bewegung und der kommunistischen. In jedem Fall ging es darum, die Gesellschaft, so wie sie war, zu kritisieren, zu verändern oder abzuschaffen, reformistisch oder revolutionär, friedlich oder mit Gewalt.
Soziale Bewegungen entstehen von unten, dort, wo Ungerechtigkeit empfunden wird. Die Flüchtlinge sind eine globale Bewegung, einstweilen komplett unorganisiert, aber jede Minute kommen statistisch 24 dazu. Was für eine Verdrängungsleistung, das als »Krise« zu bezeichnen. Diese Bewegung wird unser Jahrhundert prägen. Einer zukunftslosen Gesellschaft fällt in einer solchen Lage nicht mehr ein als: Mauern zu bauen, Obergrenzen für Flüchtlinge festzusetzen und Untergrenzen der Humanität zu ignorieren. Damit ist das Selbstbild jener Gesellschaften im Kern betroffen, die sich viel darauf zugutehalten, freiheitliche und humanistische Werte zu pflegen und zu verteidigen. Es stellt sich, besonders angesichts der mit dem wachsenden Stress zusammenhängenden neurechten und autoritären Strömungen, die Frage, ob Gesellschaften irgendwann einen Punkt erreichen, an dem die Diskrepanz zwischen ihren Selbstbildern und ihrer Praxis so groß wird, dass sie selbst daran zerbrechen. Wie viel Lebenslügen, wie viel doppelte Moral, wie viel Ignoranz kann eine Gesellschaft verkraften, bis sie schließlich selbst an den offenbaren Widersprüchen zwischen Anspruch und Wirklichkeit zugrunde geht? Die Wiederkehr der Menschenfeindinnen und -feinde, die wir heute sehen, ist ein Verfallssymptom.
Aber wenn niemand das zivilisatorische Projekt der Moderne und der offenen Gesellschaft weiterbauen mag, dann finden ihre Gegner Raum und Gelegenheit, ihre niederen Absichten gesellschaftsfähig zu machen. Das heißt: Die Menschenfeinde bilden nicht nur eine Gefahr für die Ausgegrenzten und Diskriminierten, sondern für alle jene, die eine liberale, freundliche, friedliche Gesellschaft wollen. Daher sollten auch Sie sich angegriffen fühlen.
Oder besser: aufgefordert, unsere moderne Gesellschaft weiterzuentwickeln.
Ich glaube nämlich, dass der starke Wille zur Entwirklichung der Welt auch deshalb ungebrochen ist, weil das zivilisatorische Projekt der Moderne ab dem Moment nicht mehr weitergedacht worden ist, als es sich über alle Erwartungen hinaus als erfolgreich erwies. 1989 ist das Jahr, mit dem die Modernisierung aufhörte. Es ist offenbar gerade der Erfolg der kapitalistischen Moderne, der ihre beständige Fortentwicklung und Modernisierung verhindert hat. Man glaubte sich schon angekommen, als die Probleme gerade erst deutlich wurden. Da schien es aber schon unmöglich, sich anders zu denken, als man gedacht worden war. Anders zu leben, als man gelebt worden war. Schon Oscar Wilde hat gesagt, sobald man das Land des Überflusses erreicht habe, müsse man den Blick erneut gen Horizont richten: Fortschritt sei die Verwirklichung von Utopien. Also: Haben wir genug, um alles wiedergutmachen zu können?
Ja. Auf jeden Fall. Und um das zu begründen, muss ich noch ein paar Sätze zum zivilisatorischen Projekt der Moderne sagen.
Die Moderne, wie wir sie kannten
Das, was wir die Moderne nennen, ist Ergebnis einer Konstellation, in der eine Philosophie der Vernunft, die Zurückdrängung religiös begründeter Schicksalsgläubigkeit, technologische Neuerungen (zunächst insbesondere in der Landwirtschaft, dann in neuen industriellen Produktionsweisen), neue Medien, Verstädterung und anderes mehr zusammenkamen. Diese Konstellation setzte eine zuvor ungekannte wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik in Gang, die bis heute anhält, unter anderem deshalb, weil der gegenwärtige Globalisierungsschub sie zusammen mit der Digitalisierung nochmals mit erheblicher Dynamik versehen hat.
Die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse waren dabei nicht gleichzeitig, sondern fielen abhängig von regionalen Unterschieden und Traditionen, von natürlichen Gegebenheiten und nicht zuletzt von der Herrschaftsorganisation der jeweiligen Gesellschaften langsamer oder schneller aus. Manche Gesellschaften modernisierten – und industrialisierten – sich früh, wie England und dann Frankreich, Belgien und Deutschland, andere zogen schnell nach, wieder andere blieben noch lange so, wie sie schon seit Jahrhunderten waren.
Erst mit dem Globalisierungsschub seit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Wegfall der Systemkonkurrenz zwischen Markt- und Planwirtschaft schwenkten beinahe alle Länder der Welt auf den wachstumskapitalistischen Pfad ein. Egal, welchem politischen Regierungssystem sie folgen: Kapitalistisch sind sie heute alle, und Konsumgesellschaften werden sie alle.
Es ist vor diesem Hintergrund übrigens Blödsinn, wenn dauernd mitgeteilt wird, dass die Welt komplexer geworden sei und noch werde. Das Gegenteil ist der Fall. Wir verzeichnen ja eine rapide und tiefgehende Angleichung der Lebensweisen und Kulturformen; alle Hotels, alle Einkaufsstraßen, alle Infrastrukturen weltweit sehen sich heute weit ähnlicher, als es vor zwanzig, dreißig, vierzig Jahren der Fall war. Es macht auch keinen Sinn mehr, irgendwo auf einer Reise eine Spezialität, einen bestimmten Stoff, ein Werkzeug oder ein Kunstwerk zu kaufen – es gibt ja alles überall. Mr Leary, die Romanfigur von Anne Tyler, der Reiseführer für Leute schrieb, die es überall möglichst genauso haben wollten wie zu Hause, wäre heute arbeitslos. Es ist ja längst überall sowieso schon wie zu Hause.
Abb. 2: Mr Leary: Gehen Sie einfach zu Starbucks, das ist überall.
Das heißt: Differenzen verschwinden zusehends, und wenn das der Fall ist, ist eine niedrigere Stufe von Organisation erreicht, keine höhere. Wie leben also im 21. Jahrhundert in einer niedriger komplexen Weltgesellschaft als im 20., und es könnte sein, dass auch dieser Sachverhalt das Vermögen einschränkt, sich andere Zukünfte vorzustellen als bloß die einer Gegenwart plus. Ohne Differenzerfahrung – überall nur noch Starbucks – reduziert sich das Potential an möglichen Erfahrungen, das nötig ist, um einen eigenen Sinn zu entwickeln, wofür man da ist. Und eigene Ideen, wie es weitergehen sollte.
Die Moderne war immer beides: Sie hat Menschen emanzipiert und Unterschiede nivelliert. Aus Traditionen befreit und die Menschen vereinzelt. Zu unglaublichen Steigerungen der Lebensstandards geführt und ihre ökologischen Voraussetzungen zerstört. Sie war völlig selbstzentriert und naturentfremdet. Und sie hat jenen Gesellschaften, die sich früh industrialisiert und modernisiert haben, Organisations- und damit Machtvorteile verschafft, die lang anhaltend sind. Zwar treten Imperien wie etwa das britische von der Weltbühne ab, aber die reichen Länder sind noch immer deswegen reich, weil sie früh mehr Mittel hatten, andere zu kolonisieren, auszubeuten, im Elend zu halten.
Der Erste Weltkrieg wurde von jenen Gesellschaften entfesselt, die als erste einem fossilen Energieregime folgten – Deutschland, Frankreich, England. Neue Technologien entfalten neue Gewaltmittel, und sie wecken jeweils neuen Ressourcenbedarf. Die beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts forderten zusammengenommen unvorstellbare 200 Millionen Menschenleben.[4] Zygmunt Bauman hat auf den engen Zusammenhang zwischen den Entwicklungsdynamiken der Moderne und dem Holocaust hingewiesen. Der war als industrielle Massenvernichtung eben nicht die Antithese der Moderne, sondern erst durch sie möglich und umsetzbar. Vormodern war das Massaker, das Pogrom, die Vertreibung, modern dagegen die Idee, dass Menschengruppen für kategorial schädlich erklärt und folgerichtig vernichtet wurden. Und hier folgt eine Warnung: Alles, was einmal gemacht worden ist, kann wieder gemacht werden. Mit wachsendem Stress, der auf Gesellschaftsformen wirkt, steigt die Wahrscheinlichkeit des Rückgriffs auf radikale Lösungen. Wir sehen gerade die Mechanismen.
Die Moderne existiert in einer Spannung von Kultur und Barbarei, einer Hochspannung, die sich gelegentlich entlädt. Man weiß nur immer nicht, wann. Man weiß aber: Zivilisierung ist kein linearer Vorgang. Gerade das 20. Jahrhundert weist dramatische Prozesse von Entzivilisierung auf, und es gibt wenig Grund zu der Annahme, dass das 21. Jahrhundert davor gesichert sei. Hinreichend Wahnsinnige haben sich ja schon aufgestellt, wobei Figuren wie Donald Trump, Victor Orban, Recip Erdogan, Wladimir Putin und andere auch deshalb für ihre sich selbst zu vordemokratischen Untertanen machenden Landsleute attraktiv erscheinen, weil eine aufgeklärte liberale Gesellschaft immer auch eine Zumutung ist für Menschen, die Orientierung, Halt, Anweisung brauchen. Erich Fromm hat in den 1940er Jahren das maßgebliche Buch dazu geschrieben – es heißt »Furcht vor der Freiheit« (i.O. »Escape from Freedom«).[5] Und Hannah Arendt hat ebenso wie Sebastian Haffner die größte Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft in der Heimatlosigkeit der Massenindividuen gesehen.[6] Wenn man nirgends dazugehört, hat man eben das unerfüllte Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören. Und schließt sich dort an, wo das möglich scheint. Auch das ist sehr einfach. Die Politik der Identität und der Angst setzt auf kulturell und mental heimatlose Menschen. Sie bietet Entlastung durch Unfreiheit.
Was ist dagegen Demokratie? »Ein von Furcht freier wohlmeinender Streit um die Optimierung der Mittel beim Streben nach Gemeinwohl.« (Peter Sloterdijk) Genau mit dieser Programmatik war die moderne rechtsstaatlich verfasste liberale Demokratie angetreten, und zwar in besonderer Weise in den westlichen Gesellschaften der Nachkriegszeit, also vor etwa 70 Jahren. Das totalitäre nationalsozialistische Regime war gerade in einem unfassbaren Inferno von Gewalt untergegangen; der Sowjetkommunismus repräsentierte eine totalitäre Zwangsgesellschaft, die den westlichen Alliierten höchst bedrohlich erschien. Deshalb lag dem Wiederaufbau des kriegszerstörten Mitteleuropa der Wunsch zugrunde, eine Form von marktwirtschaftlicher Gesellschaft zu etablieren, in der die Wohlstandszuwächse so relativ gleich verteilt würden, dass die Menschen dem System zustimmen konnten. Man wollte verhindern, dass sich die politische Landschaft zu rechten oder linken Extremen hin polarisierte, und das materielle Mittel dafür war, dass auch Arbeiterschichten von den Wohlstandszuwächsen profitieren konnten.
Das war der psychologische Kitt, der die liberale Gesellschaft zusammenhielt. Mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft wurde zwar wirtschaftliche Ungleichheit nicht aufgehoben, aber der »Fahrstuhleffekt« sorgte dafür, dass bei aller Ungleichheit doch fast alle gemeinsam nach oben fuhren. Und siehe da: Das Experiment einer offenen Gesellschaft auf wachstumswirtschaftlicher Grundlage funktionierte ganz exzellent und über alle Erwartungen hinaus erfolgreich.
Seit zweieinhalb Generationen herrscht in Europa Frieden, was geschichtlich, wie gesagt, eben nicht den Normalfall darstellt. Die westeuropäischen Gesellschaften haben bis 2018 alle Krisen der Nachkriegszeit überstanden, ohne dass irgendwo die gesellschaftliche Ordnung selbst in Frage stand.[7] Die Bewältigung der Finanzkrise oder der deutschen Wiedervereinigung sind Belege institutioneller Funktionsfähigkeit, übrigens auch die sechsmonatige Regierungslosigkeit der Bundesrepublik, in der sie ganz geräuschlos prächtig weiterfunktioniert hat. In den offenen Gesellschaften ist das durchschnittliche Bildungsniveau ebenso gewachsen wie der Wohlstand und die Lebenserwartung. Und die individuelle Freiheit, auch was die Wahl der Lebensformen und Lebensweisen angeht. Kurz: Die liberale rechtsstaatliche Demokratie ist die zivilisierteste Form von Gesellschaft, die es jemals gegeben hat.
Der Grund dafür: Sie ist veränderungsoffen. Ja, sie lebt – in beständig sich verändernden Umwelten – geradezu davon, dass Modernisierungsimpulse von Minderheiten ausgehen, die Benachteiligungen skandalisieren oder Entwicklungsdefizite beklagen. In diesem Sinne geben soziale Bewegungen notwendige Infusionen für jene Transformationsprozesse, mit denen soziale, technologische oder kulturelle Veränderungsanforderungen bewältigt werden.
Und die offene Gesellschaft hat einen Mechanismus, mit dem sie verhindern kann, dass notwendige Veränderungen unterbleiben: Regierungen können abgewählt werden. Das war für den Philosophen Karl Popper der zentrale Punkt. Sein Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« hat er unmittelbar im Angesicht der Verheerungen durch zwei geschlossene Gesellschaften geschrieben – der nationalsozialistischen und der sowjetischen. Das »Prinzip einer demokratischen Politik« sah Popper darin verkörpert, dass Demokratien stabile Institutionen, zum Beispiel freie Wahlen, unabhängige Gerichte etc., vorsehen, »die es den Beherrschten gestatten, die Herrscher abzusetzen.«
Popper gilt als Vordenker des Liberalismus und steht als solcher auch unter Verdacht, neoliberales Denken vorbereitet zu haben. Aber der Denker, der übrigens eine Tischlerlehre gemacht und als Lehrer gearbeitet hat, bevor er Philosoph wurde, stand als junger Mann sozialistischen Ideen sehr nah und war in der damals wichtigen Schulreformbewegung aktiv.
In der ging es der Idee nach um die Bildung freier Menschen, und das wiederum verweist auf einen anderen Aspekt der Demokratie, der im Hauptwerk Poppers zur »Offenen Gesellschaft« dann nur eine untergeordnete Rolle spielt: Der freiheitliche Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. So hat es der Verfassungsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde formuliert. Er meint damit, dass Demokratie nur unter der Voraussetzung existieren kann, dass die Mitglieder einer Gesellschaft sich selbst und dieser Gesellschaft Vertrauen entgegenbringen und Verantwortung übernehmen. Einfach formuliert: Sie müssen das sichere Gefühl haben, dass sie Teil von etwas sind, von dem die anderen auch ein Teil sind. Das stiftet den für eine Demokratie notwendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt, und der kann durch Gesetze und Verordnungen nicht vorgeschrieben werden. Denn ein freiheitlicher Staat kann, wiederum mit Böckenförde, »nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert«.
Eine sich von selbst verstehende Wertebasis, die »moralische Substanz«, ist der Boden, auf dem der freiheitliche Staat gebaut ist. Und auch in diesem Sinn hat die westliche Nachkriegsmoderne überraschend gut funktioniert – mit hoher Wahlbeteiligung, hohem Beteiligungsgrad in Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und im Ehrenamt. Mein Vater etwa war ganz selbstverständlich beim Roten Kreuz und in der freiwilligen Feuerwehr, und das keineswegs als passives Mitglied. Wenn es brannte, war er im Einsatz (solange er das gesundheitlich konnte). Solches Engagement hat zwei Seiten: Es ist einerseits ein nicht entlohnter, freiwilliger Dienst an der Gesellschaft, besteht also in gelebten Werten. Und andererseits bindet solches Engagement auch in die Dorfgemeinschaft und in die Gruppe der Engagierten ein, vergemeinschaftet und stiftet Zugehörigkeit. Das war etwa eindrucksvoll an der Beerdigung meines Vaters zu sehen, zu der, obwohl er einfacher Arbeiter war, Hunderte Menschen kamen und natürlich in Uniform und mit Musik auch die Organisationen präsent waren, in denen er sich engagiert hatte. Diese in zwei Richtungen – auf die Gesellschaft und auf das Individuum – wirkende Integrationskraft hat die Nachkriegsmoderne eindrucksvoll entfalten können. Wie gesagt auf der Basis eines Wirtschaftswachstums, das für eine relativ große Verteilungsgerechtigkeit sorgte.
Abb. 3: Moralische Substanz: Feuerwehrkapelle
Das alles lief gut, solange die moderne Gesellschaft ihre Wachstumsraten nicht durch eine immer weiter wachsende Staatsverschuldung künstlich stimulieren musste und solange nicht eine neue radikal-liberale Marktordnung das Paradigma der sozialen Marktwirtschaft ablöste, und zwar mit durchschlagendem Erfolg: Machtzuwächse besonders aufseiten global agierender Unternehmen, Machtverluste von Gewerkschaften und staatlichen Institutionen, gewachsene soziale Ungleichheit und Bildungsungleichheit. Das heutige Gesamtergebnis ist die Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der doch das Bollwerk gegen totalitäre Verlockungen sein sollte, übrigens gerade auch im postsowjetischen Osteuropa. Die guten Zeiten sind vorbei. Heute steht die rechtsstaatlich verfasste liberale Demokratie unter Angriff, und es ist unheimlich, dass dieser Angriff gleichzeitig von drei Seiten vorgetragen wird. Geopolitisch, innenpolitisch, digital.[8]
Der große Soziologe Ralf Dahrendorf hat das mal so formuliert: »Wir leben in einer Welt der Ungewissheit. Niemand weiß genau, was wahr und was gut ist. Darum müssen wir immer neue und bessere Antworten suchen. Das geht aber nur, wenn Versuch und Irrtum erlaubt sind, ja, ermutigt werden, also in einer offenen Gesellschaft. Sie wenn nötig zu verteidigen und sie jederzeit zu entwickeln, ist daher die erste Aufgabe.« Und übersetzt in die heutige Situation, lautet die Aufgabe: Demokratie verteidigen und sie auf der Basis eines neuen Naturverhältnisses weiterentwickeln. Das unvollendete zivilisatorische Projekt der Moderne fortsetzen.
Jetzt, allerspätestens, muss nachgeholt werden, was so lange versäumt wurde. Die moderne Gesellschaft ist ein Entwicklungsprojekt, an vielen Stellen nicht fertig, viele ihrer Hoffnungen enttäuscht, viele ihrer Versprechungen uneingelöst. Darum geht es jetzt: um das Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt. Man muss die Energie des Angriffs wie beim Judo aufnehmen und in eine elegante Bewegung umleiten, die einem selbst Kraft verleiht. Wir haben viel zu lange geschlafen? Na, dann aber los!