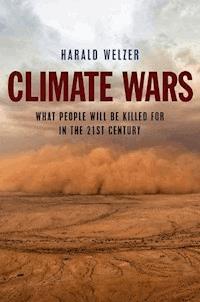9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Was erinnern Deutsche aus der NS-Vergangenheit? Die bahnbrechende Studie, die eine ganze Forschungstradition begründet hat und seit 2002 in zahllosen Auflagen und Sprachen erschienen ist Was wird in Familien »ganz normaler« Deutscher über Nationalsozialismus und Holocaust überliefert? Die Autoren haben in Familiengesprächen und Interviews untersucht, was Deutsche aus der NS-Vergangenheit erinnern, wie sie darüber sprechen und was davon an die Kinder- und Enkelgeneration weitergegeben wird. Die Ergebnisse der Interviews mit drei Generationen machen deutlich, dass in den Familien andere Bilder von der NS-Vergangenheit vermittelt werden als z.B. in den Schulen. Im Familiengedächtnis finden sich vorrangig Geschichten über das Leiden der eigenen Angehörigen unter Bespitzelung, Terror, Krieg, Bomben und Gefangenschaft. Diese Themen werden in den Familien nicht als Wissen vermittelt, sondern als Gewissheit. »Nazis« kommen in den eigenen Familien nicht vor: »Opa war kein Nazi.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Ähnliche
Harald Welzer | Sabine Moller | Karoline Tschuggnall
»Opa war kein Nazi«
Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis
FISCHER E-Books
Unter Mitarbeit von Olaf Jensen und Torsten Koch
Inhalt
1. Die Vergangenheit im intergenerationellen Gespräch
Einleitung[1]
Im Geschichtsunterricht der 12-jährigen Simone Seiler[2] wird seit einiger Zeit das Thema Holocaust behandelt. In einem Interview erzählt sie dazu: »Ja, das find’ ich auch voll interessant, weil Steinzeit hatten wir auch und Mittelalter auch. Erst hatten wir Steinzeit, dann Mittelalter, dann geht das jetzt immer ein paar Generationen voran, muss auch irgendwie so’n System haben. Dann haben wir halt jetzt dieses Thema. Ja. Macht auch Spaß.«
Nicht nur im Geschichtsunterricht, auch in anderen Fächern wird Simone mit diesem Thema konfrontiert. In »Welt- und Umweltkunde« wird gerade die Hitler-Jugend durchgenommen und im Deutschunterricht liest die Klasse »Damals war es Friedrich« von Hans-Peter Richter. Die Schülerinnen und Schüler müssen die »wichtigen Stellen« mit dem Textmarker anstreichen und zu jedem Kapitel eine Zusammenfassung schreiben. Simone findet es »voll fies«, was mit dem jüdischen Schüler Friedrich gemacht wird, aber es beschäftigt sie auch sehr, dass die Familie des nichtjüdischen Schülers Hans-Peter arm war und er »eine ganz kleine Schultüte gekriegt hat und Friedrich eine ganz große«.
Von Hitler weiß Simone, »dass er da ’n Buch geschrieben hat, aber ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, und dann haben sie erzählt, dass halt die NSDAP1928 nur 2,6 oder 2,4 Stimmenprozent hatte und dann 1930 halt schon 34,6 oder so. Die Menschen haben ja auch Hitler gewählt, die kannten den überhaupt noch nicht, weil die vielleicht gesagt haben: Ja, der ist so gut, der verspricht uns Arbeit, Essen und auch Urlaub und Sicherheit. Hat die Menschen vielleicht angezogen und dann sind die da hingegangen.«
Man sieht, dass Simone bereits über ein beträchtliches Faktenwissen über die Vorgeschichte und Geschichte des Nationalsozialismus verfügt – sie kennt Jahreszahlen, Wahlergebnisse und Personen. Sie erzählt an einer anderen Stelle des Interviews ausführlich über die Inflation und die Zeit der Weltwirtschaftskrise und sie weiß, dass mit »den Juden« später »so gruselige Dinge« geschehen sind, dass sie gar nicht einschlafen kann, wenn sie darüber etwas gelesen hat: »So’n Teil hab ich behalten, dann mussten die entlaust werden, aber das haben sie nur so gesagt, und dann wurden sie da in so Duschkabinen gesteckt und dann wurden sie vergast. Aber richtig vorstellen kann ich mir das mit dem Vergasen nicht.«
Von ihrem Großvater weiß Simone, dass der im Krieg war, aber es fällt ihr schwer, sich vorzustellen, »dass er zu Hitlers Zeit gelebt hat. Das krieg ich einfach nicht auf die Reihe. Also ich krieg’s zwar schon auf die Reihe, aber ich kann mir das nicht vorstellen.« Aus Gesprächen mit dem Großvater (der Napola-Schüler, Waffen-SS-Mann und Mitglied der Leibstandarte-SS Adolf Hitler war) weiß sie, dass die Deutschen bei Luftangriffen »immer das Licht ausmachen mussten abends, entweder das Licht aus oder das Licht an, aber ich glaube, das Licht aus, damit die Angreifer das nicht so gesehen hatten. Das finde ich eigentlich ’n bisschen doof. Und die Juden durften auch ab achtzehn Uhr nicht mehr aus dem Haus und mussten notfalls bei Freunden übernachten.«
Man wird also sagen können, dass Simone ein Bewusstsein über die Geschichte hat, das sich nicht nur aus den ganz unterschiedlichen Informationsbeständen speist, die die Schule ihr vermittelt, sondern auch aus den vielleicht beiläufigen, vielleicht absichtsvollen Erzählungen von Erlebnissen, die in ihrer Familie kursieren. Deshalb hat Simone, wie sie erzählt, auch das Gefühl, dass ihr einiges über das »Dritte Reich« schon »bekannt vorkam«, noch bevor sie in der Schule damit konfrontiert wurde: »Also dieses Hakenkreuz, ich weiß nicht, das kam mir schon so bekannt vor. Als ich schon das erste Mal Hitler gesehen hab, das kam mir irgendwie schon bekannt vor. Irgendwie hab ich das irgendwo schon mal gesehen, vielleicht in der Zeitung.«
Simones Geschichtsbewusstsein setzt sich also aus ganz unterschiedlichen Quellen zusammen, und man gewinnt den Eindruck, dass es ihr sehr schwer fällt, die Fülle all der Informationen zu einem konsistenten Bild zusammenzufügen, besonders dann, wenn es um die Judenverfolgung geht: »Ich muss ehrlich gestehen, das hab ich nicht verstanden, warum die eigentlich verfolgt wurden. Da hab ich schon öfter nachgefragt, hab aber nie so ’ne richtige Antwort gekriegt. Und das weiß ich jetzt halt immer noch nicht, wie das jetzt alles angefangen hat. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass auch zu Jesus’ Zeiten da die Juden schon verfolgt waren, dann kam das Mittelalter noch dazwischen. Wenn das Mittelalter nicht dazwischen wär, dann hätt’ ich’s mir vielleicht ’n bisschen – aber im Mittelalter war das ja so mit Rittern und Burgen und so, und da passen die Juden ja nun überhaupt nicht rein, finde ich, also irgendwie so ’ne Zeitverschiebung, ja, das passt überhaupt nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Krieg eigentlich angefangen hat, warum die sich da bekriegen. Irgendwie wollte es Adolf Hitler denen dann ja wieder heimzahlen, und dann ging das irgendwie wieder von vorn los, glaube ich.«
Das Gespräch mit Simone Seiler zeigt, dass Kinder erstaunlich viel über Geschichte wissen, aber zugleich zeigt es auch, dass sie dieses Wissen aus ganz unterschiedlichen Quellen beziehen – und dass ihnen vieles schon »bekannt« ist, wenn sie im Geschichts- und Deutschunterricht in der Schule davon hören. Nun ist gegenwärtig noch weitgehend unerforscht, aus welchen Quellen sich das Geschichtsbewusstsein eigentlich speist, wie Menschen Vorstellungen und Bilder über die Vergangenheit aus den unterschiedlichsten Versatzstücken aus so disparaten Quellen wie Geschichtsbüchern, Spielfilmen und eigener Erfahrung komponieren oder wie sich Informationen aus der eigenen Familie zu solchen aus der Schule verhalten. Und man weiß wenig darüber, wie Geschichte eigentlich angeeignet wird, auf welche Weise sich Schülerinnen und Schüler bzw. junge Menschen überhaupt ein Bild von der Vergangenheit machen, das für sie plausibel und sinnhaft ist.[3]
»Das Normale halt bekommen wir an der Schule, und die Beispiele dafür, die hört man dann bei der Oma.« Dieses Zitat stammt von einem anderen Schüler, dem 1983 geborenen Dietmar Schwaiger. Seine Bemerkung weist auf einen Unterschied im Bewusstsein über die Geschichte, der allzu oft übersehen wird, einen Unterschied zwischen kognitivem Geschichtswissen und emotionalen Vorstellungen über die Vergangenheit. Auf der Ebene emotionaler Erinnerungen scheinen sich Bindungskräfte und Faszinosa gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit entfalten und erhalten zu können, die merkwürdig unverbunden mit dem Wissen über diese Zeit sind, und zwar über die Generationen hinweg. Metaphorisch gesprochen, existiert neben einem wissensbasierten »Lexikon« der nationalsozialistischen Vergangenheit ein weiteres, emotional bedeutenderes Referenzsystem für die Interpretation dieser Vergangenheit: eines, zu dem konkrete Personen – Eltern, Großeltern, Verwandte – ebenso gehören wie Briefe, Fotos und persönliche Dokumente aus der Familiengeschichte. Dieses »Album« vom »Dritten Reich« ist mit Krieg und Heldentum, Leiden, Verzicht und Opferschaft, Faszination und Größenphantasien bebildert, und nicht, wie das »Lexikon«, mit Verbrechen, Ausgrenzung und Vernichtung.
Da, wie Raul Hilberg einmal formuliert hat, der Holocaust in Deutschland Familiengeschichte ist, stehen »Lexikon« und »Album« gleichsam nebeneinander im Wohnzimmerregal, und die Familienmitglieder haben die gemeinsame Aufgabe, die sich widersprechenden Inhalte beider Bücher in Deckung zu bringen. Diese Aufgabe wird meist dadurch gelöst, dass den Eltern bzw. den Großeltern eine Rolle zugewiesen wird, die sie von dem ausnimmt, was im »Lexikon« aufgelistet ist. Ein Medium für diese Verfertigung der Vergangenheit (neben vielen anderen) ist das familiale Gespräch, in dem en passant Geschichtsbilder entworfen und gesichert werden, mit denen alle Familienmitglieder leben können.
Die Annahme, dass Geschichtsbewusstsein eine kognitive und eine emotionale Dimension hat, wird auch dadurch gestützt, dass das menschliche Gedächtnis mit unterschiedlichen Systemen für kognitive und emotionale Erinnerungen operiert,[4] und nichts macht das greifbarer, als wenn man Angehörige der Zeitzeugengeneration, die ihre Vergangenheit »aufgearbeitet« haben und der nationalsozialistischen Geschichte höchst kritisch gegenüberstehen, mit leuchtenden Augen über »ihre Zeit« und ihre Erfahrungen in der HJ oder bei der Luftwaffe berichten hört. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Angehörigen der Zeitzeugengeneration in »schöne Zeiten« zurücktauchen, lässt es als nahe liegend erscheinen, dass der Unterschied zwischen emotional bedeutsamen historischen Erfahrungen und kognitiv angeeignetem Wissen auch folgenreich für die Weitergabe des Vergangenen ist: dass also in Familien andere Bilder und Vorstellungen von der nationalsozialistischen Vergangenheit vermittelt werden als in der Schule oder in den Medien.
Die von der Volkswagenstiftung geförderte Mehrgenerationenstudie »Tradierung von Geschichtsbewusstsein« ist also der Frage nachgegangen, was »ganz normale« Deutsche aus der NS-Vergangenheit erinnern, wie sie darüber sprechen und was davon auf dem Wege kommunikativer Tradierung an die Kinder- und Enkelgenerationen weitergegeben wird. In 40 Familiengesprächen und 142 Interviews[5] wurden die Familienangehörigen sowohl einzeln als auch gemeinsam nach erlebten und überlieferten Geschichten aus der nationalsozialistischen Vergangenheit gefragt.[6]
In diesen Gesprächen werden insgesamt 2535 Geschichten erzählt. Nicht wenige davon verändern sich auf ihrem Weg von Generation zu Generation so, dass aus Antisemiten Widerstandskämpfer und aus Gestapo-Beamten Judenbeschützer werden. In den Gesprächen finden sich zwei Beispiele, in denen die Zeitzeugen im Familiengespräch von Morden erzählen, die sie begangen haben, und es finden sich Berichte von Erschießungen, aber all das hinterlässt in den Einzelinterviews mit den Kindern und Enkeln keinerlei Spuren – es ist, als hätten sie diese Erzählungen gar nicht gehört. Wohl aber nutzen sie jeden auch noch so entlegenen Hinweis darauf, dass ihre Großeltern etwas »Gutes« getan haben, um Versionen der Vergangenheit zu erfinden, in denen diese stets als integre, gute Menschen auftreten. Alle diese Phänomene verweisen darauf, dass die Vergangenheit über intergenerationelle Weitergabeprozesse höchst lebendig in die Gegenwart hineinreicht, und man muss gar nicht psychoanalytisch nach der Tiefendimension solcher Latenzinhalte der Vergangenheit suchen, um in den Interviews und Familiengesprächen Vergangenheitsbilder und -vorstellungen zu finden, die für die Entwicklung von Gegenwartsorientierungen und von politischen Urteilen äußerst wirksam sind. In theoretischer Sicht umklammert Geschichtsbewusstsein den Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive,[7] wobei Vergangenheit niemals »authentisch« die Gegenwart erreicht, sondern stets nur als eine »erstellte, auswählende und deutende Rekonstruktion ins Bewusstsein treten kann«.[8] Vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass die vorliegende Untersuchung über die Weitergabe der deutschen Vergangenheit im intergenerationellen Gespräch keine Studie über die Vergangenheit, sondern eine über die Gegenwart ist: über die Frage nämlich, wie der Nationalsozialismus und der Holocaust im deutschen Familiengedächtnis repräsentiert sind und ob Erinnerungsgemeinschaften wie die Familie ein anderes Geschichtsbewusstsein, andere Bilder über die Vergangenheit und, vor allem, andere Rahmen für ihre Deutung bereitstellen als das »kulturelle Gedächtnis«. Jan Assmann hat das »kulturelle Gedächtnis« zunächst definiert als »Sammelbegriff für alles Wissen, das im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und Einweisung ansteht«.[9] Diesen Sammelbegriff setzt Assmann ab vom »kommunikativen Gedächtnis«.
Das »kommunikative Gedächtnis« lebt in interaktiver Praxis im Spannungsfeld der Vergegenwärtigung von Vergangenem durch Individuen und Gruppen. Das »kommunikative Gedächtnis« ist im Vergleich zum »kulturellen« so etwas wie das Kurzzeitgedächtnis der Gesellschaft – es ist an die Existenz der lebendigen Träger und Kommunikatoren von Erfahrung gebunden und umfasst etwa 80 Jahre, also drei bis vier Generationen. Der Zeithorizont des »kommunikativen Gedächtnisses« wandert entsprechend »mit dem fortschreitenden Gegenwartspunkt mit. Das kommunikative Gedächtnis kennt keine Fixpunkte, die es an eine sich mit fortschreitender Gegenwart immer weiter ausdehnende Vergangenheit binden würden.«[10] Eine dauerhaftere Fixierung der Inhalte dieses Gedächtnisses ist nur durch »kulturelle Formung« zu erreichen, d.h. durch organisierte und zeremonialisierte Kommunikation über die Vergangenheit. Während das »kommunikative Gedächtnis« durch Alltagsnähe gekennzeichnet ist, zeichnet sich das »kulturelle Gedächtnis« durch Alltagsferne aus. Es stützt sich auf Fixpunkte, die gerade nicht mit der Gegenwart mitwandern, sondern als schicksalhaft und bedeutsam markiert werden und durch »kulturelle Formung (Texte, Riten, Denkmäler) und institutionalisierte Kommunikation (Rezitation, Begehung, Betrachtung) wach gehalten« werden.[11] Das »kulturelle Gedächtnis« ist mit Assmann der »jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentümliche Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten […], in deren ›Pflege‹ sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart stützt«.[12]
So weit die mittlerweile klassische Definition. Etwas überpointiert würde das »kommunikative Gedächtnis« demgegenüber die eigensinnige Verständigung der Gruppenmitglieder darüber beinhalten, was sie für ihre eigene Vergangenheit halten, und das Familiengedächtnis, auf das wir im nächsten Kapitel ausführlicher eingehen werden, wäre somit ein Teilbereich des »kommunikativen Gedächtnisses«, und zwar, wie wir glauben, ein zentraler. Es ist ein lebendiges Gedächtnis, dessen Wahrheitskriterien an Wir-Gruppenloyalität und -identität orientiert sind.
Und um es gleich vorwegzunehmen: Die Ergebnisse unseres Projektes zeigen, dass die Tradierung von Vergangenheitsvorstellungen und -bildern im Familiengespräch und im weiteren sozialen Umfeld offensichtlich den Rahmen dafür bereitstellt, wie das gelernte Geschichtswissen gedeutet und gebraucht wird. In diesem Sinne werfen die Ergebnisse vor allem Licht darauf, wieso Aufklärungsprogramme über die NS-Vergangenheit gegen das Fortdauern romantischer und verklärter Vorstellungen über eben diese Vergangenheit selbst dann nichts ausrichten, wenn sie funktionieren. Denn Umfrageergebnisse lassen ja kaum Zweifel daran aufkommen, dass insbesondere die jüngeren Generationen umfassend über die Geschichte des »Dritten Reiches« und über den Holocaust informiert sind.[13] Aber was besagt das darüber, welchen Gebrauch man von diesem Wissen macht? Paradoxerweise scheint es gerade die gelungene Aufklärung über die Verbrechen der Vergangenheit zu sein, die bei den Kindern und Enkeln das Bedürfnis erzeugt, die Eltern und Großeltern im nationalsozialistischen Universum des Grauens so zu platzieren, dass von diesem Grauen kein Schatten auf sie fällt.
Und weiter: Man kann, wie der 21-jährige Bernd Siems, aus den Dokumenten über die Reichsparteitage auch den folgenden Schluss ziehen: »Das war doch klasse, wie die das geschafft haben! Wie sie alle dann geschrien haben ›Heil Hitler‹ oder ›Sieg Heil‹! Und diese Begeisterung der Menschen macht irgendwie das Faszinierende, wie stark dann dieses Volk war. Denn die haben ja alle Angst vor uns gehabt!« Das erschütterndste Dokument zum Verhältnis von Wissen und Gebrauch erreichte uns in Gestalt des Briefes eines 1943 geborenen Oberstudienrates, der in einem Thesenpapier zur NS-Vergangenheit u.a. mitteilt: »Die Fremdarbeiter (7–10 Mio) trugen mit ihrer Arbeit für Hitler zur Verlängerung des Krieges bis Mai 1945 bei. […] Deutschland hat für jeden ermordeten Juden (sechs Mio) mehr als einen eigenen Angehörigen (acht bis neun Mio) verloren.«
Unsere Untersuchung orientiert sich methodisch am Prinzip der »Stillen Post«, an jenem Kindergeburtstagsspiel also, in dem eine ursprünglich erzählte Geschichte durch geflüsterte Weitergabe an zweite, dritte, vierte, fünfte Personen sich immer weiter verändert, bis sie schließlich einen neuen Plot bekommt oder nur völlig verstümmelt beim Empfänger ankommt. Dieses Spiel gewinnt seinen Reiz genau dadurch, dass jeder der Teilnehmer die Geschichte mit einem eigenen Sinn versieht – so, wie er sie am besten versteht – und sie in dieser Form weitergibt. Etwas Ähnliches, so wird sich in diesem Buch zeigen, geschieht in der intergenerationellen Kommunikation – und unsere Fragestellung richtet sich darauf, welche Geschichten vom »Dritten Reich« in den einzelnen Generationen erzählt werden, wie diese Geschichten gemeinsam im Familiengespräch verfertigt werden, welche Versatzstücke und Einzelelemente weitergegeben werden und welche nicht.
Die in die Stichprobe einbezogenen Familien (s. Anhang) repräsentieren bis auf zwei Fälle[14] das, was man sich unter »ganz normalen« deutschen Familien vorstellen würde – das heißt, wir haben bewusst vermieden, Familien einzubeziehen, zu denen signifikante Holocaust-Täter in einem juristischen Sinne zählen. Dass schließlich doch Menschen zu unseren Befragten zählten, die freimütig über Morde berichteten, die juristisch als Kriegsverbrechen zu werten sind, hat sich erst in den Gesprächen selbst gezeigt. An dieser Stelle kann darauf hingewiesen werden, dass sämtliche in diesem Buch vorkommenden Namen von Interviewten oder von Personen, über die gesprochen wird, verändert worden sind. Und deutlich muss gesagt werden, dass wir es – trotz zum Teil überraschender und auch erschreckender Äußerungen in den Interviews und Familiengesprächen – mit einer Auswahl von Familien zu tun haben, in denen über die nationalsozialistische Vergangenheit gesprochen werden kann und gesprochen wird – und das ist ja keineswegs in allen deutschen Familien der Fall. Wir haben es also mit einer in diesem Sinne selektiven Stichprobe zu tun – in Bezug auf das Thema Nationalsozialismus und Holocaust haben wir mehrheitlich mit Personen gesprochen, die sich selbst ein eher kritisches Bewusstsein zuschreiben würden.[15]
Von den vorliegenden Mehrgenerationenstudien zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust[16], die sich mit den Opfern und ihren Kindern und/oder mit signifikanten Tätern und ihren Nachkommen beschäftigt haben, unterscheidet sich unsere Untersuchung also schon in der Befragtenauswahl, und sie unterscheidet sich insbesondere auch in der Auswertung: Im Gegensatz zu den psychoanalytisch inspirierten Interpretationsstrategien von Bar-On, Roberts und Rosenthal und auch der Autoren der noch am ehesten vergleichbaren Mehrgenerationenstudie »Das Erbe der Napola«[17] suchen wir nicht nach den tiefenpsychologischen Bedeutungsschichten, die in den Interviews und Familiengesprächen schlummern, sondern bleiben eher am manifesten Text und dessen kommunikativem Gehalt. Uns interessiert mit anderen Worten weniger, was die Leute nicht sagen, als das, was sie sagen und welche Wirksamkeit das Gesagte im Weitergabeprozess zwischen den Generationen entfaltet. Unsere Untersuchungsperspektive richtet sich also auf den Stoff und die Textur des Geschichtsbewusstseins vom »Dritten Reich«, und die einzige in einem wahlverwandtschaftlichen Sinne vergleichbare Studie, die sich mit der familialen Weitergabe von Geschichte und den alltäglichen Mediatoren des Geschichtsbewusstseins befasst, hat Sam Wineburg vorgelegt.[18] Auch er kommt zu dem Ergebnis, dass es weniger die Schulen und die sonstigen Agenturen des kulturellen Gedächtnisses sind, die das Geschichtsbewusstsein junger Menschen prägen, als Alltagsgespräche in der Familie und nicht zuletzt Spielfilme.[19]
Die folgenden Kapitel beschäftigen sich zunächst damit, was unserer Auffassung nach das »Familiengedächtnis« ist, welche Funktionen es erfüllt und wie sich die allmähliche Verfertigung von Vergangenheit im Gespräch vollzieht.[20] Davon ausgehend zeigen wir im 3. Kapitel, wie Geschichten sich auf dem Weg von Generation zu Generation so verändern, dass sie am Ende der Tradierungskette einen ganz neuen Sinn bekommen haben – wobei das in unserer Sicht wichtigste Ergebnis ist, dass die Kinder- und Enkelgenerationen in deutschen Familien eine starke Tendenz zeigen, ihre Eltern und Großeltern zu Helden des alltäglichen Widerstands zu stilisieren, obwohl die von diesen erzählten Geschichten das selbst gar nicht nahe legen. Ein anderes zentrales Element der tradierten Geschichte des »Dritten Reiches« ist die Überzeugung, dass Deutsche Opfer waren – Opfer von Krieg, Vergewaltigung, Kriegsgefangenschaft, Mangel und Not. Dieser Opferdiskurs wird im 4. Kapitel eingehend dargestellt, wo auch auf ein Phänomen eingegangen wird, das wir »Wechselrahmung« nennen: die Komposition von Szenen aus der Vergangenheit aus narrativen und visuellen Versatzstücken, die man aus Dokumenten über die Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung kennt.[21]
Das 5. Kapitel beschäftigt sich mit dem Stoff, aus dem Kriegserinnerungen sind, und da zeigt sich überraschenderweise, dass es nicht allzu selten vorkommt, dass autobiographische Erlebnisse gar nicht dem »wirklichen Leben« entstammen, sondern Spielfilmen und anderen Quellen entlehnt sind, den Erzählern aber – sei es durch wiederholtes Berichten, sei es durch besonders gute »Passung« zur eigenen Lebensgeschichte – so zu Eigen geworden sind, dass sie als authentischer Bestandteil gelebten Lebens erinnert und empfunden werden. Das 6. Kapitel dokumentiert, wie Topoi und Deutungsmuster die Vorstellungsrahmen für vergangene Ereignisse definieren, wobei insbesondere die Tradierung antisemitischer und rassistischer Stereotype Aufmerksamkeit verdient.
In Kapitel 7. wird der Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und dem Holocaust in west- und ostdeutschen Familien verglichen. Hier zeigt sich, dass in den Familien aus der ehemaligen DDR die Erinnerung an den SED-Staat vielfach »über« der Erinnerung an das »Dritte Reich« liegt, was sich in permanenten Vergleichen der Staats- und Lebensorganisation widerspiegelt, was unter anderem dazu führt, dass sich die Angehörigen besonders der Kindergeneration mit Vorwürfen oder Anklagen gegenüber der Zeitzeugengeneration noch stärker zurücknehmen als ihre westdeutschen Altersgenossen, da sie ja selbst eine Diktatur nicht »verhindern« konnten. Das 8. Kapitel schließlich fasst die wesentlichen Ergebnisse noch einmal zusammen und skizziert die Umrisse einer Theorie der Tradierung, die über die Weitergabe der deutschen Vergangenheit im intergenerationellen Gespräch hinaus auch für die kommunikative Tradierung von Vergangenheit in anderen Gesellschaften Gültigkeit beanspruchen kann.
Dieses Buch basiert auf Gesprächen, für die uns die Angehörigen von 40 Familien ihre Zeit geopfert und ihre Offenheit entgegengebracht haben. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt.
2. Familiengedächtnis
Über die gemeinsame Verfertigung der Vergangenheit im Gespräch
In den von Angela Keppler analysierten »Tischgesprächen«[22] findet sich der folgende Ausschnitt aus einem Familiengespräch.[23] Die Familie Braun hat gerade einen Skatabend beendet. Der Vater resümiert:
VATER:
»N schönes Spiel«
MUTTER:
»Wenn man’s nicht zu bierernst nimmt«
VATER:
»Reizvolles Spiel«
SOHN:
»Und du hast es trotz Casablanca offenbar nich’ übergekriegt«
VATER:
»Wie bitte?«
SOHN:
»Du hast es trotz Casablanca nicht übergekriegt?«
VATER:
»Ich hab’ in der ganzen Gefangenschaft kein Skat mehr gespielt.«[24]
Keppler verwendet diesen Gesprächsausschnitt als Beispiel für eine Vergangenheitsrekonstruktion en passant: In einer alltäglichen, in keiner Weise auf das Erzählen von Erinnerungen bezogenen sozialen Situation wird plötzlich ein Aspekt der Lebensgeschichte eines Beteiligten angesprochen – in diesem Fall die Kriegsgefangenschaft des Vaters, die dieser in Casablanca zugebracht hat. Interessanterweise wird dieses Thema nicht vom Vater selbst eingebracht – ganz im Gegenteil scheint er die Bemerkung seines Sohnes zunächst gar nicht zuordnen zu können. Dessen Erinnerung an eine frühere Erzählung des Vaters ist überdies ungenau, denn wie sich zeigt, hat der Vater in der Kriegsgefangenschaft überhaupt nicht Karten gespielt. Nichtsdestotrotz führt die Bemerkung des Sohnes, wie Keppler schreibt, im Anschluss zu einer eineinhalb Stunden langen Erzählung des Vaters über die Zeit seiner Kriegsgefangenschaft.
Für uns ist diese Passage bemerkenswert, weil sie einige zentrale Aspekte vereint, die – wie in diesem Kapitel ausgeführt werden wird – typisch für das »Familiengedächtnis« sind. Der wichtigste Aspekt liegt darin, dass das »Familiengedächtnis« kein umgrenztes und abrufbares Inventar von Geschichten darstellt, sondern in der kommunikativen Vergegenwärtigung von Episoden besteht, die in Beziehung zu den Familienmitgliedern stehen und über die sie gemeinsam sprechen. Solche Vergegenwärtigungen der Vergangenheit finden in der Regel beiläufig und absichtslos statt – Familien halten keine Geschichtsstunden etwa zum Nationalsozialismus ab, sondern thematisieren Vergangenes zu unterschiedlichsten Anlässen, wie hier beim Kartenspiel, bei Familienfeiern, beim Fernsehen, bei Diaabenden, wo auch immer. Dabei ist die gemeinsame Praxis des »conversational remembering«[25] etwas völlig Selbstverständliches – sie bedarf keines Vorsatzes, keiner der Sprecher muss dabei eine Absicht verfolgen, sie hat keinen festgelegten Ausgang, es braucht nichts »ausdiskutiert« zu werden, das Thema kann beliebig gewechselt oder abgebrochen werden.[26]
Weiter ist wichtig, dass das jeweilige historische Ereignis nicht vom damaligen Akteur ins Gespräch gebracht werden muss – ganz im Gegenteil kommt es häufig vor, dass ein Angehöriger der Nachfolgegenerationen die jeweilige Geschichte anspricht. Damit ergeht eine auf den ersten Blick paradoxe Aufforderung an den historischen Akteur: Er möge doch erzählen, was seine Zuhörer schon kennen. Auch im Fall der Familie Braun hat der Vater ja ganz offensichtlich schon zuvor Episoden aus seiner Kriegsgefangenschaft erzählt – andernfalls könnte sein Sohn ihn gar nicht darauf ansprechen. Dass dessen Erinnerung an die Erinnerungen des Vaters zum Thema »Kartenspielen während der Kriegsgefangenschaft« falsch ist, stellt weder ein Erzählhindernis dar, noch ist es überhaupt untypisch »für jene Geschichten, die man als Kind von seinen Eltern oft erzählt bekommen hat und bei denen man, gerade weil sie einem immer wieder von den Erwachsenen erzählt wurden, nie so ganz genau hingehört hat«.[27]
Der Umstand, dass sich Kinder und Enkel ihren ganz eigenen Reim auf die Geschichten machen, die sie von ihren Eltern und Großeltern gehört haben, dass sie diese nicht nur auf ihre Weise interpretieren, sondern oft völlig neu gestalten, ergänzen oder entstellen, wird uns noch beschäftigen – hier ist zunächst einmal wichtig, dass Geschichten in der Familie gerade deswegen erzählt werden, weil jeder sie schon kennt: denn der »Bezug auf vergangene Ereignisse (ist) nicht allein ein Akt ihrer gemeinsamen Vergegenwärtigung als etwas Vergangenes, sondern ein Vorgang der Bestätigung einer Einstellung zu wichtigen Angelegenheiten des Lebens, die sich in der Familie über die Zeiten hinweg durchgehalten hat. Die rituelle Wiederholung […] benennt eine Kontinuität des Selbstverständnisses, die sie im selben Akt bezeugt.«[28]
Die kommunikative Vergegenwärtigung von Vergangenem in der Familie ist mithin kein bloßer Vorgang der Aktualisierung und der Weitergabe von Erlebnissen und Ereignissen, sondern immer auch eine gemeinsame Praxis, die die Familie als eine Gruppe definiert, die eine spezifische Geschichte hat, an der die einzelnen Mitglieder teilhaben und die sich – zumindest in ihrer Wahrnehmung – nicht verändert. Das Beispiel des von einer falschen Annahme ausgehenden Sohnes der Familie Braun deutet schon an, dass die einzelnen Familienmitglieder durchaus verschiedene Versionen der »Familiengeschichte« im Gedächtnis haben können – das »Familiengedächtnis« bildet aber einen Rahmen, der sicherstellt, dass sich alle Beteiligten an dasselbe auf dieselbe Weise zu erinnern glauben. Das Familiengedächtnis ist, wie sich im Folgenden zeigen wird, eine synthetisierende Funktionseinheit, die gerade mittels der Fiktion eines gemeinsamen Erinnerungsinventars die Kohärenz und Identität der intimen Erinnerungsgemeinschaft »Familie« sicherstellt.
Diese implizite Fiktion liegt übrigens auch anderen, sozial distanzierteren und temporären Erinnerungsgemeinschaften zugrunde – für die Familienmitglieder ist aber die prinzipielle Anforderung kennzeichnend, Kohärenz sichern, Identität bewahren und Loyalitätsverpflichtungen nachkommen zu müssen, und das Medium par excellence für die Erfüllung dieser Anforderung sind Keppler zufolge gemeinsame kommunikative Akte des Erinnerns: »Die Einheit einer Familiengeschichte besteht […] nicht in einer einheitlichen Geschichte, sondern in der Kontinuität der Gelegenheiten und Akte des gemeinsamen Sich-Erinnerns.«[29]
Keppler weist übrigens ausdrücklich darauf hin, dass die kommunizierten Geschichten keineswegs vollständig, konsistent und linear sein müssen – ganz im Gegenteil bestehen sie häufig eher in Fragmenten und bieten in dieser Gestalt Anknüpfungspunkte für unterstützende, unterbrechende und korrigierende Kommentare und Ergänzungen. Und ebenso wenig, wie das Gros der in der Familie kursierenden Geschichten aus geschlossenen Narrativen besteht, so wenig existiert eine Familiengeschichte »aus einem Stück«: »Dieses große Ganze gibt es nicht«, schreibt Keppler, »und kann es nicht geben, wenn es denn stimmt, dass das Gedächtnis einer familiären Gemeinschaft an okkasionelle Akte des jeweiligen Sich-Erinnerns gebunden ist.«[30]
Das Familiengedächtnis basiert nicht auf der Einheitlichkeit des Inventars seiner Geschichten, sondern auf der Einheitlichkeit und Wiederholung der Praxis des Erinnerns sowie auf der Fiktion einer kanonisierten Familiengeschichte. Ihre synthetisierende Funktion wird immer aufs Neue realisiert, allerdings, so müsste man Keppler ergänzen, nur so lange, wie es gut geht: Denn bekanntlich funktionieren Familien keineswegs immer als Kommunikations- und Erinnerungsgemeinschaften und häufig zerbrechen sie ja auch, mit der Folge, dass die Vergegenwärtigung einer gemeinsam geteilten Vergangenheit unmöglich wird. Wir kommen im Übrigen auch auf den Grenzfall eines Familiengedächtnisses zu sprechen, das zu zerbrechen droht, ohne dass sich die soziale Zusammensetzung des Kollektivs verändert: Hier, am Beispiel der Familie Meier, wird die Einheitlichkeit des Familiengedächtnisses dadurch in Frage gestellt, dass einige Zeit nach dem Tod des Urgroßvaters eine von ihm verfasste Chronik entdeckt wird, die diesen als NS-Verbrecher zeigt, der stolz auf seine Taten ist. Dieses Bild vom Urgroßvater nun widerspricht auf drastische Weise demjenigen, das die Familie bis dahin gepflegt hatte, und das führt zu deutlichen Schwierigkeiten der Hinterbliebenen, zu einer gemeinsamen Erinnerung zurückzukehren. Das, was die posthum entdeckte Chronik beinhaltet, ist nicht mehr verhandelbar. Wenn der Urgroßvater seine Geschichte im Rahmen von Familiengesprächen erzählt hätte,[31] hätte das vielleicht zu einigen Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der Fiktion einer gemeinsamen Familiengeschichte geführt – aber diese wäre auf jeden Fall leichter restaurierbar gewesen, als es hier, im Angesicht der nicht mehr modifizierbaren Chronik, der Fall ist.
Vor diesem Hintergrund macht der Fall der Familie Meier, der ausführlicher im nächsten Kapitel[32] vorgestellt wird, ex negativo deutlich, dass das Familiengedächtnis als eine Funktion zu verstehen ist, die jenseits der individuellen Erinnerungen und Vergangenheitsauffassungen der einzelnen Familienmitglieder die Fiktion einer gemeinsamen Erinnerung und Geschichte sicherstellt. Denn nachdem die Geschichte des Urgroßvaters sich als völlig diskrepant zum Gedächtnis der Familie Meier herausgestellt hat, zeigt sich, dass die einzelnen Generationenangehörigen – seine Tochter, seine Enkelinnen und seine Urenkelinnen – de facto ein je anderes Bild von ihm und seiner historischen Rolle gehabt hatten: Während die Tochter dieses Mannes sich wenig irritiert gezeigt hat, weil sie selbst ihren Vater noch in der NS-Zeit erlebt hatte, und während die Urenkelin wenig erschüttert ist, weil sie zum Zeitpunkt der Entdeckung der Chronik aufgrund ihres Entwicklungsalters nicht in der Lage ist, abstrakte Geschichtszusammenhänge mit der konkreten Person ihres Uropas in Verbindung zu bringen, sind die Enkelinnen tief erschüttert. In dieser Generation wich das kommunizierte und konservierte Bild vom Großvater am heftigsten von der sich plötzlich zeigenden historischen Wirklichkeit ab. Die einzelnen Generationenangehörigen einer Familie nehmen ihre Vorfahren und deren Geschichten mithin jeweils von einer anderen Zeitstelle aus wahr, was aber im Rahmen des Familiengedächtnisses so lange nicht zur Geltung kommt, bis eine unabweisbare Evidenz zutage tritt, die das sorgsam kultivierte Bild vom Vorfahren radikal in Frage stellt – und zwar für jeden Beteiligten auf eigene Weise.
Damit können wir auf die ursprüngliche Konzeption des Familiengedächtnisses zu sprechen kommen, wie sie von Maurice Halbwachs entwickelt worden ist. In seiner mittlerweile klassischen phänomenologischen Untersuchung betont er, dass das »kollektive Gedächtnis« zwar »auf einer Gesamtheit von Menschen beruht«, dass es aber die Individuen sind, die sich erinnern. »In dieser Masse gemeinsamer, sich aufeinander stützender Erinnerungen sind es nicht dieselben, die jedem von ihnen am deutlichsten erscheinen. Wir würden sagen, jedes individuelle Gedächtnis ist ein ›Ausblickspunkt‹ auf das kollektive Gedächtnis; dieser Ausblickspunkt wechselt je nach der Stelle, die wir darin einnehmen.«[33]
Wie jede soziale Gruppe hat auch die Familie ein »kollektives Gedächtnis«, das die »jemeinigen« Erinnerungen (um mit Paul Riceour zu sprechen) der einzelnen Mitglieder mit kulturellen, sozialen und historischen Rahmen versieht, weshalb Erinnerungen immer individuell und kollektiv zugleich sind. Die Erinnerungen des einzelnen Subjekts entstehen »durch Kommunikation und Interaktion im Rahmen sozialer Gruppen«, wie Assmann unter Bezugnahme auf Halbwachs und Goffman[34] formuliert hat: »Subjekt von Gedächtnis und Erinnerung bleibt immer der einzelne Mensch, aber in Abhängigkeit von den ›Rahmen‹, die seine Erinnerung organisieren.«[35] Für die Familie gilt Halbwachs zufolge, dass die Erinnerungsgeschichten, die in Familien erzählt werden, nicht nur individuelle Vergangenheitsbilder darstellen, sondern zugleich Modelle für »die allgemeine Haltung der Gruppe«: »Sie reproduzieren nicht nur ihre Vergangenheit, sondern sie definieren ihre Wesensart, ihre Eigenschaften und ihre Schwächen. Wenn man sagt: ›In unserer Familie wird man alt‹, oder › … ist man stolz‹, oder › … bereichert man sich nicht‹, so spricht man von einer […] moralischen Eigenschaft, von der man annimmt, dass sie der Gruppe eigen sei […]. Auf jeden Fall stellt das Familiengedächtnis aus verschiedenen aus der Vergangenheit behaltenen Elementen solcher Art einen Rahmen her, den es intakt zu halten sucht.«[36]
Wenn sich ein Familienmitglied also an ein Ereignis aus der Familiengeschichte erinnert, wird es unweigerlich auf diesen Rahmen zurückgreifen und den Selbstentwurf seiner Familie implizit mit jeder seiner Erinnerungserzählungen thematisieren und fortschreiben: »Nehmen wir nun an, wir riefen uns ein Ereignis unseres Familienlebens in die Erinnerung zurück […]. Versuchen wir, diese traditionellen Ideen und Urteile, die den Familiengeist bestimmen, davon zu trennen. Was bleibt übrig? Ist es überhaupt möglich, eine solche Trennung durchzuführen und in der Erinnerung an das Ereignis zu unterscheiden zwischen dem Bild von dem, was nun einmal stattgefunden hat […], und den Vorstellungen, in denen sich gewöhnlich unsere Erfahrung von der Handlungsweise und den Verhältnissen unserer Verwandten ausdrückt?«[37]
Die explizite Erinnerung an ein Ereignis aus der Familienvergangenheit ist mithin untrennbar mit einem impliziten Konzept über diese Familie verbunden – und das eben macht die Spezifik von Familienerzählungen über die nationalsozialistische Vergangenheit und den Holocaust in unseren Gesprächen aus: Denn hier haben wir es ja mit dem Phänomen zu tun, dass eine auf der Ebene der öffentlichen Erinnerungskultur als verbrecherisch markierte Vergangenheit mit einem Familiengedächtnis in Einklang gebracht werden muss, das unter den Erfordernissen von Kohärenz, Identität und wechselseitiger Loyalität jedes Mitglied dazu verpflichtet, die »gute Geschichte« der Familie aufrechtzuerhalten und fortzuschreiben.
Mit Halbwachs kann man in diesem Zusammenhang von einem generalisierten Bild der »moralischen Wesensart unserer Eltern« sprechen, das implizit jedem erinnerten und weitergegebenen Ereignis der Vergangenheit unterliegt.[38] Das Bild, das sich von dieser »moralischen Wesensart« des Vorfahren an jener Zeitstelle hergestellt hat, von der aus man ihn kennt, wird – das belegt unser Interviewmaterial in vielfältiger Weise – auch auf jene vorausliegenden Abschnitte seiner Lebensgeschichte hin generalisiert, die man aus eigener Erfahrung und Anschauung nicht kennt, weil man zu dieser Zeit noch gar nicht auf der Welt war. Und hier entsteht sie, die maximale Diskrepanz zwischen der Person, wie man sie im Rahmen gemeinsamer Lebenspraxis, in der Praxis gemeinsam verbrachter Lebenszeit, kennen gelernt hat, und der möglichen Rolle, die diese Person zu anderen Zeiten gespielt haben kann.
In diesem Sinne lassen sich die Schwierigkeiten von Angehörigen der Enkelgeneration verstehen, ihre Großeltern in einen Geschichtszusammenhang einzufügen, der normativ eindeutig als »böse« markiert ist. Sie sind mit einer tiefen Kluft zwischen »dieser großen Geschichte und meinem kleinen Opa« konfrontiert, wie es eine Angehörige der Enkelgeneration formuliert hat. »Dass mein Großvater an diesen Dingen beteiligt gewesen sein soll«, sagte ein anderer, »das übersteigt meine Vorstellungskraft.«
Halbwachs betont (in Einklang mit Familientherapeuten),[39] dass die Familie eine im Vergleich zu anderen sozialen Gruppen »unauflösliche Einheit« bildet[40] – selbst, wenn die Familienbeziehungen aufgrund von Tod, Scheidung etc. zerreißen, bleiben Väter Väter und Söhne Söhne: In keiner anderen sozialen Gruppe, so Halbwachs, bedeutet »die Persönlichkeit jedes Menschen mehr […], wo man sich in seinen Urteilen über seine Nächsten am wenigsten durch die Regeln und Meinungen der Gesellschaft beherrschen und leiten lässt, wo man sie nach ihrer eigenen individuellen Natur und nicht als Mitglieder einer religiösen, politischen oder wirtschaftlichen Gruppe bewertet, wo man vor allem und fast ausschließlich ihre persönlichen Qualitäten in Betracht zieht und nicht das, was sie für die anderen Gruppen, die die Familie umgeben […], sind oder sein könnten.«[41]
Es leuchtet unmittelbar ein, dass die vielleicht auch andernorts widerstreitenden Verpflichtungen des Familiengedächtnisses und des kulturellen Gedächtnisses gerade in einem Land besondere Probleme aufwerfen, in dem der Nationalsozialismus und der Holocaust zur Familiengeschichte zählen. Bevor wir im nächsten Kapitel zeigen werden, dass die Lösung dieses Problems in der Herstellung eines Heroisierungsprozesses besteht, in dem antisemitische Großmütter in den Erzählungen ihrer Enkel in heldenhafte Beschützerinnen von Verfolgten verwandelt werden und »alte Kämpfer« der NSDAP in Zuckmayersche Generäle, die mit dem Teufel paktiert haben, wollen wir in diesem Kapitel zunächst beschreiben, wie Geschichten in Familiengesprächen gemeinsam verfertigt werden, wie – in anderen Worten – Vergangenheit in einem sozialen Prozess gebildet und tradiert wird.
Die Beschreibung dieses Vorgangs erscheint nicht nur deswegen überfällig, weil bislang weder eine Theorie noch eine Deskription der Weitergabe von Geschichte im Gespräch zwischen den Generationen vorliegt, sondern auch deswegen, weil – wie Keppler zu Recht angemerkt hat – Halbwachs’ Ausführungen zum Familiengedächtnis zwar im Modell höchst instruktiv sind, er aber jeden empirischen Nachweis schuldig geblieben ist, wie das Familiengedächtnis sich kommunikativ realisiert und fortschreibt: »Halbwachs spricht davon, dass Großeltern Erinnerungen an Enkelkinder weitergeben, schweigt sich aber darüber aus, wie dies im Einzelnen geschieht. Man wüsste gern, wie sich das kollektive Gedächtnis bildet, erhält und verlängert, oder genauer: wie die Einheit dieser drei Vorgänge des Bildens, Erhaltens und Verlängerns als sozialer Prozess möglich ist. Will man aber die soziale Bildung des Gedächtnisses studieren, so wäre mein Einwand, muss man jene Akte der Vermittlung untersuchen, die ein Erinnern möglich machen.«[42]
Keppler selbst hat solche Akte der Übermittlung anhand von Alltagsgesprächen untersucht, die mit Tonband aufgezeichnet wurden, ohne dass ein Interviewer anwesend gewesen wäre. Das ist ein wichtiger Unterschied zu unserer Untersuchungsanlage; ein anderer besteht darin, dass es Keppler um die Rekonstruktion der kommunikativen Vergegenwärtigung von familialer Vergangenheit als familialer Vergangenheit ging – die Thematisierung von Geschichten aus der NS- Vergangenheit geschieht dabei, wie das eingangs zitierte »Casablanca«-Beispiel zeigt, zufällig und beiläufig. In unseren Gesprächen ist der Nationalsozialismus der zentrale Gegenstand der Vergegenwärtigung in den Familiengesprächen und in den Einzelinterviews.[43]
Die Besonderheit unseres Untersuchungsdesigns, dass die beteiligten Familienmitglieder sowohl in generationsspezifischen Einzelinterviews erzählen sollten, was sie aus Familiengesprächen über die NS-Vergangenheit und die Erlebnisse ihrer Eltern und Großeltern wussten, als auch in Familiengesprächen gemeinsam über diese Vergangenheit sprechen sollten, hatte die logische Folge, dass eine Familie schon dann nicht in die Stichprobe einbezogen werden konnte, wenn nur ein Generationenangehöriger die Teilnahme ablehnte. Auf diese Weise mussten etwa einhundertfünfzig Familien angesprochen werden, um die angezielte Stichprobe von 40 Familien zu realisieren, und während ganz im Gegensatz zu landläufigen Vermutungen, die Zeitzeugengeneration würde die Vergangenheit »beschweigen«, die ehemaligen Wehrmachtsangehörigen und »Trümmerfrauen« meist spontan zusagten, waren es viel eher ihre Söhne und Töchter, die eine Teilnahme verweigerten – oft mit dem Hinweis, ihre Eltern würden über dieses Thema nicht sprechen. Dass sich hinter dieser Struktur ein eigenes Problem der so genannten 68er-Generation mit der NS-Vergangenheit und ihrem sorgsam kultivierten Mythos von der schweigenden Kriegsgeneration verbirgt, verdient eine eigene Diskussion[44] – hier bleibt es zunächst einmal wichtig, zu betonen, dass wir es mit einer Stichprobe zu tun haben, in der das Thema Nationalsozialismus erstens überhaupt als ein Thema betrachtet wird, über das man sprechen sollte (was ja keineswegs allgemein vorausgesetzt werden kann),[45] und dass zweitens in diesen Familien gemeinsam über die nationalsozialistische Vergangenheit und den Holocaust gesprochen werden kann.
Für die Einschätzung der Reichweite unseres Materials ist dies genauso wichtig wie der schon erwähnte Umstand, dass die Thematisierung von Nationalsozialismus und Holocaust in den Interviews und Familiengesprächen auch durch die Interviewerinnen und Interviewer beeinflusst ist. Wir haben uns vor dem Hintergrund einer der Methodenentwicklung dienenden Vorstudie[46] deshalb dafür entschieden, der Rolle der Interviewerinnen und Interviewer in der Auswertung der Gesprächsprotokolle systematisch dieselbe Beachtung zu schenken wie den Äußerungen der Befragten. Wir betrachten unsere Interviews und Familiengespräche als von mehreren Sprechern gemeinsam verfertigte Texte über die nationalsozialistische Vergangenheit und den Holocaust. Diese Texte können darüber Auskunft geben, wie zu einem definierten Zeitpunkt (nämlich von 1997 bis 2000) in definierten sozialen Situationen (nämlich in Forschungsinterviews und -diskussionen mit Familien) über ein definiertes Thema gesprochen wird. Diese Reichweitenbestimmung ist hinsichtlich der Forschungsfragestellung nach der Tradierung des Geschichtsbewusstseins vom Nationalsozialismus in Deutschland viel angemessener als eine konventionellere Untersuchungsstrategie, die von der Annahme ausginge, Geschichtsbewusstsein und Erinnerungen allgemein lägen in einer fixierten Form vor, die mit Hilfe »neutraler« Erhebungsverfahren ermittelt und beschrieben werden könne. Wir haben schon mit Kepplers Konzeption des Familiengedächtnisses argumentiert, dass dieses wesentlich in seiner praktischen Vergegenwärtigung besteht, mithin im sozialen Prozess gemeinsamer Erinnerung.
Die Interviewerinnen und Interviewer spielen in diesem Prozess eine Rolle als soziale Personen, und entsprechend war es ihnen gestattet, auf an sie gerichtete Fragen zu antworten, empathisch zu reagieren, sich verwundert zu zeigen, kurz: sich alles andere als neutral zu verhalten. Da das Neutralitätspostulat an den Interviewer, das noch immer nicht aus den Lehrbüchern der empirischen Sozialforschung verschwunden ist, von grundlegenden kommunikationstheoretischen Voraussetzungen absieht, und da Neutralität im Rahmen sozialer Interaktionen ein Widerspruch in sich selbst ist, werden unsere Betrachtungen von gemeinsamen Verfertigungen der Vergangenheit im Gespräch Intervieweräußerungen fallweise genauso einbeziehen wie Äußerungen von Familienmitgliedern.
Zudem haben auch die Familienangehörigen in den Gesprächen die Möglichkeit, die Rolle des Interviewers oder Moderators zu übernehmen und lenkend einzugreifen. Dieser steuernde und vermittelnde Einfluss kann so dramatisch ausfallen wie in der Familie Lerch, in der der Sohn Hans Hack, Jahrgang 1936, seine erzählende Mutter rüde unterbricht:
HANS HACK:
»Naja, Mutti, das ist auch«
EVA LERCH:
»Was?«
HANS HACK:
»Gequatsche«
EVA LERCH:
»Is’ Gequatsche?«
HANS HACK:
»Ich sage, das sind rein private Sachen alles.«[47]
Die Moderatorenrolle der Kindergeneration kann sich aber auch in der milderen Form zeigen, dass die Kinder ihren Eltern soufflieren, Stichworte liefern oder auch ganze Geschehenszusammenhänge selbst erzählen, wie im folgenden Beispiel:
HILDRUN MÜLLER:
»Das letzte Mal, wie er wieder rausfahren wollte, und man wusste aber schon, dass ähm, wir haben immer gesagt, er soll nicht fahren, er soll nicht fahren. Also, wir hatten Angst, er kommt nicht wieder, und so war es ja auch. Und dann hat Mutti gesagt: ›Nein, ich schließe die Tür ab, du kommst nicht raus!‹ ›Nein, das kann ich nicht machen, meinen Kollegen gegenüber kann ich das nicht machen, ich muss raus!‹ Und dann bist an’n Bahnhof, da war eine Straßenbahn, ne.«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Hm«
HILDRUN MÜLLER:
»Bis zum Bahnhof mitgegangen. Da muss ich wohl mitgewesen sein. Das weiß ich also auch noch.«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Ja, das kann sein. Das kann sein.«
HILDRUN MÜLLER:
»Ne, am Bahnhof war die Straßenbahn, und da haben wir dann unseren Vater weggebracht.«
Nicht nur, dass die 1938 geborene Hildrun Müller hier eine Geschichte detailliert und szenisch erzählt, die sich um ein zentrales Ereignis der Familiengeschichte, den letzten Besuch des Vaters, dreht – es scheint auch so zu sein, als wären ihrer Mutter die erzählten Details und Szenen gar nicht recht in Erinnerung. Allerdings scheint es gerade die Lebendigkeit von Hildrun Müllers Erzählung zu sein, die ihre Mutter schließlich dazu veranlasst, deren Schilderung zuzustimmen, wenn auch zögerlich: »Ja, das kann sein.«
Dieses Verfahren, dass die Tochter die Geschichten, die ihre Mutter betreffen und die eigentlich diese erzählen könnte, stellvertretend erzählt, zieht sich durch das gesamte Familiengespräch der Brinkmanns. An einer anderen Stelle ist Wilhelmine Brinkmann (Jahrgang 1915) unsicher, was sie noch berichten könnte: »Ja, und was noch?« Sofort springt ihre Tochter ein:
HILDRUN MÜLLER:
»Und dann das Schlimmste fand ich für dich«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Mein schönes Kleid«
HILDRUN MÜLLER:
»Das schönste Kleid, das Oma besaß! Sie hatte so ein wunderschönes Kleid! Und dann hat jemand geklingelt an der Tür, Bauern müssen das wohl gewesen sein«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Ja, ja.«
HILDRUN MÜLLER:
»Und dann, ja, ja, eine Dose Wurst. Für dieses Kleid. Soo eine kleine Dose Wurst!«
WILHELMINE BRINKMANN:
»So ’ne kleine bloß. Und die habe ich aufgemacht und auf den Tisch gestellt und denn«
HILDRUN MÜLLER:
»du bist rausgegangen, weil du es nicht mit ansehen konntest. Du hast gar nichts gegessen. Und wir haben das in fünf Minuten oder sieben Minuten aufgegessen. Und dein Kleid war weg, ne. Seh’ ich bis heute noch.«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Ich auch. Das sehe ich heute auch noch.«
HILDRUN MÜLLER:
»Also, das werde ich nie vergessen.«
WILHELMINE BRINKMANN:
»Nee, ich auch nicht. Nee.«[48]
Ganz ähnlich wie in der vorangegangenen Sequenz erzählt Hildrun Müller eine Geschichte, in deren Zentrum eigentlich das Erleben ihrer Mutter steht – denn es war ja ihr Kleid, das gegen eine Dose Wurst eingetauscht wurde. Die Choreographie der gemeinsamen Erzählung zeigt besonders zu Beginn und am Schluss, dass es sich hier wohl um eine schon oft erzählte Geschichte handelt: Auf Hildrun Müllers Stichwort »dann das Schlimmste« fällt Wilhelmine Brinkmann sofort »mein schönes Kleid« ein – was wiederum den Anlass für Hildrun Müller liefert, die Geschichte vom Kleid detailliert zu erzählen. Der Abschluss der Geschichte besteht in einer doppelten wechselseitigen Versicherung, dass dieses Ereignis so einschneidend war, dass es beiden Beteiligten noch heute vor Augen steht (»Seh’ ich bis heute noch« – »Das sehe ich heute auch noch«) – obwohl die Geschichte selbst ja beide Erzählerinnen in ganz unterschiedlichen Rollen zeichnet und eher den Eindruck macht, dass die Kinder weniger den Verlust des Kleides im Blick hatten als die Dose Wurst. Die gemeinsame Erzählung stellt aber retrospektiv eine Einheitlichkeit des historischen Erlebens her, die die Unterschiedlichkeit der damaligen Positionen im Familiengedächtnis löscht. Auch deshalb wird abschließend übereinstimmend die Bedeutsamkeit des Ereignisses für das gemeinsame Gedächtnis unterstrichen: »Das werde ich nie vergessen« – »Nee. Ich auch nicht.«
Gerade bei jenen Angehörigen der Kindergeneration, die selbst noch in den dreißiger Jahren geboren wurden, liegt die Herstellung einer gemeinsamen Erinnerung besonders nahe – mit dem Effekt, dass sich in den Familiengesprächen eine Koalition des zeithistorischen Darstellens und Verstehens bildet, auf die die Enkel sich einen eigenen Reim machen müssen. Dass diese den Geschichten, die häufig durch ein Hintergrundgefühl von Mangel, Not und Bedrohung getönt sind, viel eher dramatische und problematische Aspekte entnehmen, selbst wenn die Geschichten eher positiv sind, zeigt die folgende Passage aus dem Gespräch mit der Familie Lerch. Hans Hack, der 1936 geborene Sohn, erzählt, dass seine Schulklasse aus der Stadt evakuiert wurde, weshalb er, zusammen mit seiner Mutter, auf dem Land bei einer anderen Familie untergebracht wurde:
HANS HACK:
»Ja, wie gesagt, wir sind denn da aufgenommen worden, und die Verhältnisse haben sich sehr positiv gestaltet.«
EVA LERCH:
»Also, die haben uns alles abgegeben, nech. Weihnachten hat er uns ’n Tannenbaum besorgt, die Kohlen dazu und den Baum selber aus’m Wald geholt, und denn wollt’ er auch Zuckerkuchen backen, wenn ich ihm Kaffee kochte (lacht). Weil unser Vater hatte Kaffee mitgebracht.«[49]
In diese von der Zeitzeugin Eva Lerch (Jahrgang 1911) und ihrem Sohn erzählte Geschichte hinein fragt die 1968 geborene Enkelin
ANNA HACK:
»Ich wollt’ grad fragen: Wo habt ihr was zu essen hergekriegt?«[50]
Deutlich ist hier, dass Anna Hacks Bild von der Zeit, über die Eva Lerch und Hans Hack erzählen, durch ein Szenario der Not und des Mangels geprägt ist, obwohl die beiden Erzähler doch gerade eine ganz gegenteilige Geschichte berichtet haben. Frau Lerch zeigt sich denn auch etwas irritiert, bevor sie antwortet:
EVA LERCH:
»Ja, also. Alles, was ich haben wollte, hab’ ich gekriegt. Also, sie haben mir immer Eier gegeben oder auch für die Kinder, Ostern, Eier mussten sie suchen. Und als wir ankamen, hat die Frau sowieso einen Topf machen müssen. Also zusammengekocht, aber kräftig, dass wir alle zufrieden waren.«[51]
Anna Hack ist mit dieser Darstellung aber noch keineswegs zufrieden – scheint zwar die Versorgung mit Luxusgütern wie Ostereiern und Zuckerkuchen zu Weihnachten in der historischen Situation sichergestellt, muss doch ihrer Auffassung nach irgendwo Mangel geherrscht haben:
ANNA HACK:
»Und wo habt ihr eure Grundnahrungsmittel herbekommen?«
EVA LERCH:
»Was?«
ANNA HACK:
»Wo ihr eure Grundnahrungsmittel herbekommen habt, so was wie Brot?«
EVA LERCH:
»Naja, da war ’n EDEKA.«[52]
Die Irritation wird hier zunehmend wechselseitig. Es zeigt sich, dass Anna die Geschichte im Rahmen ihrer Hintergrundüberzeugung hört, es würde hier aus einer Zeit des Mangels und der Not berichtet, während Frau Lerch und Hans Hack eine durch und durch positive Geschichte erzählen – dass sie nämlich keinerlei Not zu leiden hatten. Eva Lerchs lapidare Antwort, dass sie ihre »Grundnahrungsmittel« eben bei EDEKA gekauft habe, wird dann allerdings von Hans Hack in Richtung der Erwartungen seiner Tochter ergänzt:
HANS HACK:
»Mit Lebensmittelmarken, wie das im Krieg war.«[53]
Diese Sequenz zeigt nicht nur, dass die Angehörigen der Enkelgeneration dazu neigen, von einem generalisierten Bild der Kriegsjahre und der Nachkriegszeit auszugehen, in dem ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern gelitten haben, also Opfer waren (was im nächsten Kapitel eingehender dargestellt werden wird). Sie zeigt auch, dass die Enkel ziemlich resistent gegenüber der Versuchung sind, dieses Bild zu korrigieren. Das deutet einmal mehr an, dass die einzelnen Generationenangehörigen der Familien durchaus verschiedene Bilder von den in Rede stehenden Ereignissen und Verhältnissen haben, was aber in der sozialen Situation des Erinnerns und Erzählens nur selten manifest wird. Einschübe wie die von Hans Hack sind dazu geeignet, die verschiedenen Bilder einander anzugleichen und das Begehen einer gemeinsamen Erinnerung zu erleichtern.
Dieser Befund, dass die Beteiligten vor, während und nach dem Gespräch ganz unterschiedliche Vorstellungen von der Vergangenheit hegen und auch verschiedene Versionen der erzählten Geschichten wahrnehmen, führt im Rahmen der Vergegenwärtigungssituation häufig gerade nicht zu Konflikten, sondern zu kommunikativen Lösungen, die für alle Beteiligten das Gefühl zulassen, man habe gemeinsam über dasselbe gesprochen. Dieser zunächst vielleicht überraschende Befund verdient eine genauere Aufschlüsselung: Im Gespräch mit der Familie Beck findet sich eine ganze Reihe von Geschichten, die zeigen, dass alle beteiligten Sprecherinnen und Sprecher Anteile unterschiedlicher Versionen der vermeintlich gleichen Geschichte im Gespräch realisieren – übrigens unter aktiver Beteiligung der Interviewerin.
Frau Beck, Jahrgang 1924, hat gerade eine Fluchtgeschichte erzählt, die zunächst in der russischen Besatzungszone endet. Nun beginnt, wie sie erzählt, eine »böse Zeit«:
MATHILDE BECK:
»Denn der Russe nahm ja keine Rücksicht, und wenn er merkte, wo junge Mädchen waren, o wei o wei.«[54]