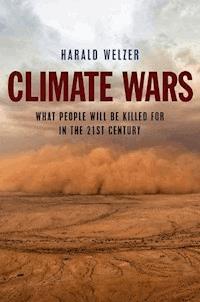7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
In diesem Band sind einige der klügsten Köpfe der Gegenwart versammelt. Sie bieten uns ein Kaleidoskop an Ideen, Impulsen und Anregungen zum Nachdenken, die uns Hinweise und Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit liefern. Das klügste Geschenk des Jahres! Mit Beiträgen u.a. von Tilman Allert, Güner Balci, Martin Seel, Harald Welzer, Nils Minkmar und Ahmad Mansour.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 261
Ähnliche
Denk mal! 2017
Anregungen von Harald Welzer, Güner Yasemin Balci, Nils Minkmar, Ahmad Mansour, Byung-Chul Han u.a.
FISCHER E-Books
Inhalt
Tilman Allert
»Das Gesicht des Autos«
Das Gesicht des Autos – Es ist kein Geheimnis, dass sich die deutsche Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wie im Selbstverständnis aller sozialen Milieus über das Mobilitätspotential, die technologische Raffinesse und das Komfortversprechen des Autos definiert. Dieser Umstand rechtfertigt den Versuch, den symbolischen Raum des Autos in der Moderne zu erschließen und dabei die Frontale der Karosserie in den Vordergrund zu rücken. Die Frage nach dem Gesicht des Autos schließt an beste hermeneutische Traditionen an. Kein Geringerer als Erwin Panofsky, Kunstwissenschaftler aus der Hamburger Warburgschule, Emigrant wie so viele, einer, der unseren Zugang zur Kultur der Renaissance erleichtert hat und dazu einer der geheimen Väter von Bourdieus Soziologie ist, er sei als prominenter Zeuge aufgerufen. Panofsky greift in einem seiner weniger bekannten Aufsätze über Renaissance-Adaptation im britischen Empire (»The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce-Radiator«) das Palladio-Format vom Kühlergrill des Silver Shadow auf und entschlüsselt kulturgeschichtliche Voraussetzungen von dessen ästhetischer Attraktion.
Wie bei allen Gegenständen hermeneutischen Verstehens beginnen wir mit einer Phänomenologie. Die Metaphorik des Gesichts bestimmt den symbolischen Raum der ersten Begegnung. Beim Auto kommt die Dimension der Wiedererkennbarkeit hinzu, diejenigen Elemente im Gesicht, über die so etwas wie Markentreue oder Firmenkonsistenz initiiert wird, und schließlich lässt sich beides historisieren zum Wandel des Autogesichts: Die Dimensionen, auch das ganz kurz, sind selbstredend analytisch gedacht, empirisch übersetzt, ergänzen sie sich, überschneiden sich korrespondierend oder konfliktiv.
Bei Menschen rückt bekanntlich die Sprache in das Zentrum einer Grenzziehungsartikulation sowie der Überprüfung des Gegenübers, mit dem wir beim Durchschreiten des Raumes in Kollision geraten. Das Sprechen und die über Lautgebung erfolgende Artikulation unseres Standortes machen die Kontaktaufnahme bei aufrechterhaltener Raumdistanz oder doch zumindest Körperdistanz möglich. Das Gehen ermöglicht die Synchronisation mit dem gesamten sensorischen Arsenal: Geht das Gehen in einer Temposteigerung in Rennen über, so wird durch die erhöhte Atemfrequenz die Artikulationsfähigkeit der Sprache eingeschränkt, und darüber hinaus wird das motorische Potential der Raumdurchquerung schneller ausgelastet, allerdings um den Preis erhöhter Kollisionsgefahr.
Während wir im Gehen über die Möglichkeit einer begleitenden Situationswahrnehmung und Situationskontrolle verfügen, wahrgenommene Hindernisse relativ schnell in eine Veränderung unserer Motorik, beispielsweise durch Tempodrosselung, übersetzen können, während wir des Weiteren bei dieser Körpertechnik sensomotorisch, olfaktorisch, visuell und akustisch auf variierende Raumsituationen reagieren können, ändert sich die Art und Weise unseres Ortswechsels folgenreich beim Gebrauch von Artefakten. Überspringen wir solche Dinge wie Stelzen, Rollschuhe oder Skier, steigen wir gleich in das Auto. Unter den Artefakten ist das Auto in vielerlei Hinsicht interessant. So verführerisch es ist, David Riesman oder den eigensinnigen Geschwindigkeitsreflexionen eines Paul Virilio zu folgen, eine Kulturkritik des Autos ist nicht angesagt. Über die besonderen Bedingungen und die Sozialitätsform nachzudenken, in denen das Autofahren erfolgt, ist in sich spannend. Eigenartig genug, der »Autofahrer ist vollständig von einem außersozialen Objekt umgeben, von physischem Kontakt mit anderen abgeschlossen und doch völlig von ihnen abhängig und mit ihnen verknüpft. Der Verkehr ist ein Strom, in den er eintaucht, gewissermaßen ohne nass zu werden.« So weit David Riesman.
Autofahren wird grundlegend bestimmt über das Motiv der Raumdurchquerung und konfrontiert die Teilnehmer des Straßenverkehrs mit der Konkurrenz um die Raumnutzung – sie erzwingt einen erhöhten Kooperationsbedarf. Diese Bedingung des Autofahrens wird unterstrichen durch die im Riesman-Zitat erinnerte Einschränkung optischer und akustischer Möglichkeiten der direkten Kommunikation. Die besondere Handlungseinbettung Straßenverkehr erzwingt Abweichungen von der Urform des sozialen Kontakts, der Face-to-face-Interaktion, und verlagert den Schwerpunkt des Austauschs auf die Wahrnehmung und Interpretation von Zeichen. Das erhöht die Elastizität und Kurzfristigkeit des Austauschs und macht ihn zugleich extrem fragil, schließlich sind diejenigen, die ein derartiges Artefakt in Anspruch nehmen, in einem viel höheren Ausmaß Kollisionsgefahren ausgesetzt. Beim Autofahren begegnen sich Menschen in einer vereinbarten Fremdheit, und die Art und Weise der Partizipation am Straßenverkehr, die man als einen kontrollierten Nomadismus bezeichnen könnte, verleitet zu Devianzen, Abweichungen, die der Chance nur kurzfristiger Begegnungen entlehnt sind: Der Vagabund, der Abenteurer, der Provokateur sind als Verfallserscheinungen der Fahrermoral vertraut. Sie entstehen hingegen nicht zwingend mentalitätsbedingt, sondern sind der Ausgangssituation Straßenverkehr geschuldet – von hier erklärt sich die hohe Rigidität der Verkehrsvorschriften. Sie übernehmen die Aufgabe, Mehrdeutigkeit auszuschließen; sich in der Kurzfristigkeit der Begegnung über Bedeutungen auszutauschen wäre umständlich, hochriskant, möglicherweise tödlich (denken wir an Szenen aus Filmen mit James Dean). Hohe Interaktionsdichte und eingeschränkte Interpretations- und Korrekturmöglichkeiten machen die Verkehrssituation zu einer gefährdungsträchtigen Erfahrungssituation, und das je mehr, je dichter der Verkehr in einem rein quantitativen Sinne wird.
Das Auto ist Teil einer Maske meines Auftritts, und der prominente Teil eines stillen Anspruchs auf Teilnahme am Austausch, am Verkehr, ist die Frontpartie – das Auto hat ein Gesicht. Zweifellos bildet der Kühlergrill dabei die prägnanteste Zone der Selbstmitteilung. Der Kühlergrill, in seiner Form technologisch erzwungen durch die Ventilation, die Luft, die dem Motor als Energiezentrum kühlend zuzuführen ist, versieht die Kommunikationsbereitschaft, die ja beim Autofahren auf die ebenso prägnante wie extrem flüchtige Präsenz beschränkt ist – allenfalls durch variierende und zugleich schnell wieder aufgelöste Distanzen wahrnehmbar –, im begrenzten Angebot der Modelle mit dem Signum der Wiedererkennbarkeit und einer ersten symbolisch aufgeladenen Geste. Der Kühlergrill rauscht als Drohung heran oder als eine Gefälligkeit, als Zurückhaltung oder als Verkniffenheit – der Kühlergrill ist somit der Gruß vor dem Gruß –, wie sich jedes Design kommunikationssoziologisch als Gruß vor dem Gruß darstellen lässt, als visuell artikulierter erster Eindruck, der Präsenz unterstreicht und bekräftigt.
Wie sehen wir das Auto? In der Regel in einer Dualität, auf unserer eigenen Seite fährt es vor uns, wir sehen es von hinten. Komplex wird die Wahrnehmung durch den Blick in den Rückspiegel, über den die Verkehrssituation antizipierend kalkuliert werden kann. Hierbei und erst recht im zwingend gebotenen vorschauenden Blick auf die entgegenkommenden Fahrzeuge wird unsere Aufmerksamkeit sekundenschnell durch das Gesicht des Autos strukturiert. Weitaus tiefgründiger, als eine schlichte Analogiebildung nahelegt, sind es der Kühlergrill und die Stellung der Scheinwerfer, die das situativ, aber auch technologisch unterbundene Sprechen mimetisch substituieren. Wir reagieren unbewusst auf die Verhältnismäßigkeit von Mund- und Augenpartie, zwei Regionen des Gesichts, die auch in der Face-to-face-Kommunikation die Aufgabe übernehmen, blitzschnell die begleitenden Empfindungen zu markieren, letztlich das Gegenüber im Hinblick auf dessen Vertrauenswürdigkeit und insofern auf sein Handlungspotential einschätzen zu können.
Faszinierend genug, das ist beim Auto nicht anders, selbstredend mit dem entscheidenden Unterschied, dass wir es mit erstarrten Elementargesten zu tun haben, geronnenen Gesten des Auftritts, in die Frontseite der Karosserie übersetzt. Es handelt sich um eine Demonstration von Territorialansprüchen, und zwar jenseits der technologisch erzwungenen Aufgabe, über die Scheinwerfer die Raumorientierung tageslichtunabhängig zu ermöglichen und minimal Zuvorkommenheit, Warnung oder auch Dank zu signalisieren – Gesten jenseits der Funktion, die heißlaufende Maschine mit hinreichend Kühlluft zu versorgen und dabei zugleich den störungsanfälligen Binnenraum unter der schützenden Motorhaube vor dem Eindringen von Wasser oder Steinschlag zu schützen. Der Kühlergrill als zentrales Element der Frontalität übernimmt die Aufgabe, erste Eindrücke zu verbreiten, und als Ensemble von Assoziationen wird er zu dem Ornament, über das die relative Schönheit des Fahrzeugs nach außen kommuniziert wird. In seiner Gitterstruktur – davon wissen die Designer in den Autounternehmen ein Lied zu singen – wird der Grill spannungsreich in ein Verhältnis der a) Indifferenz oder b) Korrespondenz zu Stellung und Ausmaß, Fassung und Form von Frontscheibe, Scheinwerfer und Stoßstange gebracht. Was somit in der mehr als nur metaphorischen Auslegung des Anblicks das Gesicht des Autos entstehen lässt, sind Wechselwirkungen, die nur in Grenzen technologischen Erfordernissen genügen, die vielmehr stets auch inneren Stimmigkeitskriterien der Gestalt genügen. Ohne hier eine Systematik vorlegen zu wollen, gibt die in der großen Vielfalt der Gesichter zwischen den beiden Extremen zugespitzter Exzentrizität und scheuer Zurückhaltung eine Reihe von Ausdrucksformen frei: die Fratze, die lächelnde Einladung, die Drohung oder auch distante Zurückhaltung.
Der geronnene Geist der Front gewinnt an Tiefe, wenn wir die zweite Dimension hinzufügen, die angesichts der Markenkonkurrenz zwingend ist: Notwendig ist es, Wiedererkennbarkeit im Gesicht unterzubringen. Wenn wir auf der ersten phänomenologischen Ebene die Frontansicht eines Autos als erstarrte Geste interpretieren können, etwas, das markenübergreifend zu beobachten ist, das die Gestalt des Fahrzeugs ausmacht, so tritt mit dem Logo des Unternehmens eine Besonderheit hinzu, ein Ornament, das unter dem ökonomisch gebotenen Zwang zur Standardisierung der Modelle die Einzigartigkeit zu unterstreichen hat, gleichsam das Rouge des Fahrzeugs – auch dies mit der doppelten Aufgabe, Ansprüche auf situative Präsenz im knappen Raum zu markieren, zugleich für Minimalvergemeinschaftung zu sorgen, die dem Fahrzeugbesitzer das Gefühl vermittelt, sich richtig entschieden zu haben. Denken wir an die hohe Bedeutung der Logos gerade deutscher Autofirmen für das Kollektivgefühl der Nation, oder denken wir an die notorischen Kopfschmerzen des VW-Konzerns, der das Modell »Phaeton« deshalb nur mit Mühen unter die Leute brachte, weil sich das VW-Symbol gegenüber dem Wunsch nach Oberklassen-Distinktion immer wieder als sperrig erweist.
Vom Gesicht ausgehend, im Logo kommentiert, werden latent Weichen gestellt für die Markentreue und für Identifikation, die sich vom Gegenstand, dem Artefakt Auto, entfernen und auf weitreichende kulturelle Traditionen, im Unbewussten bis auf Vorstellungen über National- oder Arbeitsstolz, ausgreifen. Dem französischen Strukturalisten Roland Barthes verdanken wir den Vergleich des Autos mit den großen gotischen Kathedralen. Er greift auf das Bild einer großen »Schöpfung der Epoche, die mit Leidenschaft von unbekannten Künstlern erdacht wurde und die in ihrem Bild, wenn nicht überhaupt von einem ganzen Volk benutzt wird, das sich in ihr ein magisches Objekt zurüstet und aneignet«, zurück. Fragt man nach dem Medium dieses wahrhaft magischen Verhältnisses, dem Kristallisationspunkt der hohen kulturellen Bedeutung, so stößt man jenseits der technischen Funktion, die Raumdurchquerung zu beschleunigen, auf die Frontalität des Autos, auf sein Gesicht.
Resümierend ein Blick auf den historischen Wandel: Schaut man sich die Modelle an, die auf Oldtimertreffen vorgeführt werden, so fällt auf, dass im Outfit der Fahrzeuge die Dekoration überwiegt – die angesprochenen Teile, Scheinwerfer, Kühlergrill, Stoßstange werden nicht unter das Diktat technologischer Erfordernisse gestellt.
Unter dem Gebot der Anpassung an die Aerodynamik, das wiederum auf die Knappheit der Energieressourcen reagiert, die die Reduktion des Benzinverbrauchs zum obersten Gebot werden lässt, verschwindet seit einiger Zeit die markante Besonderheit des Autogesichts unter einer integralen ästhetischen Konzeption, die dem Fahrzeug das Kantige nimmt und es markenunabhängig geschmeidig werden lässt. Diesen Vorgang als einen gleichsam eigengesetzlichen Zwang zu deuten wäre schlechte Soziologie. Vielmehr unterliegt auch diese Inkorporierung früher einmal eigenständiger Teile in eine alles schluckende windschlüpfrige Schale einem ästhetischen Wandel, der durch kulturelle Dimensionen, durch Bedeutungszuschreibung vermittelt ist. Das Schicksal, das dem Auto hier widerfährt, lässt sich als Prätentionsverzicht bezeichnen. Folgt man einigen Zeitdeutungen, so kommt darin möglicherweise zum Ausdruck, dass das Auto seine Funktion als Statussymbol eingebüßt hat, zum fahrenden Arbeitsplatz avanciert und dabei in einer wesentlich kommunikationsmobilen Gesellschaft zunehmend symbolisch trivialisiert wird. Dies mag daran sichtbar werden, dass die Autofirmen, die in ihren Angeboten natürlich nach wie vor einem Distinktionszwang folgen, das Firmenlogo zunehmend grell und opulent in die Frontalität ihrer Modelle setzen. Verglichen mit früheren Autogesichtern, begegnen uns die Fahrzeuge der Gegenwart, die technologisch raffiniert den genannten Gestaltungszwängen gerecht werden, in veränderter Frontalität. Es ist das Blinzeln hinter der Schanze, in die sich das gut gepanzerte Fahrzeug verwandelt hat, die Scheinwerfer schrumpfen auf grelle Streifen zusammen, so als gelte es, mit dem Fahrzeug die Augen zuzukneifen. Das Design ist einheitlicher geworden, die frühere Unbekümmertheit gegenüber dem Luftwiderstand hat dem Gebot einer größeren Rücksicht auf die Knappheit der Ressourcen Platz gemacht. Unter dem übergreifend funktionalen Format scheinen es beinah nur die Gesichter vom Mini und dem Fiat 500 zu sein, die sich gegen die schwere Behäbigkeit der gepanzerten Limousinen behaupten, auffallen und – was im Einzelnen genauer zu erforschen wäre – natürlich vielen gefallen.
Wie die Kinder, die sich in riskanten Manövern unbekümmert und mit weiten, neugierigen statt verschlitzten Augen im Straßenverkehr tummeln. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass Archäologen und Kulturwissenschaftler, die dereinst in den Überresten der von uns zurückgelassenen Artefakte nach Bedeutung graben und in Forschungsprojekten über die Kulturbedeutsamkeit derartiger Technologien nachdenken werden, aus diesem Ensemble von Schwergewichtigkeit und quirliger Wendigkeit Schlüsse ziehen werden über die Raumwahrnehmung der Menschen hochmobiler Gesellschaften, über das Verhältnis von Vertrauen und Misstrauen in kontingenten Sozialsituationen wie dem Straßenverkehr.
Kommen wir vom Gesicht des Autos auf die Physiognomie der Fahrer. In seiner Abhandlung zur »Ästhetischen Bedeutung des Gesichts« heißt es bei dem Soziologen Georg Simmel: »Es gibt innerhalb der anschaulichen Welt kein Gebilde, das eine so große Mannigfaltigkeit an Formen und Flächen in eine so unbedingte Einheit des Sinnes zusammenfließen ließe, wie das menschliche Gesicht. Das Ideal menschlichen Zusammenwirkens: dass die äußerste Individualisierung der Elemente in eine äußere Einheit eingehe, die, aus den Elementen freilich bestehend, dennoch jenseits jedes einzelnen von ihnen und nur in ihrem Zusammenwirken liegt – diese fundamentale Formel des Lebens hat im Menschenantlitz ihre vollendetste Wirklichkeit innerhalb des Anschaulichen gewonnen.« Das Gesicht erscheint als der Schauplatz seelischer Prozesse und als ein Sinnbild einer unverwechselbaren Persönlichkeit, ja Einzigartigkeit, und dieses gesteigert dank der Tradition der Verhüllung des Leibes, die – wie Simmel ausführt – die ästhetische Privilegierung des Gesichts außerordentlich begünstigt. Der Sonderstellung des Gesichts kommt zweifellos der Umstand entgegen, dass wir mit der Symmetrie ein Gestaltungsmittel am Werk sehen, das gleichsam universal ist – genau genommen ist die Symmetrie der für das Gesicht grundlegenden Individualität gegenläufig: Es gibt zwei Gesichtshälften, die als solche in ihrer Verwiesenheit aufeinander eine Balance in die anschauliche Objektivation der Einzigartigkeit einführt, und, um Simmel noch einmal aufzugreifen, aus diesen Spannungselementen der Symmetrie und Besonderung entsteht die für die westliche Kultur bestimmende Idee, im Gesicht den »geometrischen Ort der inneren Persönlichkeit« zu verherrlichen – ungeachtet der symbolisch in der körperlichen Bewegung zum Ausdruck gebrachten Anmut des Gangs, der Bewegung von Armen und Beinen, des Schaukelns des Oberkörpers. Im Lichte einer derart herausgehobenen Stellung des menschlichen Gesichts erreicht das Gesicht des Autos natürlich nicht mehr als den Status eines allenfalls zur Ikone erstarrten Stils, in dem zeitgeistspezifische Darstellungsimpulse mit technologischen Erfordernissen kombiniert sind; angekündigte oder allenfalls demonstrative Individualität wäre das Äußerste, was man dem Gesicht des Autos zuschreiben würde. Wie in jeder Ausdrucksform menschlicher Sozialität ist es hingegen die Kommunikation, d.h. die Wechselwirkung der Akteure, das Geben und Nehmen im Sprechen, über das Individualität in ihrer Würde wechselseitig bewahrt wird. Um das zu genießen, muss man aussteigen.
Bas Kast
»Über die lebenslange Lust an der Neugier«
Kinder sind schöpferischer als Erwachsene – und umgekehrt
Folgende Geschichte wurde von dem britischen Pädagogen und Bildungsexperten Ken Robinson überliefert. Sie handelt von einem sechsjährigen Mädchen, das normalerweise dem Schulunterricht nicht viel Aufmerksamkeit schenkte. In der Zeichenstunde jedoch war dieses Mädchen ganz bei der Sache. Eines Tages saß es bereits seit mehr als 20 Minuten über ein Blatt Papier gebeugt, versunken in eine Zeichnung, vollkommen absorbiert von dem, was es tat. Irgendwann fragte die Lehrerin, was es denn da malen würde. »Ich male ein Bild von Gott«, sagte das Mädchen, ohne aufzusehen. Die Lehrerin staunte nicht schlecht und erwiderte: »Aber niemand weiß, wie Gott aussieht.« Woraufhin das Mädchen meinte: »Warten Sie einen Moment, gleich wissen Sie es.«[1]
Die Anekdote erinnert mich an jenes berühmte »Hummel-Paradox«. Das Paradox geht so: Eine durchschnittliche Hummel besitzt 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Den Gesetzen der Aerodynamik gemäß ist es angeblich unmöglich, bei diesem Zahlenverhältnis in die Luft abzuheben. Die Hummel weiß das nicht und fliegt trotzdem.
Die Hummel weiß nicht, was sie alles nicht kann. Sie fliegt einfach. Gerade weil Kinder noch nicht wissen, was alles nicht geht und was man nicht darf, malen sie spontan drauflos, wild, unbefangen, frei … sie malen Gott und die Welt, sie malen, erzählen und spielen jenseits aller die Kreativität einschränkenden Regeln und Konventionen.
Wie blass wir Erwachsenen dagegen aussehen! Haben Sie schon einmal Ihre Freunde oder Kollegen gefragt, ob sie sich für kreativ halten? Für gewöhnlich stößt man dabei auf verhaltene Reaktionen. Fragt man dann aber, wie das war, als sie noch ein Kind waren, sieht die Sache plötzlich ganz anders aus.
Jedes Kind ist ein Künstler, soll Picasso gesagt haben, die Herausforderung bestehe darin, ein Künstler zu bleiben, wenn man groß wird.[2] Und hatte Picasso nicht recht? Kinder sind so viel leichter für verrückte Ideen zu begeistern als Erwachsene. Kinder sind wahrscheinlich die neugierigsten Wesen, die es überhaupt gibt. Sie haben noch nicht gelernt, dass man unter Umständen als blöd gilt, wenn man naive Fragen stellt oder das Unmögliche versucht. Kinder sind für alles offen – nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die Phantasie, für das Neue und die Kreativität.
Viele halten es mit Picasso und haben das Gefühl, dass sie als Kind noch diese unverfälschte Frische und Originalität besaßen, die ihnen dann aber aberzogen wurde durch langweiligen Unterricht, stupides Auswendiglernen, durch eine systematische »Verschulung« ihres Gehirns. Womöglich also kommt es nicht darauf an, Kreativität explizit zu fördern, sondern darauf, die in uns angelegte Kreativität bloß nicht durch allzu viel Bildung zu ersticken? Schadet Wissen dem Einfallsreichtum? Wie verhalten sich Neugier und Lernen zueinander? Geht das eine zwangsläufig auf Kosten des anderen? Das ist das Thema dieses Kapitels.
Vorweg muss man eine wichtige Unterscheidung treffen: Das Originelle und das Kreative sind zwar eng verwandt, sie sind aber nicht identisch. Mag sein, dass ein Kind auf die Idee kommen kann, Gott zu malen, und es mag dabei auch etwas Ungewöhnliches herauskommen. Und doch hat noch nie ein Grundschullehrer beobachtet, wie einer seiner Schützlinge etwas zu Papier bringt, das auch nur im Entferntesten an Die Erschaffung Adams erinnert.
Klar, auch die allermeisten Erwachsenen sind nicht in der Lage, die Deckenfresken der Sixtinischen Kapelle zu malen. So leicht aber ist der Einwand nicht von der Hand zu weisen. Selbst Michelangelo musste ja erst mal erwachsen werden, um Die Erschaffung Adams hinzubekommen (er war Mitte 30, als er damit anfing, davor hatte er schon als Kind in Florenz »jede freie Minute« mit dem Zeichnen verbracht, hatte ständig den Umgang mit Malern gesucht, und als 13-jähriger Knabe war er, statt die Schulbank zu drücken, von dem Freskospezialisten Domenico Ghirlandaio im Malen unterrichtet worden[3]). Was also fehlte dem großen Michelangelo als kleiner Junge? Was hält Kinder, bei aller Originalität, die sie an den Tag legen, davon ab, kreative Meisterwerke zu schaffen?
Die Antwort klingt zunächst denkbar simpel, führt uns aber einen zentralen Aspekt dessen vor Augen, was Kreativität, vor allem hohe Kreativität, im Kern ausmacht. Außerdem gibt sie uns einen Hinweis darauf, warum kreative Meisterwerke etwas Seltenes sind: Für Kreativität müssen zwei Komponenten zusammenkommen, die sich üblicherweise nicht gut miteinander vertragen.
Was die erste Zutat betrifft, sind Kinder unschlagbar. Kinder sind an Originalität kaum zu überbieten. Sie haben diese durch und durch spielerische Art, auf die Welt zuzugehen. Ihre Phantasie kennt keine Grenzen. Was ihnen dagegen weitgehend fehlt – wohlgemerkt, für hohe Kreativität, wie sie generell definiert wird und wie ich den Begriff hier verwende –, ist jene zweite Komponente, die mit Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrung zu tun hat. Eine wahrhaft kreative Schöpfung ist eben nicht nur ungewöhnlich, neu oder originell.
Wer sich jeden Morgen, bevor er das Haus verlässt, einen siebeneckigen, mintgrünen Hut mit roten Sternchen auf den Kopf setzt, der beweist zweifellos eine Neigung zur Unkonventionalität. Wahrscheinlich handelt es sich bei der farbenfrohen Kopfbedeckung um etwas historisch Einmaliges, sie ist durchaus originell. Sie ist aber, folgt man der strengen Zweikomponentendefinition, nicht sonderlich kreativ. Anders ausgedrückt: Das fertige Gottesbild des sechsjährigen Mädchens will, von den Eltern abgesehen, die ganz vernarrt sind in das Kunstwerk, vermutlich niemand an die Wand hängen, es wird nie seinen Platz in einer angesehenen Galerie finden, nie versteigert werden oder in einem Katalog auftauchen. Dazu bedarf es einer gewissen Qualität, die man nur erreicht, indem man das jeweilige Handwerk lernt, was Jahre dauert.
Zahlreiche Beobachtungen und Studien[4] in diesem Zusammenhang sprechen für jene »Zehnjahresregel«, nach der man sich mehr oder weniger zehn Jahre in ein Feld vertiefen und ganz und gar damit vertraut werden muss, um es auf dem Gebiet, sei es nun Malerei, Mathematik oder Popmusik, zu einer kreativen Höchstleistung zu bringen. Um etwas objektiv Neues von Wert hervorzubringen, muss man sich ja unter anderem erst einmal einen Überblick darüber verschaffen, was es alles schon gibt und was nicht. Welche Stile sind längst durchgenudelt? Welche Fragen sind noch nicht gelöst, prinzipiell aber lösbar? Was liegt, mit dem derzeitigen Wissen und den derzeitigen Techniken, im Bereich des Möglichen, auch wenn sich bislang noch kaum jemand daran versucht hat?
Wer auf hohem Niveau schöpferisch tätig sein will, muss sich zum Experten machen, er muss seine Fähigkeiten ausbauen, trainieren, perfektionieren, und das braucht Zeit. Ein (zugegeben eher hochgegriffenes) Beispiel: Im Jahr 1895 stellte sich Albert Einstein als 16-jähriger Junge in einem Tagtraum vor, wie es sein würde, auf einem Lichtstrahl zu reiten. Und wann fand er eine für ihn einigermaßen zufriedenstellende Antwort? Richtig, im Jahr 1905, mit seiner speziellen Relativitätstheorie. Zehn Jahre später.[5]
Auf diese »Zehnjahresregel« stößt man beim Werdegang hochkreativer Menschen auffallend häufig, egal, ob man den Werdegang der Beatles, den von Weltklasseviolinistinnen oder internationalen Schachmeistern analysiert.[6] Die Zahl 10 ist dabei »nur« eine Durchschnittsziffer, eine grobe Richtschnur.[7] Das Entscheidende ist: Es gibt so gut wie keine Spitzenleistung, auch keine kreative, die ohne intensives Üben, einfach so, spontan hervorgebracht wurde. Wir mögen Kreativität mit kindlicher Spontanität in Verbindung bringen – gerade in ihrer höchsten Ausprägung jedoch ist sie letztlich stets das Resultat von langjähriger Arbeit.
Das Gesetz der Übung trifft sogar auf den Inbegriff des Kindergenies zu, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart hat bekanntermaßen schon als kleiner Junge mit dem Komponieren angefangen. Wie allerdings eine Analyse der Handschriften ergeben hat, stammen wohl viele dieser frühen Kompositionen teilweise oder vollständig vom Vater. Leopold Mozart übrigens war nicht nur selbst Komponist und lange Vizekapellmeister in Salzburg, sondern auch ein ehrgeiziger Musiklehrer und Verfasser eines Buchs mit dem Titel Gründliche Violinschule – eines der ersten Bücher zum Thema Violinunterricht überhaupt. Mozart hatte nun wahrlich ein Gespür für Noten, mindestens ebenso erstaunlich aber war, dass man ihn nicht zum Üben zwingen musste (dass er sich damit die Zuneigung seines Vaters erarbeitete, spielte freilich eine große Rolle). Schon mit drei, vier Jahren verbrachte er »endlose Stunden am Klavier«.[8] Das Klavier war sein Spielplatz, von dem man ihn abends wegzerren musste. Und doch, bei aller Begabung, Übung und dem wohl besten Privatunterricht, den man sich vorstellen kann: Als erstes eigenständiges Meisterwerk gilt, so manchem Experten zufolge, Mozarts Klavierkonzert Nr. 9 in Es-Dur, KV 271, auch »Jeunehomme« genannt. Mozart schrieb dieses Stück im Jahr 1777. Er war damals 21 Jahre alt.[9]
Um es zusammenzufassen: Eine schöpferische Leistung von »objektiv« hohem Wert ist unmöglich ohne mühsam eingeübte Fähigkeiten und ohne Ansammlung eines gehörigen Wissens- und Erfahrungsschatzes. Genau das ist die Zutat, die Kindern natürlicherweise fehlt.
Umgekehrt fehlt uns Erwachsenen meist ebenfalls etwas. Obwohl praktisch jeder von uns als Kind diese schöpferische Ader besitzt, gibt es am Ende nur eine Handvoll Michelangelos, Mozarts und Einsteins. Warum? Eigentlich müssten wir uns mit dem ganzen Üben und Lernen im Laufe unseres Lebens doch immer mehr den optimalen Voraussetzungen für kreative Höchstleistungen nähern? Gepaart mit unserer ursprünglichen Originalität, müssten wir als Erwachsene so gut wie alle, jedenfalls weit häufiger, als man in der Praxis beobachtet, zu Meisterwerken in der Lage sein. Warum ist das nicht der Fall? Wieso bleibt der Künstler in uns mit den Jahren auf der Strecke?
Eine Antwort ist: weil sich jene beiden ausschlaggebenden Zutaten, die für hohe Kreativität nötig sind, zueinander verhalten wie Wasser zu Feuer. Es sind Gegenspieler. Je mehr Wissen wir ansammeln, desto mehr wird unsere brennende Neugierde von ebendiesem erlangten Wissen gelöscht. Erwachsenwerden heißt aus dieser Sicht: zugleich wissender und fähiger und weniger hungrig werden. Die Erfahrungen, die wir machen, sättigen uns, wie eine Mahlzeit den Hunger stillt. Wer Bescheid weiß, muss die Welt nicht mehr erforschen, er muss nicht mehr experimentieren. Er kann sich auf seine bewährten Schemata verlassen.
Auch die Phantasie leidet: Als Kind füllen wir die unerklärliche Wirklichkeit noch an allen Ecken und Enden mit den wildesten Vorstellungen aus (so könnten die Dinge sein), aber an die Stelle von Phantasie treten Fakten (so sind die Dinge). Und das Sich-Wundern und Fragen nimmt allmählich ab oder hört ganz auf: Wer Antworten hat, muss sich nicht mehr wundern. Er muss nicht mehr andauernd naiv fragen, er ist nicht mehr naiv.
Doch selbst wenn dieser Entwicklungsverlauf typisch sein mag – es geht auch anders. Einstein hat einmal, nicht ohne die ihm eigene Ironie, versucht, das Geheimnis seiner Kreativität zu deuten. »Wenn ich mich frage, woher es kommt, dass gerade ich die Relativitätstheorie aufgestellt habe«, sagte Einstein, »so scheint es an folgendem Umstand zu liegen: Der normale Erwachsene denkt über die Raum-Zeit-Probleme kaum nach. Das hat er nach seiner Meinung bereits als Kind getan. Ich hingegen habe mich geistig derart langsam entwickelt, dass ich erst als Erwachsener anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern. Naturgemäß bin ich dann tiefer in die Problematik eingedrungen als die normal veranlagten Kinder.«[10]
Natürlich widerspricht man Albert Einstein ungern, es ist jedoch belegt, dass gerade er ein neugieriges Kind war, das sich mindestens ebenso wunderte wie alle anderen Kinder auch.[11] Vor allem gibt es keine ernstzunehmenden Anhaltspunkte dafür, dass er sich langsam entwickelt hätte. Entgegen einer hartnäckigen Legende zum Beispiel war Einstein kein Sitzenbleiber und Schulversager, er war, im Gegenteil, ein ausgezeichneter Schüler – dazu an dieser Stelle nur ein Satz seiner Mutter aus der Zeit, als Einstein sieben Jahre alt war: »Gestern bekam Albert seine Noten, er war wieder der Erste, er bekam ein glänzendes Zeugnis.«[12] Worauf Einstein somit augenzwinkernd hinzudeuten scheint, ist, dass sein Staunen auch beim Erwachsenwerden, beim Anhäufen von Wissen nicht nachließ. Er stellte als Erwachsener, als Experte weiterhin »naive« Fragen. In der Hinsicht blieb er zeitlebens ein Kind.
Da er aber ein erwachsenes Kind war, befand sich Einstein in einem grundlegenden Vorteil: Er misstraute den Antworten, die ihm die Welt gab. Er war in der Lage, die Antworten selbst herauszufinden. Er machte sich zum Experten, behielt dabei aber seine lebhafte Phantasie: Auch wenn die Fachwelt ihm sagte, die Dinge seien so und so, konnte er sie sich immer noch anders vorstellen – was nicht nur für sein Vorstellungsvermögen, sondern auch für ein beachtliches Zutrauen in die eigene Urteilskraft spricht.
Warum tickte Einstein so? Und warum geht es nicht jedem so? Wie kommt es, dass einige es schaffen, beim Lernen die kindliche Naivität, das kindliche Staunen nicht zu verlieren? Wie gelingt es manchen, das Beste von beiden Welten, von Kinder- und Erwachsenenwelt, zu vereinen? Wie könnte man Wissen und Fähigkeiten ansammeln und neugierig und spielerisch bleiben? Kurz: Wie könnte man jene ursprüngliche Originalität beim Großwerden beibehalten?
Wie wir sehen werden, haben dauerhafte Neugierde, Experimentierfreude und Offenheit zwar vielleicht nicht ausschließlich, aber wahrscheinlich maßgeblich auch damit zu tun, wie man uns die erforderlichen Fähigkeiten und das nötige Wissen als Kind, Jugendlicher und auch später noch als Erwachsener vermittelt – egal, ob in oder außerhalb der Schule.
Vom Schüler zum Entdecker: Weniger Pädagogik ist mehr
Wie weckt man den Entdeckergeist eines Kindes? Oder besser gesagt, wie sorgt man dafür, dass dieser nicht vorzeitig verlorengeht? Eine erste aufschlussreiche Erkenntnis dazu ist folgende: Eine Prise weniger Pädagogik bewirkt oft mehr. Ich sage das nicht, um zu provozieren, und schon gar nicht, um mich hier an jenem beliebten Volkssport namens Lehrer-Bashing zu beteiligen, sondern einzig und allein aus dem Grund, weil es dafür einige neue, überzeugende Befunde gibt.
Einer dieser Befunde stammt aus einem Forschungslabor des Massachusetts Institute of Technology (MIT) im amerikanischen Cambridge. Dort haben die Kognitionsexpertin Laura Schulz, ihre Studentin Elizabeth Bonawitz und deren Kollegen kürzlich einen einfachen und doch eindrucksvollen Versuch mit einer Gruppe von über 80 Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren gemacht.
Das Experiment, das in einer ruhigen Ecke eines Wissenschaftsmuseums stattfand, ging so: Die Kinder bekamen ein eigens für den Versuch gebasteltes Spielzeug angeboten, das aus vier bunten Plastikröhren bestand. Jedes Rohr barg, wie ein kleines Geschenk, eine Überraschung. Ein gelbes Rohr etwa gab, sobald man daran zog, ein Geräusch von sich. In einem anderen Rohr war ein Spiegel versteckt, im nächsten befand sich ein Lichtschalter usw. Das Spielzeug verfügte also über lauter Eigenschaften oder Funktionen, die man entdecken konnte – oder auch nicht.
Wie so oft gab es, bevor es zum eigentlichen Test kam, unterschiedliche Aufwärmbedingungen. Eine Kindergruppe bekam das Spielzeug nach guter alter Pädagogikmanier präsentiert. Die Versuchsleiterin zeigte dem Kind das Spielzeug und sagte: »Schau dir mein Spielzeug an. Ich zeig dir jetzt, wie mein Spielzeug funktioniert. Pass auf!« Und dann zog sie an dem gelben Rohr, und das Spielzeug gab ein Geräusch von sich. »Wow, siehst du?«, sagte die Versuchsleiterin dann. »So funktioniert mein Spielzeug!«
In einer anderen (der »naiven«) Versuchsvariante spielte die Leiterin die Unwissende und sagte: »Ich hab hier gerade ein Spielzeug gefunden. Siehst du?« Auch jetzt zog sie an dem gelben Rohr, aber so, als sei es ein Versehen, und als dann das Geräusch ertönte, tat sie, als sei sie völlig überrascht: »Oh!«, rief sie aus. »Hast du das gehört?«
Anschließend bekamen alle Kinder das Spielzeug in die Hand gedrückt, und die Wissenschaftler beobachteten, wie sich die Kinder verhielten. Sie filmten die Kleinen sogar, um die Videoaufnahmen später von zwei unabhängigen Beobachtern auswerten zu lassen.
Alle Kinder, zeigte diese Auswertung, spielten munter drauflos. Alle zogen natürlich erst mal an dem gelben Rohr, um die lustigen Geräusche hervorzubringen. So weit, so gut.
Nach und nach jedoch offenbarten sich einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Kindern. Jene aus der zweiten, »naiven« Gruppe beschäftigten sich nicht nur deutlich länger mit dem Spielzeug – sie entdeckten dabei auch mehr von dessen Eigenschaften. Es war, als hätte die pädagogische Einführung den Erkundungsdrang der Kinder gehemmt, während die Kinder der naiven Versuchsvariante sich erheblich neugieriger und experimentierfreudiger verhielten. Die Folge war, dass sie mehr Funktionen des Spielzeugs aufspürten.
Die Forscher erklären sich das überraschende Phänomen folgendermaßen. Kinder, behaupten sie, sind rationalere Wesen, als wir meinen. Wenn ich ein Kind bin und einen Erwachsenen beobachte, der sich wie ein Lehrer benimmt, wie jemand, der Bescheid weiß, dann nehme ich automatisch die