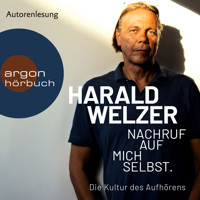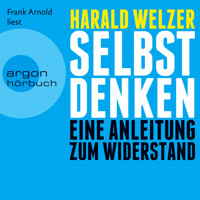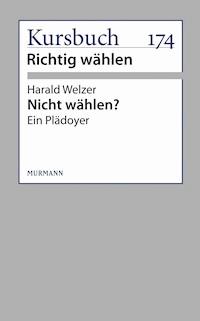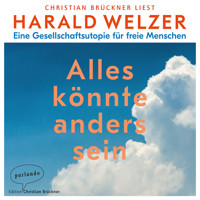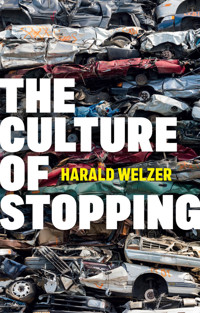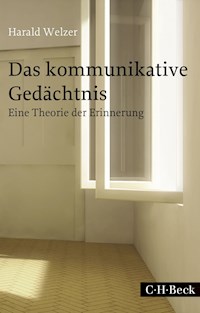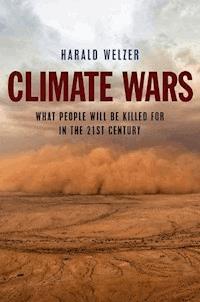9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Kampf um Trinkwasser, Massengewalt, ethnische "Säuberungen, Bürgerkriege und endlose Flüchtlingsströme bestimmen schon jetzt die Gegenwart. Die heutigen Konflikte drehen sich nicht mehr um Ideologie und Systemkonkurrenz, sondern um Klassen-, Glaubens- und vor allem Ressourcenfragen. Der Autor plädiert für ein neues Denken und zeigt, was jetzt getan werden müsste, um Menschheitskatastrophen abzuwenden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Ähnliche
Harald Welzer
Klimakriege
Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird
Sachbuch
FISCHER E-Books
Ein Schiff in der Wüste. Die Vergangenheit und die Zukunft der Gewalt
»Ein leises Klirren hinter mir ließ mich den Kopf drehen. Sechs Schwarze gingen hintereinander und quälten sich den Pfad hinauf. Sie schritten aufrecht und langsam, balancierten kleine Körbe mit Erde auf dem Kopf, und das Klirren begleitete jeden Schritt. [...] Ich konnte ihre Rippen zählen, die Gelenke ihrer Glieder waren wie Knoten in einem Strick; jeder trug ein Halseisen, und alle waren mit einer Kette verbunden, deren gleichmäßig klirrende Glieder zwischen ihnen hingen.« Diese Szene, die Joseph Conrad in seinem Roman »Herz der Finsternis« beschreibt, spielt zur Blütezeit des europäischen Kolonialismus, von heute aus gesehen vor etwas mehr als hundert Jahren.
Die gnadenlose Brutalität, mit der die frühindustrialisierten Länder damals ihren Hunger nach Rohstoffen, nach Land und nach Macht zu befriedigen suchten und die den Kontinenten ihre Signatur aufprägte, ist den heutigen Verhältnissen in den westlichen Ländern nicht mehr abzulesen. Die Erinnerung an Ausbeutung, Sklaverei und Vernichtung ist einer demokratischen Amnesie zum Opfer gefallen, als seien die Staaten des Westens immer schon so gewesen wie jetzt, obwohl ihr Reichtum wie ihr Machtvorsprung auf eine mörderische Geschichte gebaut ist.
Stattdessen ist man stolz auf die Erfindung, Einhaltung und Verteidigung der Menschenrechte, praktiziert political correctness, engagiert sich humanitär, wenn irgendwo in Afrika oder Asien ein Bürgerkrieg, eine Überschwemmung oder eine Dürre den Menschen die Überlebensgrundlage nimmt. Man beschließt militärische Interventionen, um die Demokratie zu verbreiten und übersieht dabei, dass die meisten westlichen Demokratien auf einer Geschichte von Ausgrenzung, ethnischer Säuberung und Völkermord beruhen. Während sich die asymmetrische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in den Luxus der Lebensumstände in den westlichen Gesellschaften eingeschrieben hat, tragen viele Länder der zweiten und dritten Welt schwer an der Geschichte, die sie damals mit Gewalt überkam: Nicht wenige postkoloniale Länder haben es niemals zu stabiler Staatlichkeit, geschweige denn zu Wohlstand gebracht; in vielen Staaten wurde die Ausbeutungsgeschichte unter veränderten Vorzeichen fortgeschrieben, und in zahlreichen fragilen Gesellschaften stehen heute die Zeichen nicht auf Besserung, sondern auf weiteren Abstieg.
Die Klimaerwärmung, ein Ergebnis des unstillbaren Hungers nach fossiler Energie in den frühindustrialisierten Ländern, trifft die ärmsten Regionen der Welt am härtesten; eine bittere Ironie, die jeder Erwartung Hohn spricht, dass das Leben gerecht sei. Der Umschlag dieses Buches zeigt den Postdampfer »Eduard Bohlen«, dessen Überreste seit fast hundert Jahren in der namibischen Wüste vom Sand bedeckt werden. Er spielt eine kleine Rolle in der Geschichte der großen Ungerechtigkeit. Das Schiff ist am 5.September 1909 im Nebel auf Grund gelaufen, vor der Küste des Landes, das damals Deutsch-Südwestafrika hieß. Heute liegt das Wrack zweihundert Meter landeinwärts; die Wüste hat sich immer weiter ins Meer vorgearbeitet. Die »Eduard Bohlen« fuhr für die hamburgische Woermann-Linie seit 1891 als Postschiff regelmäßig Deutsch-Südwestafrika an. Während des Vernichtungskriegs der deutschen Kolonialverwaltung gegen die Herero und die Nama wurde es zum Sklavenschiff.
In diesem völkermörderischen Krieg, dem ersten des 20. Jahrhunderts, fand nicht nur ein großer Teil der einheimischen Bevölkerung Südwestafrikas den Tod; es wurden auch Konzentrations und Arbeitslager eingerichtet, und Kriegsgefangene verkaufte man als Sklavenarbeiter. Gleich zu Beginn des Krieges bot die deutsche Kolonialverwaltung dem südafrikanischen Händler Hewitt 282 Gefangene an, die man mangels besserer Unterbringungsmöglichkeiten an Bord der »Eduard Bohlen« gebracht hatte, und von denen man nicht recht wusste, was man mit ihnen anfangen sollte, solange die Hereros noch nicht besiegt waren. Hewitt war begeistert über diese Gelegenheit und drückte den Preis von 20 Mark pro Kopf mit dem zutreffenden Argument, dass die Männer ja ohnehin schon auf See seien und er nicht bereit sei, für bereits abgefertigte Ware den normalen Preis und den regulären Zoll zu bezahlen. Er bekam die Gefangenen günstiger, und die »Eduard Bohlen« verließ am 20.Januar 1904 Swakopmund mit Ziel Kapstadt, wo die Männer in den Minen arbeiten mussten. [1]
Die Herero hatten den Krieg gegen die deutsche Kolonialherrschaft in der Nacht vom 11. auf den 12.Januar 1904 begonnen, eine Bahnlinie und mehrere Telegrafenleitungen zerstört und 123 deutsche Männer bei Überfällen auf Farmen getötet. [2]Nach erfolglosen Verhandlungen zur Beilegung der Kämpfe übertrug die Reichsregierung in Berlin Generalleutnant Lothar von Trotha das Kommando der deutschen Schutztruppe. Von Trotha verfolgte von vornherein das Konzept eines Vernichtungskrieges, weshalb er die Herero nicht nur militärisch zu bekämpfen versuchte, sondern sie nach einer Feldschlacht in die Omaheke-Wüste abdrängte, dort die Wasserstellen besetzte und seine Gegner einfach verdursten ließ. [3]Diese Strategie war so erfolgreich wie grausam; es wird berichtet, dass die Verdurstenden ihrem Vieh die Kehlen durchschnitten, um das Blut zu trinken und schließlich die letzten Reste Feuchtigkeit aus den Gedärmen pressten, um an Flüssigkeit zu kommen. Sie starben trotzdem. [4]
Der Krieg ging auch weiter, nachdem die Herero vernichtet waren: Die Nama, ein anderer Stamm, sollten, wo die deutschen Truppen schon einmal da waren, entwaffnet und unterworfen werden. Die Nama ließen sich anders als die Herero auf keine offene Schlacht ein, sondern verlegten sich auf einen Guerillakrieg, der die Schutztruppe vor gewaltige Probleme stellte und zu Maßnahmen greifen ließ, die noch öfter im mörderischen 20. Jahrhundert Anwendung finden sollten: Um den Kämpfern den Rückhalt zu nehmen, ermordeten die Deutschen die Frauen und Kinder der Nama oder steckten sie in Konzentrationslager.
Gewalt findet unter Handlungsdruck statt und fordert Erfolge. Bleiben diese aus, werden neue Gewaltmittel ersonnen, die immer wieder angewendet werden, wenn sie sich als effizient erwiesen haben. Und Gewalt ist innovativ; sie schafft neue Mittel und neue Verhältnisse. Die deutsche Schutztruppe konnte die Nama trotzdem erst nach mehr als drei Jahren schlagen. Die Konzentrationslager standen übrigens nicht alle unter staatlicher Aufsicht; auch private Unternehmen wie die Woermann-Linie unterhielten eigene Zwangsarbeitslager. [5]
Dieser Vernichtungskrieg war nicht nur ein Beispiel für die Gnadenlosigkeit der kolonialen Gewalt, sondern eine Blaupause für künftige Völkermorde – mit seiner Absicht der totalen Ausrottung, mit den Lagern, mit der Strategie der Vernichtung durch Arbeit. Das alles konnte damals noch als Erfolgsgeschichte erzählt werden; die Kriegsgeschichtliche Abteilung I des Großen Generalstabs berichtete 1907 stolz, dass »keine Mühen, keine Entbehrungen« gescheut wurden, »um dem Feinde den letzten Rest seiner Widerstandskraft zu rauben; wie ein halb zu Tod gehetztes Wild war er von Wasserstelle zu Wasserstelle gescheucht, bis er schließlich willenlos ein Opfer der Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten: die Vernichtung des Hererovolkes.« [6]Das ist hundert Jahre her; seitdem haben sich die Formen der Gewalt geändert, noch mehr aber die Art und Weise, in der über sie gesprochen wird. Der Westen übt nur noch in Ausnahmefällen direkte Gewalt gegen andere Staaten aus; Kriege sind heute Unternehmungen mit langen Handlungsketten und vielen Akteuren, Gewalt wird delegiert, umgeformt, unsichtbar. Die Kriege des 21. Jahrhunderts sind postheroisch und sehen aus, als würden sie wider Willen geführt. Und mit Stolz über die Vernichtung von Völkern zu sprechen – das ist seit dem Holocaust unmöglich geworden.
Die »Eduard Bohlen« rostet heute im Sand dahin, und vielleicht wird einmal das ganze westliche Gesellschaftsmodell mit all seinen Errungenschaften von Demokratie, Freiheitsrechten, Liberalität, Kunst und Kultur aus der Sicht eines Historikers des 22. Jahrhunderts als so deplatziert gestrandet erscheinen wie das nun in der Wüste schwimmende Sklavenschiff, ein eigentümlicher Fremdkörper aus einer anderen Welt. Falls es im 22. Jahrhundert noch Historiker geben sollte.
Dieses Gesellschaftsmodell, so gnadenlos erfolgreich es ein Vierteljahrtausend lang war, kommt nun, in dem Augenblick, wo sein Siegeszug global wird und selbst kommunistische und gerade noch kommunistisch gewesene Länder in den Attraktionsrausch eines Lebensstandards mit Auto, flat-screen und Fernreise gezogen hat, an eine Grenze seines Funktionierens, mit der in dieser Konsequenz kaum jemand gerechnet hätte. Die Emissionen, die der Energiehunger der Industrie- und immer mehr auch der Schwellenländer produziert, drohen das Klima aus dem Takt zu bringen. Die Folgen sind jetzt schon sichtbar, für die Zukunft aber unabsehbar; gewiss ist nur, dass die schrankenlose Vernutzung fossiler Energie nicht endlos weitergehen kann, und dass dieses Ende nicht, wie lange Zeit angenommen, vom Versiegen der Ressourcen diktiert ist, sondern von der Unbeherrschbarkeit der Folgen ihres Verbrennens.
Aber nicht nur, weil die Klimawirkungen der emittierten Schadstoffe ab einem Schwellenwert der Erwärmung um etwa zwei Grad nicht mehr kontrollierbar sein werden, kommt das westliche Modell an seine Grenze, sondern auch, weil eine globalisierte Wirtschaftsform, die auf Wachstum und Ausbeutung von Naturressourcen setzt, als weltweites Prinzip nicht funktionieren kann. Denn logisch funktioniert sie nur dann, wenn Macht sich an einer Stelle der Welt akkumuliert und an einer anderen Stelle angewendet wird; ihr Wesen ist partikularistisch, nicht universal – nicht alle können sich gegenseitig ausbeuten. Da die Astronomie noch keine kolonisierbaren Planeten in Reichweite anbieten kann, kommt man um die ernüchternde Feststellung nicht herum, dass die Erde eine Insel ist. Man kann nicht weiterziehen, wenn das Land abgegrast und die Rohstoff-Felder abgebaut sind.
Da nun aber die Überlebensressourcen schwinden, zumindest in manchen Regionen Afrikas, Asiens, Osteuropas, Südamerikas, der Arktis und der Inselstaaten im Pazifik, wird das Problem auftreten, dass immer mehr Menschen immer weniger Grundlagen zur Sicherung ihres Überlebens vorfinden. Es liegt auf der Hand, dass dies zu Gewaltkonflikten zwischen denen führt, die sich von ein- und demselben Stück Land ernähren oder aus derselben verrinnenden Wasserquelle trinken wollen, und genauso liegt es auf der Hand, dass man in absehbarer Zeit Umwelt- und Kriegsflüchtlinge nicht mehr sinnvoll voneinander unterscheiden können wird, weil neue Kriege umweltbedingt entstehen und Menschen vor der Gewalt fliehen. Da sie irgendwo bleiben müssen, entwickeln sich weitere Gewaltquellen – in den Ländern selbst, in denen man nicht weiß, wo man hin soll mit den Binnenflüchtlingen, oder an den Grenzen der Länder, in die sie hineinwollen, wo man sie aber auf keinen Fall haben möchte.
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie Klima und Gewalt zusammenhängen. In einigen Fällen, wie beim Krieg im Sudan, ist dieser Zusammenhang direkt, geradezu mit Händen zu greifen. In vielen anderen Kontexten heutiger und künftiger Gewalt – in Bürger- und Dauerkriegen, im Terror, in illegaler Migration, in Grenzkonflikten, in Unruhen und Aufständen – besteht die Verbindung zwischen Klimawirkungen und Umweltkonflikten nur indirekt und vor allem in der Weise, dass die Klimaerwärmung die globalen Ungleichheiten in den Lebenslagen und Überlebensbedingungen vertieft, weil sie die Gesellschaften sehr unterschiedlich trifft.
Aber ganz gleich, ob Klimakriege eine direkte oder indirekte Form dessen sind, wie Konflikte im 21. Jahrhundert gelöst werden – die Gewalt hat in diesem Jahrhundert eine große Zukunft. Es wird nicht nur Massenmigrationen sehen, sondern gewaltsame Lösungen von Flüchtlingsproblemen, nicht nur Spannungen um Wasser- oder Abbaurechte, sondern Ressourcenkriege, nicht nur Religionskonflikte, sondern Überzeugungskriege. Ein zentrales Merkmal der Gewalt, wie sie vom Westen ausgeübt wird, besteht im Bemühen darum, diese so weit irgend möglich zu delegieren – an private Sicherheits- und Gewaltunternehmen oder im Fall der Grenzsicherung dadurch, dass die Grenzen nach außerhalb, in wirtschaftlich und politisch abhängige Länder verlegt werden. Auch die sicherheitspolitischen Bemühungen, Täter schon dingfest zu machen, bevor sie Taten begangen haben, also die Vorverlagerung von Tatbeständen, gehört in diesen Prozess der wachsenden Indirektheit von Gewalthandeln. Während der Westen nicht nur zum direkten Mittel des Krieges wie in Afghanistan und im Irak greift, sondern Gewalt bevorzugt auslagert und indirekt macht, lassen sich in anderen Ländern Gesellschaftszustände beschreiben, in denen Gewalt permanent und zur zentralen Bedingung wird, unter der Menschen ihr Leben zu fristen versuchen. All dies ist Ausdruck jener Asymmetrie, die vor 250 Jahren weltgeschichtlich bestimmend geworden ist, sich bis heute fortschreibt und durch die Klimaerwärmung vertieft wird.
Es wäre wenig ergiebig, eine Untersuchung über künftige Kriege und Gewaltkonflikte rein prognostisch anlegen zu wollen, weil sich soziale Prozesse nicht linear entwickeln – man kann heute nicht wissen, welche Wanderungen das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien in Gang setzen oder welche Gewalt die Überflutung einer Megacity oder eines ganzen Landes auslösen wird. Und noch weniger kann man wissen, wie Menschen auf künftige gefühlte Bedrohungen reagieren und welche Folgen wiederum diese Reaktionen auslösen werden. Das gilt übrigens für die naturwissenschaftlichen Ansätze, den Klimawandel und seine Folgen zu verstehen, ebenso: Es wird allzu leicht übersehen, dass die argumentative Basis der Klimaforscher in der Regel eine historische ist. Sie rechnen nämlich Veränderungsprozesse hoch, die bereits nachweisbar stattgefunden haben, etwa wenn sie Kohlendioxidkonzentrationen in der Luft oder im Wasser in Eis- oder Gesteinsschichten messen, deren Alter man exakt bestimmen kann.
Die Zukunftsszenarien, die öffentliche Beunruhigung hervorrufen, beruhen also auf Daten aus der Vergangenheit, und ganz ähnlich wird in diesem Buch weniger über mögliche Zukünfte spekuliert, als darüber berichtet, wie und wofür Gewalt in der Vergangenheit ausgetragen wurde und in der Gegenwart ausgeübt wird, um ermessen zu können, welche Zukunft die Gewalt im 21. Jahrhundert hat. Da Gewalt immer eine Option menschlichen Handelns ist, ist es unausweichlich, dass gewaltsame Lösungen auch für Probleme gefunden werden, die auf sich verändernde Umweltbedingungen zurückgehen.
Deshalb finden sich auf den folgenden Seiten nicht nur Darstellungen von Klimakriegen, sondern auch Untersuchungen darüber, wie sich Menschen im Rahmen von Kriegen zum Töten entscheiden oder darüber, wie sich die Wahrnehmung von Umwelten verändert – weil nicht die objektiven Bedingungen einer Situation darüber entscheiden, wie sich Menschen verhalten, sondern die Art und Weise, wie sie diese Bedingungen wahrnehmen und deuten. In diesen Zusammenhang gehören auch Fragen wie die, warum sich Menschen dazu entschließen, zu Selbstmordterroristen zu werden, warum es Kriege gibt, an deren Beendigung niemand interessiert ist, oder warum immer mehr Menschen dazu bereit sind, ihre Freiheitsrechte gegen Sicherheitsversprechen einzutauschen.
Das Buch gliedert sich grob in eine Darstellung des Problems, dass gefühlte Probleme dann auf Lösungen dringen, wenn sie als bedrohlich wahrgenommen werden, anschließend in drei Untersuchungen zum Töten von gestern, heute und morgen und schließlich in eine Beschreibung von shifting baselines, also des faszinierenden Phänomens, dass Menschen sich mit ihrer Umwelt in ihren Wahrnehmungen und Werten verändern, ohne das selbst zu bemerken.
Die abschließende Frage eines solchen Buches lautet natürlich, was getan werden kann, um das Schlimmste zu verhindern, oder – pathetischer gesagt – um praktische Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Das erste Schlusskapitel beschäftigt sich daher mit Möglichkeiten eines kulturellen Wandels, der einen Auszug aus der tödlichen Logik von unaufhörlichem Wachstum und grenzenlosem Konsum erlaubt, ohne dass man das als Verzicht empfinden müsste. Optimisten sollten am Ende dieses Kapitels die Lektüre beenden und sich überlegen, was sie mit dem Konzept einer guten Gesellschaft anfangen wollen, das hier entwickelt wird.
Denn es folgt noch ein zweites Schlusskapitel, und das stellt die dunkle Perspektive dar, die meiner Einschätzung entspricht, wie die Sache mit dem Klimawandel ausgehen wird: nicht gut. Seine Folgen werden nicht nur die Welt verändern und andere Verhältnisse etablieren, als man bislang kannte, sie werden auch das Ende der Aufklärung und ihrer Vorstellung von Freiheit sein. Aber es gibt Bücher, die schreibt man in der Hoffnung, dass man Unrecht hat.
Klimakonflikte
Der Westen I
Im Jahr 2005 ist eine »Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union« ins Leben gerufen worden. Hinter diesem sperrigen und bürokratisch klingenden Namen verbirgt sich eine höchst dynamische Institution, die die Überwachung der Außengrenzen der EU schlagkräftiger und effizienter machen soll. Dafür beschäftigt sie derzeit etwa einhundert Mitarbeiter und plant einen Einsatzpool von circa fünf- bis sechshundert mobil einsetzbaren Grenzpolizisten, die aus den Mitgliedstaaten kommen und – dies ist ein rechtliches Novum – auch außerhalb dieser Staaten grenzpolizeiliche Aufgaben übernehmen sollen. Die Agentur verfügt gegenwärtig über zwanzig Flugzeuge, dreißig Hubschrauber und mehr als hundert Schiffe, daneben über ausgefeilte technische Ausrüstung wie Nachtsichtgeräte, Laptops etc.
Da der offizielle Name offenbar zu unhandlich ist, hat man sich auf ein eingängiges Kürzel verständigt: Nach dem französischen »frontieres exterieures« heißt das Ganze jetzt sprechend »Frontex«, und es ist nicht auszuschließen, dass dieser Name programmatisch ist. Frontex arbeitet eng mit anderen Behörden wie EUROPOL zusammen, berät die örtlichen Grenzpolizeien an den Brennpunkten illegaler Migration und hilft, wie es heißt, »den Mitgliedstaaten bei der Durchführung von gemeinsamen Rückführungsmaßnahmen gegenüber ausreisepflichtigen Drittstaatsangehörigen«. [7]Ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige sind Personen, die kein Asyl bekommen und wieder in ihre Herkunftsländer zurücktransportiert bzw., im offiziellen Sprachgebrauch, »repatriiert« werden, nachdem sie auf irgendeine Weise ein EU-Land bzw. eines der in das Schengener Abkommen einbezogenen Länder [8]erreicht hatten.
Das am 26.März 1995 in Kraft getretene Schengener Abkommen hat das Sicherungsproblem der Grenzen der Mitgliedsländer an die Außenränder Europas gelegt. Während innerhalb des Schengen-Raums Freizügigkeit herrscht, also Verzicht auf Grenzkontrollen etwa bei der Reise von Deutschland nach Holland oder Österreich, verlangt eine »Herkunftsstaatenregelung« von Asylbewerbern den Nachweis einer politischen Verfolgung, sofern sie aus als »sicher« eingestuften Ländern kommen; die »Drittstaatenregelung« sorgt hingegen dafür, dass Personen, die es geschafft haben, beispielsweise aus Sierra Leone in das spanische Andalusien zu gelangen und sich von dort nach Deutschland durchzuschlagen, von hier aus wieder umstandslos nach Spanien zurückgeschickt werden und in Deutschland niemals mehr einen Asylantrag stellen können. Dass diese Regelung den Druck auf die spanischen und portugiesischen, aber auch auf osteuropäische Grenzen erheblich erhöht hat, während die Bewerbungen um Asyl in Deutschland auf ein Viertel des Niveaus von 1995 abgesunken sind, ist nicht verwunderlich. Gerade daraus ergibt sich aber auf EU-Ebene die Frage, wie angesichts der schon gegenwärtig, künftig aber wegen des Klimawandels noch erheblich schneller anwachsenden Flüchtlingszahlen die europäischen Außengrenzen der EU wirksamer geschützt werden können, als es im Augenblick der Fall ist.
Deshalb wurde Frontex auf dem Verordnungswege eingerichtet und hat offenbar schon erste Erfolge zu verzeichnen – etwa in Gestalt eines erheblichen Rückgangs der auf den Kanarischen Inseln anlandenden Flüchtlingsboote. Die Flüchtlinge wiederum, die – meist in Schlauchbooten – 1200 Kilometer über das offene Meer aus Westafrika nach Gran Canaria oder Teneriffa fahren, sind Personen, die aus Ländern kommen, in denen Bedingungen herrschen, die ein Überleben nahezu unmöglich machen. Sie wurden wegen Staudammprojekten umgesiedelt, sind vor Bürgerkriegen geflohen und in Lagern oder Megastädten wie Lagos gelandet, wo drei Millionen Menschen in Slums leben und wo es weder Frischwasser noch Kanalisation gibt. Sie kaufen sich für nach ihren Verhältnissen exorbitante Summen bei so genannten Schleppern ein und bekommen einen Platz auf einem jener überfüllten, meist nicht seetüchtigen Boote, ohne Rückfahrschein, aber mit hohem Risiko, die Reise nicht zu überstehen. [9]Immerhin 30 000 haben es im Jahr 2006 lebend auf die Kanaren geschafft, was die dortigen Sicherheitsbehörden und nicht zuletzt auch die Tourismusindustrie vor beträchtliche Probleme stellt.
Andere Flüchtlinge nehmen die zwar nur 13 Kilometer lange Strecke über die Meerenge von Gibraltar, die aber wegen der dort herrschenden Strömungsverhältnisse und des dichten Schiffsverkehrs nicht minder gefährlich ist. Entsprechend erreicht eine große Zahl der Flüchtlinge die gegenüberliegenden Ufer Spaniens oder Portugals nicht, von wo aus sie aber in der Regel ohnehin zurückgeschickt würden; Schätzungen gehen davon aus, dass allein im Jahr 2006 ungefähr 3000 Personen unterwegs ertrunken sind. Das erwähnt auch Frontex, das gerade in der Vermeidung »der unter lebensbedrohenden Umständen erfolgenden illegalen Einreiseversuche« ein wichtiges Anliegen hat. [10]
Da man den Flüchtlingen ihre Motive, Europa um jeden Preis erreichen zu wollen, nicht nehmen kann und sie, je effektiver Frontex arbeiten wird, auf desto gefährlichere Routen ausweichen werden, läge die ideale Form der Grenzsicherung natürlich darin, die EU-Außengrenzen nach Afrika zu verlegen, um die Flüchtlinge von vornherein daran zu hindern, den Kontinent zu verlassen. Schon im Oktober 2004 hatte der damalige Bundesinnenminister Otto Schily den Vorschlag gemacht, in Afrika Auffanglager einzurichten und gleich an Ort und Stelle zu prüfen, ob ein Asylanspruch bestehe oder nicht. [11]Diese Idee erzeugte bei den meisten anderen Innenministern der EU erhebliches Unbehagen und stieß zugleich auf heftige Proteste von Menschenrechtsorganisationen. Die Suche nach anderen Lösungen und die entsprechenden Verhandlungen mit der Afrikanischen Union gestalten sich bis heute noch zäh, sodass zu einer verschärften Grenzsicherung gegenwärtig keine Alternativen bestehen, wenn man diese Leute nicht nach Europa hereinlassen will. Die Lage in den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla versinnbildlicht das Problem geradezu, indem die Grenzanlagen beständig verstärkt und erhöht werden, während die Flüchtlinge immer verzweifelter Mittel ersinnen, um über die Zäune zu klettern – etwa in Form eines Massenansturms wie im September 2005, als etwa 800 Personen gleichzeitig die Grenze zu stürmen versuchten.
Mittelfristig wird den bedrängten Ländern innovative Technik Entlastung verschaffen – so wie an der amerikanischen Grenze zu Mexiko, wo gegenwärtig ein zwei Milliarden Dollar teures Barrieresystem geplant wird, das unter anderem erlaubt, die Positionen potenzieller Grenzverletzer per GPS zu ermitteln und via live stream an die Laptops der am nächsten patroullierenden Grenzpolizisten weiterzuleiten. Man erwartet, dass die Zahl der illegalen Grenzübergänger dadurch drastisch reduziert werden kann. Im Jahr 2006 wurden 1,1 Millionen Personen an dieser Grenze verhaftet. Das US-Repräsentantenhaus hat im September 2006 dem Plan zugestimmt, einen 1125 Kilometer langen Hightech-Zaun zu errichten, der die erwähnten Sicherungsfunktionen unterstützt. Die Grenze ist zwar insgesamt 3360 Kilometer lang, aber man geht davon aus, dass die Maßnahmen viele potenzielle Grenzverletzer abschrecken werden, denn das verbleibende Gelände ist kaum begehbar, da es entweder aus Wüsten- oder aus Bergland besteht; der kürzeste Fußmarsch beträgt 80 Kilometer. Zwischen 1998 und 2004 sind an dieser Grenze 1954 Personen gestorben.
Amerika und Europa werden sich künftig wirksamer schützen müssen vor dem Ansturm der befürchteten Millionen von Flüchtlingen, die wegen des Klimawandels zu erwarten sind – Hunger, Wasserprobleme, Kriege und Verwüstungen werden für einen kaum abschätzbaren Druck auf die Grenzen der Wohlstandsinseln Westeuropa und Nordamerika sorgen. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass »aktuell 1,1 Milliarden Menschen über keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser in ausreichender Menge und Qualität verfügen. Diese Situation«, heißt es weiter, könne »sich in einigen Regionen der Welt weiter verschärfen, weil es durch den Klimawandel zu größeren Schwankungen in den Niederschlägen und der Wasserverfügbarkeit kommen dürfte«. [12]
Zudem seien weltweit 850 Millionen Menschen unterernährt, eine Zahl, die aus Sicht des Gutachtens infolge des Klimawandels ebenfalls erheblich ansteigen kann, weil die zu bewirtschaftenden Anbauflächen kleiner werden. Die daraus resultierenden internen Verteilungskonflikte führen zu einem erhöhten Risiko von Gewalteskalationen mit den entsprechenden Folgen für Bevölkerungsverschiebungen und Migrationen, weshalb die Zahl der so genannten Migrationsbrennpunkte zunehmen wird. Entwicklungspolitik sollte vor diesem Hintergrund, so schlägt der WBGU vor, als »präventive Sicherheitspolitik« verstanden werden.
Diese Entwicklungen geben einen Vorgeschmack darauf, was passieren wird, wenn die Flüchtlingsströme durch den Klimawandel weiter anwachsen. Die mit der Erderwärmung einhergehenden Raum- und Ressourcenkonflikte werden in den nächsten Jahrzehnten fundamentale Auswirkungen auf die Gestalt der westlichen Gesellschaften haben – Frontex ist da nur ein unscheinbarer Vorbote. Der Klimawandel ist deshalb nicht nur eine umweltpolitische Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit, sondern er wird zugleich die größte soziale Herausforderung der Moderne sein, weil er die Überlebenschancen von Millionen von Menschen gefährdet und diese zu Massenmigrationen zwingt. Damit wird die Frage unausweichlich, wie mit den Massen von Flüchtlingen verfahren werden soll, die dort, wo sie herkommen, nicht mehr existieren können und an den Überlebenschancen in den privilegierten Länder teilhaben möchten.
Die Anderen
Im nördlichen Sudan hat sich die Wüste in den letzten vierzig Jahren um hundert Kilometer weiter in Richtung des zuvor fruchtbareren Südens ausgebreitet. Das liegt daran, dass zum einen die Regenfälle immer weiter zurückgehen und zum anderen die Überweidung von Grasflächen, das Abholzen von Wäldern und die dann einsetzende Bodenerosion das Land unfruchtbar gemacht haben. Vierzig Prozent des Waldes sind im gesamten Sudan seit der Unabhängigkeit des Landes verloren gegangen; im Augenblick schreitet die Entwaldung mit jährlich 1,3 Prozent des Bestandes voran. Für manche Regionen prognostiziert das Umweltprogramm der Vereinten Nationen einen Totalverlust des Waldes innerhalb der nächsten zehn Jahre.
Klimamodelle sagen für den Sudan einen Temperaturanstieg von 0,5 Grad Celsius bis 2030 und von 1,5 Grad bis 2060 voraus; zugleich wird die Regenmenge um weitere fünf Prozent im Jahresdurchschnitt abnehmen. Für die Getreideernten bedeutet das einen Rückgang um circa 70 Prozent. Im nördlichen Sudan leben etwa 30 Millionen Menschen. Man muss zur Beurteilung dieser Zahlen wissen, dass das Land schon jetzt zu den ärmsten Regionen der Welt gehört; zugleich ist es ökologisch erheblich gefährdet, und seit einem halben Jahrhundert wird im Sudan Krieg geführt. Es gibt deshalb fünf Millionen Flüchtlinge im Land, so genannte Internal Displaced Persons (IDPs), Menschen, die ihre Dörfer verlassen mussten, weil sie von Milizen systematisch vertrieben wurden. Die morden nicht nur, sie verbrennen auch die Dörfer und Wälder, um die Davongekommenen an einer Rückkehr zu hindern.
Die meisten IDPs leben in Lagern, die praktisch keine Infrastruktur haben, keinen Strom, keine Kanalisation, kaum Wasser und ärztliche Betreuung. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln wird weitgehend durch internationale Hilfsorganisationen gewährleistet. Die Insassen haben alles verfügbare Holz im Umkreis von bis zu zehn Kilometern um die Lager herum geschlagen; sie brauchen das Brennholz, um kochen zu können. Das kahle Land ist gefährlich; viele Frauen werden auf der Suche nach Holz vergewaltigt und getötet. Beraubt werden sie nicht; sie haben nichts, was man stehlen könnte.
Die Region Darfur im Westen zeigt dasselbe Bild, vielleicht ist es hier sogar noch schlimmer, seitdem sich die Kampfhandlungen auch auf die angrenzenden Länder Tschad und die Zentralafrikanische Republik ausgedehnt haben. In Darfur gibt es noch einmal zwei Millionen IDPs, meist leben sie in wilden Camps am Rande größerer Ansiedlungen und Städte. In einigen Orten ist die Einwohnerzahl um 200 Prozent gestiegen, seit in Darfur offener Krieg herrscht. Zwischen den USA und Europa besteht gegenwärtig keine Übereinstimmung, ob man von Völkermord sprechen soll. 200 000 bis 500 000 Menschen sind bislang getötet worden.
Der Sudan ist der erste Fall eines kriegsgeschüttelten Landes, für den als sicher gilt, dass Klimaveränderungen eine Ursache für Gewalt und Bürgerkrieg bilden. Bislang nahm man an, dass die Gewaltfolgen des Klimawandels eher indirekt sind, aber dort, wo das Überleben ohnehin schon gefährdet ist, bekommen selbst geringfügige Verschiebungen erhebliche Brisanz. Und im Sudan sind sie nicht geringfügig. Das ist eine Sache von Überlebenskonkurrenz. In einem Land, in dem 70 Prozent der Bevölkerung auf dem und vom Land leben, gibt es ein Problem, wenn Weideflächen und fruchtbares Land verschwinden. Nomadische Viehzüchter brauchen Weiden, auf denen ihre Tiere grasen können, wie auch Kleinbauern Land brauchen, um Getreide und Früchte für ihr Überleben und das ihrer Familien anbauen zu können. Wenn die Wüste sich ausbreitet, beanspruchen die Viehzüchter das Land der Bauern, oder umgekehrt. Es gibt eine kritische Untergrenze, von der an Überlebensinteressen nur noch mit Gewalt durchgesetzt werden.
Der Sudan hat von 1967 bis 1973 und dann zwischen 1980 und 2000 eine Reihe katastrophaler Dürren erlebt – zum Teil mit der Folge von großräumigen Bevölkerungsverschiebungen und Tausenden von Hungertoten. Natürlich gibt es neben dem ökologischen Desaster eine Fülle weiterer Konfliktursachen, sogar so viele, dass einen die Versuche, historische Übersichten vorzulegen, heillos verwirrt zurücklassen. [13]Kein Wunder: Seit 1955 wird dort in unterschiedlicher Intensität und in unterschiedlichen Regionen und Provinzen Krieg geführt, seit einem halben Jahrhundert also. Lediglich zwischen 1972 und 1983 gab es eine Phase eines fragilen Friedenszustands. 2005 wurde ein Friedensabkommen unterzeichnet, seitdem wird im südlichen Sudan tatsächlich nicht mehr gekämpft. Aber seit 2003 herrscht dafür Krieg in Darfur, im westlichen Sudan. Die Konfliktsituation ist desaströs, selbst wenn noch gar kein Wort über Trinkwassermangel, Überschwemmungskatastrophen, Vergiftungen durch ungeklärte Abwässer, riesige Müllhalden und Umweltzerstörungen durch die expandierende Ölindustrie verloren worden ist. Es gibt einen direkten Zusammenhang von Klimawandel und Krieg. Der Blick auf den Sudan ist ein Blick in die Zukunft.
Der Westen II
In den westlichen Ländern hat sich die Aufregung um den Klimawandel und seine Folgen vom Jahresanfang 2007, als die drei Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) veröffentlicht wurden, inzwischen gelegt. Auch wenn die Szenarien global düster erscheinen: Man weiß mittlerweile, dass es auch Regionen geben wird, die als Gewinner des Klimawandels gelten, weil sich die Anbaubedingungen genauso verbessern können wie die touristische Attraktivität. An den deutschen Nordseeküsten freuen sich die Hotelbetreiber; Weinbaugebiete rücken immer weiter nach Norden vor. Der Stern-Report [14], der die Kosten eines ungebremsten Temperaturanstiegs mit den Kosten für ein Abstoppen des Erwärmungsprozesses verglichen hat, scheint nach einer ersten Schrecksekunde ganz neue ökonomische Horizonte für Hochtechnologieländer eröffnet zu haben. Sir Nicholas Stern, der ehemalige Chefökonom der Weltbank, hat berechnet, dass die Kosten einer ungebremsten Klimaerwärmung zwischen 5 und 20 Prozent des globalen Pro-Kopf-Einkommens beanspruchen würden, wobei der höhere Wert der wahrscheinlichere ist. Dagegen kostet eine Stabilisierung des CO2-Ausstoßes bis zum Jahr 2050 lediglich ein Prozent des Bruttosozialprodukts, was mit einer normalen wirtschaftlichen Entwicklung durchaus vereinbar wäre.
Natürlich gibt es dabei branchenspezifische Unterschiede – Erzeuger von erneuerbaren Energien werden profitieren, der Skitourismus wird verlieren etc. Aber insgesamt wird in einem sofortigen Einläuten einer Wende in der Klimapolitik eine wirtschaftliche Chance für den Westen gesehen. Verbesserte Verfahren der Energiegewinnung, energieeffizientere Geräte aller Art, Hybridfahrzeuge, Biosprit, Sonnenkollektoren und vieles mehr verheißen Zukunft. Man spricht von der dritten industriellen Revolution und übersieht dabei, dass die erste und zweite die Ursachen der jetzigen Probleme sind.
Die Bürgerinnen und Bürger zeigen Umweltbewusstsein, indem sie nicht mehr mit gutem, sondern mit schlechtem Gewissen Flugzeuge benutzen. Nachdenken über den Klimawandel führt zu unerwarteten Reaktionen. Autofahrer greifen zum stärkeren Modell als ursprünglich vorgesehen, weil die Zeit für großvolumige Geländewagen mit 12 Zylindern und 500 PS bald abgelaufen sein könnte. [15]So genannte Klima- und Nachhaltigkeitsfonds werden mit dem Argument beworben, dass sich Kurse von Unternehmen, die im Klimabereich aktiv sind, »nachhaltig« besser als der Gesamtmarkt entwickeln. »Privatanleger können mit Fonds nicht nur finanziell vom Klimawandel profitieren, sie haben gleichzeitig das gute Gewissen, etwas gegen ihn zu unternehmen.« [16]
Was zeigen solche Beispiele? Sie zeigen Anpassungen von Menschen an sich verändernde Umweltbedingungen. Dabei wird deutlich, dass solche Adaptierungen nicht unbedingt in verändertem Verhalten liegen müssen, sondern auch in einer modifizierten Wahrnehmung der Probleme bestehen können. Vor kurzem wurde eine Studie darüber veröffentlicht, wie Fischer am Golf von Kalifornien den Rückgang der Fischbestände einschätzen. Trotz erheblicher objektiver Rückgänge in den Fischpopulationen und Überfischung in den küstennahen Regionen zeigten sich die Fischer desto weniger besorgt, je jünger sie waren. Sie kannten im Unterschied zu den älteren Kollegen viele Vorkommen und Arten gar nicht mehr, die früher in der Nähe der Küste gefischt worden waren. [17]
Man kann die kommenden Klimaprobleme als Chance, als ferne und vage Möglichkeit oder als unbedeutend wahrnehmen und sich so gegenüber der diffus gefühlten Bedrohung positionieren, in ein Verhältnis dazu setzen. In sich verändernden Gegenwarten verschieben sich, wie bei den südkalifornischen Fischern, auch die Wahrnehmungen derer, die Teil dieser Gegenwarten sind, und wenn trotzdem Dissonanzen entstehen, sind die Möglichkeiten vielfältig, sie zu glätten. Dazu kann schon genügen, ein Bewusstsein über das Problem zu haben, was einem suggeriert, dass man ihm nicht gleichgültig oder gedankenlos oder gar ohnmächtig gegenübersteht. Man ändert also seine Einstellung zum Problem und nicht seine Ursache.
Dabei muss man sehen, dass Einstellung und Verhalten zwei Dinge sind, die nur sehr lose miteinander verkoppelt sind, wenn überhaupt. Einstellungen kann man situationsentlastet, jenseits von Realitätsprüfungen und konkreten Entscheidungsbedingungen haben, während Handlungen in der Regel unter Druck stattfinden und von situativen Erfordernissen bestimmt werden – weshalb es sehr oft vorkommt, dass Menschen Handlungen begehen, die ihrer Einstellung widersprechen. Interessanterweise haben sie aber nur selten nennenswerte Schwierigkeiten damit, solche Widersprüche zu integrieren. Man vergleicht dann sein eigenes Verhalten mit dem noch schlimmeren der anderen, findet es im Rahmen der gesamten Problematik lächerlich unwichtig oder beschließt, es in Zukunft anders zu machen. All dies dient der Reduktion einer Dissonanz zwischen dem moralisch vertretenen und dem tatsächlichen Verhalten. [18]
Solche Dissonanzreduktionen sind nicht trivial; sie können auch im Kontext extremer Situationen wirksam sein, etwa dann, wenn Menschen aufgefordert werden, andere Menschen umzubringen, und Schwierigkeiten damit haben, diese Aufgabe mit ihrem moralischen Selbstbild zu verbinden. Ich habe in einer Studie über Massenmörder im Vernichtungskrieg zu zeigen versucht, wie es diesen Männern gelingt, Mord und Moral in Übereinstimmung zu bringen. [19]Es gelingt ihnen, indem sie sich innerhalb eines mentalen Referenzrahmens orientieren, der keinerlei Zweifel an der Notwendigkeit und Richtigkeit ihrer Handlungen aufkommen lässt.
Diese Männer handelten in Gruppen, fern ihrer gewohnten sozialen Zusammenhänge, und damit waren die Normen, die sich unter ihnen entwickelten und wechselseitig bestätigten, durch keinerlei Kritik von außen infrage gestellt. Sie handelten im Rahmen »totaler« Situationen, [20]in denen die soziale Heterogenität eines Alltags fehlt, in dem wechselnde Rollen, Sozialkontakte und Anforderungen korrigierend oder konflikthaft aufeinander einwirken. Das Töten selbst wurde als eine Aufgabe betrachtet, die notwendig war, den Männern aber erhebliche Schwierigkeiten bereitete, weil es ihrem Selbstbild durchaus nicht entsprach, wehrlose Menschen und besonders Frauen und Kinder zu töten. Gerade darin aber, dass sie sich selbst als Menschen empfinden konnten, die unter der Aufgabe litten, die sie erfüllen zu müssen meinten, konnten sie ihr moralisches Selbstbild als eigentlich »guter Kerl« mit ihrer grauenhaften Arbeit in Einklang bringen [21]– weshalb auch kaum einer von ihnen im Nachkrieg massive Schuldgefühle entwickelt hat und die meisten sich unauffällig und erfolgreich in die deutsche Nachkriegsgesellschaft integrieren konnten.
In der Tat ist es das hervorstechende und deprimierende gemeinsame Merkmal von Täteraussagen im Zusammenhang von Massenmorden, dass eine persönliche Zurechnung von Schuld nirgendwo vorkommt, dagegen aber regelmäßig eine ostentative Darstellung dessen, dass man gegen seinen eigenen Willen und gegen sein eigenes Empfinden in die Lage gekommen war, grauenhafte Dinge zu tun – worunter man selbst gelitten habe. Man kann hier eine Spur der Himmlerschen Ethik der »Anständigkeit« [22]erkennen, die seinerzeit nicht nur handlungsleitend war, sondern es den Tätern ermöglichte, sich selbst als Menschen zu sehen, die unter den unangenehmen Aspekten ihrer Arbeit leiden konnten. Im Nachkrieg stellt diese Selbstwahrnehmung die biografische Bruchlosigkeit und Kohärenz sicher, die beim Lesen ihrer Aussagen so sehr frappiert.
Solche Beispiele extremen Gewalthandelns zeigen, dass für das Verhalten von Menschen in konkreten Situationen prinzipiell nicht die objektiven Bedingungen dieser Situationen ausschlaggebend sind, sondern ihre Wahrnehmungen und ihre Interpretationen dieser Wahrnehmungen. Erst die Interpretation führt zu einer Schlussfolgerung, und die wiederum zu einer Handlung. Deshalb können auch Handlungen, die von außen betrachtet als völlig irrational, kontraproduktiv oder sinnlos erscheinen, für denjenigen, der sie ausführt, sogar dann höchst sinnhaft sein, wenn er sich selbst dabei schadet. So hat Mohammed Atta einen Sinn darin gesehen, ein Flugzeug in die Twin Towers zu steuern, und der RAF-Terrorist Holger Meins darin, sich in der Haft zu Tode zu hungern. Überrationalisierte Menschenbilder, wie sie vielen Handlungstheorien zugrunde liegen, haben für solche Formen partikularer Rationalität keinen Platz. Erst wenn man untersucht, wie Menschen ihre Wirklichkeit wahrnehmen, kann man verstehen, wieso sie Schlussfolgerungen aus diesen Wahrnehmungen ziehen, die – von außen betrachtet – völlig bizarr erscheinen.
Vielleicht gewinnt man so auch etwas mehr Einsicht in die eigentümliche Lage, derzufolge einerseits kaum Zweifel daran bestehen kann, dass vielen Gesellschaften in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ein klimabedingter Kollaps bevorsteht [23]und dass sich die Lebensbedingungen für alle Menschen mittelfristig stark verändern werden, was aber andererseits niemand wirklich glaubt. Diese irritierende Form der Apokalypseblindheit (Günter Anders) hat neben der merkwürdigen Fähigkeit von Menschen, sich durch Widersprüche im eigenen Verhalten nicht irritieren zu lassen, eine Reihe sehr handfester Gründe, deren wichtigste in der Komplexität moderner Handlungsketten und in der Unzurechenbarkeit von Handlungsfolgen liegen. Dieses Phänomen hat Zygmunt Bauman als »Adiaphorisierung« bezeichnet, das Verschwinden von Verantwortung durch den arbeitsteiligen Vollzug von Handlungen. [24]
Eine Voraussetzung dafür, verantwortlich handeln zu können, besteht zum Beispiel darin, dass die Parameter für ein planvolles Handeln bekannt sind. In modernen funktional differenzierten Gesellschaften mit ihren langen Handlungsketten und ihren komplexen Interdependenzen ist es für den Einzelnen prinzipiell schwierig, ein Verhältnis zwischen dem herzustellen, was er an Handlungsfolgen auslöst, und dem, was er qua eigener Handlungssteuerung praktisch verantworten kann. Genau aus diesem Grund sind Institutionen wie Gerichte, Psychiatrische Anstalten, Beratungsagenturen etc. entstanden, die die Herstellung solcher Verhältnisse zu moderieren und regeln versuchen – mit einer eigenen Dialektik, denn auch hier sind die Prozesse arbeitsteilig, was dazu führen kann, dass sich, wie Heinrich Popitz formuliert, die Nichtzuständigkeit des Mitarbeiters in »fataler Weise mit der Nicht-Zugehörigkeit der Menschen [verbindet], deren Fälle bearbeitet werden. Beides zusammen (Nichtzuständigkeit für Nicht-Zugehörigkeit) führt zu den reibungslosen Exzessen an Indolenz, die wir kennen.« [25]
Das Problem des Schwindens von Verantwortung ist also eines, das sich mit gesellschaftlichen Modernisierungsprozessen selbst ergibt, und es stellt gewissermaßen den Preis der Fortentwicklung und Neuschaffung solcher Institutionen dar – Verantwortlichkeit transformiert sich in Zuständigkeit, und damit automatisch auch in Nicht-Zuständigkeit. Gravierender ist aber vielleicht noch, dass man Verantwortung nur übernehmen kann, solange ein zeitliches Verhältnis zwischen Handlung und Handlungsfolge besteht, das eine wechselseitige Zurechnung erlaubt. Solange man es mit linearen Ursachen- und Wirkungszusammenhängen zu tun hat, die die Lebenszeit der beteiligten Akteure nicht überschreiten, sind solche Zurechnungen möglich, wie man es etwa an der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes sehen kann, dass Serbien zwar keinen Völkermord an den muslimischen Bosniern verübt, es aber verfehlt hat, gegen einen solchen Völkermord zu intervenieren. Andere Beispiele lassen sich im Bereich des Schuldrechts bei der Produkthaftung, im Strafrecht, im Versicherungsrecht usw. finden. In allen diesen Fällen wird erwogen, inwieweit jemand der Verursacher einer Handlungsfolge war und inwieweit er die eingetretene Handlungsfolge antizipieren konnte.
Wie aber steht es mit Problemlagen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Verursacher für eine eingetretene Handlungsfolge nicht verantwortlich gemacht werden können, weil sie schon gar nicht mehr am Leben sind? Im Unternehmensrecht ist dieses Problem über die Institution des Rechtsnachfolgers geregelt, [26]das es bei Privatpersonen aber nicht gibt. Das ist nur der mildere Aspekt des Problems. Kompliziert wird die Sache dann, wenn wie im Fall des Klimawandels die Ursachen für die sich gegenwärtig abzeichnenden Probleme mindestens ein halbes Jahrhundert zurückliegen und nach dem damaligen Stand der naturwissenschaftlichen Forschung gar nicht vorherzusehen waren. Und noch komplizierter wird das Ganze, wenn Interventionsstrategien gegen die seinerzeit nicht antizipierbaren Handlungsfolgen in der Gegenwart nur höchst unsichere und überdies in einer zeitlich weit entfernten Zukunft Erfolge bringen können. Hier ist die zeitliche Beziehung zwischen Handlung und Handlungsfolge generationenübergreifend verlängert und darüber hinaus nur durch wissenschaftliche Vermittlung darstellbar. Sinnlich erfahrbar ist sie kaum, was für die Erzeugung von Handlungsmotivationen ein Hindernis darstellt und auch nicht dazu beiträgt, sich wenigstens einen Teil der Verantwortung für die heutigen Probleme zuzurechnen.
Denn logisch ergibt sich daraus, dass einer im Jahr 2007 lebenden 40-jährigen Person eine Verantwortung für ein Problem zugeschrieben wird, dessen Verursachung zeitlich vor ihrer Geburt und dessen Lösung nach ihrem Tod lokalisiert ist, weshalb sie weder auf die Verursachung noch auf die Lösung direkt Einfluss nehmen kann. Gleichwohl müsste von dieser Person ein verantwortlicher Umgang mit dem Problem erwartet und gefordert werden, und es stellt sich die Frage, ob sie überhaupt mit einem solchen Problem im traditionellen Sinn verantwortlich umgehen kann und, wenn ja, wie die Realisierung einer solchen Verantwortung aussehen könnte.
Diese Frage hat eine erhebliche Tragweite für demokratische Staatswesen: Denn was bedeutet das Auseinanderfallen von zeitlich zurechenbaren Verursacher-Folgen-Ketten für die Entwicklung von politischem Bewusstsein und für politische Entscheidungen überhaupt? Und weiter: Welchen Einfluss hat die eingebaute Verantwortungslosigkeit darauf, wie die mit dem Klimawandel entstehenden sozialen Folgen und Lösungsmöglichkeiten wahrgenommen werden? Oder noch weiter: Welche Lösungen werden wir in einigen Jahren für möglich halten, die uns heute noch als ganz undenkbar erscheinen?
Lösungsversuche
Im ersten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts, als noch niemand daran denken konnte, dass zweihundert Jahre später eine als »die Moderne« bezeichnete Epoche ihre Ideale von Fortschritt, Rationalität und Effizienz in den industriellen Massenmord umsetzen würde, entwickelte Jonathan Swift ein Konzept, wie der Verelendung der irischen Bevölkerung Einhalt zu gebieten sei. Folgte man diesem Vorschlag, so Swift, würden die Kinder der Armen nicht mehr wie ihre Eltern einem trostlosen Dasein des Hungers, des Stehlens und der Bettelei entgegensehen und dem Königreich zur Last fallen müssen, vielmehr sollten sie »für den Rest ihrer Tage weder an Nahrung noch an Kleidung Mangel leiden, sondern [könnten] im Gegenteil einen Beitrag leisten zur Ernährung und teilweise zur Bekleidung vieler Tausender«. Das ist die Aufgabe, für die Swift eine Lösung bereithält, und er illustriert sie mit statistischen Daten über das stetige Anwachsen der Armutsbevölkerung, die auf jedes Kind entfallenden volkswirtschaftlichen Kosten und den disproportionalen Ertrag, der bei all dem herauskommt.
Und dann kommt die Lösung: »Ich gebe deshalb untertänig der Öffentlichkeit den Vorschlag zu bedenken, dass von den hundertzwanzigtausend Kindern, die wir schon errechnet haben, zwanzigtausend für die Aufzucht reserviert werden, wovon nur ein Viertel männlichen Geschlechts sein muss [...]. Die übrigen hunderttausend können als Einjährige Leuten von Rang und Vermögen im ganzen Königreich zum Kauf angeboten werden, wobei den Müttern zu raten ist, sie sollten die Kinder während des letzten Monats kräftig an der Brust nähren, so dass sie für eine gute Tafel schön rund und fett werden. Aus einem Kind lassen sich zu einem Essen mit Freunden zwei Gänge ausrichten, und wenn die Familie allein ist, so gibt die Laffe oder der Schinken ein ordentliches Essen ab; mit Pfeffer und Salz gewürzt, schmeckt das auch als Siedfleisch noch sehr gut, besonders im Winter.« [27]
Danach listet Swift eine ganze Reihe von positiven Effekten auf, die sich ergeben, wenn Kinder als Rohstoff für den Handel, die Gastronomie, die Lederwarenindustrie betrachtet werden. Und er bedenkt moralische Fragen, die aber – weil Abtreibungen und Kindsmorde zurückgehen würden – zugunsten seines Vorschlages entschieden werden können. Gegen Ende seiner Abhandlung resümiert Swift, dass er kein anderes Motiv kenne »als das Gemeinwohl meines Landes durch die Belebung des Handels, die Sorge für die kleinen Kinder, die Hilfe für die Armen und die Bereitstellung von einiger Lustbarkeit für die Reichen«.
Der »bescheidene Vorschlag« ist gewiss die bekannteste Satire von Swift, und sie bezieht ihren unheimlichen Charakter gerade aus der rationalen Entwicklung einer Lösung, die vor dem Hintergrund abendländischer Moralvorstellungen als ganz und gar undenkbar erscheint. Mit dem wissenschaftlichen Nachweis der Rationalität des Massenmordes, unterfüttert mit statistischem Material und flankiert durch moralische Erwägungen, wirft Swift einen Blick voraus in eine Zukunft, in der die instrumentelle Vernunft jede Moral auf eine Restkategorie reduziert, die allenfalls noch der Selbstvergewisserung der Handelnden dienen mag, aber keiner Unmenschlichkeit Schranken setzen kann.
Die Geschichte der Moderne hat schon eine Menge radikale Lösungen gefühlter gesellschaftlicher Probleme gesehen; bis zu welcher Konsequenz das gehen kann, zeigt die »Endlösung der Judenfrage«, die in der Vernichtung der Juden und damit der Annullierung der Frage bestand. Obwohl wir aus der Türkei, aus Deutschland, aus Kambodscha, aus China, aus Jugoslawien, aus Ruanda, aus Darfur oder aus dem weiten Feld der ethnischen Säuberungen [28]wissen, dass radikale Lösungen immer, auch für demokratische Gesellschaften, eine Option sind, werden solche mörderischen Prozesse gern noch als Abweichungen von »normalen« Entwicklungsverläufen, also als »Sonderfälle« interpretiert.
Die wenigen Sozialwissenschaftler, die diese Perspektive umzukehren versuchten und die Frage stellten, was das Phänomen der sozialen Katastrophe eigentlich für die Theorie der Gesellschaft bedeutet, sind bislang randständig und wissenschaftlich weitgehend ohne Einfluss geblieben. Das gilt für philosophische Ansätze wie die von Günter Anders oder Hannah Arendt ebenso wie für soziologische von Norbert Elias oder Zygmunt Bauman. Die Katastrophensoziologie hat zwar Eingang in Heimatschutzkonzepte gefunden, aber kaum in die soziologische Theoriebildung. In der Geschichtstheorie sind Katastrophentheorien bisher ebenso rar wie in der politischen Theorie.
Dabei haben gerade die sozialen Katastrophen des 20. Jahrhunderts in aller Deutlichkeit gezeigt, dass ethnische Säuberungen und Völkermorde keine Abweichung vom Pfad der Moderne darstellen, sondern als soziale Möglichkeit mit modernen Gesellschaftsentwicklungen erst entstehen. Soziale Prozesse wie der Holocaust sind so betrachtet nicht als »Zivilisationsbruch« (Dan Diner) oder »Rückfall in die Barbarei« (Max Horkheimer und Theodor W. Adorno) zu verstehen, sondern als Konsequenz moderner Versuche, Ordnung herzustellen und gefühlte soziale Probleme zu lösen. Wie Michael Mann gerade in einer umfangreichen Untersuchung gezeigt hat, stehen ethnische Säuberungen und Völkermorde in einem engen Zusammenhang mit Modernisierungsprozessen, auch wenn das wegen der archaisch scheinenden Gewalt, mit der sie ausgeführt werden, ganz anders aussieht. Dasselbe könnte für den islamistischen Terrorismus gelten, der eine Reaktion auf Modernisierung darstellt und ihr insofern, wenn auch negativ, eng verbunden ist.
Zygmunt Bauman hat in seinen Untersuchungen zur »Dialektik der Ordnung« [29]dargelegt, warum der Holocaust nie zu einem systematischen Gegenstand der Sozialwissenschaft geworden ist: Erstens, weil er als Ereignis der jüdischen Geschichte betrachtet worden sei, somit als ein Problem der Pathologie der Moderne gelten konnte, nicht aber als eines ihrer Normalität, [30]und zweitens, weil der Holocaust auf eine unglückliche Synthese von verhängnisvollen Faktoren zurückgehe, die – jeder für sich genommen – nicht sonderlich brisant waren und im Regelfall durch die soziale Ordnung gezähmt würden. Damit habe sich die Soziologie beruhigt und davon abgesehen, sich systematisch mit dem Holocaust zu befassen. Das würde nämlich etwa bedeuten, die industrielle Massenvernichtung als »Testfall« für das latente Potenzial der Moderne zu betrachten, was neuen Aufschluss über ihre Verfasstheit und ihre Bewegungsmechanismen zuließe. Bauman konstatiert also ein »Paradox«: dass nämlich der Holocaust mehr Aufschluss über den Stand der Soziologie liefere, »als diese in der jetzigen Form imstande ist, zur Erklärung des Holocaust beizutragen«. [31]Folgerichtig plädiert er dafür, den Holocaust als so etwas wie einen soziologischen Versuchsaufbau zu betrachten, in dem Merkmale moderner Gesellschaften freigelegt werden, »die sich unter ›nicht-experimentellen‹ Bedingungen nicht hätten beobachten und empirisch nachweisen lassen«. [32]
Hannah Arendt hat eindrücklich auf den gesellschaftstheoretisch systematischen Charakter von modernen Institutionen wie dem Konzentrationslager hingewiesen. [33]Die Lager zeigen, dass totalitäre Gesellschaften und soziale Gewaltdynamiken neue Wirklichkeiten kreieren, in denen partikulare Rationalitäten etabliert werden, die von außen betrachtet sinnlos oder geradezu irre erscheinen, in der Perspektive der Akteure aber in umfassende Sinnsysteme eingebunden sein können. Auf solche partikulare Sinnsysteme sind die gesellschaftswissenschaftlichen Deutungsinstrumente nicht geeicht, da sie an rationalen Handlungsmodellen orientiert sind.
Die Geschichtswissenschaft hat hier besondere Probleme, erschließt sie doch rückblickend Geschehnisse als sinnhaft, die es zeitgenössisch möglicherweise gar nicht waren. Historisch betrachtet liegt ein Grund dafür darin, dass sich die Geschichtswissenschaft am geisteswissenschaftlichen Verstehensbegriff orientiert, der sich auf das »einfühlend sympathetische Sehen und Beobachten eines früheren historischen Kulturzustandes« bezieht und »sein Rücklager in einem kulturoptimistischen, idealistischen Begriff der Geschichte« hat. [34]Dieser Verstehensbegriff erweist sich angesichts von modernen Gesellschaftsverbrechen als untauglich, weil er mit einer im konventionellen Sinn unverstehbaren Realität konfrontiert ist.
Töten macht Sinn
Die nationalsozialistische Vernichtungspolitik hat eine Variante des Tötens aus dem Kolonialkrieg wieder aufgenommen, die als überflüssig oder schädlich definierte Personen nicht einfach beseitigte, sondern der Vernichtungsgewalt noch ein Maximum an Nutzen abgewann: »Vernichtung durch Arbeit«. Bei der Errichtung gigantischer unterirdischer Produktionsanlagen für die V2-Raketen oder die Me 262-Düsenjäger zum Beispiel wurden die Gefangenen so radikal ausgebeutet, dass ihre durchschnittliche Lebenserwartung nach Einlieferung in die Lager bei nur wenigen Monaten lag. Arbeit konnte als Ausbeutung und Tötungsmittel zugleich angewandt werden, weil ständig Nachschub an Menschen kam, die sich dann zu Tode arbeiten mussten.
Dies bedarf freilich der Planung und Durchführung, wobei mutatis mutandis Töten als Arbeit in den Blick kommt. Denn Vernichtung durch Arbeit muss ja logistisch und technisch organisiert werden; es bedarf eines Lagers, man braucht dazu Baracken für die Häftlinge, Waschkauen, Personalunterkünfte, Transportwege, Strom, Wasser, Schienen, Loren und so weiter. In der Entwicklung und Bereitstellung von Infrastruktur für die Vernichtung durch Arbeit nimmt die Vernichtung für die Entwicklungsingenieure und Architekten selbst die Form eines komplexen betriebsförmigen Ablaufs an, mit allen Aspekten der Professionalisierung und Effizienzsteigerung, wie sie auch in anderen beruflichen Zusammenhängen angestrebt werden. Die Betriebsförmigkeit des Tötens findet sich sogar in der Organisation von Massenmorden, wie sie etwa ab 1941 hinter der vorrückenden Front in eroberten russischen Gebieten stattfanden. Auch hier geht es um die Normalisierung des Tötens dadurch, dass dieses als Arbeit wahrgenommen wird, und den Bedarf an professionellen Problemlösungen, die sich – wie in anderen Betrieben auch – vor die Wahrnehmung des Gesamtzusammenhangs der Aufgabe schiebt, nämlich an einem systematischen Massenmord beteiligt zu sein. Dieser Vorgang ist arbeitsteilig, niemand muss sich dabei als Mörder fühlen, obwohl die Morde als Direkttaten, nicht etwa in Form distanzierender Tötungstechniken – wie Gaskammern – stattfinden.
Im nationalsozialistischen Vernichtungskrieg bezog das Töten eine Rationalität in den Augen der Täter gerade daraus, dass sie es als Arbeit interpretieren konnten, als »dreckige Arbeit« sogar, an deren Ausführung sie selbst leiden konnten. Die Belastungen, die diese als notwendig betrachtete Arbeit für die Täter mit sich brachte, waren – wie gesagt – ein beständiges Thema in Reden Heinrich Himmlers wie auch in den Gesprächen der Täter. Gerade ihr Leiden erlaubte es ihnen, sich an keiner Stelle als Mörder empfinden zu müssen, weder bei der Ausführung der Morde noch später, in der Nachkriegszeit. Sie waren in der Lage, ihre Handlungen in einen für sie sinnhaften Referenzrahmen einzubetten. Diese Fähigkeit zur Herstellung sinnhafter Referenzen – ich töte zugunsten eines höheren Zwecks, ich töte für die kommenden Generationen, ich töte anders als die anderen, mir macht diese Arbeit keine Freude – ist ein psychologischer Modus, der Menschen mit der Fähigkeit ausstattet, die unvorstellbarsten Dinge zu tun, ja, schlechthin alles zu tun; menschlichem Handeln sind im Gegensatz zu nicht bewusstseinsfähigen Lebewesen keine instinktiven oder anlagebedingten Verhaltensbeschränkungen auferlegt.
Menschen existieren in einem sozialen Universum, und deshalb sollte man tatsächlich alles für möglich halten. Es gibt keine natürliche oder auf sonstige Weise gezogene Grenze für menschliches Handeln, und wie die Kultur des Selbstmordattentats zeigt, gibt es sie nicht einmal dort, wo das Leben aufhört. Man sollte es daher für soziologische Folklore halten, wenn behauptet wird, dass Menschen Jagdinstinkte entwickeln, sich zu Meuten zusammenrotten und Bluträusche erleben, mit der beeindruckenden Begründung, dass das eben anthropologisch so sei. Gewalt hat historisch und sozial spezifische Formen und findet in ebenso spezifischen Kontexten der Sinngebung statt. [35]
Im Nationalsozialismus bestand die Sinngebung des Tötens in dem höheren Zweck, der rassereinen Gesellschaft zur Weltherrschaft zu verhelfen. Die kurze Entwicklungszeit der Vernichtungstechnik führte zu einer Distanzierung und Auslagerung der Gewalt – statt Massenerschießungen gab es Vernichtungsanlagen; die Täter legten nicht mehr selbst Hand an, sondern übertrugen das Töten der Technik und die Behandlung der Opfer Funktionshäftlingen. Seit der Einführung der Gaskammern und der Verwendung von Zyklon B als Tötungsmittel kam die eigentliche Vernichtung ohne direkte Gewaltausübung durch die Täter aus.
Gedenktage und -veranstaltungen zur Erinnerung an den Holocaust werden immer mit dem Sinn verknüpft, dass man aus der Geschichte lernen könne und von den Historikern Wissen bereitgestellt würde, das man benötige, damit »nie wieder« geschehe, was »damals« geschehen ist. Warum aber, so könnte man fragen, sollte etwas »nie wieder« geschehen, wo doch die Beispiele zeigten, dass Menschen noch die radikalsten Abweichungen vom humanistischen Denken, die gegenmenschlichsten Theorien, Definitionen, Schlussfolgerungen und Handlungen sinnhaft finden und in Konzepte integrieren können, die ihnen vertraut sind – auch Menschen übrigens, deren Intelligenz und humanistisches Bildungsniveau nichts zu wünschen übrig lässt.
Sollte man vor dem Panorama der zahllosen historischen Beispiele der Herstellung von Tötungsbereitschaft und der Wandlungen der Gewalt nicht eher davon ausgehen, dass der Holocaust die Wahrscheinlichkeit erhöht hat, dass solche Dinge erneut vorkommen? 1994 hat es in Ruanda die Bevölkerungsmehrheit für sinnvoll gehalten, innerhalb von drei Wochen 800 000 Tutsi zu töten. Es ist ein modernistischer Aberglaube, der beständig vor dem Gedanken zurückschrecken lässt, dass Menschen das Töten von anderen Menschen für eine Lösungsoption halten, wenn diese anderen für sie ein Problem darstellen. Mit Aggression im psychologischen Sinn hat das oft weniger zu tun als mit Zweckrationalität. Zur Lösung von Problemen, schreibt Hans Albert, hat sich die Herstellung von Waffen »in vielen Fällen mehr gelohnt als die Herstellung von Werkzeugen«. [36]Was bedeutet also: Lernen aus der Geschichte?
Global warming und soziale Katastrophen
Ende August des Jahres 2005 fegte der Hurrikan Katrina über den Südosten der USA hinweg, richtete einen Sachschaden von mehr als 80 Milliarden Dollar an und ließ die Stadt New Orleans fast vollständig untergehen. Hierbei handelte es sich um eine angekündigte Katastrophe; bereits im Oktober 2001 wurde das Überflutungsszenario in der Zeitschrift Scientific American beschrieben. [37]
Nach zwei Kanalbrüchen standen 80 Prozent der Stadtfläche bis zu 7,60 Meter tief im Wasser. Stromausfälle führten dazu, dass das Wasser nicht abgepumpt werden konnte, überschwemmte Zufahrtstraßen verhinderten zunächst, dass Hilfe von außen die Stadt erreichen konnte. Die Katastrophenhilfe erwies sich als vollständig überfordert; schon kurz nach der Flut begannen die ersten Plünderungen. Der zur Notunterkunft für Flutopfer umfunktionierte Superdome war nach kürzester Zeit überfüllt, um ihn herum entwickelte sich eine Gewalteskalation, die die Behörden zu der Prüfung veranlasste, ob man nicht den Kriegszustand ausrufen und Kriegsrecht verhängen könne. Die Gouverneurin von Louisiana, Kathleen Blanco, wies am 1.September die Nationalgarde an, auf Plünderer zu schießen: »Diese Truppen (die Nationalgarde) können schießen und töten. Sie zögern nicht, es zu tun, und ich hoffe, sie werden es tun.« [38]
Im Hauptbahnhof von New Orleans wurde ein provisorisches Gefängnis für circa 700 Personen errichtet, das aus mit Ketten verbundenen Käfigen bestand; trotz aller Anstrengungen bekamen die Polizei und die Nationalgarde die Lage vorerst nicht in den Griff. Es gab Angriffe auf Rettungsmannschaften, Schießereien, Vergewaltigungen, geplünderte Geschäfte, Einbrüche etc. Erst das Militär, das mit einer Stärke von 65 000 Mann zum Katastropheneinsatz kam, vermochte die Lage sukzessive zu beruhigen. Teilweise erwies es sich als schwierig, die verbliebenenen Menschen zu evakuieren.
Die Flut traf die Menschen nicht gleichermaßen: Während viele der wohlhabenderen Bewohner fliehen konnten, war es besonders die arme, zumeist afroamerikanische Bevölkerung, die zunächst in der zerstörten Stadt blieb. Auch die Stadtviertel wurden unterschiedlich hart getroffen. John R. Logan, der die sozialen Folgen des Hurrikans Katrina untersucht, belegt, dass 45,8 Prozent der zerstörten Teile von New Orleans von Afroamerikanern bewohnt wurden; in den unzerstörten betrug der schwarze Bevölkerungsanteil lediglich 26,4 Prozent. Ähnliche Relationen ergeben sich bei Armutsindikatoren. [39]
Insgesamt wurde die Stadt so zerstört, dass es Überlegungen gab, sie nicht wieder aufzubauen. Seit dieser Katastrophe gibt es den Begriff des Klimaflüchtlings, einer Person, die sich aufgrund eines Wetterereignisses auf der Flucht befindet. 250 000 ehemalige Bewohner von New Orleans sollen nach der Evakuierung nicht zurückgekehrt sein und sich inzwischen anderswo angesiedelt haben. Von den weißen Einwohnern sind ein Jahr nach dem Hurrican etwa ein Drittel nicht zurückgekehrt; von der afroamerikanischen Bevölkerung drei Viertel, so dass New Orleans nach der Katastrophe eine anders zusammengesetzte Bevölkerungsstruktur aufweist als zuvor. Damit hat die Stadt durch die Katastrophe nicht nur eine neue Sozialstruktur, sondern auch eine neue politische Geographie bekommen. [40]
Das, was man gewöhnlich als Naturkatastrophe bezeichnet, wie beispielsweise eine Überschwemmung infolge eines extremen Wetterereignisses, erwies sich im Fall von New Orleans in jeder Facette als etwas anderes: Vom Ignorieren der Überflutungsgefahr bis zum völlig unzureichenden Katastrophenschutz, von der entstehenden und kaum einzudämmenden Anarchie bis zu den extremen Reaktionen der Sicherheitskräfte, von der sozialen Ungleichheit auf der Folgenseite des Hurrikans bis hin zur Schöpfung einer neuen Kategorie von Flüchtlingen und der neuen Soziodemographie der Stadt, lässt sich der gesamte Ereigniszusammenhang viel treffender als eine soziale Katastrophe bezeichnen.