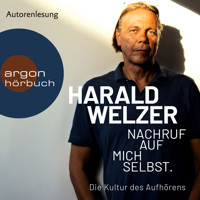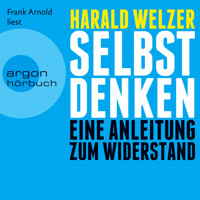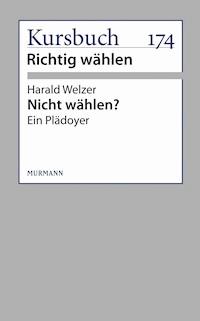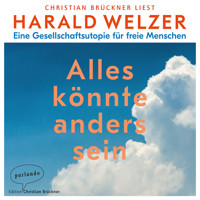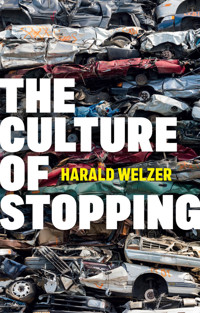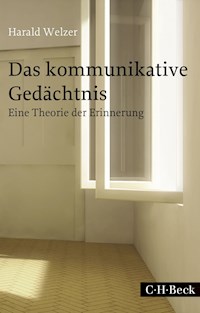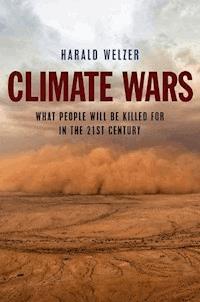6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Schlagende Argumente gegen Rechtspopulisten und andere Menschenfeinde Das Buch für Offenheit und demokratische Werte Populisten dominieren immer stärker den öffentlichen Diskurs, Politik und Medien reagieren aufgeschreckt. Es scheint fast vergessen, dass es immer noch eine demokratische und freiheitliche Mehrheit gibt. Zeit sich zu Wort zu melden! Der Bestsellerautor und Sozialpsychologe Harald Welzer liefert die Argumente, die man allen rechtspopulistischen Dummheiten erfolgreich entgegenhalten kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 109
Ähnliche
Prof. Dr. Harald Welzer
Wir sind die Mehrheit
Für eine Offene Gesellschaft
FISCHER E-Books
Inhalt
So wenig sich die Deutschen genügend darüber im Klaren sind, was für eine Errungenschaft die Bundesrepublik gegenüber früheren Jahrhunderten deutscher Geschichte bedeutet, so wenig ist sich die jetzige Generation der Europäer bewusst, welche Leistung es war, Europa so weit zu bringen, wie es heute ist.
Fritz Stern, Historiker
Seien wir ehrlich. Wer braucht hier noch so etwas wie Literaten?
Asli Erdogan, Schriftstellerin
Wofür soll man denn stehen
Wenn man alles auf sich sitzen lässt
Und trotzdem ständig danebenliegt
Wohin soll es gehen?
Faute Couture, Rapper
Ein Tiefpunkt und ein Höhepunkt der politischen Kultur
Am Abend des 19. Dezember 2016 ermordete der islamistische Terrorist Anis Amri auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche 12 Menschen und verletzte mehr als 50 weitere, zum Teil schwer. Noch vor Tagesfrist und lange bevor die Tatumstände auch nur annähernd klar waren, twitterte der AfD-Politiker Pretzell: »Wann schlägt der deutsche Rechtsstaat zurück? Wann hört diese verfluchte Heuchelei endlich auf? Es sind Merkels Tote!« Wenig später nutzte der bayerische Ministerpräsident Seehofer seine stehend vorgebrachte Trauerrede für die folgende Mitteilung: »Wir sind es den Opfern, den Betroffenen und der gesamten Bevölkerung schuldig, dass wir unsere gesamte Zuwanderungs- und Sicherheitspolitik überdenken und neu justieren.« Menschen wie Pretzell und Seehofer, so lässt sich unschwer erkennen, fehlt jeder Anstand, ja sogar das ganz normale moralische Grundgerüst, das wir voneinander in modernen Gesellschaften erwarten. Wer jede auch noch so dramatische und entsetzliche Begebenheit nur als Gelegenheit betrachtet, daraus politisch Kapital zu schlagen, disqualifiziert sich selbst für jede Tätigkeit, in der man Verantwortung für andere tragen muss. Solche Leute kann man nicht wählen, das ist sonnenklar. Seehofer, der ja im Unterschied zum hetzenden Pretzell ein Amt bekleidet, bildet den personifizierten Tiefpunkt der politischen Kultur der heutigen Bundesrepublik Deutschland.
Ich glaube, in hysterisierten Zeiten wie diesen muss man sich gelegentlich an ganz einfache Grundsätze halten und sich vergewissern, dass man Dinge, wie sie Pretzell und Seehofer tun, schlicht und ergreifend nicht tut. Wer Anschuldigungen vornimmt und politische Forderungen stellt, bevor auch nur entfernt geklärt ist, wer was wie warum getan hat, macht den Eindruck, er habe direkt auf den Anschlag gewartet und sich dafür schon vorab munitioniert. Das gehört nicht in eine aufgeklärte politische und moralische Kultur; schon deshalb nicht, weil man die Opfer als Objekte politischer Ausbeutung missbraucht.
Der moderne demokratische Verfassungsstaat setzt bei seinen Bürgern eine Übereinstimmung auch darüber voraus, was nicht abstimmbar ist – Vertrauen, Verantwortung, Gemeinwohl. Das sind moralische Grundvoraussetzungen, die das soziale Leben grundieren, ohne dass es dafür Gesetze gibt. Im Moment erleben wir eine chronische Verletzung solcher Grundvoraussetzungen, und man muss sich davor hüten, sich an so etwas zu gewöhnen. Dann nämlich verliert man den moralischen Kompass, der gerade in krisenhaften Zeiten nötiger ist als in ruhigeren.
Damit ist schon umrissen, was ich in diesem kleinen Buch erzählen möchte – dass wir in einer Gesellschaft leben, die uns allen die Freiheit eröffnet, sie nach unseren Bedürfnissen und Wünschen mitzugestalten, die uns aber auch die persönliche Verantwortung auferlegt, aktiv für diese Gesellschaft einzutreten und sie zu schützen, wenn sie angegriffen wird. Und im Augenblick wird sie so massiv angegriffen wie noch nie in der Nachkriegsgeschichte.
Da sind zum einen die islamistischen Terroristen, die alles andere wollen als eine offene Gesellschaft und dafür Menschen ermorden, scheinbar wahl- und ziellos, wie auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Aber Terror ist, auch wenn es sich merkwürdig anhören mag, vor allem Kommunikation: Gerade mit der Beliebigkeit der Orte und der Opfer, mit der Unberechenbarkeit des nächsten Anschlags und in der Verachtung ihres eigenen Lebens erzeugen Terroristen Ängste, die Vertrauen zersetzen. Ihre Gewalttaten sind kalkulierte Inszenierungen, die die politische Aufmerksamkeit auf Fragen der Sicherheit zentrieren und zugleich attraktiv auf Verführbare wirken: Wie muss man sich als kleiner Dschihadist wohl fühlen, wenn – wie nach den Anschlägen von Paris und Brüssel – Flughäfen geschlossen und Innenstädte von Metropolen leergefegt werden? Grandios – wenn man es als spätpubertärer junger Gewalttäter hinkriegen kann, eine komplette Gesellschaft, die man hasst, in Angst und Schrecken zu versetzen.
Daraus kann man zwei Lehren ziehen: Die erste ist frustrierend und lautet, dass es gegen Terror keinen absoluten Schutz gibt. Punkt. Die zweite ist schon erfreulicher: Man kann Terrorismus am besten bekämpfen, indem man aufhört, den Mördern öffentliche Bühnen zu bauen. Man muss schlicht damit aufhören, endlos die Gesichter und Namen durch die Medien zu jagen, die Überwachungsvideos zu zeigen, die Taten wieder und wieder zu dokumentieren. Denn genau das macht die Mörder unter ihresgleichen zu Helden, und an nichts könnten wir weniger interessiert sein als daran.
Und da sind ihre scheinbaren Gegner: die Pretzells und Seehofers und eine erstaunlich große Zahl von politischen Aktivisten weltweit, aber leider auch in Europa, die die offene Gesellschaft und den demokratischen Verfassungsstaat ablehnen und autoritäre Gesellschaftsformen herbeiwünschen, in denen »national« gedacht wird. Was meistens »nationalistisch« bedeutet. »Nationalistisch« denken heißt: biologische Unterschiede zwischen Menschen machen, »echte« Deutsche von »Kopftuchmädchen« und überhaupt von Leuten »mit Migrationshintergrund« zu unterscheiden. Es bedeutet, dass kein gleiches Recht für alle gilt, dass Minderheiten ausgegrenzt und unterdrückt, nicht selten auch verfolgt und getötet werden, und dass statt Recht Willkür herrscht.
Das 20. Jahrhundert hat uns mit dem Nationalsozialismus, dem Sowjetsystem und einigen anderen mörderischen staatlichen Experimenten darüber belehrt, wie gewalttätig nichtdemokratische Gesellschaften sind oder jederzeit sein können. Und ein Blick in die Türkei, aber auch nach Polen oder nach Ungarn zeigt uns darüber hinaus in Echtzeit, was es bedeutet, wenn man unter autoritären Regimen versucht, eine eigene Meinung zu äußern: Man verliert seinen Job, man wird bedroht, diffamiert oder, wie in der Türkei, verhaftet. Wer kann sich solche Verhältnisse wünschen?
Die Antwort: alle Freiheitsfeinde. Und damit sind wir schon beim wichtigsten Punkt: Freiheits- und Demokratiefeinde der unterschiedlichsten Erscheinungsformen brauchen einander innig: Der Radikale, der gegen die »Islamisierung des Abendlandes« wettert, braucht die islamistischen Terroristen genauso wie die die »Kreuzritter«, die angeblich gegen die Rechtgläubigen kämpfen; die Neurechten und ihre bürgerlichen Bewährungshelfer brauchen die Ängste, um sie als ihr politisches Kapital vermehren zu können. Genauso wie die Terrororganisationen den Hass und die Repression der Gegenseite brauchen, um ihre Behauptung unter Beweis zu stellen, man befinde sich im Krieg mit den Ungläubigen. Wenn die »Ungläubigen« das dann auch noch sagen: Man befinde sich im Krieg – umso besser. Beide Gruppen sind sich in vielerlei Hinsicht ähnlich: Beide verachten sie Demokratie und Pluralismus, beide trennen sie die Menschen in gut und böse sowie in zugehörig und nicht-zugehörig, beide sehen sich im Krieg und beide lieben sie Hass, Angst, Manipulation, Ausgrenzung, Wut und Gewalt. Sie bauen sich gegenseitig die Bühne, auf der sie sich dann als die Retter vor den jeweils anderen inszenieren können. Was bedeutet: Gäbe es die einen nicht, blieben die anderen ganz unbedeutend.
Da wir gegen den islamistischen Terror nur sehr langfristig etwas ausrichten können, sollten wir ihm zunächst das Widerlager wegnehmen, das ihm Stabilität verleiht: also unsere eigenen Freiheitsfeinde. Das ist ganz einfach: Man wählt sie nicht. Oder man wählt sie ab. Tatsächlich gibt es keinen erkennbaren Grund, weshalb bei der nächsten Bundestagswahl im September eine neurechte Partei über die 5-Prozent-Hürde kommen sollte. Die Umfragen sagen etwas anderes? Klar, aber Umfragen sind keine Wahlen, sie entscheiden nichts. Die von den etablierten Parteien gehen alle davon aus, dass die Rechten 14 oder 15 Prozent kriegen? Klar, aber nur weil sie Talkshowfeiglinge sind, die sich hinterher von Anne Will nicht vorhalten lassen wollen, dass sie deren Wählerpotential unterschätzt haben. Mal ehrlich: Wie kann ich denn als Politikerin oder Politiker einer etablierten Partei allen Ernstes nicht das Ziel ausgeben, dass man nichtdemokratische Parteien am Einzug in den Bundestag hindern will? Das ist doch selbst Ausdruck mangelnder politischer Kultur und Courage und sagt den Kampf schon ab, bevor der Ring überhaupt eröffnet ist.
Dabei sind hierzulande die Voraussetzungen dafür, die Freiheitsfeinde von den Parlamenten fernzuhalten, ganz ausgezeichnet. Denn in Deutschland wählt die Mehrheit ja weit überwiegend Volksvertreterinnen und -vertreter, die sich dem Grundgesetz, also der Freiheit und dem Recht verpflichtet fühlen, und die Mehrheit ist auch bereit, für die Rechte von Minderheiten – etwa von Asylbewerbern, von misshandelten Kindern, von Obdachlosen, von Gewaltopfern und anderen mehr – einzutreten.
Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat im Sommer 2016 die Einstellungen der Deutschen untersucht und festgestellt, dass vier Fünftel die Aufnahme von Flüchtlingen »gut« (56 %) oder »teils-teils« gut (24 %) finden. 77 % waren der Meinung, dass es der Gesellschaft gut gelinge, die Situation zu bewältigen. Allerdings sind Vorurteile gegenüber Asylsuchenden angestiegen, von 44 % im Jahr 2014 auf 50 % 2016. Neuere Studien zeigen auch eine sinkende Zustimmung zur Flüchtlingspolitik. Auffällig ist eine deutlich stärkere Verbreitung von menschenfeindlichen Vorurteilen in Ostdeutschland sowie unter Anhängern der AfD (88 %).
Haltungen und Gefühle gegenüber Geflüchteten hängen weniger vom Einkommen oder anderen soziodemographischen Merkmalen ab als vielmehr von der politischen Grundhaltung. Insbesondere unter den potentiellen Wählern der AfD sind ablehnende Einstellungen gegenüber Geflüchteten weit verbreitet, während bei den Anhängern aller anderen etablierten Parteien und auch den erklärten Nichtwählern eine positive Grundhaltung zur Aufnahme von Geflüchteten überwiegt. Die Befragten mit einer generell negativen Haltung zu Geflüchteten sind auch gegenüber anderen Gruppen (Sinti und Roma, Fremde generell) feindlich eingestellt und stimmen rechtsextremen Auffassungen deutlich mehr zu. Besonders auffällig ist, dass die Radikalisierung von Einstellungen in der Gruppe der AfD-Anhänger sich im Zeitverlauf intensiviert hat, was sich in der Normalbevölkerung aber nicht spiegelt.
Den eindrucksvollsten Nachweis für ihre demokratische Haltung hat die deutsche Bevölkerung angetreten, als sie auf den rapiden Anstieg der Flüchtlingszahlen im Sommer 2015 so reagierte, wie sich jede Gemeinschaftskundelehrerin und jeder Geschichtslehrer das wünscht: Lernziel erreicht! Eine Gesellschaft gerät unter Stress, und die Bürgerinnen und Bürger überlegen nicht lange, sondern kommen spontan ihrer Verantwortung nach, organisieren praktische Hilfe, sammeln Kleider und Geld und machen darüber hinaus etwas ganz und gar Unglaubliches: Sie heißen die Ankommenden willkommen, demonstrativ, human, menschenfreundlich.
Das war für mich der Höhepunkt der politischen Kultur, die gelebte Antithese zu den Tiefpunktpolitikern. Ich war in jenen Wochen unglaublich stolz auf die Bevölkerung meines Landes, ja, habe zum ersten Mal tief empfunden, dass dies mein Land ist. Ein Freund von mir hat die damalige Stimmung so auf den Punkt gebracht: »Selbst Leute wie ich, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie sich mal so engagieren könnten, tun das – toll!«
Sehr vielen ging es so: sich plötzlich als jemand zu erleben, der sich einsetzt, wo es nötig ist, ganz neue Fähigkeiten an sich entdeckt, auch Rollen spielen kann, die im normalen Berufsalltag nie gefragt gewesen sind. Wenn in einer eigentlich höchst unaufgeregten und eher langsamen Stadt wie Flensburg sich von 80000 Einwohnerinnen und Einwohnern sage und schreibe 10000 ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren und den Bahnhof in eine superprofessionelle Anlaufstation für alle Geflüchteten auf dem Weg nach Dänemark und Schweden machen, dann ist das nichts anderes als eindrucksvoll, ja, geradezu sensationell. Und als die dänische Regierung die Grenze dichtmachte, reihten sich eine Menge dänische Bürgerinnen und Bürger in die Flüchtlingshilfe ein, um deutlich zu machen, dass sie nicht derselben Auffassung wie ihre Regierung waren. Und halfen den Flüchtlingen, nach Schweden zu kommen.
Hbf Flensburg Herbst 2015: Gute Menschen. Foto: Michael Staudt
So war es in vielen Städten des Landes, und das war: aktives Eintreten für die Offene Gesellschaft. Und zwar, ohne auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden, dass dies jetzt »Eintreten für die Offene Gesellschaft« war. Die meisten machten das einfach, weil sie es für nötig hielten und weil sie die Möglichkeiten dazu hatten. Wie es ein Handwerksmeister sagte, der Flüchtlingen beibringt, wie man Fahrräder repariert: »Warum mache ich das? Weil ich es kann!«
Das ist das ganz selbstverständliche und in der Regel unausgesprochene Ethos der Offenen Gesellschaft. Die meisten Menschen teilen es, nicht weil sie es bewusst gelernt haben, sondern weil sie in einer solchen Gesellschaft aufgewachsen sind, sie ganz real erfahren haben. Denn die Offene Gesellschaft ist keine Wunschvorstellung und keine Fiktion. Auch keine Utopie. Nicht Multi-Kulti, win-win, ein ewiger Ponyhof, wo alle gut zueinander sind und es niemals regnet. Die Offene Gesellschaft gibt es: Sie ist der demokratische Verfassungsstaat, ihre modernste Verfassung bis heute ist das Grundgesetz von 1949. Das Grundgesetz regelt das Zusammenleben aller Deutschen, egal welcher Herkunft sie sind, es schützt die Einzelnen vor Willkür, Not und Unrecht, es erlaubt ihnen unabhängig von ihrem Vermögen oder ihrer Gesundheit Teilhabe, und es sieht vor, dass der Staat als Sozialstaat Daseinsvorsorge betreibt.
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2