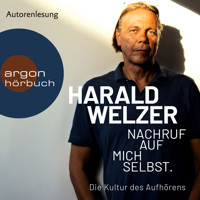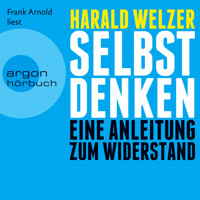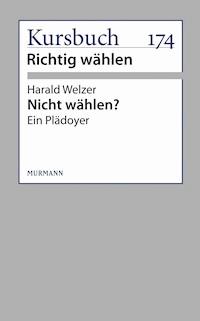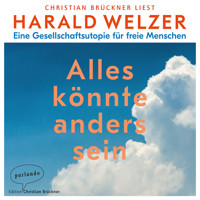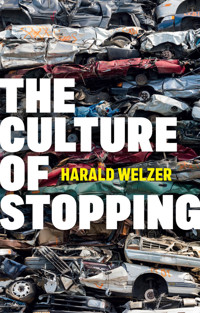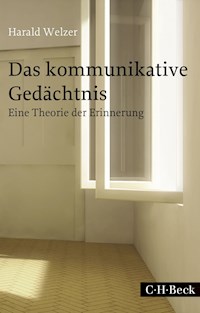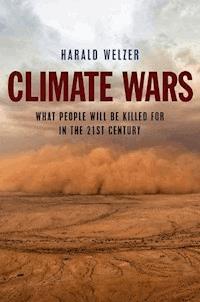9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Bestseller-Autor Harald Welzer legt mit ›Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit‹ eine neue und frische Analyse der großen gesellschaftlichen Zusammenhänge in Deutschland vor, eine umfassende Diagnose der Gegenwart für alle politisch Interessierten. Unsere Gesellschaft verändert sich radikal, aber fast unsichtbar. Wir steuern auf einen Totalitarismus zu. Das Private verschwindet, die Macht des Geldes wächst ebenso wie die Ungleichheit, wir kaufen immer mehr und zerstören damit die Grundlage unseres Lebens. Statt die Chance der Freiheit zu nutzen, die historisch hart und bitter erkämpft wurde, werden wir zu Konsum-Zombies, die sich alle Selbstbestimmung durch eine machtbesessene Industrie abnehmen lässt, deren Lieblingswort »smart« ist. Was heißt das für unsere Gesellschaft? Nach seinem Bestseller ›Selbst denken‹ analysiert Harald Welzer in ›Die smarte Diktatur. Der Angriff auf unsere Freiheit‹, wie die scheinbar unverbundenen Themen von big data über Digitalisierung, Personalisierung, Internet der Dinge, Drohnen bis Klimawandel zusammenhängen. Daraus folgt: Zuschauen ist keine Haltung. Es ist höchste Zeit für Gegenwehr, wenn man die Freiheit erhalten will!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 345
Ähnliche
Harald Welzer
Die smarte Diktatur
Der Angriff auf unsere Freiheit
FISCHER E-Books
Inhalt
Dem Gedenken an Cioma Schönhaus gewidmet, der am 22. September 2015 gestorben ist und damit seine Ermordung um 74 Jahre überlebt hat.
Kapitel 1Überwachung
Über Heuhaufen im digitalen Zeitalter, warum man heute keine Verfolgten mehr retten kann, die Jagd nach Menschenfleisch und die Tatsache, dass wir heute alle sichtbar sind, aber nicht füreinander.
Die Erde auf Erden
»Die Welt ist mehr Nichtkrise als Krise: sie ist gewiss nicht der Himmel auf Erden, aber auch nicht die Hölle auf Erden, sondern die Erde auf Erden.«[1] Das ist ein Ausgangspunkt. Wir können gestalten.
Freiheit
Sogar immer mehr. Denn die Welt ist mehr Nichtkrise als Krise, weil wir auf einen Zivilisationsprozess zurückblicken, der es über die Jahrhunderte hinweg für mehr und mehr Menschen möglich gemacht hat, in größerer Sicherheit und zugleich in Freiheit zu leben. Davon profitieren natürlich noch immer nicht alle Menschen überall, und zurzeit erleben wir einen Rückschlag. Gegenwärtig häufen sich Kriege, Bürgerkriege, Massaker, Flucht, Vertreibung, Anschläge. Solche Rückschläge begleiten den Zivilisationsprozess; er läuft nicht linear, und er schafft keine Sicherheit vor Rückfällen in unzivilisiertere Verhältnisse. Im Gegenteil: Mit mehr technischen Möglichkeiten und größerer Rationalität wächst auch das Maß an Unmenschlichkeit, das angerichtet werden kann. Der Holocaust war ein Produkt der Moderne, kein »Rückfall in die Barbarei«, wie es in Sonntagsreden immer noch heißt. Barbaren erfinden keine großtechnologischen Menschenvernichtungsanlagen, auch keine Drohnen. Das gegenmenschliche Verhängnis wird immer mit den Mitteln der Zeit hergestellt.
Zivilisation ist nie gesichert, das hat das 20. Jahrhundert auf das Grausamste gezeigt. Und die Kräfte zu ihrer Zerstörung, auch das lehrt die Geschichte, kommen nicht immer von außen. Die Furcht vor der Freiheit und vor der Verlassenheit des Einzelnen sind die gefährlichsten Antriebskräfte, die zum Kampf gegen die Moderne und ihre Freiheitszumutungen führen können. Und diejenigen, die die Werte und die Praxis der modernen Zivilisation bekämpfen, müssen nicht so aussehen wie die Nazis, wie sie uns in Hollywoodfilmen vorgeführt werden. Sie müssen keine Uniformen tragen und Märsche gut finden. Sie müssen auch nicht auftreten wie Skinheads und Neonazis und »Freiwild« gut finden. Und sie müssen nicht aussehen wie die Mörder und Mörderinnen des IS. Die alle bieten uns den Vorteil, dass wir sie als fremd und feindselig erkennen können; wir haben keine Schwierigkeit damit, gegen sie vorgehen zu wollen.
Schwieriger ist es aber mit den Gefährdungen von Freiheit und Demokratie, die aus dem Inneren der freien Gesellschaft selbst entspringen. Deren Vorreiter sehen nämlich genau so aus wie Sie und ich oder wie unsere Kinder. Sie hören auch dieselbe Musik, gehen in dieselben Clubs, sehen dieselben Filme, scheinen dieselben Ansichten zu haben wie wir. Es könnte aber auch sein, dass sie unsere Ansichten schon so weit geformt haben, dass wir nur noch glauben, es seien unsere, während es längst schon ihre sind. Kurz: Ich fürchte, heute haben wir es mit einem neuen Phänomen zu tun; einer freiwilligen Kapitulation vor den Feinden der Freiheit. Die findet statt, weil die heutigen Freiheitsfeinde nicht in Uniformen und Panzern daherkommen. Sie sagen sehr freundlich, dass es ihnen um die Verbesserung der Welt ginge. Sie sind smart. Sie fragen nur nie, ob sie jemand um die Verbesserung der Welt gebeten hat. Und sind plötzlich da wie Gäste auf einer Party, von denen jeder glaubt, dass jemand anderer sie eingeladen hat.
Weltbildstörung
Ein Autounfall. Letztes Schuljahr. Wir, die Anti-Kernkraft-links-alternativ-punk-Clique, waren Pizzaessen gewesen. Beim Herausrangieren aus der Parklücke hatte ich vergessen, nach hinten zu schauen. Links in die Fahrerseite des handgerollt orangelackierten Käfers mit dem »Atomkraft? Wie ungeil!«-Aufkleber rauschte mit hässlichem Geräusch ein Taxi. Das hatte nicht ausweichen können, weil es gerade in diesem Moment von einem Polizeiwagen überholt wurde. Absurderweise fuhr direkt hinter dem Taxi auch noch ein zweites Polizeifahrzeug. Ich konnte von Glück sagen, dass es nicht ins vollbremsende Taxi geknallt war, das jetzt nur leicht beschädigt neben dem lädierten Käfer stand.
Aus dem Taxi stieg ein Fahrgast, Anzug und Schlips, der uns, die wir leicht geschockt aus dem Käfer gekrochen waren, sofort zu beschimpfen begann: »Ihr linken Spinner! Ihr Anarchisten! Wollt uns ans Leben! Gehört alle eingesperrt! Seht aus wie die Affen.« Undsoweiter. Ich nahm das eher wattig auf; das Geräusch von Blech auf Blech hallte in meinen Ohren noch nach und außerdem versuchte ich, die Sache mit den beiden Polizeiwagen kognitiv irgendwie zu verarbeiten.
Der Mann beschimpfte uns weiter. Bis ein Polizist auf ihn zutrat: »Sie setzen sich sofort wieder ins Auto und hören auf, ordentliche Staatsbürger zu beleidigen. Sonst zeigen die Sie an. Und ich sage Ihnen, sie haben sehr gute Zeugen!« Der Mann erstarrte, schaute den Polizisten fassungslos an, verschwand nach einem kurzen Augenblick aber ohne weiteres Wort wieder im Taxi.
Wir hatten dann noch eine gute Zeit. Die Polizisten rieten dem Taxifahrer und mir, einfach die Adressen auszutauschen und den Schaden privat zu regulieren, wir versicherten uns, dass alles ja noch mal gut gegangen sei, alle verstanden sich.
Garantiert Freiheit: Polizei.
Dieser Unfall war nicht nur ein Blechschaden, er war die bis dahin tiefste Verbeulung meines gerade frisch gebildeten Weltbildes. Das waren jetzt »die Bullen« gewesen? Also die, die bei Demos immer auf der falschen Seite standen? Die in den Comics von Gerhard Seyfried »Pop! Stolizei!« riefen, weil sie einfach zu allem zu dumm waren? Und auf der Seite eines Staates standen, an dem wir so ziemlich alles falsch und repressiv und kapitalistisch fanden, irgendwie. Die uns jetzt, obwohl der Unfall ja zweifellos einzig und allein meine Schuld war, sofort verteidigten, gegen einen taxifahrenden Bürger?
Taxi und Polizei fuhren davon. Meine Freunde krochen zurück in den Käfer. Ich blickte den davonfahrenden Polizisten noch lange hinterher.
Eigentlich bis heute. Politische Bildung ist, wie man an diesem Beispiel sehen kann, eine Sache der Praxis. Man hat eine freiheitliche Ordnung dann verstanden, wenn man erfährt, dass es Institutionen gibt, die dafür da sind, einen als Staatsbürger gegen Willkür, Beleidigung, Gewalt zu verteidigen. Wenn man erlebt, dass Freiheit nicht einfach da ist, sondern für sie gehandelt werden muss. Dass moderne Staatlichkeit auf der Idee der Freiheit basiert, aber eine Verwaltung, eine Justiz, eine Polizei braucht, um sie praktisch zu gewährleisten. 2015 warb die Bundeswehr in einer Kampagne um neue Rekruten mit dem Satz: »Wir kämpfen auch dafür, dass Du gegen uns sein kannst.« Ziemlich klug. In diesem Satz ist das Paradox der Freiheit auf die kürzest mögliche Formel gebracht. Ihr Geltungsbereich umfasst auch die, die anders sind oder anders denken. Aber ihre Geltung muss man jederzeit gegen die Feinde der Freiheit zu verteidigen bereit sein.
Wer rettet die Welt?
»Das Problem mit Regierungen ist doch, dass sie von Mehrheiten gewählt werden, die sich um die Artenvielfalt einen feuchten Kehricht scheren. Wohingegen Milliardäre durchaus ein Interesse daran haben. Ihnen ist daran gelegen, dass der Planet nicht völlig vor die Hunde geht, weil sie und ihre Erben diejenigen sein werden, die genügend Geld haben, um ihn noch zu genießen.«[2] Die Romanfigur Walter, die das in Jonathan Franzens Epos »Freiheit« sagt, stellt einen Zusammenhang her, der überrascht, einen Zusammenhang zwischen Artensterben, Demokratie und Geld. Auch wenn Walter im Roman ein problematischer Typ ist: Auf die Herstellung von Zusammenhang kommt es an. Wir haben uns angewöhnt, Klimawandel, soziale Ungleichheit, Finanzmarktkrise, Flüchtlinge, Artensterben, Digitalisierung, Globalisierung, Hyperkonsum, Wirtschaftswachstum, Mobilität, Kriege, Überwachung, Terrorismus als voneinander säuberlich getrennte Erscheinungen zu betrachten, als seien sie auch in der Wirklichkeit voneinander getrennt.
Das sind sie aber nicht: Die wachsenden Emissionsmengen, die den Klimawandel anfeuern, haben ihre Ursache in Konsum und Hyperkonsum, die dafür erforderlichen Material- und Energiemengen müssen, wegen des »globalen Wettbewerbs«, so billig wie möglich gewonnen werden, weshalb Raubbau an Naturressourcen wie an menschlicher Arbeitskraft betrieben wird, was zu sozialer Ungleichheit und auch zu Konflikten und Kriegen und Terrorismus führt, weshalb expansive Überwachungsstrategien verfolgt werden, die durch einen privatwirtschaftlich-staatlichen Komplex der Kontrolle von Staatsbürgerinnen und -bürgern gewährleistet werden, der zugleich für personalisierte Beeinflussung verwendet wird, die zu noch mehr Konsum und Hyperkonsum anleitet, was zu mehr Energie- und Materialverbrauch …
Und die Folgen nennen wir dann »Krisen«. Wir haben also eine Klimakrise, eine Flüchtlingskrise, eine Eurokrise, eine Griechenlandkrise, Südeuropa hat eine Wachstumskrise usw. usf. Aber das sind keine Krisen. Die Sache mit dem Klimawandel werden wir ja nicht los. Das Klima ist träge, sein Wandel folgt den Emissionsmengen mit dem Abstand von etwa einer Generation. Was wir heute als Wandel sehen, ist das Ergebnis des industriellen Stoffwechsels vor dreißig bis fünfzig Jahren. Was heute emittiert wird, bestimmt erst das Klima in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. Und was die Flüchtlinge angeht: Wieso sollten die Zahlen zurückgehen? Sie hängen mit Kriegen, Bürgerkriegen, Vertreibungen, Landverlusten, Folgen des Klimawandels, steigenden Nahrungsmittelpreisen, wachsendem Bevölkerungsdruck zusammen – wieso sollte sich daran in Zukunft etwas ändern? Die Eurokrise ist wie die Griechenlandkrise ein ungelöstes Problem, das durch immer neue Schulden weiter in die Zukunft verschoben wird – wo wäre das Ende der Krise? Das Prinzip der Wachstumswirtschaft breitet sich mit ungeheurer Dynamik weltweit aus – wie sollten die ökologischen Folgen – Artenrückgang, Überfischung, Versalzung von Flüssen, Versauerung der Meere – weniger werden?
Gute Zukunft, schlechte Zukunft
Man könnte das jetzt beliebig fortsetzen, aber man erkennt auch so ohne Mühe: Das wird nicht einfach wieder gut. Das sind keine Krisen. Das ist ein Wandlungsprozess. Was die Welt des kapitalistischen Westens, also Europas und Nordamerikas, zusammengehalten hat, was hinsichtlich Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als extrem erfolgreiches Zivilisationsmodell gelten konnte, das hält nicht mehr zusammen. Es gibt Kräfte, die neu dazugekommen sind, geopolitisch, und Kräfte, die sich im Inneren herangebildet haben, finanz- und informationspolitisch. Dieser Kapitalismus ist nicht der, den wir kannten. Er ist räuberischer, desintegrativer, zerstörerischer denn je. Aber das finden nicht alle schlecht.
Der smarte Kollege in der Karikatur von Bob Mankoff hat ja recht. Es sieht nicht gut aus mit der Zukunft im 21. Jahrhundert, womöglich sind wir wirklich »pre-end«. Aber in einer ungleichen Welt trifft auch das Ende unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten, und für einige bedeutet »pre-end« eine phantastische Gelegenheit, gute Geschäfte zu machen. Warum? Weil eine der banalsten Wahrheiten im Kapitalismus darin liegt, dass Angebot und Nachfrage den Preis regeln, weshalb knapper werdende Ressourcen zwar schlecht für viele Menschen sind, für einige aber, die Zugang zu diesen Ressourcen haben, sehr gut. Mehr noch: Wenn Ressourcen knapper werden, verstärken sich die Vorteile, die starke Gruppen, Konzerne und Einzelpersonen haben, gegenüber denen, die schwächer sind, ihre Macht- und Organisationsvorteile nämlich. Die Rechnung ist ganz einfach: Der Nachteil der einen ist der Vorteil der anderen.
Den Starken, die die Macht- und Organisationsvorteile haben, wachsen von Tag zu Tag mehr Machtpotentiale zu. Das liegt zum einen am Kapital, das sie haben, zum anderen an den Daten, über die sie verfügen. Beides bedeutet eine Dynamisierung der Möglichkeiten, mit denen man Macht steigern kann. Das nennt man »smart«.
Die Ergebnisse, die aus diesen Vorgängen folgen, machen die meisten Menschen ärmer, dümmer, ohnmächtiger und zerstören ihre Überlebensbedingungen. Oder die derjenigen, die nach ihnen geboren sind und werden. Diesen Vorgang nennt man Raubbau. Oder Landnahme.
Aber diese Begriffe klingen irgendwie sehr alt im Angesicht dessen, was gerade geschieht. Wir haben es mit einem Geschehen zu tun, das schwer zu überblicken ist; einem Geschehen, in dem nationalstaatlicher Einfluss ebenso auf dem Rückzug ist wie Demokratie. Dafür sind Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf dem Vormarsch, genauso wie eine Art Neo-Feudalismus, in dem gilt, dass die Schwächeren einfach das Pech gehabt haben, schwächer zu sein. Schicksal. Diese neue Ordnung steht, anders als der historische Feudalismus, nicht auf einem religiösen Fundament, wird nicht als gottgegeben annonciert. Gleichwohl sind Glück und Pech auch hier von einer höheren Macht verteilt, die fordert, dass man an sie glaubt. Sie heißt Markt. Die Forderung, an diese Macht zu glauben, ist antimodern, gegenaufklärerisch, gestrig.
Hier entsteht ein neuer Typ von Diktatur. Die smarte Diktatur. Und wenn man nicht gegen sie kämpft, bedeutet das: das Ende der Freiheit.
Während du schliefst
Am 12. Februar 2015 erschien im New York Times Magazine eine Geschichte mit dem Titel »How one stupid tweet blew up Justine Sacco’s life«.[3] Diese Geschichte geht so: Die 30-jährige Justine Sacco, ihres Zeichens Senior Director of Corporate Communications bei der IAC, einem Unternehmen, zu dem die Videoplattform Vimeo gehört, befindet sich auf einer Reise nach Südafrika, um ein paar Tage Ferien zu machen. Die ganze Zeit schon hat sie spaßige Tweets über Mitreisende abgesetzt, über einen »bescheuerten Deutschen« beispielsweise, der schlecht riecht und besser ein Deodorant benutzen sollte. Justine macht es Spaß, zu twittern. Von London Heathrow aus, wo sie ihr Flugzeug nach Kapstadt besteigt, schreibt sie den folgenden tweet: »Going to Africa. Hope I don’t get Aids. Just kidding. I’m white!«
Sie besteigt das Flugzeug. Der Flug von London nach Kapstadt dauert elf Stunden. Nach der Ankunft schaltet Sacco ihr Smartphone an. Die erste Nachricht, die sie vorfindet, stammt von einer Person, von der sie seit ihrer Highschoolzeit nichts mehr gehört hat: »Es tut mir so leid, was da gerade geschieht.« Die zweite Nachricht: Ihre beste Freundin, Hannah, bittet sie um einen sofortigen Anruf. Unablässig gehen weitere Nachrichten ein. Dann klingelt das Handy. Hannah ist dran und teilt Justine mit: »Du bist die weltweite Nummer 1 auf Twitter.«
Die Ereignisse hatten sich überschlagen, während Justine in ihrem Flugzeugsitz schlief. Inzwischen gab es nicht nur einen gigantischen Shitstorm, der noch während des Fluges über sie hereingebrochen war, sondern einen Hash-Tag #HasJustine LandedYet, mit dessen Hilfe sich die rasend schnell entstandene Meute wechselseitig informierte. Tatsächlich gab es soziale Netzwerker, die sich in Kapstadt zum Flughafen begaben, um Sacco bei der Ankunft zu fotografieren – die Verfolgung wechselte von online zu offline; das ist der Moment, in dem virtuelle Gewaltbereitschaft in reale übergeht. Justines Arbeitgeber IAC hatte zwischenzeitlich mitgeteilt: »Dies ist ein ungeheuerlicher, beleidigender Kommentar. Die verantwortliche Mitarbeiterin befindet sich im Augenblick auf einem internationalen Flug und ist daher nicht erreichbar.«
Machen wir es kurz: Justine Sacco ist ihre komplette soziale Existenz in den paar Stunden zwischen London und Kapstadt abhanden gekommen. Die IAC hat sie gefeuert, ihre südafrikanischen Verwandten, die lange gegen die Apartheit gekämpft hatten, fühlten sich durch ihren Tweet verletzt, der Shitstorm ebbte nicht ab, sie wurde medial verfolgt, alte Tweets von ihr wurden ausgegraben und umgehend veröffentlicht (»16 tweets Justine Sacco regrets«) usw. usf. Eine besondere Ironie liegt darin, dass ein Flugzeug so ziemlich noch der einzige Ort auf der Welt ist, an dem man nicht erreichbar ist. Sacco konnte also nicht online miterleben, wie gerade ein Prozess gegen sie eröffnet worden war und seinen Lauf nahm. Sie war erst wieder dabei, als das Urteil online schon gesprochen war. Die Strafe erfolgte offline, im wirklichen Leben. Wie war das alles möglich?
Offensichtlich sehr einfach. Im Zeitalter der sogenannten sozialen Netzwerke und der »Überall-Medien« wie Handys, Drohnen und Kameras ist es extrem leicht, Menschen zu Opfern sozialer Ausgrenzung zu machen. Man braucht nur einen minimal skandalisierungsgeeigneten Anlass und eine ausreichende Menge an Followern, um einen veritablen Shitstorm zu entfachen. Zur Begriffserklärung: Follower sind Mitläufer eines Kollektivs, ein Shitstorm ist die kollektive Ausscheidung der Scheiße, die die Mitläufer im Kopf haben. Eigentlich eine anatomische Unmöglichkeit, aber das digitale Zeitalter bringt ja bekanntlich viele Wunder hervor. Man wird nicht sagen können, dass Justines Tweet sonderlich intelligent war, aber ganz sicher war für seine Verwendung als Vernichter ihrer Existenz etwas notwendig: Man musste ihn aus dem Kontext reißen. Denn genau gelesen war ihr getwitterter Satz nicht rassistisch, sondern ein Spiel mit rassistischen Stereotypen.
Als Angehörige einer südafrikanischen Familie ist ihr das geläufige Vorurteil, dass Aids in Afrika vor allem auf das angeblich promiske Sexualverhalten der schwarzen Bevölkerung zurückzuführen sei, natürlich bestens bekannt, und ihr Spiel mit der Angst und der sofortigen Abwiegelung, sie könne ja kein Aids bekommen, da sie ja weiß sei, ist ein auf Twitter-Länge gebrachter Diskurs über rassistische Phobien, die sexuell grundiert sind. Auf jeder Kabarett-Bühne wäre das als halbwegs gelungener Gag durchgegangen. Der Maschine der sozialen Netzwerke aber ist Ironie wesensfremd. Ironie braucht die Intelligenz des Zusammenhangs, aber gerade die Zerstörung von Zusammenhängen ist das wichtigste Prinzip der Skandaltechnologie. Im Internet kommt dieses Prinzip so zur Geltung wie niemals zuvor in der Geschichte der menschlichen Kommunikation.
Man braucht Justines Satz nur wörtlich zu nehmen, und schon ist er eindeutig rassistisch. Und in den sozialen Netzwerken reicht schon ein dumpfbeuteliger Retweeter, der etwas wörtlich nimmt, was wörtlich nicht zu verstehen war, um eine Lawine loszutreten, wie sie Justine Sacco zum Verhängnis wurde. Der Ausbreitungsmechanismus wird in dem erwähnten Artikel aus dem New York Times Magazine gut dargelegt; letztlich ist er total simpel: Jemand muss den Tweet absichtlich oder unabsichtlich falsch verstehen, alsdann sein Netzwerk dazu bringen, in seine Empörung einzustimmen, dann muss die Welle der Empörung jemanden erreichen, der professionell in der Abteilung ich-bin-dafür-zuständig-jede-diskriminierende-Äußerung-mit-aller-Macht-zu-verfolgen-egal-ob-ich-sie-verstanden-habe-oder-nicht tätig ist, also irgendein Blogger oder selbsternannter Aktivist für risikofreien Widerstand, und dann muss die Zustimmungschance zu den Empörungsreaktionen so groß und attraktiv sein, dass selbst Rassistinnen und Rassisten in den Shitstorm einsteigen können – denn schließlich geht es ja darum, jemanden ohne das allergeringste persönliche Risiko fertigzumachen. Das tun ja besonders Rassisten gern.
Mussten 1933 die SA-Männer, die jüdische Geschäfte blockierten oder Menschen durch die Straßen trieben, was eine frühe Form des Shitstorms war – mussten die immerhin noch Gesicht zeigen, so ist das heute keineswegs mehr erforderlich. Aus der Anonymität des Netzes heraus geht jede Form von Ausgrenzung und Hetze, ohne dass ein Hetzer auch nur im mindesten Gefahr läuft, seinerseits dafür belangt zu werden. Das heißt: Diese Form der Kommunikation erlaubt eine radikal asymmetrische Machtverteilung, den Zusammenschluss Vieler zum Zweck der Beschämung eines oder einer Einzelnen.
Shaming
Das ist widerwärtig, aber nicht neu. Denn »Shaming« ist wahrscheinlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Jede Gesellschaft, die wir kennen, unterscheidet zwischen Zugehörigen und Nicht-Zugehörigen. Diese Unterscheidung kann sich auf sehr viele Merkmale stützen: Sie kann biologisch, national, regional, geschlechtlich, sozial begründet sein, führt aber ganz unabhängig von der jeweiligen Begründung zur Schaffung einer Gruppe von Zugehörigen und einer – meist kleineren – Gruppe von Außenseitern. Die Mitglieder der Mehrheit schreiben sich selbst positive und den Außenseitern negative Eigenschaften zu; die Definition von »Anderen« hat immer die Funktion, die Selbstbewertung und die Kohärenz der eigenen Gruppe zu verbessern. Und die Beschämung der Außenseiter basiert gerade auf der Behauptung, sie würden die Standards der Etablierten nicht erfüllen.[4]
Wie gesagt: Das ist absolut nichts Neues. Die Geschichte hat von den frühesten Stammesgesellschaften bis zu den totalitären Gesellschaften des 20. Jahrhunderts jede Spielart von Ein- und Ausgrenzung vorgeführt. Beides gehört zusammen. Das liegt daran, dass Menschen in Gruppen existieren und Identität sich nicht nur daran definiert, wer man ist, sondern auch daran, wer man nicht ist. Was aber neu ist: Heute sind die Kategorien von Zugehörigkeit und Ausgeschlossensein anscheinend total flexibel, sie lösen sich von der identitären Gruppe ab. Und sie brauchen keinerlei Vorgeschichte. Im Gegenteil: Sie zeichnen sich gerade durch das Fehlen jeder Vorgeschichte aus. Eine besonders widerliche Variante liefert eine neue App, die Fotos, die man von Obdachlosen in New York macht, automatisch auf eine Stadtkarte stellt, damit jeder sehen kann, wo jemand liegt oder sitzt. Dann kann man um diese Stelle einen Bogen machen oder, je nach Persönlichkeitsstruktur, vielleicht hingehen, um den Obdachlosen zu beschimpfen, auszurauben oder zusammenzuschlagen.[5]
Das Shaming im digitalen Zeitalter bedeutet aber nicht nur das Beschädigen einer beliebigen Person, die negative Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, sondern dient dem spontanen Kollektiv, sich im Modus des Shaming zu bilden: »eine pluralistische Gesellschaft, die sich nicht mehr an positiv zu bestimmende Werte gebunden fühlt, eine Gesellschaft, die in ganz unterschiedliche Welten und Wirklichkeiten zerfällt, fingiert eine Einheit, eine kollektive Moral in der Abgrenzung und dem gemeinsamen Zorn auf das, was sie als schlecht und böse erkannt hat.«[6] Historisch betrachtet könnte man sagen: Eine bessere Ausgangslage für Mobs und Pogrome gegen tatsächliche oder vermeintliche Andere lässt sich nicht denken.
Dies lässt sich auch an der täglich zunehmenden Hetze, an den aus der Anonymität heraus gemachten Androhungen von Gewalt, an Beschimpfungen und Diffamierungen sehen: Das, was früher ein gesamtgesellschaftlich unbedeutendes Dasein an Stammtischen, vor dem Fernseher und in Fußballstadien führte, dringt mit dem Internet in die Sphäre der öffentlichen Kommunikation ein: hier, und das ist das eigentliche Problem, gilt jede Äußerung gleichviel. Und wie früher die Grenze zwischen verbaler und manifester Gewalt schmal und brüchig war, so ist sie es auch heute, und dabei müssen die Gewalttäter mit den Maulhelden nicht identisch sein, sondern können sich durch letztere auch nur aufgefordert fühlen, zuzuschlagen. Die Grenze liegt jetzt nicht mehr zwischen verbal und manifest, sondern zwischen online und offline.
Ein Traum wird Wirklichkeit
Wie hat man eigentlich das Verhalten von Bürgern und Mitmenschen bewertet, als es noch kein Internet gab? Gar nicht, vorausgesetzt es handelte sich nicht um »Personen des öffentlichen Lebens«, die mussten schon immer einiges über sich ergehen lassen. Privatmenschen waren dagegen allenfalls Objekt von Klatsch, aber ob jemand zu viel Alkohol trank, ein Angeber war, ein Langweiler oder ein Phantast: Das galt als private Angelegenheit, und die private Existenz von Menschen ist in freien Gesellschaften nicht Gegenstand von Bewertungen. Das alles konnte sich auf den Erfolg im Job oder bei der Partnersuche auswirken, unterlag aber keiner Bewertung durch irgendeine übergeordnete Instanz. Heute gibt es eine solche Instanz, die einen Namen hat, über den die Historiker des 23. Jahrhunderts nachdenken werden. Soziale Netzwerke. Soziale Netzwerke sind eine Sozialform der Kommunikation und Bereitstellung von Bewertungen. Alles, was jemand im Netz an Inhalten absondert, dient zugleich als Datum, das zum Zweck einer Bewertung verwendet werden kann, ebenso wie alle seine Klicks und Likes, seine Suchanfragen und Bestellungen von irgendetwas. Alles zusammen liefert eine komplette Bewertungsmatrix der Person. Die kann vielfältig verwendet werden: um ihr noch mehr Produkte anzudrehen, aber auch zu Zwecken ihrer Disziplinierung.
Die Chinesen haben da schon mal einen Vorschlag. Er heißt »Soziales Kreditsystem« und berechnet sich nach unterschiedlichen Merkmalen und Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger, etwa nach der Kreditwürdigkeit, Aktivitäten in Sozialen Netzwerken, dort geäußerten Meinungen usw. Dazu werden Daten von Banken, Unternehmen und sozialen Netzwerken miteinander verknüpft. Je nachdem nimmt man einen Platz auf einer Rangskala zwischen 350 und 950 Punkten ein. »Wohin man geht, was man kauft, wie viele Strafpunkte man auf dem Führerschein hat – all das wird erfasst und an die Identifikationsnummer gekoppelt. Verwaltet wird das System vom Versandriesen Alibaba und dem Online-Konzern Tencent, die alle sozialen Netzwerke in China betreiben und deshalb Zugang zu gigantischen Datenmengen und Sozialkontakten haben.«[7] Natürlich ist das alles total transparent: Seinen eigenen score kann man mittels einer App mit dem großartigen Namen »Sesame Credit« einsehen; wenn man parteikonforme Meinungen postet und schön bei Alibaba bestellt, steigt er. Einkaufen bei der Konkurrenz oder Kritik schaden sichtlich: Der Score fällt sofort. Das ist nicht alles: Man kann auf einer Internetseite auch den Score seiner Freunde einsehen, oder den seiner Feinde. Sogar das Verhalten der eigenen Freunde in den sozialen Netzwerken wirkt sich auf die eigene Punktzahl aus – auf diese Weise wird jeder zum Blockwart des anderen. Bei Wohlverhalten wirken Vergünstigungen, etwa Reisevisa; auch bei der Karriere dürfte ein guter Rangplatz auf der Skala wichtig werden. Das Regime führt das soziale Kreditsystem erst mal auf freiwilliger Basis ein, testweise gewissermaßen. Man könnte auch sagen: um die Leute schon mal an ein neues Disziplinarsystem zu gewöhnen. Eines, das sie sich selbst auferlegen. Ab 2020 soll es verbindlich werden. Die digitalen Möglichkeiten sind uferlos. Man sieht es immer wieder.
Genauer gesagt: Die digitalen Möglichkeiten der Einführung von Selbstzwangtechnologien sind uferlos. Heute muss man schon daran erinnern, dass die Zeit nicht so lang zurückliegt, in der es digitale Überwachung überhaupt noch nicht gab. Vor einem halben Jahrhundert gab es zum Beispiel weder Videokameras an Straßenkreuzungen noch SMS-Nachrichten noch WhatsApp noch Instagram noch Twitter. Das Mobiltelefon war noch ein Vierteljahrhundert entfernt, und selbst als es die ersten klobigen Handys gab, hätte noch niemand gedacht, dass man mit einem Telefon einmal fotografieren oder Filme drehen könnte. Die Drohne war ein phlegmatisches Tier aus dem Reich der Bienen, und die Aufdeckung eines Sex-Skandals erforderte aufwendigste Investigation. Das Fehlen all dieser Technologien bedeutete praktisch: Das Leben war auch dann privat, wenn jemand seine geheimsten Wünsche Wirklichkeit werden ließ oder den größten Blödsinn von sich gab. So etwas ging niemanden etwas an, außer den Beteiligten natürlich. Für alle anderen war das, mit einem schönen Wort, unbeachtlich.
Heute ist der Weg vom Privaten ins Öffentliche kurz, so kurz, dass es eigentlich von völlig willkürlichen Faktoren abhängig ist, ob und wie lange etwas verborgen bleibt. Alles, was jemand tut, ist potentiell beachtlich und damit grundsätzlich niemals mehr privat.
Ein paar Daten dazu? Gar nicht so einfach, weil man keine belastbaren Statistiken für die Überwachung im öffentlichen Raum findet – zu viele Kameras sind privat installiert, fliegen in Spielzeugdrohnen, sind an Baumstämme montiert, um Wildwechsel zu beobachten, oder sitzen als sogenannte GoPros auf Helmen von Mountainbikern und sonstigen Abenteuersportlern. 2014 wurden in Augsburg eine 18-jährige und ein 19-jähriger wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verurteilt, weil sie den Namen »Erlebnisgrotte« in der »Felsenlandschaft« der »Titania-Therme« im bayerischen Neusäß allzu wörtlich genommen und dort Sex hatten. Was sie nicht wussten: In der vermeintlichen Grotte war eine Unterwasserkamera installiert.
In Berlin sind offiziell 12000 Kameras an Straßenkreuzungen, in S-Bahnen, an öffentlichen Gebäuden installiert, in Bayern zählen Land und Kommunen 17000 Kameras, wohl in beiden Fällen nur die Spitze des Eisbergs. In England kommt auf zehn Einwohner eine Überwachungskamera. Wo irgendeine Ecke nicht ausgeleuchtet ist, schaut ein Hubschrauber oder eine Drohne genauer hin. Die Briten waren die ersten, die mit der Videoüberwachung im großen Stil begonnen haben; heute ist England eines der am stärksten überwachten Länder der Welt.
Der »National Police Air Service« ist, wie man das von Engländern erwartet, eine sehr humorvolle Stasi und kommentiert seine im Internet veröffentlichten Überwachungskamerabilder gern mit Sätzen wie »Herrliches Wetter heute«. Man erlaubt sich auch mal ein Quiz für seine Bürgerinnen und Bürger: »›Bei der Arbeit in Zentrallondon haben wir heute einen gewissen energetisch-lustigen Mann entdeckt … Können Sie erraten, wen?‹ O ja, das konnten die 120000 Follower, denn es handelte sich um den Star-Comedian Michael McIntyre, der morgens um 8.03 Uhr auf dem Leicester Square fotografiert wurde.«[8]Dieser freundliche Morgenscherz zog eine Rüge des zuständigen Ministers nach sich; immerhin handele es um ein Überwachungsfoto, das nicht »zum Spaß« aufgenommen wurde. Vorerst müssen die Polizisten also ihren Spaß für sich behalten.
Im Juli 2015 wurde die »Avid Life Media« (ALM) gehackt. Die Firma betreibt unter anderem die Website »Ashley Madison«, ein Seitensprungportal mit etwa 37 Millionen eingetragenen Nutzern. Deren Daten, Fotos, Wünsche und Vorlieben befanden sich nun in der Hand von Kriminellen; Millionen Ehen, Beziehungen, Karrieren waren mithin von einem Augenblick auf den anderen gefährdet. Die Hacker argumentierten moralisch (»Wie blöd für diese Männer, dass der Konzern Sicherheit versprochen hat, aber sein Versprechen nicht eingelöst hat.«), aber vermutlich ging es um Erpressung. ALM war zu diesem Zeitpunkt kurz davor, an die Börse zu gehen, ein Datenskandal dabei sehr hinderlich.[9] Im August 2015 machten die Datendiebe ihre Beute tatsächlich öffentlich.
Solche Dinge liest man so oft, dass die eigentliche Neuigkeit nicht auffällt: die liegt darin, dass sich durch legale Verfügung über Daten wie im Fall des »National Police Air Service« ebenso wie durch kriminelle Aneignung wie im Fall ALM informationelle Macht gewinnen lässt, die nicht gegen eine einzige Person, ein ausgesuchtes Opfer, gerichtet wird, sondern potentiell gegen Millionen. Diese Möglichkeit ist den Gebrauchern und Missbrauchern allein dadurch zugewachsen, dass die Daten permanent gesammelt und unter mehr oder weniger klar definierten Bedingungen abgerufen werden können. So etwas wäre, wie gesagt, vor nur zwei Jahrzehnten nicht möglich gewesen, aber niemanden scheint diese Annullierung der Voraussetzungen unserer privaten Existenz wirklich zu beunruhigen. Selbst der ebenfalls Mitte 2015 durch Wikileaks aufgedeckte Sachverhalt, dass seit den Zeiten von Gerhard Schröder Bundeskanzler nebst Entourage systematisch abgehört wurden, hatte keinen öffentlichen Aufregungswert und war schon am nächsten Tag wieder aus den Medien verschwunden.
Hier ist auf höchst bemerkenswerte Weise ein sozialpsychologisches Phänomen wirksam, das Phänomen der »shifting baselines«. Damit bezeichnet man den Umstand, dass Menschen in sich wandelnden Umgebungen den Wandel nicht registrieren, weil sie ihre Wahrnehmungen permanent parallel zu den äußeren Veränderungen nachjustieren.[10] Es existiert mithin kein Referenzpunkt, an dem sich der kontinuierliche Wandel festmachen lassen würde. Anders als disruptive Ereignisse wie Erdbeben, Regimewechsel, Unfälle wird solcher Wandel nicht als einschneidend wahrgenommen; meist bleibt er überhaupt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle.
Im Fall der informationellen Selbstbestimmung ist das aber trotzdem erstaunlich, weil gerade hier eine so große Diskrepanz zwischen der spektakulären Dimension der Veränderung und ihrer Eindringtiefe in die privateste Existenz einerseits und andererseits der achselzuckenden Unaufgeregtheit besteht, mit der das hingenommen wird. Auch die Politik versagt hier radikal – in den Worten der bereits zitierten Süddeutschen Zeitung: »Das liegt auch daran, dass die Politik in den letzten Jahren nie als Korrektiv des marktwirtschaftlichen Datenrauschs gewirkt hat, sondern, wenn sie es denn intellektuell überhaupt geschafft hat, die Technologie zu erfassen, als Beschleuniger.«[11]
In der Tat: Was Strategien des Überwachens und Datensammelns angeht, sind Staaten und ihre Geheim- und Nachrichtendienste nachgerade hyperaktiv. Den größten Schub für den Überwachungsfuror lieferte der Anschlag auf das World Trade Center 2001 und der sodann umgehend ausgerufene »Krieg gegen den Terror«, der die Kooperation von westlichen Geheimdiensten ebenso intensiviert hat wie die Dauerausforschung aller Bürgerinnen und Bürger. Und der dafür gesorgt hat, dass etablierte grundrechtlichte Standards in den demokratischen Rechtsstaaten an vielen Stellen perforiert wurden. Das bereits erwähnte England beispielsweise hat nicht nur die größte Kameradichte im öffentlichen Raum weltweit, als Mutterland der Demokratie erlaubt es sich heute, terrorismusverdächtige Personen 42 Tage ohne richterlichen Beschluss inhaftieren zu dürfen oder der amerikanischen NSA bei der »Überstellung« verdächtiger Personen zu helfen, die dann auch unter Folter »verhört« werden können.[12] Die Skandale der Übertretung von Bürger- und Völkerrecht seither sind unzählbar; das eigentlich Erstaunliche dabei ist die ausbleibende Beunruhigung aufseiten der Bevölkerungen in den westlichen Demokratien darüber, dass hier die Grundvoraussetzungen von Rechtsstaatlichkeit systematisch unterminiert werden.
Heuhaufen werden digital
Die Zahl der (offiziellen) Mitarbeiter der NSA hat sich gegenüber der Zeit vor nine-eleven um ein Drittel erhöht, der Etat hat sich verdoppelt, die Geheimdienste der USA insgesamt sehen heute mehr als 107000 Planstellen vor; da sind die privaten Vertragsfirmen, die Dienstleistungen für die NSA erbringen, noch nicht mitgerechnet.[13] Der Datenhunger dieser Behörde ist in einem Satz zusammengefasst, den General Keith Alexander, der frühere NSA-Chef, gesagt hat, den aber ein surrealistischer Dichter nicht besser hätte formulieren können: »Sie brauchen den Heuhaufen, um die Nadel zu finden.«
Der Heuhaufen ist ziemlich groß. Laut Schätzungen des skandinavischen Research-Centers »Sintef« wurden 90 Prozent aller Daten, die die Menschen je generiert haben, in den letzten zwei Jahren produziert. Diese Zahl stammt aus dem Jahr 2013, ist also uralt. »Google sammelt pro Tag 24 Petabyte, Facebook erhält pro Stunde 10 Millionen neue Fotos, und pro Tag geben die Nutzer dieses sozialen Netzwerks etwa drei Milliarden Kommentare oder ›Gefällt mir‹-Klicks ab. Die Nutzer des Videokanals YouTube laden pro Sekunde eine Stunde Videomaterial hoch. Und die Anzahl der Twitter-Kurznachrichten lag 2012 bei über 400 Millionen pro Tag.«[14]
Keith Alexanders Satz bringt zum Ausdruck, dass der gigantische Apparat aufgebaut wurde, um präventiv Terrorverdächtige auszumachen. Allerdings scheint er für diesen Zweck, nämlich Terroristen daran zu hindern, Anschläge zu verüben, völlig untauglich. Er hat seinen Zweck in sich selbst. Tatsächlich wurde ja weder der Anschlag von Anders Breivik in Oslo und Utoya im Sommer 2011 verhindert, noch der beim Boston-Marathon im April 2013, noch die Ermordung der Charlie-Hebdo-Redakteure in Paris im Januar 2015; wir wissen auch nichts von verhinderten Attentaten in Mumbay, Islamabad, Bagdad usw. usf. durch die rastlosen Aktivitäten der NSA und ihrer verbündeten und unverbündeten Geheimdienste. Offiziell ist von 54 Anschlägen die Rede, die die NSA rechtzeitig erkannt und verhindert habe. Laut einer Recherche von »ProPublica« halten lediglich vier davon einem akribischen Faktencheck stand.[15] Aber man muss gar nicht auf die NSA schauen. Als symptomatisch für die Ineffizienz der Totalüberwachung kann auch die Inhaftierung eines islamistischen Ehepaares in Deutschland im Frühjahr 2015 gelten, das möglicherweise einen Anschlag auf das internationale Radrennen »Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt« geplant hatte. Hier kam der entscheidende Hinweis keineswegs aus den Datenspeichern des BND oder der NSA, sondern von einer aufmerksamen Baumarktmitarbeiterin, der die vom Ehepaar gekaufte Menge Wasserstoffperoxid verdächtig vorkam und die daraufhin die Polizei verständigte.
Angesichts der offenbar äußerst dünnen Erfolge der umfassenden Überwachung erscheint der in den vergangenen 15 Jahren betriebene Datensammel-Aufwand nachgerade absurd – oder nur für den Fall sinnvoll, dass er anderen Zwecken dient, etwa einer künftigen Unruhen- oder Aufstandsbekämpfung. Dafür sind Massendaten zweifellos sehr gut zu verwenden, denn dann geht es darum, »Rädelsführer«, »Störer« und »Radikalisierte« zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Mit Terrorismusprävention zu argumentieren ist nicht mehr als Überwachungsmarketing.
Eine hervorragende Zusammenfassung der gegenwärtigen Überwachungspraxis liefert das Buch »NSA-Komplex« der beiden SPIEGEL-Redakteure Marcel Rosenbach und Holger Stark, die die unglaubliche Expansion der Überwachungsaktivitäten der NSA und der mit ihr kooperierenden Geheimdienste minutiös rekonstruiert haben. Sie sprechen von einer bereits heute existierenden »totalen Überwachung«, die mit Hilfe von Spionageprogrammen, Anzapfen von Glasfaserkabeln, Abhören von Telefonaten, Mitlesen von SMS und E-Mails erfolgt und eben nicht nur Terrorverdächtige, was immer das ist, im Netz der informationellen Kontrolle einfängt, sondern buchstäblich Jede und Jeden, sofern er oder sie mit Hilfe elektronischer Mittel kommuniziert.
Dabei kommt der NSA vor allem zugute, dass heutzutage fast jeder die perfekte Überwachungsunit in der Hosen- oder Manteltasche trägt: Diese mit Mikrophonen und Kameras ausgestatteten mobilen Endgeräte machen es möglich, die Bewegungen ihrer Benutzer im Raum genauso zu registrieren wie ihre schriftlichen und mündlichen Kommunikationen – als sogenannte Metadaten, die Profile über das Verhalten von Gruppen zu erstellen erlauben, ebenso wie als individuelle Daten, die einzelnen Personen völlige Transparenz verleihen, selbstverständlich ohne deren Wissen.
Für den gemeinen Staatsbürger mag das einzig Erfreuliche daran sein, dass in diesem Universum der Überwachung tatsächlich mal alle Menschen gleich sind – die Bundeskanzlerin wird ja genauso abgehört wie Sie oder ich, wahrscheinlich sogar intensiver. Aber diese Form des Überwachungssozialismus vermag kaum zu trösten, wenn der Preis dafür der vollständige Verlust von Privatheit ist. Die Computer der NSA durchsuchen die Daten, die über die großen Glasfaserkabel laufen, »nach Stichworten, die von einem für die Erfassung von Zielen zuständigen Referat festgelegt wurden und die einer vom Weißen Haus vorgegebenen Liste mit Länderschwerpunkten folgen. Ausgesiebt werden zwischen 10 und 40 Prozent, Metadaten ebenso wie Inhalte, Telefongespräche und so weiter. Am Ende des Selektionsprozesses werden in zwei Datenbanken 43 Gigabyte und 132 Gigabyte Daten eingespeist, die dann von verschiedenen Abteilungen der NSA weiterverarbeitet werden – all dies geschieht an einem einzigen Tag.«[16]
Der hegemoniale Zugriff der NSA auf alles, was sich im Bereich elektronischer Kommunikation abspielt, geht historisch darauf zurück, dass der Ursprung des Internet in den USA liegt und der größte Netzwerkhersteller Cisco und der größte Cloud-Anbieter Amazon dort ihre Sitze haben. »Google, Amazon, Ebay, Skype, Apple, Microsoft, Facebook & Co. sind Firmen, die Standards setzen und den Markt beherrschen. Die digitale Dominanz amerikanischer Dienste und Konzerne ist erdrückend. Im Netz sind die USA immer noch eine unangefochtene Supermacht.«[17]
Wenn 90 Prozent aller Internetnutzer – das sind heute etwa 3,2 Milliarden Menschen – Google benutzen und es mittlerweile 1,5 Milliarden Facebook-Nutzer gibt (jede Sekunde kommen sechs neue dazu),[18] kann man sich in etwa vorstellen, wie groß die Macht der Überwacher ist: denn jede Nachricht, jede Suche, jeder Klick, jedes Liken, jede Weiterleitung einer Nachricht, jeder Tweet usw. usf. liefert Informationen über alle, die da als unermüdliche Datenlieferanten tätig sind. Hochgeladene Fotos können per Gesichtserkennung zugeordnet werden, Freundschaftsnetzwerke, Einkaufs- und Mobilitätsgewohnheiten dechiffriert, geheime Vorlieben identifiziert werden – all dies ist nicht neu, spricht sich in seiner Funktion als Machterzeugungsmaschine offensichtlich aber noch immer nicht herum. Nimmt man die unendliche Menge an Daten hinzu, die vertrottelte Autokäufer, Haus- und Wohnungsbewohner, die sich mit »smarter« Technologie haben ausstaffieren lassen, Selfie- und sonstige Peinlichkeitsposter ohne Unterlass erzeugen, dann weiß man ungefähr, was hier an Machtquellen zur Verfügung steht.
Teenager benutzen ihr Smartphone im Schnitt einhundertzehnmal pro Tag.
Vor allem, seit es Smartphones gibt, und das ist seit noch nicht einmal einem Jahrzehnt der Fall, hat sich die Datenverfügbarkeit radikal erhöht. Dass die mit Hilfe des NSA-Programms »Prism« abgeschöpften Unternehmen der Informationsindustrie die geheimdienstlichen Aktivitäten gelegentlich für problematisch halten, verwundert nicht – schließlich leben ihre Geschäftsmodelle vom schlafwandlerischen Vertrauen, das ihre Nutzerinnen und Nutzer in sie setzen. Dieses Vertrauen ist gefährdet, wenn die NSA invasiv Daten dieser Unternehmen abschöpft, was sie mittlerweile auch selbst realisiert: »98 Prozent der ›Prism‹-Ergebnisse beruhen auf Yahoo, Google und Microsoft; wir müssen sicherstellen, dass wir diesen Quellen keinen Schaden zufügen.«[19]
Natürlich ergibt die Kombination der Überwachungs- und Ausforschungsbedürfnisse von Geheimdiensten mit der uferlosen Datensammelwut von Unternehmen aus kommerziellen Gründen die unheilvollste Allianz, die man sich überhaupt vorstellen kann: Beides zusammen macht die einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger vollkommen wehrlos gegenüber den allfälligen Zugriffsmöglichkeiten auf ihr Inneres von Außen. Umso schlimmer, wenn das Bewusstsein über die eigene staatsbürgerliche Verletzlichkeit so verschwindend gering ist, wie es gegenwärtig scheint – da haben NSA-Mitarbeiter allen Grund, sich über iPhone-Käufer als »zahlende Zombies« lustig zu machen, die auch noch Geld ausgeben, um ihre eigene Stasi-Leitstelle mit sich herumzutragen.[20]
Das hat es historisch noch nicht gegeben: Denn zu früheren Zeiten waren Geheimdienste und Geheimpolizeien noch darauf angewiesen, die Daten, die sie zur Ausforschung der Bürgerinnen und Bürger benötigten, selbst über Einbrüche, Lauschangriffe, Anheuern von Spitzeln, Belohnung von Denunzianten, verdeckte Ermittler usw. zu erheben. Heute liefern sie den Diensten alles frei Haus, die Bürgerinnen und Bürger. Organisationen wie die NSA und der BND und alle anderen müssen diese Datenflut nur noch in ihre Kanalisationssysteme leiten. Das macht alle zu Komplizinnen und Komplizen ihrer eigenen Überwachung.
Schönhaus
Ich habe in meinem Leben eine Reihe von Menschen kennengelernt, die mich sehr beeindruckt haben. Einer davon ist Cioma Schönhaus. Schönhaus ist Jude und zählte im Nationalsozialismus als junger Mann damit zur Gruppe der Verfolgten. Wie viele dieser verfolgten Personen stand er 1941 in Deutschland vor der Frage: Soll ich mich deportieren lassen, oder soll ich untertauchen?
Diese Frage war für viele Verfolgte insofern auch sehr komplex, weil sie meist nicht allein die Aufforderung bekamen, sich deportieren zu lassen, sondern weil die ganze Familie betroffen war. Oft waren die älteren Familienmitglieder dazu geneigt, sich deportieren zu lassen, weil sie eher ordnungsgläubig waren und die Hoffnung hegten, es würde schon nicht so schlimm kommen. Während die Jüngeren nicht selten eine größere Sensibilität dafür hatten, dass das tödlich enden würde, so dass die Familien schon in solchen Situationen zerbrechen konnten. Jedenfalls sind die Jüngeren relativ häufiger untergetaucht, während die Älteren sich nach Theresienstadt oder Auschwitz haben deportieren lassen.
Schönhaus arbeitet in einer Fabrik und hat von seinen Arbeitgebern eine Bescheinigung, dass er dort gebraucht wird, seine Eltern haben so etwas nicht. Die Eltern beschließen, sich deportieren zu lassen, Schönhaus sagt: »Ich mache das nicht, versteht das bitte, ich bleibe hier.« Nachdem er zuerst durchkommt mit seiner Bescheinigung, aber dann wenige Wochen später wiederum von der Gestapo aufgefordert wird, sich an der zentralen Sammelstelle einzufinden und sich deportieren zu lassen, beschließt er, unterzutauchen.
Es gab in Berlin zu jener Zeit und in den Folgejahren einige tausend Menschen, die untergetaucht sind und die mit Hilfe von sozialen Netzwerken überleben konnten, womit natürlich nicht die sozialen Netzwerke von heute gemeint sind, sondern informelle Hilfeorganisationen, in denen Menschen, oft mit erheblichem Risiko für ihre eigene Sicherheit, dafür sorgten, dass Verfolgte irgendwo versteckt und mit Nahrung versorgt werden konnten.[21] Natürlich sind auch viele der Untergetauchten, der sogenannten U-Boote, aufgeflogen, unter anderem, weil es Spitzel gab: Menschen, die selbst Verfolgte waren, wurden von der Gestapo angeheuert, suchten systematisch nach anderen U-Booten und verrieten sie. Sie wurden »Greifer« genannt.[22]
Schönhaus entgeht seiner Entdeckung, indem er als Untergetauchter etwas Spektakuläres macht: Er versteckt sich nicht