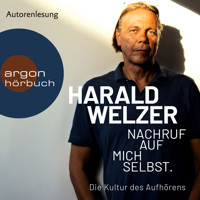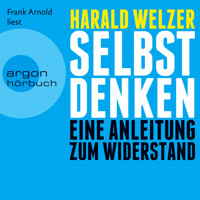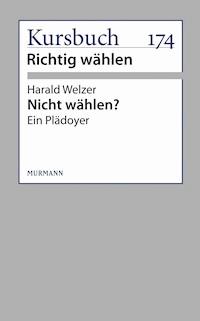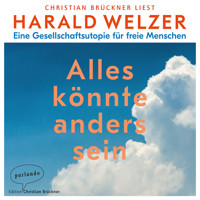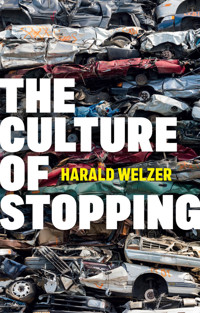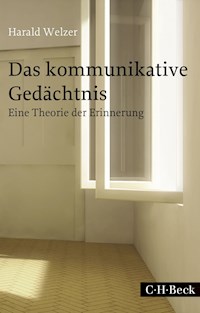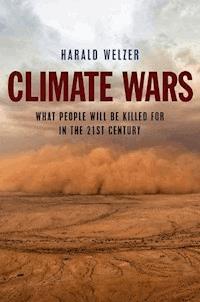9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Zeit des Nationalsozialismus. "Schwarze Reihe".
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Auf beunruhigende Weise wird gezeigt, wie Tötungsbereitschaft erzeugt wird und wie wenig wir unseren moralischen Überzeugungen trauen können. Über den Holocaust ist viel geschrieben worden, aber die wichtigste Frage ist bis heute nicht beantwortet: Wie waren all die "ganz normalen Männer", gutmütigen Familienväter und harmlosen Durchschnittsmenschen imstande, massenhaft Menschen zu töten? Es gab keine Personengruppe, die sich der Aufforderung zum Morden verschlossen hätte, weshalb Erklärungsansätze, die sich auf die Persönlichkeiten der Täter, ihre Charaktereigenschaften, ihre psychische Verfassung richten, nicht weiterführen. Welzer untersucht Taten aus dem Holocaust und anderen Genoziden in ihrem sozialen und situativen Rahmen und zeigt, wie das Töten innerhalb weniger Wochen zu einer Arbeit werden kann, die erledigt wird wie jede andere auch. Mit seiner sozialpsychologischen Studie öffnet sich eine Perspektive auf die Täter, die auf beunruhigende Weise erhellt, wie Tötungsbereitschaft erzeugt wird, und wie wenig Vertrauen wir in die Stabilität unserer moralischen Überzeugungen haben sollten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Ähnliche
Harald Welzer
Täter
Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden
Sachbuch
FISCHER E-Books
Unter Mitarbeit von Michaela Christ Die Zeit des Nationalsozialismus Eine Buchreihe Herausgegeben von Walter H. Pehle
Inhalt
Unsere Adressen im Internet: www.fischerverlage.de www.hochschule.fischerverlage.de
Die Zeit des Nationalsozialismus Eine Buchreihe Herausgegeben von Walter H. Pehle
Was ist ein Massenmörder?
Wenn Menschen, die eine gleiche Erziehung genossen haben wie ich, die gleichen Worte sprechen wie ich und gleiche Bücher, gleiche Musik, gleiche Gemälde lieben wie ich – wenn diese Menschen keineswegs gesichert sind vor der Möglichkeit, Unmenschen zu werden und Dinge zu tun, die wir den Menschen unserer Zeit, ausgenommen die pathologischen Einzelfälle, vorher nicht hätten zutrauen können, woher nehme ich die Zuversicht, daß ich davor gesichert sei?
Max Frisch, 1946
Als die Hauptkriegsverbrecher, unter ihnen Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer, Hans Frank und Julius Streicher, im Nürnberger Gefängnis saßen, galt ihrer psychischen Verfassung erhebliches Interesse: Was waren das für Leute, die das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte jeder auf seine Weise geplant und durchgeführt hatten, die die Entwürfe für das Großdeutsche Reich, für seine Hauptstadt Germania, für die Niederwerfung des Bolschewismus, die Vernichtung der Juden, des »Untermenschentums« überhaupt, vorbereitet und veranlasst hatten? Die Maßstabslosigkeit der nationalsozialistischen Verbrechen ließ den Schluss nahe liegend erscheinen, dass man es mit psychologisch irgendwie auffälligen Persönlichkeiten zu tun haben müsste, und die Vorstellung, dass die Verantwortlichen für den millionenfachen Mord, psychologisch betrachtet, ganz normale Männer hätten sein können, wäre den meisten Zeitgenossen auch angesichts der gelegentlich operettenhaften oder bizarren Züge, die die NS-Führungselite in Gestalt etwa von Hermann Göring, Joseph Goebbels oder Rudolf Hess zeigte, als völlig absurd erschienen. Entsprechend wurden die Angeklagten sorgfältig psychologisch untersucht, mit Hilfe von Interviews, Beobachtungen und Tests. Der in Nürnberg zunächst verantwortliche Gerichtspsychologe Douglas Kelley notierte 1946: »Das erhobene Material enthielt Rorschachtests in vollständiger Form, dazu zahlreiche verwandte Persönlichkeitstests sowie sorgfältige psychiatrische Beobachtungen, graphologisches Material, Intelligenztests.« [1]
Kelleys Interesse galt den Ergebnissen dieser Rorschachttests, jenes damals als höchst zuverlässig betrachteten projektiven Verfahrens, bei dem Patienten oder Versuchspersonen amorphe Tintenklecksbilder unter verschiedenen Aspekten zu interpretieren hatten. Je nach den protokollierten Assoziationen – welche Tiere etwa in den abstrakten Bildern gesehen werden, wofür Schattierungen stehen, ob die Probanden vom Detail oder vom Ganzen ausgehen usw. – meinen versierte Psychologen, Aufschluss über die psychische Befindlichkeit und die Persönlichkeit der Testpersonen ziehen zu können. Die Hoffnung, etwas über die Geistesverfassung der Hauptkriegsverbrecher gerade mit Hilfe der Rorschachtests herausfinden zu können, zeigte sich besonders darin, dass Kelley beabsichtigte, das erhobene Material »führenden Rorschachexperten [zuzusenden] und später ihre Gutachten zusammenzuführen, um ein möglichst klares Bild dieser Individuen zeichnen zu können – der schlimmsten Verbrechergruppe, die die menschliche Gattung jemals kennengelernt hat.« [2]
Es sollte noch ein Jahr dauern, bis Kelleys Absicht in die Tat umgesetzt wurde. Dann wurden zehn führende Rorschachexperten mit der Bitte angeschrieben, »signifikante Charakteristika dieser Menschen herauszuarbeiten, um die Untersuchungen der weniger erfahrenen Psychologen zu ergänzen«, die in Nürnberg vor Ort mit den Angeklagten konfrontiert gewesen waren. [3]Das Ergebnis war durchaus verblüffend. Obwohl es sich doch um ein absolut einzigartiges Fallmaterial handelte, schien das Interesse der Experten äußerst gering. Genauer gesagt: Kein einziger der zehn Experten kam der Aufforderung nach, ein Gutachten zu erstellen; die Entschuldigungen, falls solche formuliert wurden, waren lau: Man hatte keine Zeit, kam gerade nicht dazu oder sah sich mit unvorhergesehenen privaten Problemen konfrontiert.
Diese offenbar unabgestimmte, aber völlig einheitliche kollektive Verweigerung der Experten hatte allerdings einen tieferen Grund, der selbst etwas mit dem Untersuchungsmaterial zu tun hatte. Wie Molly Harrower, die zu dem Kreis der eingeladenen Gutachter gehörte, dreißig Jahre später schrieb, waren sich die Experten nur allzu klar über die Erwartung der Öffentlichkeit gewesen, dass die Tests eine einzigartige Psychopathologie aufdecken würden, eine den Nazis »gemeinsame Persönlichkeitsstruktur von besonders abstoßender Art«. [4]Aber genau die war in dem übersandten Material nicht zu entdecken, und diese Botschaft mochten die Experten der Welt offenbar nicht überbringen. Lediglich Kelley selbst hatte den Mut, in seinem abschließenden Statement die so schlichte wie dramatische Schlussfolgerung zu formulieren: »Aus unseren Befunden müssen wir nicht nur schließen, dass solche Personen weder krank noch einzigartig sind, sondern auch, dass wir sie heute in jedem anderen Land der Erde antreffen würden.« [5]
Nun hat dieser ernüchternde Befund, wie wir wissen, den Wunsch nicht versiegen lassen, dass man über die abnorme Geistesverfassung der NS-Verbrecher doch irgendetwas herausfinden möge, was eine Erklärung für das liefere, was sie getan bzw. verantwortet hatten. Theodor W. Adorno etwa, der Psychoanalyse deutlich stärker zugeneigt als psychologischen Tests, regte in seinem Essay »Erziehung nach Auschwitz« an, »die Schuldigen an Auschwitz mit allen der Wissenschaft verfügbaren Methoden, insbesondere mit langjährigen Psychoanalysen, zu studieren, um möglicherweise herauszubringen, wie ein Mensch so wird.« [6]Es wäre wohl nicht viel dabei herausgekommen. Wie Kelley konstatierten George Kren und Leon Rappoport 1980 in einer Untersuchung über die Psychologie des SS-Personals, dass ihrer Überzeugung nach die überwiegende Mehrheit der SS-Männer, sowohl innerhalb der Führung als auch der Mannschaften, mit Leichtigkeit die psychologischen Eignungstests der amerikanischen Armee oder der Polizei von Kansas City passiert hätten. Sie schätzen auf der Grundlage von Zeugenaussagen, dass nach klinischen Kriterien allenfalls zehn Prozent der SS-Männer als pathologisch einzustufen gewesen wären. [7]Die Ratlosigkeit, die einen angesichts dieser Unauffälligkeit der Täter befallen mag, kommt prägnant in dem zum Ausdruck, was ein Gutachter 1961 über Adolf Eichmann gesagt hat: nämlich, dass er normal sei. Und er fügte hinzu: »normaler jedenfalls, als ich es bin, nachdem ich ihn untersucht habe.« [8]
Aber wie Adorno und viele andere hat auch Molly Harrower die Frage, wes Geistes Kind die Täter waren, nicht ruhen lassen. 1974 holte sie das Nürnberger Material wieder hervor und unterzog es mit ihrem in nunmehr drei Jahrzehnten angesammelten Knowhow einer erneuten Analyse – wobei sich wiederum ein uneinheitliches Bild zeigte. Während etwa Hess emotionale Auffälligkeiten aufwies und Ribbentrop klare Anzeichen einer Depression zeigte, die aber wohl eher mit seinen trüben Zukunftsaussichten als mit seiner Vergangenheit zu tun hatten, wiesen andere Täter das Profil von in jeder Hinsicht psychisch gesunden Persönlichkeiten auf – angesichts des Schicksals, das sie zum Zeitpunkt des Tests noch erwartete, ein bemerkenswerter Befund. Harrower wollte es nun aber noch einmal genauer wissen und forderte 15 Rorschachexperten auf, das Material zu sichten und zu bewerten – dieses Mal freilich mit einer entscheidenden methodischen Änderung: Während die Experten 1947 wussten, von welchen Personen das Material stammte, wählte Harrower nun acht Tests aus der Gruppe der Hauptkriegsverbrecher aus, anonymisierte die Urheber und kombinierte es mit analogem Testmaterial von acht Personen aus anderen Untersuchungen. Dieses Paket übersandte sie mit der Bitte an die Gutachter, sie mögen herausfinden, ob sich die sich zeigenden Persönlichkeitsprofile erkennbar unterschieden und sich womöglich zu bestimmten Personengruppen zusammenfügen bzw. zuordnen ließen.
In diesem Fall erstatteten zehn der aufgeforderten Sachverständigen ausführliche Gutachten (drei hatten aus verschiedenen Gründen abgelehnt, zwei nie geantwortet), mit dem Ergebnis, dass kein einziger auch nur eine entfernt zutreffende Vorstellung davon entwickelte, mit welcher Art Personen er es zu tun hatte. Im Gegenteil: Die Hypothesen, um welche Gruppen es sich bei denjenigen handelte, die in den Tests am eindrucksvollsten abgeschnitten hatten, reichten von Bürgerrechtlern bis zu höchst intelligenten, fantasievollen und tatkräftigen Persönlichkeiten – und wohl nicht zuletzt dieser Eigenschaften wegen äußerte einer der Gutachter denn auch die Vermutung, es würde sich wahrscheinlich um Psychologen handeln.
Barry Ritzler, der 1978, angeregt durch die Veröffentlichung Harrowers, selbst eine subtile Re-Analyse von 16 originalen Tests veröffentlichte, kam zu dem Ergebnis, dass die einzige Auffälligkeit bei den Angeklagten in einem eher geringen Empathiepotential bestand, resümierte aber insgesamt, dass sich keinerlei klinische Auffälligkeiten finden ließen. [9]Allerdings, so Ritzler, entsprächen die Persönlichkeitsprofile keineswegs Hannah Arendts Charakterisierung von der »Banalität des Bösen« – dazu waren die sich zeigenden Profile zu schillernd, kreativ und fantasiebegabt. Und auch eine letzte Ironie der Geschichte sei nicht verschwiegen: Insgesamt am bemerkenswertesten fand Ritzler, dass immerhin fünf der 16 untersuchten Personen Chamäleons in den Bildern zu identifizieren meinten – was in anderen Rorschach-Stichproben höchst selten vorkommt. Vielleicht war es kein Zufall, dass vier der fünf Nazis, die dieses höchst anpassungsfähige Tier in den Tintenbildern zu sehen meinten, in Nürnberg ihren Kopf aus der Schlinge ziehen konnten und nur zu Haftstrafen verurteilt wurden...
Mit Hilfe der Rorschachbilder konnte man also keine »Täterpersönlichkeit« oder auch nur psychologisch auffällige Merkmale einer solchen Persönlichkeit identifizieren. [10]Nun lässt sich einwenden, dass die in Nürnberg Angeklagten auch keineswegs direkt Hand an ihre Opfer gelegt hatten und insofern – im Unterschied zu den Tätern aus den Einsatzgruppen oder den Mördern in den Konzentrationslagern oder den SS-Ärzten – auch nicht die Merkmale von sadistischen oder narzisstisch gestörten Persönlichkeiten haben mussten, um ihre Taten zu begehen. Aber auch, wenn man die Hierarchie Stufe für Stufe herabsteigt – über die höheren SS- und Polizeiführer zu den Einsatzgruppenkommandeuren, von den Rasseexperten im Rasse- und Siedlungshauptamt zu den KZ-Kommandanten, und von dort aus zu den Polizeibataillonsangehörigen an den Erschießungsgruben und zum Wachpersonal in den Lagern –, findet man nur ausnahmsweise sadistische Persönlichkeiten, etwa vom Schlag Ilse Kochs, der Ehefrau des seinerseits wegen Verfehlungen abgesetzten Kommandanten von Buchenwald, Erich Koch, oder Amon Göths, Kommandant des durch Steven Spielberg berühmt gewordenen Lagers Plaszow, der zum persönlichen Vergnügen Häftlinge von der Veranda seiner Villa aus zu erschießen pflegte. Der Prozentsatz der psychisch auffälligen Personen unter den zahllosen Vordenkern und Exekutoren der Vernichtung wird regelmäßig auf etwa fünf bis zehn Prozent taxiert; verglichen mit normalgesellschaftlichen Verhältnissen in der Gegenwart keine spektakulär hohe Quote. [11]Aber das heißt im Umkehrschluss, dass die weit überwiegende Mehrheit der Täterinnen und Täter psychologisch exakt jenem Bild entspricht, das wir uns selbst zuschreiben würden: »normal« zu sein. Der Holocaust-Überlebende Primo Levi konstatierte denn auch: »Es gibt die Ungeheuer, aber sie sind zu wenig, als dass sie wirklich gefährlich werden könnten. Wer gefährlicher ist, das sind die normalen Menschen.« [12]
Das nun ist freilich ein bedrückender Befund – denn die Taten, die von diesen psychisch normalen Menschen begangen wurden, waren ja so anormal, dass uns bis heute jeder überzeugende Erklärungsansatz fehlt, wie das alles hat geschehen können. Und ich muss gestehen, dass mich bei den Vorarbeiten zu diesem Buch gelegentlich der Mut zu verlassen drohte, wenn schon keine Erklärung, so doch wenigstens einen sozialpsychologischen Rahmen für eine Erklärung jener »tragischen Leichtigkeit« (Germaine Tillion) entwickeln zu können, mit der Menschen zu Mördern und Massenmördern wurden, die selbst nur kurze Zeit zuvor im Traum nicht daran gedacht haben, dass sie jemanden töten könnten. Denn wenn man etwa in den Vernehmungsprotokollen von Einsatzgruppentätern en detail liest, wie tief die Täter bei den Erschießungen buchstäblich im Blut ihrer Opfer gestanden haben, wenn sie immer neuen Menschen befahlen, sich auf die bereits Getöteten zu legen, um diese dann – je nach Geschmack und Erfahrung des betreffenden Kommandos – mit Gewehr-, Pistolen- oder Maschinenpistolenschüssen zu töten und sich von Knochensplittern und Teilen der Gehirnmasse der Ermordeten bespritzen zu lassen – wenn man sich also mit den Details des Tötens konfrontiert, dann fällt einem tatsächlich nicht mehr viel dazu ein, wie das alles wohl möglich geworden war. Man entwickelt fast reflexartig die Tendenz, sich von diesem Grauen abzuwenden, zumal dann, wenn man so zynisch scheinende Aussagen vor Gericht liest wie die, dass die wirklich Leidenden die Täter gewesen seien: »Ich muß sagen, dass unsere Männer, die daran teilgenommen haben, mehr mit ihren Nerven ’runter waren als diejenigen, die dort erschossen werden mussten.« [13]
Aber diesem Wunsch, sich abzuwenden, den die Täter einem so leicht zu machen scheinen, sollte man nicht folgen – denn gerade in solchen Sätzen liegt ein Schlüssel für die Erklärung, wie sie tun konnten, was sie getan haben: Vielleicht waren sie fähig, sich selbst als Opfer einer Aufgabe wahrzunehmen, die ihnen die historischen Umstände zu diktieren schienen. Und in dem Augenblick, in dem sie so etwas formulieren, gehen sie subjektiv davon aus, dass sie anderen ihr Handeln plausibel und nachvollziehbar machen können, so plausibel, wie es ihnen 1941 beim Morden selbst erschienen war. Oder so plausibel, wie es ihnen teilweise noch nach Jahrzehnten bei ihren Vernehmungen erschien. Im Unterschied zu den überlebenden Opfern, die sich – zum Beispiel als Angehörige von jüdischen Sonderkommandos – nicht wiederfinden können in dem, was sie zu sein gezwungen waren, haben die Täter in ihren Aussagen keine Schwierigkeiten, ihre eigene Person, damals wie heute, als ungebrochen und kontinuierlich wahrzunehmen. Das Bedrückendste beim Lesen der Vernehmungsprotokolle und autobiographischen Aufzeichnungen ist das völlige Fehlen von Unverständnis demgegenüber, was man getan hat, ist die psychologische Bruchlosigkeit, mit der man ein Leben leben kann, das die Erschießung von, sagen wir, 900 Männern, Frauen und Kindern ebenso enthält wie das Nachdenken darüber, welches Studienfach denn wohl für den eigenen Sohn das geeignete wäre. [14]
Ein »Verweilen beim Grauen«, wie Hannah Arendt das genannt hat, ist also notwendig, weil es die erste Voraussetzung dazu liefert, überhaupt beschreiben zu können, wie die Täter sich selbst wahrgenommen haben, als sie ihre Morde begingen, und in welchen Interpretationsrahmen sie ihre eigenen Handlungen einzuordnen imstande waren. [15]Und weiter: Wenn man sich klarmacht, dass die Vernehmungsprotokolle nicht selten zwanzig, dreißig Jahre nach den Taten verfasst wurden, die Erzähler demzufolge in der zwischendurch verstrichenen Zeit – eben zwanzig, dreißig Jahre lang – ihre ganz normalen Leben geführt hatten und Handwerksmeister, Polizeikommissare oder Journalisten geworden waren, geheiratet und Kinder in die Welt gesetzt und Eigenheime gebaut hatten, dass sie also auch lange, nachdem sie getan hatten, was sie zu tun als sinnvoll betrachteten, jedenfalls nicht in epidemiologisch auffälliger Weise an Schlaflosigkeit, Depressionen, Angstzuständen und dergleichen zu leiden hatten – übrigens ganz im Unterschied zu den Überlebenden unter ihren Opfern –, dann mag einem gelegentlich der Versuch, so etwas erklären zu wollen, als völlig hoffnungslos erscheinen.
Aber auch diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit sollte man nicht folgen, denn gerade die Nachgeschichte des Tötens gibt Hinweise darauf, wie es möglich war, Massenmorde wie jenen in der Schlucht von Babi Jar zu begehen, wo es wenige hundert Männer [16]binnen zweier Tage geschafft hatten, mehr als 33 000 Männer, Frauen und Kinder zu töten, mit eigener Hand, in direkter physischer Aktion. Offenbar war es ihnen gelungen, selbst ein solches Tun so in ihr Lebenskonzept zu integrieren, dass ihnen die Einrichtung in einer bürgerlichen Normalität auch nach 1945 keine Probleme bereitete. Einer der Schlüssel dafür, dass dieses Einrichten so problemlos möglich war, liegt darin, dass Menschen fähig sind, ihr Handeln in jeweils spezifische Referenzrahmen einzuordnen (»es war eben Krieg«, »es war eben Befehl«, »ich fand es grausam, aber ich musste es tun«), die es ihnen erlauben, ihr Handeln als etwas von ihrer Person Unabhängiges zu betrachten. Dazu später mehr.
Neben solchen eher analytischen Gründen, beim Grauen zu verweilen, gibt es auch politische Gründe, sich möglichst genau mit den Taten und ihren Tätern zu konfrontieren: Zum einen ist es eine intellektuelle und politische Selbstentmündigung, jedes Mal dann, wenn sich ein massenmörderischer Prozeß – wie in Ex-Jugoslawien oder Ruanda – vollzogen hat, über die dabei freigesetzte Grausamkeit so entsetzt zu sein, als wäre es das erste Mal, dass so etwas passiert, anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass Gewalthandeln erstens eine Geschichte und sich wiederholende Aspekte hat und sich zweitens in Prozessen vollzieht, die man beschreiben kann. Es handelt sich bei kollektiven Gewalttaten in der Regel nicht um unerklärliche Eruptionen, sondern um wiederkehrende soziale Vorgänge mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss, und diese Vorgänge werden von denkenden Menschen und nicht von Berserkern erzeugt. Genozidale Prozesse entwickeln freilich selbst eine innere Dynamik – im Mittelteil wird möglich, was zu Anfang noch ganz undenkbar erschien –, und Gewalt selbst ist nicht prinzipiell destruktiv: Sie hat am Schluss eine neue Struktur geschaffen, die vor der Gewalt noch nicht da war. Ob diese Struktur im Ergebnis in Staatsbildungsprozessen nach ethnischen Kategorien besteht oder etwa in einer nachhaltigen sozialpsychologischen Wirkung wie der, dass man sich Juden nach dem Holocaust vor allem als Opfer vorstellt, ist an dieser Stelle unerheblich – es geht darum, Gewalt in ihrer strukturbildenden Funktion zu verstehen und Gewaltakteure als denkende Menschen zu beschreiben, um das Entstehen genozidaler Prozesse dann beobachten und womöglich verhindern zu können, wenn sie noch im Werden sind.
Mit diesem prozessualen Charakter von Massenmorden und Genoziden hängt ein zweiter gegenwartsbezogener Grund zusammen, der es als notwendig erscheinen lässt, dem Handeln der Täter tiefer auf den Grund zu gehen, als es bislang der Fall war. Obwohl die Systemtransformationen, die wir am Ende der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erlebt haben (und die noch keineswegs zum Abschluss gekommen sind), die Möglichkeit äußerst rapider gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozesse noch einmal deutlich vor Augen geführt haben, fehlt bislang noch jede soziologische oder sozialpsychologische oder auch historische Theorie sich selbst dynamisierender sozialer Veränderungsprozesse.
Wenn man sich etwa die Geschwindigkeit vergegenwärtigt, mit der in Jugoslawien die Ethnisierungsprozesse verlaufen sind, die eine ganze Gesellschaft in einen äußerst brutalen Krieg inklusive ethnischer Säuberungen und Massenerschießungen gezogen haben, oder bemerkt, in welch unglaublich kurzem Zeitraum die deutsche Gesellschaft sich nach Januar 1933 nationalsozialisiert hat, beginnt man zum einen zu ahnen, wie schwach es um die Stabilität und Trägheit moderner Gesellschaften in ihrem psychosozialen Binnengefüge bestellt ist, an die wir so gern glauben. Zum anderen wird verständlich, dass es eben nicht nur abstrakte, analytische Kategorien wie »Gesellschaft« und »Herrschaftsformen« sind, die sich innerhalb weniger Monate verändern, sondern dass die konkreten Menschen, die diese Gesellschaften bilden und ihre Herrschaftsformen realisieren, sich in ihren normativen Orientierungen, in ihren Wertüberzeugungen, in ihren Identifikationen und auch in ihrem zwischenmenschlichen Handeln schnell verändern können. Entscheidungen zur Benachteiligung anderer Gesellschaftsmitglieder, dann zu ihrer Entrechtung, zu ihrer Beraubung, schließlich zu ihrer Deportation und Tötung, liegen ja 1933 keineswegs in ihrem vollen Ausmaß vor, sondern werden sukzessive durch aktive Toleranz und Partizipation der Volksgenossinnen und Volksgenossen formatiert. Dabei wird zunehmend für normal und akzeptabel gehalten, was zu Beginn des Prozesses noch als unmenschlich und unakzeptabel gegolten hätte – und diese Beobachtung ist höchst relevant auch für das Erklären von Tätern und ihren Taten.
Ein gesellschaftlicher Prozess, in dem die radikale Ausgrenzung von Anderen zunehmend als positiv betrachtet wird und der schließlich das Tötungsverbot in ein Tötungsgebot verwandelt, bildet gewissermaßen den ersten Kreis des Tatzusammenhangs. Dieser Kreis schafft eine dynamische gesellschaftliche Deutungsmatrix, die den individuellen normativen Orientierungen und ihren Veränderungen einen Rahmen gibt. Dieser kann fallweise über- oder unterschritten oder ignoriert werden; er ist aber für die Analyse von Täterhandeln deswegen von Bedeutung, weil die Entscheidungen für das eigene Handeln nicht rein situativ und individuell getroffen werden, sondern immer auch an diesen größeren Rahmen gebunden sind – in dem Sinne etwa, dass die wahrgenommene Legitimität einer Judenerschießung durch einen gesellschaftlich dominanten Antisemitismus und Rassismus oder, noch allgemeiner, durch eine nationalsozialistische Moral kontextualisiert ist. Dieser Rahmen verändert sich in den zwölf Jahren zwischen 1933 und 1945 rapide, und er ist wichtig für die Wahrnehmung einer gegebenen Situation durch den Einzelnen – sei es eine Situation, in der man vor der Frage steht, ob man es sich erlauben sollte, in einem jüdischen Geschäft einzukaufen, sei es eine, in der die Gewalt der »Reichskristallnacht« beobachtet wird, sei es eine der angeordneten Erschießung jüdischer Kinder. Denn Situationen werden grundsätzlich interpretiert, bevor eine Schlussfolgerung gezogen und eine Entscheidung für das eigene Handeln (oder Nichthandeln) getroffen wird – und in solche Interpretationsprozesse gehen gesellschaftlich dominante Normen ebenso ein wie situativ gebildete Gruppennormen, sozialisierte Werthaltungen, religiöse Überzeugungen, vorangegangene Erfahrungen, Wissen, Kompetenz, Gefühle usw. usf.
Die soziale Situation und ihre Deutung durch einen Akteur bildet mithin einen zweiten, inneren Kreis des Tatzusammenhangs. Dieser ist in sich differenziert – nach den Erwartungen und Erfahrungen, mit denen jemand in die Situation kommt, nach den Modi der Bewältigung der gegebenen oder sich ergebenden Aufgaben, den dabei auftretenden Problemen und vorgenommenen Korrekturen des eingeschlagenen Wegs, die neue Entscheidungen nach sich ziehen usw. Erst wenn dieser Kreis für eine gegebene Tat beschrieben werden kann, öffnet sich analytisch der Raum für die Betrachtung eines dritten, nun eher individuellen Kreises des Geschehens: die Einschätzung des eigenen Handlungsspielraums durch den jeweiligen Akteur. Ein solcher Spielraum ist nicht einfach objektiv gegeben; er ist davon abhängig, ob und wie ein Akteur ihn wahrnimmt, welche möglichen Konsequenzen er bei der Entscheidung für diese oder jene Option (mitschießen oder »sich drücken« oder sich verweigern etc.) erwartet, bevor er sich schließlich für eine entscheidet. [17]Erst auf dieser Ebene kommt Psychologie ins Spiel – denn die Interpretation des Spielraums und die auf dieser Basis gezogene Schlussfolgerung ist auch von persönlichen Dispositionen, biographischen Erfahrungen, individuellen Einstellungen und Überzeugungen, der Handlungskompetenz usw. abhängig.
Eine Tat spielt sich also im Rahmen mehrerer Kontexte ab, die von der gesellschaftlichen bis zur individuellen Ebene zu unterscheiden sind. Mit Hilfe einer solchen Unterscheidung lässt sich nicht nur beschreiben, was die Akteure getan haben, sondern auch, wie sie als Personen die jeweilige Situation wahrgenommen, welche situativen Bedingungen ihr Handeln bestimmt haben und unter welchen überindividuellen, jenseits der Grenzen der subjektiven Zurechnung liegenden, sozialen und normativen Rahmenbedingungen das jeweilige Handeln stattfand.
Massenmord und Moral
»Ich war mir immer dessen bewusst, dass die Täter, Opfer und Zuschauer denkende Menschen gewesen sind.«
Raul Hilberg
Willy Peter Reese, seine hinterlassenen Fotos und Selbstzeugnisse belegen es, war gewiss kein harter Bursche. Er war äußerlich wie innerlich so etwas wie ein bebrillter junger Schöngeist, einer, der Dichter sein wollte, obwohl er nach dem Abitur auf das Drängen seines Vaters hin erst mal eine Banklehre machte. Reeses kurzes Leben war eher unspektakulär, genauso wie sein Tod, über den wir nichts wissen, außer dass er, einer Recherche des Suchdienstes des Roten Kreuzes zufolge, »mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den Kämpfen, die zwischen dem 22. und 30.Juni 1944 im Raum Witebsk geführt wurden, gefallen ist.« [18]
Reese war 23 Jahre alt, als er starb. 1942, da war er schon ein Jahr Soldat bei der deutschen Wehrmacht, verfasste er die folgenden Gedichtzeilen:
»Wir dürfen mit Geschütz, Gewehr und Säbel
das größte Unheil schaffen, das gefällt,
die Menschlichkeit und Freiheit weiter knebeln –
denn wir sind ja die Herren dieser Welt.
Das Reich ist unser, morgen auch die Erde,
ein Clown regiert, ein Rudel Rindvieh brüllt
im Propagandastall zu unserer Herde.« [19]
Reese verfasste seine Gedichte, um sich zu schützen, unter dem doch kaum verfremdenden Pseudonym Peter Reiser. Dass er dem Nationalsozialismus auf eine durchaus selbstgefährdende Weise kritisch gegenüberstand, wird in den folgenden Zeilen aus derselben Zeit noch deutlicher:
»Die Juden ermordet,
als brüllende Horde
nach Russland marschiert,
die Menschen geknebelt,
im Blute gesäbelt,
vom Clowne geführt,
sind wir die Gesandten
des allwärts Bekannten
und waten in Blut.
Wir tragen die Fahnen
der arischen Ahnen:
sie stehen uns gut.« [20]
Reese hat Gedichte, Briefe, Zeichnungen und vor allem einen ausführlichen Bericht aus dem Krieg hinterlassen, was bei einem so jungen Kriegsteilnehmer sehr ungewöhnlich ist. Sein 140-seitiges »Bekenntnis aus dem großen Krieg« schreibt er während eines Fronturlaubs Anfang 1944. Diesen Aufzeichnungen gibt er den munteren Obertitel »Russische Abenteuer«, und diese Abenteuer beinhalten Schilderungen wie die folgende:
»... [wir] wurden melancholisch, teilten uns Liebeskummer und Heimweh mit, lachten wieder und tranken weiter, jauchzten, tobten über die Geleise, tanzten in den Wagen und schossen in die Nacht hinein, ließen eine gefangene Russin Nackttänze aufführen und bestrichen ihr die Brüste mit Stiefelfett, machten sie so betrunken wie wir selber waren.« [21]
Oder diese:
»Die Gehenkten schaukelten an einem überragenden Ast. Ein fader Verwesungsgeruch umgab die starren Gestalten. Ihre Gesichter waren bläulich verschwollen, zu Fratzen verzogen. Von den Nägeln der gefesselten Hände löste sich das Fleisch, eine gelbbraune Flüssigkeit sickerte aus ihren Augen und verkrustete auf den Wangen, worauf die Bärte noch im Tode gewachsen waren. Ein Soldat fotografierte sie, ein anderer schaukelte sie mit einem Stock. Partisanen. Wir lachten und zogen weiter über Knüppeldämme im Laubwald.« [22]
Oder, nach einem Angriff:
»Über die deutschen Soldaten deckten wir eine Zeltbahn, den Kosaken zogen wir die Filzstiefel, Mützen und auch Hosen und Unterwäsche aus und zogen sie an. In den übrig gebliebenen Häusern rückten wir enger zusammen. Ein Soldat hatte keine Filzstiefel mehr gefunden, die ausgezeichnet gegen die Kälte schützten, und fand erst am nächsten Tag einen steifgefrorenen Toten der Roten Armee. Vergeblich zerrte er an dessen Beinen. Er nahm eine Axt und schlug dem Leichnam beide Unterschenkel ab. Er nahm die Stümpfe unter den Arm und stellte sie neben unser Mittagessen in den Ofen. Als die Kartoffeln kochten, waren auch die Beine aufgetaut, und er zog sich die blutigen Filzstiefel an. Uns machte das Aas neben dem Essen so wenig aus, wie wenn einer zwischen den Mahlzeiten seine Erfrierungen verband oder Läuse zerknackte.« [23]
Reese schildert, wie seine Einheit Kriegsgefangene erschießt, [24]Zivilisten ermordet, [25]Dörfer niederbrennt und Vorräte plündert. Er schreibt auch über Frauen, die – als Gefangene oder Prostituierte – von ihm und seinen Kameraden missbraucht werden, kurz: er schreibt über alles, was über das Verhalten ganz normaler Soldaten in Zeiten des Krieges bekannt ist. Dann wieder, im September 1943, schreibt er: »Ich breche unter dieser Schuld zusammen« – nachdem seine Einheit auf dem Rückzug Dörfer verwüstet, Menschen getötet und vermutlich alle Arten von Gewalt ausgeübt hat. [26]
Wer war dieser junge Mann? Eine bigotte Figur, die sich über ein Regime aufregt, für das er selbst in den Vernichtungskrieg zieht? Ein Zyniker, den eine ungute Melange aus Intellektualität, Weltschmerz und Alkohol die Folter einer nackten Gefangenen goutieren lässt? Ein junger Mann voller Todesangst, der um des eigenen Überlebens willen mordet, plündert, brandschatzt? Ein Schöngeist, der äußerste Brutalität und Menschenverachtung expressionistisch überhöht? Ein Widerständler, der sich immerhin aufzuschreiben und zu sagen traute, was er von dem Ganzen hielt? Ein Opfer einer Gewalteskalation, deren Teil er war, für die er aber trotzdem nichts konnte? Williges Teil einer Gesellschaft, deren Mitglieder mehrheitlich der Auffassung waren, dass es schon in Ordnung sei, den Ostraum zu erobern und die dort lebenden Menschen entweder umzubringen, zu versklaven oder zu deportieren?
Die Antwort ist: Ja, das war Willy Peter Reese. Und damit ist er gewiss nicht vollständig beschrieben. Wenn man sich mit Massenmorden und den Menschen, die sie begehen, befasst, muss man sich von einigen behütenden Vorannahmen verabschieden. Eine dieser Vorannahmen besteht eben darin, dass wir, wenn etwas Ungewöhnliches oder scheinbar Unerklärliches geschieht, die Persönlichkeiten der Handelnden auf eine Dimension verkleinern: Jemand, der tötet, ist ein Mörder, womit impliziert ist, dass seine Persönlichkeit irgendetwas »Mörderisches« aufweise oder sich geradezu durch das »Mörderische« definiere. [27]In diesem Zusammenhang mag ein grundlegendes psychisches Phänomen von Interesse sein, das als »fundamentaler Zuschreibungsfehler« bezeichnet wird: Hier geht es darum, dass Menschen prinzipiell dazu neigen, ihr eigenes Verhalten mit situativen Faktoren zu begründen (»das hat sich so ergeben«, »ich musste so handeln, weil...«), während das Verhalten anderer auf Persönlichkeitsfaktoren zurückgeführt wird (»der war schon immer so«, »sie neigt zur Hysterie« usw.). [28]
In Geschehenszusammenhängen, die uns mit einer so außerweltlich erscheinenden Brutalität und Grausamkeit konfrontieren, dass wir uns in ihnen nicht zurechtfinden, neigen wir dazu, die Persönlichkeiten der Akteure binär zu konzipieren: Sie handeln moralisch oder amoralisch, gut oder schlecht, als Täter oder als Opfer, als Nazis oder Anti-Nazis. Menschen sind aber niemals eindeutig, abgesehen von pathologischen Einzelfällen, die in den Geschehnissen, von denen dieses Buch handelt, keine Rolle spielen. Es gab im Zusammenhang des Vernichtungskriegs und des Holocaust überzeugte Nazis, die Juden gerettet haben, [29]und man musste kein überzeugter Nationalsozialist sein, um sie zu töten. Die Bezugnahme auf die geistigen Besitzstände deutscher Kultur, auf Beethoven, Mozart, Goethe und Keller, die im Deutschland des »Dritten Reiches« gepflegt und zelebriert wurde, war den handelnden Personen keine zynische Ornamentik, sondern oft ein echtes Anliegen, ein tief gefühlter Genuss, Teil ihrer Identität. Die Wissenschaftler, die an eugenischen Konzepten tüftelten oder Pläne für die Besiedelung des »Ostraums« entwarfen, waren keine »Pseudo«-Wissenschaftler, sondern kultivierte Menschen, die ihre international kompatible Qualifikation für anti-humane Zwecke einsetzten; »katholische Geistliche segneten die Waffen für den Kreuzzug gegen den gottlosen Bolschewismus und wehrten sich gleichzeitig gegen die Euthanasie-Verbrechen«, [30]und gewiss gab es nicht wenige Volksgenossinnen und -genossen, denen die Juden nicht geheuer waren, die aber trotzdem in jüdischen Geschäften einkauften, weil es dort preiswert war. Und genauso gewiss gab es Menschen, die sich über die schändliche Behandlung jüdischer Gerichtsräte oder Ärzte echauffieren konnten und ein Gefühl des Beschämtseins darüber hatten, was diesen Menschen angetan wurde, die aber trotzdem die Gelegenheit nutzten, einen komfortablen Wohnzimmersessel oder ein hübsches Landschaftsbild dort zu kaufen, wo es eben günstig war: bei den »Judenkisten« am Hamburger Kamerunkai zum Beispiel, wo die »arisierten« Einrichtungsgegenstände der zur Emigration gezwungenen oder deportierten belgischen und holländischen Juden verhökert wurden.
Auch wenn wir uns selbst betrachten, zeigen sich gelegentlich erhebliche Diskrepanzen zwischen unseren moralischen Ansprüchen und Handlungen; wir sind je nach Situation zu höchst unterschiedlichen Deutungs-, Handlungs- und Redeweisen in der Lage, erlauben uns »schlechtes« Verhalten trotz »besseren« Wissens, beherrschen Lüge, Widerspruch, Missachtung ebenso gut wie das Gegenteil: Vertrauen, Integrität, Anerkennung. Und eine solche Selbstbetrachtung zeigt sofort auch noch etwas anderes: dass wir, wenn wir gedanklich das Patchwork unserer moralischen Existenz durchmustern, bei jeder Facette, die uns selbst moralisch als etwas fragwürdig erscheint, sofort zu legitimieren versuchen, weshalb wir dies oder jenes wider ein vorhandenes besseres Vermögen getan haben, warum wir unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, was der Grund war, dass wir lügen, betrügen, verraten oder enttäuschen mussten. Erstaunlicherweise finden wir meist solche guten Gründe, die ein als falsch empfundenes Verhalten nachträglich sinnhaft und damit wenigstens für uns selbst gerechtfertigt erscheinen lassen, und wir brauchen solche Gründe, um unseren eigenen moralischen Ansprüchen gerecht werden zu können, selbst wenn wir ihnen »ausnahmsweise« zuwidergehandelt haben.
Tötungsmoral
»Ich glaube, meine Herren, dass Sie mich soweit kennen, dass ich kein blutrünstiger Mensch bin und kein Mann, der irgendwie an etwas Hartem, das er tun muß, Freude oder Spaß hat. Der aber andererseits so gute Nerven und ein so großes Pflichtbewusstsein hat – das darf ich für mich in Anspruch nehmen –, dass ich dann, wenn ich eine Sache erkenne, und als notwendig erkenne, sie kompromisslos durchführe.« [31]Dieses Zitat stammt, wie ein ungleich berüchtigteres, [32]von Heinrich Himmler, und es ist gewiss kein Zufall, dass Täter wie er oder Rudolf Höß oder zahllose andere immer wieder betont haben, dass es eine unangenehme, der eigenen »Menschlichkeit« widerstrebende Aufgabe war, Menschen zu vernichten, dass sich aber gerade in der Selbstüberwindung zum Töten die besondere charakterliche Qualität der Täter zeige. Es geht hier um die Verkoppelung von Töten und Moral, und es ist diese Verkoppelung zwischen der Einsicht in die Notwendigkeit unangenehmer Handlungen und dem Gefühl, diese als notwendig angesehenen Handlungen gegen das eigene mitmenschliche Empfinden auszuführen, die den Tätern die Möglichkeit gab, sich noch im Morden als »anständig« zu empfinden, als Person, die – um Rudolf Höß zu zitieren – »ein Herz hatte«, die »nicht schlecht war.« [33]
Wenn die Täter autobiographisches Material – Tagebücher, Aufzeichnungen, Interviews – hinterlassen haben, zeigt dieses in der Regel ein auffälliges Merkmal. Selbst wenn die betreffenden Personen offenbar keinerlei humanen Zurechnungsmaßstab für das zu haben scheinen, was sie angerichtet haben, sind sie doch regelmäßig ängstlich darauf bedacht, nicht als »schlechte Menschen« dazustehen, sondern als Personen, deren moralisches Vermögen gerade auch im Rahmen der extremen Situationen ihres Handelns intakt geblieben war. Ich möchte dieses Bedürfnis anhand des Falles des Kommandanten von Treblinka, Franz Stangl, etwas eingehender skizzieren.
Stangl, 1908 in Österreich geboren, von 1940 bis 1942 Polizeivorstand der Euthanasieklinik Schloss Hartheim, von März bis September 1942 Kommandant des Vernichtungslagers Sobibor, war bis zum August 1943 der Kommandant von Treblinka. 1971 hat er der Journalistin Gitta Sereny ausführliche Interviews über seine Vergangenheit gegeben, [34]die das Material für die folgenden Ausführungen liefern. Sereny hat – ähnlich wie in ihrem Buch über Albert Speer [35]– versucht, die Persönlichkeit des Täters über sein Verhältnis zur Schuld aufzuschließen – ein etwas problematisches Unterfangen, weil es ja voraussetzt, dass er so etwas wie Schuld überhaupt empfunden hatte. Aber Serenys Interviews mit Stangl sind sehr aussagekräftig, weil sich der Massenmörder gegenüber der Interviewerin als jener gute Kerl darzustellen versucht, der er seiner eigenen Überzeugung nach wohl war.
Wenn Stangl erzählt, geht es in erster Linie um seine eigene Befindlichkeit, nicht um die der Opfer. Emotionale Betroffenheit gegenüber seinen Opfern zeigt er nur dann, wenn sie schon tot sind und irgendetwas mit ihrer Beseitigung nicht funktioniert: »Sie hatten zuviele Leichen [in eine Grube] hineingelegt, und die Verwesung war so weit fortgeschritten, daß unten alles flüssig wurde. Die Leichen sind übergequollen, aus der Grube hinaus – und den Berg hinuntergerollt. Ich hab da welche gesehen – mein Gott, es war fürchterlich.« [36]Stangl löst diese Probleme der Konfrontation mit grauenerregenden Szenen – ganz ähnlich wie der AuschwitzKommandant Rudolf Höß [37]– durch Distanzierung vom Geschehen: Entweder schaut er weg oder vermeidet die Schauplätze des Tötens generell (»In Sobibor konnte man fast vollkommen vermeiden, es zu sehen« [38]oder stürzt sich in manische Aktivitäten, [39]die ihn qua Arbeitsüberlastung darin hindern, wahrzunehmen, welche Resultate seine rastlose Tätigkeit hervorbringt.
Interessanter als solche Vermeidungsstrategien der unmittelbaren Konfrontation mit den ekelerregenden Aspekten seiner Aufgabe ist aber, welche Einschätzungen Stangl in den Interviews gegenüber den moralischen Aspekten seines Tuns abgibt – etwa wenn er auf der Grundlage des auf der Polizeischule Gelernten einzuschätzen versucht, ob er an verbrecherischen Handlungen beteiligt gewesen sei: »In der Polizeischule hatten sie uns beigebracht – ich erinnere mich genau, es war Rittmeister Leitner, der das immer sagte –, daß ein Verbrechen vier Grundvoraussetzungen erfüllen muß: die Veranlassung; den Gegenstand; die Tathandlung und den freien Willen. Wenn eines von diesen vier Prinzipien fehlte, dann handelte es sich nicht um eine strafbare Handlung. [ ... ] Sehen Sie, wenn die ›Veranlassung‹ die Nazi-Regierung war, der ›Gegenstand‹ die Juden, und die ›Tathandlung‹ die Vernichtungen, dann konnte ich mir sagen, daß für mich persönlich das vierte Element, der ›freie Wille‹ fehlte.« [40]
Nun zeigt Stangl in Erzählzusammenhängen, die im Rahmen seines Verantwortungsbereiches mit dem verknüpft waren, was er als »freien Willen« bezeichnet, dass er großen Wert auf eine moralische Charakterisierung seiner Handlungsweise legt. Dabei spielt die Zurückweisung des Verdachts, er habe persönlich etwas gegen Juden gehabt, genauso eine zentrale Rolle wie die peinliche Vorstellung, er habe als Kommandant irgendwelche Unkorrektheiten durchgehen lassen. So schildert er etwa die Beschwerde eines gerade in Treblinka angekommenen Juden (»ein anständig aussehender Kerl«), der sich über einen Aufseher beklagte, der ihm Wasser versprochen hatte, wenn er ihm dafür seine Uhr geben würde. »Aber dann hatte der Litauer die Uhr genommen, ihm aber kein Wasser gegeben. Ja, das war nicht korrekt, oder? Auf jeden Fall, Klauen hat’s bei mir nicht gegeben. Ich habe die Litauer sofort gefragt, wer die Uhr genommen hatte. Aber es hat sich niemand gemeldet. Franz [ ... ] flüsterte mir zu, daß es sich um einen der litauischen Offiziere handeln könnte – die Litauer hatten sogenannte Offiziere – und daß ich doch nicht einen Offizier öffentlich blamieren könnte. Ich habe ihm gesagt: ›Das interessiert mich absolut nicht, was ein Mann für eine Uniform trägt. Mich interessiert nur, was in ihm drinnen steckt.‹ Das ist auch sofort nach Warschau weitergegangen. Aber das war mir ganz egal. Was recht ist, muß recht bleiben, stimmt das nicht?« [41]
Auffällig ist hier das Ethos der überpersonalen Korrektheit, das den Juden als Beschwerdeführer genauso einbezieht wie das mögliche Fehlverhalten kollaborierender Offiziere – »was recht ist, muß recht bleiben« ist Stangls Handlungsmaxime, die völlig unvermittelt zu dem Kontext ist, in dem sich die ganze Situation abspielt, und die völlig abgekoppelt von dem Umstand ist, dass der Beschwerdeführer wahrscheinlich noch vor dem Ende von Stangls Recherche in der Gaskammer ermordet worden war. Auf Serenys Frage jedenfalls, was mit dem Mann geschehen sei, antwortet Stangl lapidar: »Ich weiß nicht.« Der Kontext der Massenvernichtung bleibt Stangl im Rahmen seiner Geschichte völlig äußerlich, wichtig ist ihm die Herausstellung seiner korrekten Handlungsweise, die von persönlichen Bevorzugungen oder Benachteiligungen strikt absieht. Daraus schöpft sich die moralische Integrität, die Stangl sich selbst zuschreibt, und da sie sich auf der Ebene des konkreten Handelns zumindest aus seiner Sicht unzweifelhaft darstellen und belegen lässt, vermag die sonstige Erfüllung seiner Aufgaben, soweit sie seinem »freien Willen« nicht unterlag, keinerlei Beunruhigung bei ihm hervorzurufen.
Dazu allerdings ist eine andere Geschichte geeignet, die Stangl in Gefahr bringt, als jemand, der aus persönlichen Motiven heraus handelt, ja, als sadistischer Charakter dargestellt zu werden – und diese Geschichte ist es, die ihn in seinen Gesprächen mit Sereny in größter Unbehaglichkeit und Aufregung zeigt. Es geht dabei um den Zeugen Stan Szmajzner, der als 14-jähriger Junge nach Sobibor kam und dort der Vernichtung entgehen konnte, weil er Qualitäten als Goldschmied bewies und offenbar eine Art von Sympathie bei Stangl wecken konnte. Stangl ließ sich von ihm mehrere Schmuckgegenstände fertigen und kam gelegentlich, wie Szmajzner berichtete, auch nur zum Plaudern zu ihm. Eine wichtige Rolle bei seinen gerichtlichen Aussagen spielte, daß Stangl ihm jeden Freitagabend Würstchen brachte mit den Worten: »Hier sind Würste für Dich, um den Sabbat zu feiern.« Auf die damit angedeutete Infamie, den jüdischen Jungen dazu zu verführen, Schweinefleisch ausgerechnet am Sabbat zu essen, kam Stangl in seinen Gesprächen mit Sereny mehrere Male zurück, und in der Tat war es genau diese Geschichte, die ihn von allen Zeugenaussagen im Prozess gegen ihn am meisten beunruhigte und aufbrachte: »Diese Sache mit den Würstchen wurde absichtlich mißgedeutet [ ... ]. Es ist wahr, daß ich ihm Sachen zum Essen brachte, und wahrscheinlich waren auch Würstchen dabei. Aber nicht um ihn mit Schweinefleisch zu locken oder ihn zu verhöhnen: Ich brachte ihm ja auch andere Sachen. Ich glaube, es war, weil wir selbst unsere Lebensmittelzuteilungen am Freitag bekamen und weil das Lager ja meistens voll mit Essen war und uns Nahrungsmittel übrigblieben. Ich mochte diesen Jungen.« [42]
Für unseren Zusammenhang ist es ganz gleichgültig, ob Stangl seine Gaben tatsächlich aus einer besonderen Infamie heraus oder gutwillig und bloß gedankenlos darbrachte – bemerkenswert ist dabei, dass ihm weder seine verantwortliche Beteiligung an den Massenmorden zu schaffen machte noch die Tatsache, dass er zwei Vernichtungslager kommandiert hatte, sondern dass seine moralische Integrität im persönlichen Umgang mit einer konkreten Person öffentlich in Zweifel gezogen wurde. Sereny selbst sieht das ganz richtig – »das, was er konkret getan hatte, und nicht das, was er war«, machte ihm am meisten zu schaffen [43]–, allerdings sieht sie darin einen Beleg für Stangls »moralische Korrumpiertheit« und die Weigerung, »sich mit der totalen Veränderung seiner Person auseinanderzusetzen.«
Der eigentlich integre Stangl hat sich also, so sieht Sereny das, im Vernichtungsprozess korrumpieren lassen und sein moralisches Vermögen verloren. Die umgekehrte Deutung wäre viel nahe liegender: Stangl hat keine oder kaum moralische Irritationen durch die »Arbeit« gehabt, die er seiner Auffassung nach zu verrichten hatte – weil er diese in einen Referenzrahmen einordnen konnte, der jenseits seiner Verantwortung lag. Und solche Irritationen hatte er insbesondere dann nicht, wenn er sich in Bezug auf seine Person als »guten Kerl« wahrnehmen konnte: gerecht, sachlich, ohne Parteinahme und gelegentlich über seine Vorschriften hinaus hilfreich und freundlich. Die Aufrechterhaltung dieses Selbstbildes wird es gewesen sein, die sichergestellt hat, dass Stangl ob seiner eigentlichen Funktion, die darin bestand, Massen von Menschen dem Tod zuzuführen, eben keinerlei moralische Bedenken befielen: Hier ist eine Aufgabe, die in ein Universum so oder so begründbarer Zwecke einzuordnen ist, dort ist ein Mann, der seine Aufgaben jederzeit pflichtgemäß zu erfüllen bereit ist, der aber daneben auch »Mensch bleiben« will.
Dass man daran zweifeln könnte, ist es denn auch, was Stangl bedrückt – und gerade hier bemüht er sich, seine Handlungen moralisch in das richtige Licht zu rücken. Dass er im Übrigen in den Lagern nicht erst moralisch korrumpiert wurde, sondern – wenn man denn in solchen Kategorien denken möchte – es schon von Beginn an war, erschließt sich unter anderem daraus, dass Stangl die Stirn hatte, dem Ausladen der eingetroffenen Transporte von Deportierten im weißen Reitanzug beizuwohnen. Seine Begründung dafür bestand darin, dass er erstens wegen der schlechten Wege das Reiten als Fortbewegungsart bevorzugte, dass es zweitens heiß gewesen und drittens Zufall gewesen sei, dass der Schneider im Nachbarort lediglich einen weißen Leinenstoff verfügbar hatte, als Stangl wegen des Verschleißes seiner Uniform beschloss, sich einen Anzug machen zu lassen. Dieser besondere Verschleiß wiederum resultierte Stangl zufolge aus der mehrmaligen Desinfektion seiner Kleider wegen Sandfliegenbefalls. Als Stangl diese Geschichte erzählt, hakt Sereny ein und fragt: »Diese Sandfliegen müssen für die Gefangenen ein schreckliches Problem gewesen sein.« Worauf Stangl lapidar antwortet: »Nicht jeder reagierte so empfindlich auf sie wie ich [ ... ]. Sie mochten mich halt.« [44]
Auch wenn man hier gewiss von einem völligen Fehlen von Empathie und einer nachgerade schizoiden Gedankenlosigkeit sprechen kann – einen Prozess von moralischer Korrumpierung deutet diese Episode gerade nicht an, sondern ein vorgängiges und ganz fragloses Gefühl von Überlegenheit und Allmacht. Deshalb stürzt ihn die Sache mit dem Anzug, ganz im Gegensatz zu den Zweifeln an seiner moralischen Integrität, auch 25 Jahre nach den Ereignissen noch in keinerlei Beunruhigung. Mit Bestürzung allerdings erfüllt ihn, dass es gerade dieser Anzug war, der ihn im Chaos der ankommenden Transporte später für überlebende Zeugen identifizierbar machte als jemand, der in die Menge geschossen hatte – was ihn wiederum aufs Tiefste empört und zu Beteuerungen veranlasst, so etwas niemals getan zu haben. [45]Und komplementär zu dieser Empörung, die ihn angesichts der Erschütterung seiner gefühlten Integrität befällt, sind Geschichten, die Stangl erzählt, um eben diese Integrität unter Beweis zu stellen – wie jene vom Häftling Blau, den er, offenbar aus Sympathie, zum Koch gemacht hatte: »Er wußte«, berichtet Stangl, »daß ich ihm helfen würde, wann immer ich konnte. Eines Tages klopfte er in der Frühe an meine Bürotür, stand habt acht und bat um Erlaubnis, mit mir zu sprechen. Er sah sehr besorgt aus. Ich sagte: ›Natürlich, Blau, kommen Sie herein. Was haben Sie denn auf dem Herzen?‹ Er antwortete, es wäre wegen seinem 80jährigen Vater. Er sei mit dem Morgentransport angekommen. Könnte ich nicht etwas tun? Ich sagte: ›Nein, wirklich, Blau, das ist unmöglich, das verstehen Sie doch; ein Achtzigjähriger ...‹ Er erwiderte schnell, daß er das natürlich verstünde. Aber könnte er mich um Erlaubnis bitten, seinen Vater ins ›Lazarett‹ (anstatt in die Gaskammer) bringen zu dürfen? Und könnte er seinem Vater vorher in der Küche etwas zu essen geben? Ich antwortete ihm: ›Gehen Sie und tun Sie, was Sie für das Beste halten, Blau. Offiziell weiß ich von nichts. Aber inoffiziell können Sie dem Kapo von mir sagen, es geht in Ordnung.‹ Als ich am Nachmittag zurück ins Büro kam, wartete Blau schon auf mich. Er hatte Tränen in den Augen, stand habt acht und sagte: ›Herr Hauptsturmführer, ich möchte Ihnen danken. Ich habe meinem Vater zu essen gegeben und ihn ins ›Lazarett‹ gebracht – es ist alles vorüber. Ich danke Ihnen sehr.‹ Ich antwortete: ›Ja, Blau, da ist gar nichts zu danken, aber wenn Sie mir danken wollen, dann können Sie es natürlich tun.‹« [46]
Gerade der Eindruck von einem unglaublichen Zynismus, mit dem man eine solche Geschichte von heute aus zur Kenntnis nimmt, führt an der ja nachgerade treuherzigen Intention Stangls, diese Episode zu erzählen, glatt vorbei: Die Geschichte liefert keinen Beleg für einen moralischen Verfall, sondern dafür, dass sich jemand im Rahmen der zeitgenössischen normativen Orientierungen schon dann als »guten Kerl« wahrnehmen konnte, wenn er einem Menschen durch eine Unterlassungshandlung den Weg in den Tod ein wenig erleichterte. Die Tatsache, dass Stangl in der Lage ist, derlei Geschichten als Illustrationen seiner »menschlichen« Haltung zu erzählen, zeigt exemplarisch, dass Täter solche Beispiele offensichtlich als Belegmaterial benötigen, um ihr Selbstbild als integre Persönlichkeit aufrechterhalten zu können – und davon ausgehen, dass sie auch für ihre Zuhörer als solche erscheinen.
Es scheint einen grundlegenden Widerstand von Menschen dagegen zu geben, als »schlecht« zu gelten, und noch der skrupelloseste Verbrecher scheint aller Erfahrung nach größten Wert darauf zu legen, in irgendeiner Facette seiner Persönlichkeit als »menschlich« wahrgenommen und nicht jenen Kategorien von Personen zugeordnet zu werden, die sie selbst verabscheuen. [47]Diese Alltagsbeobachtung vermag in einer sozialpsychologischen Perspektive kaum zu irritieren, die davon ausgeht, dass es jenseits von sozialer Eingebundenheit menschliches Leben schlichtweg nicht gibt – und insofern, da kann man Sereny allerdings zustimmen, wäre es für Täter vom Schlage Stangls denn in der Tat zuviel gewesen, sich als das Ungeheuer zu erkennen, das er in unserer Perspektive war.
Aber war er tatsächlich ein Ungeheuer? Diese Frage ist politisch wie moralisch vielleicht ganz umstandslos zu entscheiden, nicht aber wissenschaftlich. Sozialpsychologisch betrachtet – und das sträubt man sich angesichts des Ungeheuerlichen seiner Taten zu schreiben – hat er nichts anderes getan, als sich einerseits im Rahmen zeitgenössischer normativer Standards, wissenschaftlicher Lehrmeinungen, militärischer Pflichtauffassungen und kanonisierter Ehrendefinitionen zu verhalten und andererseits sich ebenso zeitgenössischer Definitionen von moralischem Verhalten zu versichern. Und das war es denn auch, was ihn noch Jahrzehnte nach seinen Taten lediglich daran zweifeln ließ, ob er nicht im konkreten zwischenmenschlichen Verhalten gefehlt habe.
Dieser Zweifel an der durchgehaltenen »Anständigkeit« findet sich immer, wenn man sich mit autobiographischen Materialien über Täter beschäftigt, wo diese sich mit der persönlichen Dimension ihres Tuns beschäftigen, dort also, wo sich Stangl mit dem Vorwurf persönlicher Gemeinheit konfrontiert sieht, oder wo Rudolf Höß über von ihm selbst begangene Handlungen räsoniert, »die jedem noch menschlich Empfindenden das Herz im Leibe umdrehen ließen.« [48]
Der Wunsch, als moralisch handelnde Personen angesehen zu werden, existiert, so weit ich sehe, für alle Täter, gleichgültig, wie ihr Bildungsstand, ihre hierarchische Position, ihre Intelligenz ausfiel. Noch Kurt Franz, Stellvertreter und Nachfolger von Franz Stangl als Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka, ein ausgewiesener Sadist, unter dessen Kommando etwa 300 000 Personen und mindestens 139 durch seine eigenen Hände brutal getötet wurden, [49]behauptet in einem Interview, »dagegen« gewesen zu sein, und führt als biographischen Beleg für seine Haltung an, »niemals in meinem Leben irgendwo mit irgendwelchen Juden Schwierigkeiten gehabt« zu haben, was zum Beispiel daraus hervorgehe, dass er »mit den Juden im Stadion in Düsseldorf Makabi als Gegner Handball gespielt« habe. [50]Es geht auch ihm um eine Unterstreichung seiner persönlichen Integrität, die auf eine Differenzierung zwischen dem eigenen moralischen Vermögen und der geforderten mörderischen Aufgabe hinausläuft. Man muss dabei auch im Auge behalten, dass zwischen dem Zeitpunkt der Tat und dem der Rechtfertigung ein Wechsel des Referenzrahmens stattgefunden hat: Während das Töten von Juden, Behinderten, Sinti und Roma etc. bis 1945 als moralische, im völkischen Sinn notwendige Handlung betrachtet wurde, galt es nach dem Zusammenbruch des »Dritten Reiches« als niederträchtiges, durch und durch amoralisches Handeln. Auf diesen Wechsel des Referenzrahmens reagieren die Täter, indem sie Geschichten erzählen, die davon handeln, wie »menschlich« sie unter unmenschlichen Verhältnissen gehandelt haben. Und das ist wahrscheinlich nur zum Teil bewusst gelogen. Es spricht einiges dafür, dass sie daran auch selbst glaubten.
Richard Breitman schließt seine Biographie Heinrich Himmlers mit der deprimierenden Feststellung, dass der Architekt des Massenmords bis zum Schluss davon überzeugt war, ein Moralist gewesen zu sein. [51]Diese Selbsteinschätzung ist, von heute aus betrachtet, nicht zustimmungsfähig, war es aber vermutlich in weiten Teilen der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung bis 1945. Und das verweist eindringlich darauf, dass wir bei der Analyse von Täterhandeln nicht von einem universalistischen Moralkonzept ausgehen können, nach dessen Maßstäben die Täter ganz zweifellos unmoralisch gehandelt haben, sondern von einem partikularen Moralkonzept, das von unserem abweicht, aber in der Sicht der Akteure Geltung beanspruchen und ihr Handeln anleiten konnte. [52]
Diese partikulare nationalsozialistische Moral enthielt, worauf ich noch ausführlicher eingehen werde, als zentrales Moment die Vorstellung erstens von einer absoluten Ungleichheit von Menschen, die aus der Sicht der Akteure wissenschaftlich begründet war, und zweitens die Setzung, dass diese Ungleichheit eine Bedrohung für die nach rassistischen Kriterien höherwertige Gruppe von Menschen bedeutete, der man um des eigenen Überlebens willen begegnen musste. Im Licht einer solchen partikularen Moral musste es keineswegs einen Widerspruch darstellen, wenn man aus rassenbiologisch begründeten Überzeugungen, aber auch aufgrund einer »völkischen Weltanschauung« der Auffassung war, dass das »Judentum« an sich eine Gefahr darstellte, während man gleichzeitig persönlich gar nichts gegen einzelne Juden hatte. Im Gegenteil: Die Einsicht in die historische Notwendigkeit, die feindlichen »Rasse« in die Schranken zu weisen oder sie in letzter Konsequenz zu vernichten, kann moralisch begründet sein, gerade dann, wenn die Maßnahmen dem eigenen »mitmenschlichen« Gefühl widersprechen. Vor diesem Hintergrund ist etwa die Formulierung eines Angehörigen eines Erschießungskommandos einzuordnen, der nach der Exekution einer Gruppe von 200 Juden, die zum Teil den Schützen persönlich bekannt waren, gesagt hat: »Menschenskind, verflucht noch mal, eine Generation muß dies halt durchstehen, damit es unsere Kinder besser haben.« [53]
Diese Äußerung fällt am 21.Juni 1941, also zu Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion; die Erschießungsaktion fand im deutsch-litauischen Grenzgebiet statt. Eine mentalitätsgeschichtliche Rekonstruktion der erfolgreichen Vermittlung rassenbiologisch und völkisch begründeter Moralvorstellungen, die sich von den akademischen und politischen Eliten bis zu den Reservepolizisten an den Erschießungsgruben herunterdeklinierte, kann und braucht hier nicht vorgenommen zu werden. Ulrich Herbert – und nach ihm eine Reihe anderer Historikerinnen und Historiker – haben diese Arbeit am Beispiel unterschiedlicher Gruppen so weit wie möglich geleistet. [54]In Zentrum von Ulrich Herberts brillanter Studie steht der spätere Stellvertreter Heydrichs, Werner Best, der als junger Jurist in den zwanziger Jahren, und zwar keineswegs als einziger, das Konzept eines »seriösen Antisemitismus« entwickelt und vertreten hat. Nach diesem Konzept war die Bekämpfung des politischen und rassischen Gegners »aus dem Vollzug der Gesetze der Natur heraus und in der Verfolgung der Interessen des eigenen Volkes« zu begründen – weshalb »der Kampf nicht mehr in Emotion und Leidenschaft, sondern als ›sachliche‹ Arbeit geführt werden« konnte. [55]
Mit dieser Konzeption eines »sachlichen Antisemitismus«, der gerade aus der Ablehnung persönlicher Motive und akuter Gefühle heraus argumentierte und politische Strategien entwickelte, teilte Best die Auffassung breiter Teile einer akademischen Jugend, die dann nur ein Jahrzehnt später die junge und hochmotivierte Führungselite des »Dritten Reiches« bildete. Wie Herbert herausarbeitet, wird das argumentative Fundament des »seriösen Antisemitismus« zum einen durch die rassenbiologische Lehre, zum anderen durch die völkische Theorie gebildet, die das Wohlergehen und die »Gesundheit« des Volkes als »überzeitlicher Gesamtwesenheit« (Himmler) gegenüber dem Geschick des Einzelnen privilegiert. Daraus leitet sie das Recht ab, dem übergeordneten Interesse des Volkes die Interessen des Einzelmenschen genauso unterzuordnen, wie jene der »Sklavenvölker« denen der »Herrenvölker« zu unterwerfen sind. In der innenpolitischen Theorie des mittlerweile zum Hauptabteilungsleiter des Geheimen Staatspolizeiamtes avancierten Juristen Best lautet das daraus abgeleitete Programm: »Der politische Totalitätsgrundsatz des Nationalsozialismus, der dem weltanschaulichen Grundsatz der organischen und unteilbaren Volkseinheit entspricht, duldet keine politische Willensbildung in seinem Bereiche, die sich nicht der Gesamtwillensbildung einfügt. Jeder Versuch, eine andere politische Auffassung durchzusetzen oder auch nur aufrechtzuerhalten, wird als Krankheitserscheinung, die die generelle Einheit des unteilbaren Volksorganismus bedroht, ohne Rücksicht auf das subjektive Wollen seiner Träger ausgemerzt.« [56]
Die außenpolitische Variante dieser Programmatik bestand in der aus der »völkischen Weltanschauung« hergeleiteten Auffassung, dass es den »ewigen Gesetzen des Lebens« entspreche, wenn sich nach rassischen Kriterien definierte Völker als Feinde gegenüberstünden und auf Leben und Tod bekämpften. Die besondere Rolle der Juden als Gefahr für das Überleben der anderen Völker leitet sich im Rahmen dieser Theorie aus dem Umstand ab, dass sie deren völkische Identität bedrohen, weil sie innerhalb dieser Völker leben und sich mit ihren Angehörigen vermischen. Der zentrale Feind der gesunden Entwicklung des deutschen Volkskörpers wohnt als »Parasit« in diesem selbst und muss ebenso konsequent »ausgemerzt« werden wie andere Träger »schädlichen Erbgutes«, auf jeden Fall aber konsequenter bekämpft werden als äußere Feinde in Gestalt anderer »Völker«.
Dieser »seriöse Antisemitismus« war für Angehörige der Führungselite vom Schlage Bests, wie gesagt, keineswegs ein Anlass, etwa persönliche Ressentiments gegenüber einzelnen Angehörigen der jüdischen Bevölkerung zu entwickeln oder gar die Ausschreitungen »gewöhnlicher Antisemiten« auch in den Reihen der eigenen Partei oder deren Organisationen zu befürworten: Die Juden waren in dieser Perspektive einfach »aufgrund ihrer Abstammung Teil eines den Deutschen feindlichen Volkstums, das zu bekämpfen, zu vertreiben, unter Umständen auch zu vernichten im Sinne [ ... ] der Vorstellungen von den völkischen ›Lebensgesetzen‹ eine unumgängliche, von individuellen Gefühlen aber ganz unabhängige Notwendigkeit darstellte, die mit dem eigenen Verhalten gegenüber einzelnen Juden gar nicht in direkter Verbindung stand.« [57]
Das Vorhandensein solcher Orientierungen in den Kreisen der politischen, administrativen, medizinischen, naturwissenschaftlichen und technischen Eliten sagt freilich nichts darüber aus, wie der faktische Umgang mit Angehörigen der Opfergruppen aussah, und man sollte auch vorsichtig mit Spekulationen über den Verbreitungsgrad bestimmter Einstellungen in verschiedenen Bevölkerungsgruppen sein. Klaus Michael Mallmann geht zum Beispiel davon aus, dass der sachliche Antisemitismus vorwiegend im Kreis der Eliten Widerhall fand, während die Vertreter der darunter angesiedelten Hierarchieebenen der Exekutive – etwa die Dienststellenleiter der Gestapo – ebenso wie ihre Untergebenen »kaum oder gar nicht geprägt von den Leitvorstellungen der ›Generation der Sachlichkeit‹« waren. »Ihr Weltbild war weit weniger intellektuell, ihr Antisemitismus handfester, blutrünstiger, ihr Verhältnis zu unmittelbarer Gewalt bedeutend direkter. Sie befahlen nicht nur, sie schossen und folterten auch.« [58]Aber es geht an dieser Stelle weniger um die statistische Verteilung von Einstellungsmustern unter verschiedenen Personengruppen, die sich retrospektiv ohnehin kaum abbilden lassen, sondern grundlegend um die Frage, welche Rolle moralischen Überzeugungen im Vernichtungsprozess überhaupt zukommt.
Festhalten lässt sich zunächst, dass sich im abstrakteren Sinne einer Moral, die sich auf das Wohlergehen überindividueller und übertemporaler Einheiten bezieht, also von subjektiven Motiven und Zielsetzungen ausdrücklich absieht, Auffassungen wie die von Werner Best durchaus als »moralische« bezeichnen lassen – wenn auch der Inhalt dieser Moral eben partikular ist und sich auf den Ausschluss bestimmter Personengruppen aus ihrem Geltungsbereich richtet.
Im Lichte der prominentesten psychologischen Theorie der Moralentwicklung, derjenigen von Lawrence Kohlberg, müsste man Werner Best sogar eine postkonventionelle Moral zuschreiben, mithin die höchste Stufe der moralischen Entwicklung, die nur von einer Minderheit von Menschen erreicht wird. Kohlberg unterscheidet drei Niveaus der Moralentwicklung, das präkonventionelle, das konventionelle und das postkonventionelle Niveau. Präkonventionell sind nach diesem Modell zum Beispiel Kinder bis etwa zum neunten Lebensjahr oder jugendliche Straftäter, die etwas nur dann für Unrecht halten, wenn es entdeckt wird. Sie haben das zugrunde liegende Normensystem (noch) nicht verinnerlicht. Das konventionelle Niveau ist durch eine Identifikation mit dem herrschenden Normensystem gekennzeichnet; konventionell moralische Personen können deshalb zu autoritärem Verhalten neigen oder im Extremfall Normpathologien wie Adolf Eichmann entwickeln, der in seinem Jerusalemer Prozess die legendäre Stellungnahme abgab, dass er sich selbstverständlich zivilcouragiert verhalten hätte, wenn Zivilcourage angeordnet gewesen wäre. Das konventionelle Niveau wird Kohlberg zufolge von den meisten Erwachsenen erreicht. Das postkonventionelle Niveau bleibt dagegen einer Minderheit von Personen vorbehalten, die sich »von den Regeln und Erwartungen anderer unabhängig gemacht« haben und »ihre Werte im Rahmen selbstgewählter Prinzipien« definieren. [59]
Die postkonventionelle Perspektive ähnelt der präkonventionellen insofern, als sie tradierte Normen und Werte aus einer individuumsbezogenen Perspektive befragt und revidiert, allerdings so, »dass soziale Verpflichtungen in einer Weise definiert werden, die gegenüber einer jeden moralischen Person gerechtfertigt werden kann.« [60]Kohlberg setzt bei seiner etwas tautologischen Argumentation voraus, dass diese Rechtfertigung auf einer universalistischen Basis stattfindet, aber seine Definition postkonventioneller Moral funktioniert auch dann, wenn man eine Wir-Gruppe nimmt, die eine partikulare Moral etabliert hat. Eine Person wie Werner Best argumentiert zweifellos postkonventionell im Rahmen einer partikularen Moral, nämlich normsetzend – nur dass seine Moral lediglich im Geltungsbereich der Volksgemeinschaft universalisierbar ist und nicht für diejenigen gilt, die per definitionem aus ihr ausgeschlossen sind und als feindlich betrachtet werden.
Ohne Kohlbergs definitorische Bemühungen allzu einseitig auslegen zu wollen, wird doch unmittelbar einsichtig, dass solche deskriptiven Modelle der Moralentwicklung ohne weiteres Raum für die Zuordnung der Moral von NS-Tätern bieten, und zwar sowohl auf dem konventionellen wie auf dem postkonventionellen Niveau.
Das empirische Problem besteht dabei lediglich darin, dass die Inhalte der partikularen Moral eines »sachlichen Antisemiten« von dem abweichen, was wir als universalistische Moral akzeptieren würden. Das theoretische Problem hingegen lässt sich so bestimmen, dass wir unterschiedliche Moralkonzepte zur Kenntnis nehmen müssen, wenn wir dem Handeln der Täter analytisch näher kommen wollen. Auch das partikulare Moralkonzept, vor dessen Hintergrund sich die Täter orientieren und bewegen, verpflichtet das Individuum auf ein Handeln, das über seine eigenen Interessen und über seine eigene leibliche Existenz hinausgeht und einem Gemeinwohl dient. Hier taucht aber das Problem auf, dass das, was einem solchen Gemeinwohl dient und was als moralisch richtiges Handeln gilt, epochen- und gesellschaftsspezifisch definiert ist. Deshalb sind Moralkonzepte prinzipiell anfällig dafür, praktisch mit jeglichem Inhalt gefüllt werden zu können, weshalb es etwa auch als moralisch akzeptabel oder sogar notwendig erscheinen kann, bestimmte Personengruppen aus dem Geltungsbereich moralischen Handelns auszuschließen.
Diesen Geltungsbereich kann man in Anlehnung an Helen Fein als »Universum der allgemeinen Verbindlichkeit« bezeichnen. [61]Worum es sozialpsychologisch geht, ist eine verallgemeinerte Definition von Zugehörigkeit und Ausschluss, die auch die Ebene subjektiv gefühlter Selbstverständlichkeiten des Umgangs umfasst. Solche »Universen allgemeiner Verbindlichkeiten« können gruppen- und kulturspezifisch höchst unterschiedlich definiert sein und beziehen sich in der Regel auf eine mehr oder minder weit ausgelegte »Wir-Gruppe«, aus der von vornherein bestimmte andere Gruppen ausgeschlossen sind. Ein zentraler Mechanismus auf dem Weg zum Völkermord scheint nun aber in der Tat darin zu bestehen, dass auch Personengruppen, die ursprünglich, peripher oder gar zentral dem Universum allgemeiner Verbindlichkeit zugerechnet wurden, sukzessive aus diesem ausgeschlossen werden.
Die erste Stufe aller bekannten Genozide liegt entsprechend darin, dieses Universum der allgemeinen Verbindlichkeit neu zu definieren, das heißt, Kriterien von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit zu entwickeln, diese Definition normativ zu begründen und die Zugehörigen auf die zugrunde liegende partikulare Moral zu verpflichten.
Und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Der Grund dafür, dass die weit überwiegende Zahl der Täter an ihrer Aufgabe nicht zerbrach, obwohl viele von ihnen vielleicht tatsächlich gegen ihr »eigentliches« Empfinden töteten, liegt darin, dass die Tötungsmoral des Nationalsozialismus sowohl persönliche Skrupel als auch das Leiden an der schweren Aufgabe des Tötens normativ integriert hatte. Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass die Sprache des Nationalsozialismus aus den »Befehlsempfängern« die »Befehlsträger« gemacht hatte – Transporteure von Zwecken, die an ihrer Last auch selbst leiden konnten. [62]Genau deshalb konnte es als Ausweis von intakter Moralität gelten, im Töten »anständig« geblieben zu sein. Und das wiederum setzt voraus, dass sich die Definition dessen, was Recht und Unrecht ist, insgesamt verschoben hatte – so dass das Töten von Menschen als »gut« gelten konnte, weil es dem übergeordneten Wohl der Volksgemeinschaft diente.
Insofern ist es im Rahmen einer partikularen Moral wie der des Nationalsozialismus »normal«, Dinge zu tun, die nach Maßgabe einer universalistischen Moral verboten sind. Ganz in diesem Sinn sagt Hannah Arendt über Adolf Eichmann, »dass er ›normal‹ und keine Ausnahme war und dass unter den Umständen des Dritten Reiches nur ›Ausnahmen‹ sich noch so etwas wie ein ›normales‹ Empfinden bewahrt hatten.« [63]Mit der Verschiebung des normativen Rahmens wird zum abweichenden Verhalten, was zuvor als integriert gegolten hätte, und umgekehrt. Das macht Töten zum gesellschaftlich integrierten Handeln.
Subjektiv wird die Bereitschaft zum Töten noch durch einen anderen Aspekt moralischer Integrität befördert. Denn die Täter waren gerade im Rückgriff auf eine von ihnen als moralisch definierte besondere Handlungsweise imstande, sich darüber zu versichern, dass ihr moralisches Vermögen noch intakt war. Das heißt, sie wählten eine je besondere Art des Tötens, die ihnen subjektiv vertretbarer schien, als die, die andere favorisierten. Ein horribles, aber leider nicht ungewöhnliches Beispiel dafür hat ein Angehöriger des durch Christopher Browning einerseits und Daniel Goldhagen andererseits berühmt gewordenen Polizeibataillons 101 geliefert, dessen knapp 500 Mitglieder etwa 35 000 Menschen ermordet und weitere 45 000 nach Treblinka deportiert haben: »Ich habe mich, und das war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar erschoß dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind, weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben konnte. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die nicht ohne ihre Mutter mehr lebensfähigen Kinder zu erlösen.« [64]
Dass so etwas möglich und von den Akteuren moralisch integrierbar ist, zeigt, dass die Täter keine mitgebrachten moralischen Hemmungen haben überwinden oder sich korrumpieren lassen mussten. Es zeigt, dass es die Selbstvergewisserung über ihr trotz allem noch intaktes moralisches Vermögen war, die es ihnen erst ermöglichte, Morde zu begehen und sich dabei nicht als Mörder zu fühlen. Sie mordeten gewissermaßen nicht als Person, sondern als Träger einer historischen Aufgabe, hinter der ihre persönlichen Bedürfnisse, Gefühle, Widerstände notwendig zurückstehen mussten. Das heißt, sie mordeten mit Hilfe einer subjektiven Distanz von der Rolle, die sie ausfüllten.
Rollendistanz ist, wie Erving Goffman ausgeführt hat, eine zentrale Bedingung professionellen Handelns; sie bezeichnet den Abstand »zwischen Tun und Sein«. [65]