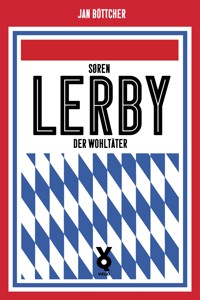9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
„Ich versuche ständig, mit der Fremde warm zu werden. So wie ich nicht anders kann, als mit der Wärme zu fremdeln.“ In Deutschland lernen sie sich kennen. Im kriegszerstörten Kosovo können sie nicht zusammenbleiben. Nur ihrem Sohn gelingt es, die alten Grenzen hinter sich zu lassen. Jan Böttcher hat einen großen europäischen Roman geschrieben: die Geschichte einer ungleichen Liebe zwischen Nord und Süd, Heimat und Fremde, Schicksal und Selbstbestimmung. »Ein Roman, der grenzübergreifend relevant sein wird.« Sasa Staniši »So spannend wie erhellend – dieser Roman ist ein Tanz der Lebenslust in Todesnähe. Und eine der traurigsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe!« Moritz Rinke Dieser Roman erschien 2016 unter dem Titel "Y" im Aufbau Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Ähnliche
Informationen zum Buch
»Ich versuche ständig, mit der Fremde warm zu werden. So wie ich nicht anders kann, als mit der Wärme zu fremdeln.«
In Deutschland lernen sie sich kennen. Im kriegszerstörten Kosovo können sie nicht zusammenbleiben. Nur ihrem Sohn gelingt es, die alten Grenzen hinter sich zu lassen. Jan Böttcher hat einen großen europäischen Roman geschrieben: die Geschichte einer ungleichen Liebe zwischen Nord und Süd, Heimat und Fremde, Schicksal und Selbstbestimmung.
»Ein Roman, der grenzübergreifend relevant sein wird.« Sasa Stanišić
»So spannend wie erhellend – dieser Roman ist ein Tanz der Lebenslust in Todesnähe. Und eine der traurigsten Liebesgeschichten, die ich in den letzten Jahren gelesen habe!« Moritz Rinke
Dieser Roman erschien 2016 unter dem Titel "Y" im Aufbau Verlag.
JAN BÖTTCHER
Y
ROMAN
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Teil II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Dank
Über Jan Böttcher
Impressum
Für Meike, Joakim und Milan
Wir suchen alle nach den gleichen Dingen – nach Schutz, Nahrung, Wasser und Schönheit.
Marjetica Potrč, Dringliche Architektur
Die Natur, so scheint der logische Verstand zu sagen, hätte doch alle die nützlichen Funktionen wie Entladung überschüssiger Energie, Entspannung nach Kraftanstrengung, Vorbereitung für Forderungen des Lebens und Ausgleich für Nichtverwirklichtes ihren Kindern auch in der Form rein mechanischer Übungen und Reaktionen mit auf den Weg geben können. Aber sie gab uns gerade eben das Spiel mit seiner Spannung, seiner Freude, seinem Spaß.
Johan Huizinga, Homo Ludens
TEIL I
1
Für mich beginnt diese Geschichte mit dem Sommerabend, an dem mein Sohn Benji seine Angewohnheit fallenließ, im Wohnzimmer zu erscheinen und uns eine gute Nacht zu wünschen. Es war eine der letzten Verbindlichkeiten zwischen uns, und bevor ich um kurz nach zehn an seine Zimmertür klopfte, hatte ich schon mehrfach auf die Uhr gesehen.
Er reagierte nicht auf das Klopfen, weil er auf seinem Balkon saß. Was noch ungewöhnlicher war, er hatte einen Gast.
»Leka«, sagte Benji.
»Hallo«, sagte ein Junge, der unbewegt auf den Betonboden blickte. Sie hatten beide eine Lemonbierflasche in der Hand – eine davon durfte Benji pro Woche offiziell trinken –, neben ihnen war ein dritter Balkonstuhl aufgeklappt, was ich als Aufforderung verstand, selbst Platz zu nehmen. Mein Sohn weitete die Augen. Mehr passierte nicht.
»Was ist los mit euch?«
»Ach lass mal, Papa.«
Benji war gern der Meinung, uns Informationen über seine Freunde bereits mitgeteilt zu haben, auch wenn sich außer ihm niemand daran erinnerte. Den Namen Leka hatte ich noch nie gehört.
»Okay, was haltet ihr davon, wenn ich mir auch so ein Lemon hole.«
»Meinetwegen nicht«, stöhnte Benji.
Ich stand auf und kehrte keine halbe Minute später mit einer offenen Flasche zurück. Meine Frau und ich versuchten alles, wir gaben uns nah und machten uns rar, wir sehnten ein neues Kommunikationszeitalter mit Benji herbei, stritten aber ständig über das richtige Maß an Zuwendung, und womöglich hätte Maren, wäre sie dabei gewesen, den dritten Balkonstuhl eher eingeklappt, als darin eine Gesprächsgelegenheit zu sehen.
»Kennt ihr euch aus der Schule oder aus dem Park?«
»Weder noch.«
»Einfach so Freunde.«
»Jawollo.«
»Leka?«
»Richtig«, sagte Benji, der alle Antworten gab, weil sein Freund anscheinend in eine Sommerstarre verfallen war. Um genau zu sein: Benji sagte rischtich, weil er anders als seine Eltern in Berlin geboren ist und es gern betont.
»Er möchte heut bei mir übernachten.«
»Darf ich ihn vorher kennenlernen, ich meine, spricht er?«
Benji sah zu Leka hin, auffordernd.
»Er versteht uns nicht, oder?«
»Doch. Morgen spricht er.«
Wer bin ich, dass ich meinem Sohn verbieten würde, in den Schulferien einen Freund bei sich übernachten zu lassen? Feierlich sprach ich meine Erlaubnis aus, was Benji mir am nächsten Morgen als pseudogroßzügig vorhielt. Da saß Leka allerdings nicht an unserem Frühstückstisch. Ich begegnete dem Jungen erst am übernächsten Abend wieder, gegen 22.40 Uhr auf unserem Flur, weil wir beide zur Toilette wollten. Benji musste ihn in unsere Wohnung gelotst haben, und mir blieb nichts anderes übrig, als mich ein weiteres Mal mit den beiden Jungs zusammenzusetzen.
»Klar, kein Hotelbetrieb«, kam mir Benji zuvor, obwohl ich etwas Derartiges noch nie von mir gegeben hatte.
»Leka, warum musst du hier übernachten?«
»Weil er sonst nirgendwo bleiben kann.«
»Kann ich das jetzt bitte mal von deinem Freund selbst hören?«
Leka zuckte mit den Schultern. »Ja«, sagte er schließlich, »ist so.«
»Deine Eltern sind nicht in Berlin?«
Ich habe kein erkennungsdienstliches Talent, aber die Pause, die meiner Frage folgte, machte mich misstrauisch. Sie sahen einander an und verneinten erst dann, synchron.
»Okay, du bist zu Hause rausgeflogen.«
Es war ein bisschen wie in dem Ratequiz aus alten Tagen, als noch Fünfmarkstücke in Porzellanschweine fielen: Kandidat und Moderator sahen sich wieder in die Augen, Benji nickte, Leka nickte auch, dieses Mal bejahten beide.
Ich wies sie auf den Widerspruch ihrer beiden Aussagen hin und zog sofort meine Schlussfolgerung: »Du bist ausgerissen.«
Sie stellten sich wirklich dumm an.
»Einmal noch, Papa, ja?«
»Und was ist morgen?«
»Findet sich jemand, bestimmt.«
Mit ratlos erhobenen Händen und einem kumpelhaften »Tu, was du für richtig hältst«, das meiner Haltung überhaupt nicht entsprach, verließ ich den Raum.
Lange saß ich noch im Sessel, erkenntnislos. Erfreut darüber, dass mein Sohn Empathie für einen Jungen in Not aufbrachte, aber auch mit dem lauten Rauschen aller abgefahrenen Züge im Ohr, die Benji genommen hatte, während wir Eltern am Bahnsteig stehen geblieben waren. Die Züge waren eher ein Bild für mein wachsendes Unwissen als für mein mangelndes Verständnis.
Nachts schlich ich hinüber, wollte sehen, wo Leka schlief. Er lag auf meiner aufblasbaren Camping-Isomatte. Ich hob seine Jeans vom Boden auf, befühlte die Vordertaschen nur von außen, weil ich Klimpergeld vermutete. In der Gesäßtasche steckte eine Visitenkarte. Ich nahm sie mit, auf dem Flur las ich:
CubeGame Computerspieldesign
Jakob Schütte / Geschäftsführer
Manager / Chief Operating Officer
Das Firmenlogo auf dem kleinen Stück Pappe – grüner Stern im orangefarbenen Kreis – strahlte mich auffordernd an, was Visitenkarten aus meinem beruflichen Umfeld, dem Literaturbetrieb, niemals taten. Ich schrieb mir Name, Web- und Mailadresse ab, steckte die Karte wieder in Lekas Hosentasche und ging ins Bett, ohne irgendwas zu googeln.
Und wieder erschien mein Sohn allein zum Frühstück. Leka, sagte er, sei schon auf der Piste, um sich einen neuen Schlafplatz zu besorgen.
Die Angelegenheit schien erledigt zu sein, weil Leka weder an diesem noch am folgenden Abend auftauchte. Dafür strafte mich Benji mit Ignoranz, der schlimmsten aller Waffen, gegen die ich mich einfach nicht verteidigen konnte.
»Was ist los, Benji?«
»Leka ist verschwunden.«
»Das hab ich gemerkt.«
»Nicht hier, er ist insgesamt weg. Gestern und heute nicht im Mauerpark aufgetaucht.«
»Verstehe. Ich hab eine Frage an dich. Komm mal mit an meinen Rechner, pass auf, ich zeig dir jemanden, und du sagst mir, ob du ihn schon mal gesehen hast.«
»Ja.«
»Weil?«
»Das ist sein Vater, oder?«
»Wenn du das sagst. Woher kennst du ihn?«
»Einmal bin ich hinterher, Leka ist immer um sechs Uhr abgeholt worden, er ist dann einfach weggelaufen und in ein Auto gestiegen. Weißt du, wo das Auto gewartet hat?«
»Nein.«
»Im Gleimtunnel.«
»Und das war er hier?«
»Glaub ja. Vielleicht. Weiß ich nicht. Was fragst du immer für Sachen? Weiß ich doch nicht, Mann!«
Erst jetzt war Benji bewusst geworden, dass hier etwas nicht stimmte. Woher hatte ich den Link zu Jakob Schütte? Wir stritten ein wenig, ich will hier nicht den kompletten Wortlaut wiedergeben. Anscheinend war Leka von diesem Jakob Schütte abgehauen und wollte auch nicht zurück zu ihm. Womöglich irrte er gerade durch Berlin. Viel wichtiger aber: Mein Sohn hing an dem stummen fremden Jungen.
Er vermisste einen Freund. Möglich, dass er sich vorwarf, selbst zu wenig aus Leka herausgepresst zu haben, oder er hatte ein angekündigtes Verschwinden nicht ernst genommen. Benji teilte nicht mit, was genau ihn umtrieb, nur dass sie eine gute Zeit gehabt hatten. Ein paar Fotos gab es, ein kurzes Video vom Basketballplatz. »Er kann ein paar coole Moves«, sagte Benji. Mir schien der Junge kein besonders gutes Ball- und Körpergefühl zu haben. Und sonst? Hobbys? Bevorzugte Kleidung, bevorzugte Droge? Mein Sohn lächelte offenherzig, und ich schloss damit immerhin aus, dass sie sich gemeinsam zugedröhnt hatten und Benji womöglich nicht Leka, sondern eine entbehrte Substanz vermisste.
Am nächsten Tag konnte ich im Büro kaum stillsitzen. Ich verstand nichts vom Leben meines Sohnes. Und ja, das war schlimm. Und ja, beim Mittagessen brachte die Unruhe einen Entschluss hervor: Ich würde Benji nachher im Mauerpark abholen, wir würden seinen Kumpel Leka gemeinsam suchen. Er sollte sehen, dass ich Anteil nahm an seinen Freundschaften, dass meine Arbeit jederzeit zurückstehen konnte etc.
Ich schob mein Fahrrad von der Eberswalder Straße in den Park hinein und fand Benji sofort, er trug sein blaues Basketballtrikot und saß mit einem Mann auf den Betonstufen am Rand des einzigen Korbes. Offensichtlich redete der Typ auf Benji ein, er wirkte richtiggehend zudringlich, fuchtelte mit den Händen und beugte sich immer wieder vornüber. Ich beobachtete das Szenario, bis sich mein Beschützerinstinkt zuschaltete, und nach ein paar langen, schnellen Schritten stellte ich mich als Benjis Vater vor. Spielte mich auf, sagte Benji später, aber egal.
Aus der Nähe erkannte ich das Gesicht wieder, das ich im Netz gesehen hatte.
»Schütte, hallo.«
Er war in meinem Alter, trug schwarze, streifenlose Turnschuhe, eine schwarze Anzughose und ein giftgrünes T-Shirt. Ein typischer Jungunternehmer des 21. Jahrhunderts, dachte ich, ein Macher, Manager, Trainer, das floss ja dieser Tage zumindest optisch alles ineinander. Ich sage das, weil sich Jakob Schütte im nächsten Moment mit klingelndem Handy von uns losmachte, die Hand, wohl zur Entschuldigung erhoben, blockte uns ab.
»Er sucht ihn auch«, sagte Benji.
Mir blieb gar nichts anderes übrig, als Schütte zu beobachten. Beim Telefonieren wiegte er leicht den Kopf, dann hastete er einem fehlgegangenen Basketball nach und warf ihn in die Spielrunde zurück, einmal sah er mich zufällig an und verdrehte die Augen über den Menschen, der da gerade irgendwas mit ihm bereden wollte.
So nahm er Abstand und suggerierte Nähe. Dass er beides gleichzeitig vermochte, schockierte mich, denn mir selbst ging diese Fähigkeit völlig ab. Wie viel Aufwand hatten meine Frau und ich darauf verwendet, unserem Sohn gegenüber an- und abwesend zugleich zu sein. Aber siehe da, Vollprofis können so etwas, sie bespielen die ganze Bühne.
Das war mein erster Eindruck von Jakob Schütte.
»Erfolg zieht die Fliegen an«, sagte er, als er das Telefonat beendet hatte. »Und die geistigen Tiefflieger«, setzte er hinzu. »Und was führt Sie her?«
Seiner deplatzierten Frage wegen grinste er mich an. Er hatte eine hohe Stirn, eher schon Halbglatze, und trug das leichtgewellte Haupthaar cäsarisch nach vorn gekämmt.
»Ich will den Freund meines Sohnes suchen.«
»Das ist ehrenwert. Dann sind wir schon zu dritt.«
Schütte und ich tauschten ein paar Plattitüden aus, echt voll hier, unübersichtlich hier, Kreuzberg aber auch, ganz Berlin ein internationales Tollhaus. Mitten im Satz hielt er inne und wandte sich an meinen Sohn:
»Wer von denen hier kennt Leka noch?«
Benji nannte ihm einen weiteren Kumpel, der auch am Rand des Spielfeldes saß. Daraufhin gab mir Jakob Schütte seine Karte, und ich musste mir ein Lächeln verkneifen.
Das verschwundene Kind blieb leider verschwunden. Benji fand nicht zur Tagesordnung zurück. Er fuhr auf einen Wochenend-Rave und blieb vier Tage weg, und als er so gnädig war, seinen Aufenthalt abends per Telefon zu verlängern, wurde er auch noch pampig. Meine Frau hatte die Nase voll. Wir diskutierten drastische Maßnahmen, aber da der gemeinsame Urlaub wegen unserer beider Arbeit in diesem Jahr sowieso gestrichen war, konnten wir uns weder zu Hausarrest noch zu einer Taschengeldsperre durchringen. Zu Hause hätte Benji die Zeit nur mit irgendwelchen Adventures vor dem Rechner verbracht, und wir hatten seine Spielerei erst kürzlich erfolgreich eingedämmt.
Schüttes Visitenkarte bewahrte ich mittlerweile in meiner Brieftasche auf. Erst jetzt sah ich mir die Internetpräsenz von CubeGame an, anscheinend eine erfolgreiche Firma, wenn auch kein Global Player. Ich schlug mich mit dem kindischen Gedanken herum, diese Sache müsste unter Erwachsenen geregelt werden.
Ich hatte Leka zweimal flüchtig gesehen. Aber ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass ein Junge, der so alt war wie mein Sohn, von einem Tag auf den anderen verschwunden war.
»Du darfst die Dinge jetzt nicht vermischen«, sagte meine Frau.
»Was nehmen andere Eltern alles in Kauf, wenn sie die Möglichkeit sehen, die Gunst ihrer Kinder wiederzugewinnen«, sagte ich.
Sie antwortete nicht mehr.
Ich zog die Visitenkarte hervor und rief Jakob Schütte an, um mich mit ihm zu verabreden.
2
Für Jakob Schütte begann die Geschichte mit der Party, auf der er seine zweite Chance bekam.
Er hatte nicht mehr dafür getan, als den Türsummer zu drücken und ein Gelächter in den Hausflur einzulassen, das ihm Treppe für Treppe entgegenstieg, bis an die Wohnungstür im dritten Stock. Jakob musste zurückweichen, Mäntel fielen vom Haken, ein Unbekannter bekam die Tür ins Kreuz, stolperte und fiel in Kantes Arme. Im Hintergrund tanzten gelbe Gerbera, über Kopf gehalten, abgetaucht, wieder emporsteigend, gelbe Gerbera, die unten auf der Susannenstraße noch spätabends in großen Kübeln angeboten wurden, sie kamen immer näher, und Jakob suchte nach dem zugehörigen Gesicht, konnte aber plötzlich nur noch schwer atmen:
»Du?«
»Die Freundin einer Freundin hat mich …«
So wurde ihm Arjeta Neziri in die Wohnung gespült, so trafen sie sich im September 1998 wieder, so erzählte er mir davon. Sein Mitbewohner Kante feierte damals in seinen 25. Geburtstag hinein, aber den gelben Gerberastrauß drückte Arjeta spontan Jakob in die Hand. Und der konnte nicht umhin, in der Frau, die vor ihm stand, das Mädchen zu sehen, das er einmal gekannt hatte. Arjetas Haar war etwas länger als zu Abizeiten, ihr Outfit – ein schlichtes schwarzes Kleid über roten Kniestrümpfen – geradezu stilvoll im Vergleich, denn als Teenager hatte sie grobmaschige Strickpullis getragen, regelrechte Spinnennetze.
Jakob ging voran in die Küche. Während er aus dem Unterschrank eine Vase hervorkramte, sagte Arjeta etwas, das über ihn in der Abizeitung gestanden hatte: »Ich dachte, du wolltest nach Amerika, dir war doch in Deutschland alles zu langsam, zu zurückgeblieben.«
»Stimmt. Da war was. Amerika!«
Er geriet gleich ins Schwärmen: die San Francisco Bay, seine immer stärkere Leidenschaft für Computer, die unglückliche Liebe zu einer Amerikanerin. Jakob merkte selbst, wie schnell er sprach, aber als er sich ein Bier holen ging, schloss er danach nahtlos an: seine Faulheit an der Universität, wie einsam er sich im Studium gefühlt habe, dass ihm zu viel Abschied auf der Seele lag (seine Mutter war früh bei einem Autounfall gestorben, was Arjeta wusste), Jakob wurde von der ZVS nach Bamberg geschickt, die Amerikanerin meldete sich gar nicht mehr, alles sei ihm abhandengekommen: »Ich bin dann nach Hamburg gezogen. Vielleicht weil ich in der Nähe meines Vaters sein wollte.«
An dieser Stelle verengten sich ihre Augen. »Ich wohne immer noch bei meinen Eltern«, sagte Arjeta.
Das war die erste Information von ihr.
Die zweite war, dass die Familie Neziri kurz nach Arjetas Abitur nach Wilhelmsburg auf die Elbinsel gezogen war. Den dritten Satz brach sie ab, weil sie meinte, im Tanzzimmer laufe irgendein Song, der schon auf ihrer Abifeier gelaufen war. Sie wollte aber nicht tanzen, sie fand es in der Küchennische gemütlicher; dort, wo Jakob auch manchmal mit Kante frühstückte, saßen sie auf den einzigen beiden Stühlen, Erdnüsse und Cracker knabbernd. Jakob trank weiter Bier und dachte daran, dass sein Vater längst nicht mehr der Grund war, warum er in Hamburg wohnte. Arjeta ließ sich den zweiten Caipirinha reichen, im Hintergrund wurden lautstark Cocktails gemixt. Die Party war in vollem Gange, zwei Typen hatten Birnenschnaps aus einer illegalen Destille im Alten Land mitgebracht, einen 5-Liter-Kanister, und um Mitternacht wehte aus dem Wohnzimmer das Geburtstagsständchen für Kante herüber, Akkordeon, Hans Albers, Seemannslieder, da fragte Jakob gerade: »Und was macht die Heimat?«
»Das willst du nicht wissen.«
»Warum nicht?«
»Entsetzlich.«
»Entsetzlich klingt spannend.«
»Zum Beispiel wurde mein Großvater verhaftet. Und geschlagen. Dafür, dass mein Vater früher mal für einen reichen Albaner gearbeitet hat. Ich meine, wie lange sind wir jetzt in Deutschland? Dreizehn Jahre?«
Das also machte die Heimat. Verhaftung, Schläge. Jakob hatte keinen blassen Schimmer, wie so etwas geschehen konnte. Der reiche Albaner hieß Herr Krasnici, ein guter Mann, erzählte Arjeta, fast eine Art Familienmäzen. Ihm gehörten in Kosova einige Restaurants und Pensionen, auch diejenige, in der ihr Vater seinerzeit gearbeitet habe. Aber die Pension stand nun schon lange leer. Als die Krasnicis ins Ausland gingen, kamen bald die Kinder der Eisenhändler herüber. Erst waren es nur Mäuse, die übers Dach der Pension trippelten, aber sie kehrten als Ratten zurück, größer und aufdringlicher, wie eine Plage suchten sie das Dach jedes verwaisten Hauses heim, bis sie auch ihre älteren Brüder, die Kleinelefanten, mitbrachten, unter deren Schritten und Tritten jedes Dach irgendwann zusammenbrach.
So übersetzte er sich in laufende Bilder, was Arjeta viel sachlicher erzählte. Die fremden Jungs stiegen ein, rissen den Rezeptionstresen heraus, demontierten die Schrifttafeln, trugen sogar die Eingangstreppe ab, weil sie aus Platten bestand, nicht aus massivem Beton.
Das wusste sie alles von ihrem Großvater.
»Aber stell dir vor, bei der Pension Krasnici hat es drei Monate gedauert, mit unserem Haus ging es in einer Nacht. Die Serben haben alles weggenommen und abgebaut, das Dach aufgemacht, ein Lagerfeuer mittenrein. Die Asche hat noch am nächsten Tag geglüht, als mein Großvater von der Polizei zurückkam.«
Jakob hätte Arjeta beinahe sein Beileid ausgedrückt, wie auf einer Beerdigung. Stattdessen bohrte er sich den Daumen in die Mulde übers Schlüsselbein, bis der Nervenschmerz in den Unterarm strahlte.
Sie sah ihm dabei zu.
»Jetzt is’ besser. Sag mal, wie haben wir das geschafft, Hamburg, Amerika, Kosova, haben wir jetzt echt fast vier Stunden erfolgreich über unsere Schulzeit hinweggeredet?«
Ihr Lachen erinnerte ihn an früher, sie lachte wie über einen guten Witz oder eine lustige Frage.
Und dann zog sie, hilflos wie Jakob, die Schultern hoch. »Kann sein. Glaub schon.«
Arjeta war der letzte Partygast gewesen. Die Haustür unten sei nachts oft abgeschlossen, hatte er behauptet. Nur um sie hinunterzubegleiten. Die Tür war offen. Bei der Umarmung auf der Straße hatte er versucht, sie etwas länger festzuhalten. Er wusste dabei nicht, ob er sich festhielt an dem Mädchen, das einmal in der letzten Bankreihe gesessen hatte, wusste nur, dass sie jetzt Kunstgeschichte studierte und dass ihr Elternhaus in Prishtina verwüstet war.
Zurück in der Wohnung, nahm Jakob sich ein letztes Bier aus dem Kühlschrank und schrieb die Telefonnummer ab, die ihm Arjeta auf den Handballen geschrieben hatte, versuchte dabei, ihre Handschrift zu imitieren. Danach grub er die Abizeitung aus, das hatte er lange nicht gemacht. Er masturbierte zu ihrem Foto, brach aber auf halber Strecke wegen stechendem Kopfschmerz ab.
Alles Mögliche hatte Jakob ihr an diesem Abend erzählt, und wenn das der Plan gewesen war, dann war es ein guter Plan gewesen. Je bunter man sein gegenwärtiges Leben ausmalte, desto blasser mussten doch Scham und Erinnerung werden, bis sie unerkennbar in die Ferne rückten.
Jakob hatte dem Mädchen Arjeta einst Zettel und Briefe geschrieben. Nicht bloß dieses Ja-Nein-Zeug zum Ankreuzen. Vierzehnjährig hatte er sich ihr offenbart. Es aber kein einziges Mal geschafft, sie anzusprechen, gerade so, als seien seine Liebesbriefe in allen Belangen wichtiger als ihre Reaktion darauf. Als habe ihn im Grunde gar nicht interessiert, was sie daraus machte.
Er hoffte, dass sie auf dem Nachhauseweg nicht an seine missratenen Briefe dachte. Dass sie fortan nie mehr daran dachte.
*
Die Blumen standen auf Jakobs Schreibtisch.
Zehn Sonnen, die bis in den letzten Winkel des Zimmers strahlten. Er sah zu, wie die nur noch gelblichen Blütenzungen erschlafften. Nach zehn Tagen pflückte Jakob die Blättchen ab und legte sie vor seinen Büchern im Regal aus, wo sie auch ihre letzte Farbe verloren. Dann sammelte er sie in einer Streichholzschachtel, die er immer wieder auf und zu schob.
Vor lauter Nervosität hatte er beinahe den Zeitpunkt verpasst, Arjeta anzurufen. Dabei wartete sie nur darauf. Sie nannte sofort einen Treffpunkt: Die Schilleroper, Foyerbar eines ehemaligen Zirkus, lag in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung. In den alten Couchgarnituren, sagte Jakob, seien sie versunken wie in einer Luftblase auf offenem Meer. Um unter Wasser ihre Lebensgeschichten auszutauschen.
Blütenblätter, Luftblase.
Sie sahen sich täglich. Aber die Schilleroper hatte Arjeta nicht ausgewählt, um danach bei Jakob zu übernachten. Sie verabschiedeten sich wie nach der Party, nur dass die Umarmung länger anhielt. Jakob meinte, er sei so oft spät nach Hause gekommen, dass er mit diesem letzten Viertel des Jahres 1998 ein spezielles Geräusch verbinde: die herunterrasselnden Rollläden der Kneipe gegenüber.
Blütenblätter, Luftblase, Rollläden.
Immerhin ging er nicht zu seinem früheren Ich auf Distanz, spielte seine Gefühle nicht herunter.
Die Kneipen schlossen also ihre Augen, Jakob stand am Fenster, sah dem Herbstlaub unten auf der Straße beim Herumwirbeln zu. Er dachte an die Schulzeit und an Arjetas Mädchengesicht. Hatte er sie damals angehimmelt, ohne sich im Geringsten für ihre Herkunft zu interessieren? Wie konnte es sein, dass er von all dem, was sie ihm nun über ihre Flucht nach Deutschland erzählte, noch nie gehört hatte?
Jakob schämte sich ein wenig dafür. Gleichzeitig machte es ihn aufmerksamer für die Gegenwart. Dies hier war ein anderes, reiferes, ein höheres Verliebtsein. Nacht für Nacht stand er am Fenster und wiederholte die Dinge, die Arjeta gesagt hatte. Er wollte nichts davon verlieren.
Auf dem Fußboden seines WG-Zimmers lag der alte Diercke-Weltatlas, aufgeschlagen die Doppelseite Mitteleuropa. Prishtina war schon nicht mehr drauf, es lag zu südlich, deshalb konnte er Arjetas Reise erst ab Belgrad mit dem Zeigefinger nachgehen, über Budapest und Wien bis nach Nürnberg. Es dauerte keine drei Sekunden.
In diesen Nächten wurden Arjetas Bilder seine Bilder.
Ihre Eltern mit Gepäck am Körper und in beiden Händen, so viel wie sie mitnehmen konnten. Das Mädchen selbst mit einem schweren Sack auf dem Rücken, links und rechts ihre kleinen Brüder an der Hand, Naim und Rrustem, elf und sieben Jahre alt.
In Nürnberg hatten die Neziris die erste Nacht verbracht, in einer Untersuchungshaftzelle, in Nürnberg stand auch die Asylbehörde, wo Arjetas Vater alle möglichen Dinge auf den Tisch legte, von denen er meinte, sie gehörten da auf den Tisch gelegt. Ihre jugoslawischen Pässe. Ein Grundbuch. Die beiden Zahnruinen, sie waren ihm in der Pension ausgeschlagen worden, weil er einem serbischen Offizier nicht gestattet hatte, eine Nutte mit aufs Zimmer zu nehmen. Dazu Unterlagen, die seine berufliche Kompetenz bestätigten, Gegenstände, die belegen sollten, dass der Familie ein Leben in der Heimat nicht mehr zuzumuten war.
Der ganze Tisch war wie eine Flohmarktdecke voll gewesen mit Zeug.
Und alle dachten, das müsse ja wohl reichen.
Hatte es aber nicht.
Ihr Antrag wird bearbeitet.
Sie waren ins niedersächsische Uelzen gefahren, dort wohnte Arjetas Großonkel Aki, den die Neziris seit zwei Jahrzehnten für einen Schuhmacher hielten, dabei saß er bloß noch auf dem Sofa herum. Ein alter Mann, der nach all den Jahren in Deutschland den Anschluss zu den Nachbarn und Arbeitskollegen verloren oder ihn überhaupt nie gefunden hatte. Einem von Arjetas Brüdern war die Anstrengung der Flucht auf die Bronchien geschlagen, bellender Husten, fast ohne Unterbrechung. Der andere drehte ziellose Runden durch die Uelzener Innenstadt und schnorrte Zigaretten für seinen Vater, ohne dass er die Sprache dafür hatte. Arjeta selbst nahm ein Deutsch-Lehrbuch aus dem Schrank.
Ihr Antrag weist gravierende Formfehler auf.
Die Neziris hätten nicht in ganzer Familienstärke kommen sollen, hieß es jetzt, eine Wiedereinreise nach Kosova sei ihnen grundsätzlich zuzumuten.
Andererseits, sagte ihr Anwalt, ein halbes Jahr Duldung, das sei ein halbes Jahr Zeit, um weitere Schriftstücke zu besorgen, die einen weiteren Antrag ermöglichten.
Arjetas Mutter hatte daraufhin Geschirr geschmissen wie auf einem Polterabend. Beim Großonkel Aki konnten sie im Winter sowieso nicht bleiben. Die städtische Behörde vermittelte ihnen einen Platz im Durchgangslager. Ein Wohncontainer. Gewelltes PVC, gammeliges Gemeinschaftsklo, nicht mal die Containertür war verschließbar. Kurz vor der Dunkelheit kamen die Männer des Lagers zusammen, um Feuerholz zu sammeln. Von drei Waschmaschinen zwei kaputt, alle stritten sich um die dritte. Dafür gab es einen wilden Hund, der Arjetas kleinen Bruder anfiel. Und eine Art Lagerkommandantin, die ihnen sogar beim Spielen zusah.
Hier hätte die Flucht auch enden und die Reise zurückgehen können, hatte Arjeta gesagt.
Ihr Vater aber blieb hartnäckig und wandte sich an einen neuen Anwalt in Lüneburg, obwohl er den Landkreis Uelzen gar nicht verlassen durfte. Dieser Anwalt verschaffte ihm einen Job. Sie verließen das Lager. Eines führte zum anderen. Der Job zur Wohnung, die Wohnung zum Ortswechsel.
*
In Lüneburg stand die Schule, auf der er Arjeta begegnet war. Damals hatte sie ihn einen Freak genannt, er war für alle der Computerfreak gewesen. Darüber lachte sie nun, als sie sagte, das Praktische an ihm, das Drängende, Originelle, Nervöse – früher sei ihr das alles gar nicht aufgefallen.
Jakob wusste nicht, ob er sich verändert hatte, aber wenn er die Schultern hochzog, dann nicht aus Ratlosigkeit. Okay, sagten diese Schultern. Wenn du meinst. Arjeta konnte jetzt erzählen, weil er zuhörte. Er hörte jetzt zu, weil sie erzählen konnte. Leben in der Luftblase. Unverwundbar sein. Draußen das Hamburger Schmuddelwetter, die zunehmend dunklen Tage, und sie saßen in der Wärme, geschützt von ihrer Liebe, sechsundzwanzigjährig, Arjetas dunkle Augen und sein grünes Flaschenglas im Kerzenschein.
Sie erzählte von ihren Eltern. Ihre Mutter Blerina, die sich in allen Wohnungen sofort einrichten wollte. Ihr zögerlicher Vater Nikola, der zwar nach Arjetas Erlebnissen in der neuen Schule fragte, aber immer auch danach, woran sie sich in der Heimat erinnerte und ob sie auch oft genug an ihre Freundinnen in Kosova dachte. Die Geschichte eines Landes, so zitierte sie ihn, fängt in dem Augenblick an, wo man sich mit ihr beschäftigt. Und sie hört demnach auf, wenn man es nicht mehr tut. Einprägsame Worte. Ihr Vater muss zu dieser Zeit eine Art Alltagsphilosoph gewesen sein.
Ein Kind zu bekommen.
Jemanden gehen zu lassen, obwohl man ihn liebt, weil man ihn liebt.
Einen Freund zu verraten.
Ein Haus zu verlassen und das Land.
Das waren für Nikola Neziri die großen Dinge des Lebens.
Arjeta wollte, dass Jakob das Auswandern für eine Leistung hielt. In jedem Fall wollte sie ihm zeigen, wie wichtig ihr Vater für sie war. In Lüneburg hob er Baugruben aus – in Prishtina hatte er noch in der Pension gearbeitet und die besten Anzüge getragen. Die harte körperliche Arbeit war ihm zu hart und zu körperlich. Und Arjeta, sie bekam ein schlechtes Gewissen. Sie war in Kosova auf eine gute Schule gegangen, in Deutschland hatte ihr Vater dafür gesorgt, dass sie auf eine noch bessere ging. Er hatte ihr sogar erlaubt – das sogar hatte Jakob sich gemerkt –, in der Bücherei die Sprachlernkassetten aus dem Serbokroatischen zu verwenden, weil es keine albanischen gab.
»Dieser Gedanke kam immer wieder zurück, dass meine Eltern es so schwer haben und ich so leicht.«
»Meinst du, er hat dir das in den Kopf gesetzt?«
»Weiß ich nicht. Nein, eigentlich nicht.«
Eine Pause entstand, dann sagte Jakob:
»Du darfst nicht vergessen, dass du selbst gekämpft und dich durchgesetzt hast.«
Den Satz bereute er später. Sich durchsetzen. Sie hatte zu Boden geblickt, als könne er nicht wissen, was so ein Satz wirklich bedeutete. Als sagten die Deutschen solche Sätze einfach.
»Warum wir überhaupt in Deutschland waren, hat euch so viel interessiert wie … ’ne Erdkundehausaufgabe für die übernächste Woche.«
»Arja, wir kannten wahrscheinlich noch nicht mal das Wort Auswandern.«
»Erinnerst du dich an einen Einschnitt?«
Nein, tat er nicht.
»Nur weil ich still war, sah das vielleicht aus, als würde ich mich einschüchtern lassen. Aber ich hab genau gesehen, was um mich herum geschah. Ich hab eure Sprache aufgesaugt, eure Gewohnheiten und die Macken, das Gefummel der älteren Pärchen in den Pausen. Wie alle anderen, nur heimlich. Ich hab die Musikmagazine gelesen, Pop und Wave und das beginnende Öko, diese ganze zerrissene Kultur, die so vielen die Frisur ruiniert hat. Und irgendwie kamen mein Fleiß und Ehrgeiz dazu. Die Sommerferienwochen hab ich komplett in der Bücherei verbracht, ein Jugendhörspiel nach dem anderen, Märchen, Comics und die Bravo. Das war chemisch irgendwie. Nachts setzten sich die Schwebeteilchen in mir, tagsüber wirbelte ich die neue Sprache auf. Erinnerst du dich echt nicht daran?«
»Woran denn?«
»Wie die Schule im Spätsommer wieder begann. Und Arjeta Neziri konnte Deutsch. Die Tür ging auf, und ihr habt mich gemocht. Erst keiner, plötzlich alle.«
»Wir fanden dich noch schöner, Arjeta.«
»Wie bitte?«
»Wahrscheinlich weil du nach den Sommerferien an den richtigen Stellen ›geil‹ und ›cool‹ gesagt hast.«
»Na vielen Dank, Herr Schütte.«
»Für meine Schwärmerei?«
»Für deine Abgeklärtheit.«
Sie hatte recht, Jakob wollte lustig sein und war ignorant. Nicht mit Absicht. Aber er hatte immer noch keine Ahnung, von welchem Einschnitt sie sprach, und das konnte nur bedeuten, dass er überhaupt erst nach diesem Einschnitt angefangen hatte, Arjeta wahrzunehmen.
3
Im Winter wurde Norddeutschland von einem geschichtsträchtigen Orkantief heimgesucht, am ersten Februarwochenende 1999 sank vor Sylt ein dänisches Frachtschiff. Zwei Seeleute starben, erzählte mir Jakob, in bis zu 160 Stundenkilometer schnellen Sturmböen. Ich weiß nicht, warum er das alles so genau im Kopf behalten hatte, jedenfalls wurden auch im Hamburger Hafen mehrere Flutwellen erwartet, und Arjetas Vater arbeitete Tag und Nacht für den Deichverband in Wilhelmsburg.
Bislang war Jakob immer durch St. Pauli und den Alten Elbtunnel zu ihr gefahren, über die Brücken in die Höhe, wo der Blick frei wurde für die kreischende Containerwelt und den Wald aus Kränen. Aber der Elbtunnel war gesperrt, der Fluss hatte die kritische Marke von fünfeinhalb Metern am Samstagmorgen überschritten. Jakob nahm sein Fahrrad deshalb mit in die S-Bahn bis Veddel, fuhr von dort gen Westen – immer auf dem Deich, wo sich der Wind tückisch zurückhielt und dann wieder so stark wehte, dass Jakob die Pedale nicht treten konnte oder nur schlingernd vorwärtskam.
Arjeta wartete schon, den Mund verhüllt von einem langen Schal, die Handschuhe im Mantel verborgen. Und die Mütze hätte sie sich am liebsten noch über die Augen gezogen, dachte Jakob. Eine kurze, ungelenke Begrüßung, beide mit ihrem Fahrradrahmen zwischen den Beinen, dann strampelte sie gegen den Sturm an, er hinterher. Jede Bewegung geschah in Zeitlupe, neben ihnen schlichen ein paar Vierzigtonner über die Brücke nach Steinwerder.
Erst über dem Eingang zum Alten Elbtunnel stiegen sie von den Rädern. Drüben, an den Landungsbrücken, tanzte eine Lichtorgel in Orange und Blau, die Farben spiegelten sich im Wasser. Der Fluss stand so hoch, dass Jakob das Gefühl hatte, nur ein weiterer Tropfen müsste ihn zum Überlaufen bringen.
Ja, der Fluss stand.
Und seine Freundin sah in ihrem Kleiderkokon aus wie eine Kältestatue. Vier Monate waren sie jetzt zusammen, und noch immer spielte sie mit ihm diese Eroberungsspiele; Schicht für Schicht, den lieben langen Wintertag würde er damit verbringen, ihr näherzukommen. Vor Kälte trat sie von einem Fuß auf den anderen, ihr ganzer Körper wippte. Sicher fragte sie sich, warum sie jetzt hier war (nicht dort drüben), warum sie jetzt hier war (aber nicht zur Ruhe kam), warum sie jetzt hier war (und es nirgendwo lange aushielt). Arjetas Gedankenspiele, die so existentiell klangen und so sinnlos waren – er suchte nach ihrer Hand, bevor sie damit anfing.
»Das ist schon spektakulär«, sagte ein Passant.
Arjeta wendete sich der Stimme zu und antwortete: »Der Fluss grollt.«
Sie ging hinüber zum Kiosk, sie tat das, damit Jakob Zeit hatte, das Grollen auf sich selbst zu beziehen, auf die Deutschen, auf den Westen. Er sollte wissen, dass das eigentliche Drama nicht hier, sondern in weiter Entfernung stattfand, in Arjetas Heimat. Seit in Kosova Krieg herrschte, war Arjeta wie alle Neziris süchtig nach den Nachrichten, und nie hielten die Nachrichten ihrer Wut, Angst und Neugier stand.
Eine Tageszeitung unter der Achsel, kam Arjeta zurück. Auf einer Bank, die Blätter vierfach gefaltet gegen den Wind, beugten sie sich über die ersten Beobachterstimmen. Die Delegationen waren in Rambouillet eingetroffen. Ein französisches Schloss. Mehr stand da eigentlich nicht. Jakob hatte sich mühsam antrainiert, wie alle Neziris die albanische Form für ihr Heimatland zu benutzen: Kosova. Was tat man nicht alles aus Liebe. Näher an Arjeta heranrücken, zum Beispiel. Und tatsächlich schob sie ihren Arm unter seinen, hakte sich ein. Mit dem anderen Handschuh tippte sie auf ein Foto, das einen UÇK-Kommandanten abbildete.
»Weißt du, dass wir ihnen die Waffen bezahlen?«
Wer wir? Nein, wusste er nicht.
»Vor zehn Jahren sind fast alle Albaner in Kosova aus der kommunistischen Partei und der Gewerkschaft ausgeschlossen und aus ihren Jobs entlassen worden. Sie haben sich aber eine Art Parallelstaat errichtet. Drei Prozent der Löhne aller Exilanten werden von einer Exilregierung in Bonn gesammelt und fließen zurück ins Land, und durch diese Gelder«, so erklärte es ihm Arjeta, »können albanische Ärzte weiterarbeiten, Lehrer geben in privaten Räumen weiter Schulunterricht in albanischer Sprache.«
Jakob machte ein ungläubiges Gesicht. Dabei hatte er nur nicht richtig zugehört. Sie konnte manchmal fast zu gut reden, da schaltete er einfach ab. Unweit des Elbtunneleinganges stand ein Kinderkarussell. Es lief nicht, trotzdem saß der dickleibige Betreiber in seinem Kassenhäuschen. Womöglich hatte die Firma, die den Abbau machte, ihm den Dienst verweigert, und jetzt wollte er mit seinem Karussell absaufen.
»Ich finde, die Drei-Prozent-Regel ist ein supertolles Steuersystem«, sagte Arjeta.
»Wer verwaltet das Geld?«
»Hab ich doch gerade gesagt, eine Exilregierung. Mein Vater meint aber, wir haben eine Spaltung in der Armee. Und er gibt nur was an eine Vaterlandsstiftung in der Schweiz, Vendlindja Thrret.«
»Guck mal da drüben, der Dicke. Mit seinen Hubschraubern, dem Krankenwagen und der Feuerwehr. Sitzt da und setzt auf die Rettung der Menschheit. Der Kinder, mein ich.«
»Was du immer so siehst. Hier, lies mal.«
»Wahrscheinlich ist er bewaffnet.«
»Jakob, bitte!«
»Er schützt sein Karussell, wie in Battlezone. DieFrage ist bloß, was wir mit einem Wagen wollen, der nur im Kreis fährt.«
Arjeta hörte nicht mehr zu, sie war kopfüber in die Zeitungsberichte abgetaucht. Immer kleiner musste sie das Papier falten, um im Wind darin zu lesen, bis es beinahe konspirativ aussah. Auf der nächsten Seite waren zwei Fotos von den Friedensverhandlungen. Die albanische Befreiungsarmee trug Camouflage. »Das sieht schon cool aus«, sagte Jakob, »eure Soldaten zwischen den Geschäftsmännern.«
Da boxte Arjeta ihm mit ganzer Kraft auf den Oberarm, aber seine Winterjacke ließ ihn den Schlag kaum spüren. Sie war manchmal aggressiv, wenn ihre Angst zu groß wurde, die Angst vor der politischen Unerfahrenheit ihrer Landsleute, vor dem blankgewetzten Nationalstolz.
Jakob hatte keinen Satz parat, der gepasst hätte. Er suchte auch nicht danach. Die Konferenz in Rambouillet würde über die Zukunft von Arjetas Heimat entscheiden. So viel hatte er inzwischen begriffen. Alles hing jetzt von der Anzahl der Unterschriften ab.
Und der Fluss stand. Oder grollte. Oder beides.
Die Plastikfenster knackten im Sturm. Sie tranken Yogitee in Arjetas Zimmer, Jakob knetete ihre Füße, die in dicken Wollsocken steckten. Bis zu diesem Nachmittag hatte er gemeint, ihren Schulgeruch noch zu kennen, aber es war kein Geruch, nicht mal ein Parfüm, es waren die Socken und ihr Pullover, es war ein Wollwaschmittel, das er früher selbst mal benutzt hatte. Sie räkelten sich auf dem Teppich, spielten Backgammon, um die Zeit bis zur nächsten Nachrichtensendung zu überbrücken.
Ihr Vater Nikola kehrte kurz von der Arbeit heim, um seine Gereiztheit abzuladen. Dieses Mal traf es niemand anderen als Jakob selbst, denn den Frust hatten die Computerprogramme des Deichverbandes ausgelöst. Arjetas Vater tat so, als hätte Jakob persönlich sie geschrieben und sei dafür verantwortlich zu machen, dass sie nicht funktionierten. »Ihr Computerfuzzis«, sagte Nikola, und »gefährlich« und »der Deichvogt nervös«.