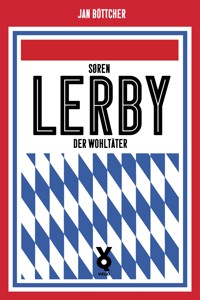9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Familie, Freunde, Erinnerung? Darauf hat Architekt Michael Schürtz nie etwas gegeben. Er ist für die Karriere in die Großstadt gezogen und kehrt nur widerwillig für einen Bauleiterjob in seinen Heimatort zurück. Doch die Menschen kommen ihm näher, als er möchte. Und irgendwann muss er einsehen, dass er nie mehr war als das: ein Nobody aus einem Kaff in der norddeutschen Tiefebene. Und dass sein Leben hier und jetzt beginnen kann. »Mit viel Witz und leiser Wehmut erzählt Jan Böttcher von der Rückkehr ins Kaff als Rückkehr zum Ich.« Benedict Wells »Das Kaff zeigt eindrücklich die Unterschiede zwischen Stadt und Land, Oben und Unten, die kulturelle Kluft. Hier wird der Riss spürbar, der die Welt zurzeit spaltet. Wer die Gegenwart verstehen will, muss Jan Böttcher lesen.« Jan Brandt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Ähnliche
Über Jan Böttcher
1973 in Lüneburg geboren, war Jan Böttcher zunächst Songtexter und Sänger der Berliner Band »Herr Nilsson«. Seit 2003 hat er fünf Romane veröffentlicht. Mit »Nachglühen« gewann er den Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. Sein letzter Roman »Am Anfang war der Krieg zuende« ist als Aufbau Taschenbuch lieferbar. Er lebt in Berlin.
Informationen zum Buch
Familie, Freunde, Erinnerung? Darauf hat Architekt Michael Schürtz nie etwas gegeben. Er ist für die Karriere in die Großstadt gezogen und kehrt nur widerwillig für einen Bauleiterjob in seinen Heimatort zurück. Doch die Menschen kommen ihm näher, als er möchte. Und irgendwann muss er einsehen, dass er nie mehr war als das: ein Nobody aus einem Kaff in der norddeutschen Tiefebene. Und dass sein Leben hier und jetzt beginnen kann.
»Mit viel Witz und leiser Wehmut erzählt Jan Böttcher von der Rückkehr ins Kaff als Rückkehr zum Ich.« Benedict Wells
»Das Kaff zeigt eindrücklich die Unterschiede zwischen Stadt und Land, Oben und Unten, die kulturelle Kluft. Hier wird der Riss spürbar, der die Welt zurzeit spaltet. Wer die Gegenwart verstehen will, muss Jan Böttcher lesen.« Jan Brandt
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Jan Böttcher
Das Kaff
Roman
Inhaltsübersicht
Über Jan Böttcher
Informationen zum Buch
Newsletter
Anbaden
Gutachten
Derby
Eierlikör
Frischluft
Himmelstreppe
Verdienste
Gewölbekeller
Meister
Crémant
Kraftpfeile
Utopie
Türschwelle
Ausdauer
Sommerregen
Bauchraum
Evolution
Chorpause
Nachtvorstellung
Würstchen
Geburtstag
48 Stunden
Lichtsirup
Anpacken
Sonnenloch
Offensive
Strandgut
Waschmaschine
Briefkopf
Schwitzkasten
Frohsinn
Spielfeld
Impressum
Niemand, vermute ich, gesteht einem anderen Menschen wirklich wahre Existenz zu. Er mag einräumen, daß dieser Mensch lebendig ist, daß er fühlt und denkt wie er, aber es wird da immer ein namenloses Etwas des Unterschieds, eine materialisierte Benachteiligung bestehen.
Fernando Pessoa: Das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares
Der rechte Baumeister kommt aber nicht einfach an einer bestimmten Stelle an, schon gar nicht mit Blaupausen. Er zieht nämlich im Lande umher, ohne Freunde und Schmeichler.
Reinhard Lettau: Schwierigkeiten beim Häuserbauen
Anbaden
Der ganze Wald hört mich kommen. Kiefern wippen im Wind, Buchen fallen sich über dem Weg in die Arme, man huldigt dem König der Rostgurken. Greg hat mir dieses Rad hingestellt, Dreigangnabe, sogar ein Drahtkorb vornedran. Meine Tonspur ist eine Kette, die mit allen Gliedern über den Kettenschutz schlurft.
Ich sehe natürlich, dass sich beide Reifen drehen, aber der Weg nimmt kein Ende. Vielleicht wird der Wald mitbewegt, eine Tapete auf Rollen, oder er hat schlichtweg seine Grundfläche erweitert. Längst müsste die kleine Holzhütte in Sicht kommen – stattdessen aufgetürmte Baumstämme, neonrot beziffert. Die Kurve. Erinnere ich mich an die Kurve? Dahinter blinkt die Sonne durch die Stämme. Einmal richtig in die Pedale treten, ja, jetzt bin ich mir sicher, jetzt nur noch abwärts. Vom Sattel gleiten, und das Fahrrad rollt ohne mich weiter, bis es über eine Baumwurzel springt, stolpert, stürzt. Mein Handtuch fällt aus dem Korb. Vor Glück, denke ich.
Die Sträucher am Ufer sind plattgetreten, ich kann einfach in die Ull hineingehen, schon werden meine Beine vom Wasser umspült wie Brückenpfeiler. Die Strömung ist die Strömung geblieben, hinreißend mitreißend. Der Fluss kommt von Süden, eine lange silberne Schnur.
In den Pappeln hocken Krähen, die Pappeln sind gewachsen, sehr sogar. Und dieses Schiffstau. Die Jungs haben ein Tau von Ufer zu Ufer gespannt, von Pappel zu Erle, sie haben das Westufer der Ull erobert, lautstark halten sie es besetzt. Ich höre ein Mädchen aufschreien, als zwei Jungs ihr nasses Haar über ihm ausschütteln, wie Hunde ihr Fell. Stark, denke ich, dass so etwas überliefert wird.
Drei, vier große Schritte und jetzt sind die jungen Hunde am Tau, machen sich hangelnd zu Affen, schwingen die Beine gegeneinander. Sie umklammern sich, treten, und raffen sich schließlich, als ihnen die Kräfte ausgehen, zu einem letzten Angriff auf, bei dem sie zwangsläufig beide abstürzen müssen.
Prustend strömen die Jungs an mir vorbei. Ich brauche ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass es ihnen gar nicht um Sieg und Niederlage gegangen ist, sondern um die Blicke der Mädchen. Um meinen Blick vielleicht auch.
Und jetzt schließe ich die Augen, gehe bis in die Mitte des Flusses, wo ich kaum noch stehen kann. Tief einatmen, die Knie zwischen die Arme nehmen
und ab
ab auf die Ullfahrt,
lass dich schieben, mitnehmen, mitreißen von der Strömung, zieh den Kopf unter Wasser … ein Stein, Körperkiesel, der stromabwärts treibt … die Augen geschlossen, eine Vorwärtsrolle, den Kopf rausstrecken, japsen. Aaah! Aufschreien über die Wucht dieses kleinen Flusses … So kräftig ist er, so schnell wird man, dass die Kurve nicht zu kriegen ist, zweihundert Meter vom Einstieg
schiebt die Ull alle Badenden
an Land.
Am Ufer wirkt die Gegenkraft, drängt mich zurück. Den tiefschwarz ausgetretenen Pfad entlang. Nach fünfzig Metern beginnt die Pappelreihe, alle Stämme wie Reihenhaustüren im gleichen Abstand. Links aber dichter Wald. Ich gehe schnell. Biege ins hohe Wiesengras ab, zwischen den Pappeln hindurch wieder in den Fluss. Sofort greift mir die Strömung unter die Arme.
Nimm mich einfach mit, du Ull, du. Bis in die Kurve. Ans Ufer. Den Trampelpfad zurück. Gleich nochmal hinein.
Gehen und baden, Badegänge. Nach dem vierten zittere ich, so stark erfrischt mich die Ull. Oder meine Haut ist dünner geworden. Der Bauch auf jeden Fall dicker. Ich esse zu viel Mist, rauche mehr, als ich mir vornehme zu rauchen. Aber nun sieh dir mal die fette Abendsonne an, was soll die sagen. Wenn ich den Rücken durchdrücke und den Kopf strecke, können meine Augen das Schiffstau über den Sonnenball schieben. Hoch bis in die Mitte, ein Gürtel, ein Sonnenäquator.
Auf dem Tau reißen sich die beiden Jungs um ein Handtuch. Vom Westufer winkt ein anderer mit einem Paar Flipflops. Ich suche meine Latschen im Gras, dann auch das Handtuch. Kann – nicht – wahr – sein.
»Aber ganz schnell!«, rufe ich. Die Stimme brüchig. Ich habe mich schon aufgemacht in Richtung Tau, da lässt einer der Kerle los, der andere verliert das Gleichgewicht, stürzt rücklings ins Wasser. Mit meinem Handtuch.
Die Szene fährt mir in die Glieder. Erst mal abhauen, wenn einer laut wird. Haben wir das genauso gemacht? Wildfremde Leute belästigen, sind wir so weit gegangen? Ich steige ins Wasser und folge ihnen flussabwärts bis in die Kurve. Die beiden Jungen stehen bereits am Ufer, mir reicht das Wasser bis zur Hüfte.
»So, ist genug jetzt. Handtuch!«
»Krieg dich ein«, sagt der eine.
»Wo sind die Flipflops?«
»Eeeey Tobi, seine Flipflops sucht er«, ruft der andere.
Hinter mir strömen zwei weitere Jungs in die Kurve ein. Locker auf dem Rücken treibend fragt mich einer von ihnen, ob’s Ärger gebe. Der Vierte hat die Hand in der Badehose:
»Geh nach Hause, Alter.«
Das ist des Rudelführers Wort. Ein Schlaks, tatsächlich größer als ich, aber Typ Hühnerbrust, blasshäutig und blaue Lippen.
»Frierst du?«, frage ich.
Besser, ich spiele nicht auf meine Kindheit an, sicher wollen sie die ersten Halbstarken an der Ull sein, die ersten auf dem gesamten Planeten, der sich jetzt dreht, unter mir wegdreht … Meine Zehen krallen sich in den schlickigen Boden, der Schlaks hat damit begonnen, mich nass zu spritzen. »Ob ich was?«, ruft er dabei. »Hau ihm eine rein, Sasch.« »Du zuerst, Tobi.« »Sasch, come on.« »Geh nach Hause, Alter«, höre ich noch einmal, danach stoßen sie nur noch Laute aus. Affenlaute wie auf dem Tau.
Mit Sasch ist der Schlaks gemeint. Er bläht sich vor uns auf, dass die Rippen zählbar werden, von den letzten Sonnenstrahlen modelliert. Vielleicht vierzehn Jahre alt und eine Bundeswehrmarke um den Hals. Schlaks geht im Wasser auf mich zu, wir sehen uns an, aber er will auf mich herabblicken, kommt deshalb immer näher, bis auf zwei Handbreit, und jetzt bleibt er regungslos stehen. Ich habe mit meiner rechten Hand zugepackt, blitzschnell, seinen Oberarm knapp über dem Ellbogen, vier Finger auf dem Knochen und den Daumen auf dem Bizeps. Die Schraubzwinge.
Der Junge hält vor Schmerz die Luft an.
Er versucht gar nicht erst, mit seinem anderen Arm einen Nahkampf zu beginnen. Es ist seine Passivität, die den anderen Jungs Angst macht. Auch sein offenstehender Mund, ein stummer Schrei, alles ist leicht zu übersetzen. Zehn, fünfzehn Sekunden lang geschieht nichts.
»Einer holt die Flipflops, einer legt das Handtuch ans Ufer.«
Ich will klingen, als sei der Streit schon beigelegt. Sie beobachten mich genau, kurz muss ich die Augen schließen, mich konzentrieren.
»Was ist, soll ich ihm erst noch eine reinhaun?«
Guter Tonfall. Sie müssen spüren, dass es mir ernst ist. Einer zieht die Badelatschen aus dem Farnkraut, ein anderer schmeißt mein Handtuchknäuel ans Ufer, es soll abschätzig aussehen, aber es sind Gesten der Enttäuschung.
Dann lockere ich den Griff, der Schlaks macht ein paar lange Schritte, und ich frage mich, ob er den erlebten Schmerz vor den anderen Jungs in Worte fassen wird. Gleich nachher oder jemals. Ob er demnächst demontiert wird. Noch folgt ihm die Bande auf den Waldpfad.
Erst als sie zurück sind an der Einstiegsstelle, stapfe ich aus dem Wasser, wringe das Handtuch aus und schlüpfe in die Flipflops. Hau ihm eine rein, Sasch. Du zuerst, Tobi. So empfangt ihr mich, so wollt ihr, dass meine Rückkehr aussieht? Na, dann mal los. Ich bin gewappnet.
Gutachten
Im letzten Jahr war ich schon einmal hier. Sie hatten mich zu ihrer Abifeier eingeladen, als Überraschungsgast, Stargast, und ich hab den Quatsch mitgemacht, weil ich gern das Gesicht meiner alten Schulfreundin Jasmin sehen wollte. Sie tauchte gar nicht auf. Stattdessen fand ich mich mit Gregor Hartmann am Tresen wieder, ein Bier nach dem anderen stürzend. Die Verdrängungskräfte setzten ein und wurden immer stärker, in der Nacht meinte ich, mindestens drei Viertel der Anwesenden nie in meinem Leben gesehen zu haben.
Greg ist wirklich mal ein Schulfreund gewesen, aber wir können an diese Zeit nicht anknüpfen. Er ist damals nach dem ganzen Mist, den wir gemeinsam gebaut haben, auf dem Gymnasium geblieben, ich nicht, er ist später im Kaff geblieben, ich nicht, und beides stand auf dem abendlichen Jahrgangstreffen zwischen uns wie eine unüberwindbare Mauer. Immerhin teilte er mein Bedürfnis, nicht über die Vergangenheit zu reden, und erzählte mir von seinem geplanten Langzeiturlaub, drei bis vier Monate Kreta mit der ganzen Familie, bevor sein Sohn im Herbst eingeschult würde. Im Gegenzug redete ich von dem Angebot, just im kommenden Sommer eine Bauleitung hier in der Heimatstadt zu übernehmen.
So ist es gekommen, dass ich jetzt bei Gregor Hartmann wohne, in der Nähe des Kalkhafens. Ich finde nicht, dass er mir nach fünfundzwanzig Jahren irgendetwas schuldet, aber er wollte partout keine Miete nehmen, und so zahle ich für die drei Monate nicht mehr als die Grundkosten für Wasser und Strom.
Kalkhafen ist ein irreführender Titel, das Gebiet bestand schon zu Kriegszeiten zu zwei Dritteln aus Weideland und Brachen, nach dem Zustrom der Flüchtlinge aus dem Osten wurde es schnell als Baugebiet erschlossen. Gregs verklinkertes Reihenhaus ist Baujahr 1952, und es atmet noch die Enge der Nachkriegszeit. Im Parterre befinden sich Küche und Klo (beide winzig) und das ganzflächig mit taubenblauem Teppichboden ausgelegte Wohnzimmer, an der Wand der flachste Flachbildschirm. Dazu das Kämmerlein für meine Arbeit, die Baupläne lappen weit über den Rand der Schreibtischplatte. Oben ein Kinderzimmer, das elterliche Schlafzimmer, ein Bad. Greg und ich haben vergessen, über ein Gästezimmer zu sprechen. Es gibt keines. Am ersten Abend habe ich auf einer Yogamatte auf dem Flurboden geschlafen. Dann entdeckte ich den Stab, mit dem man die Dachluke an einer Öse aus der Decke ziehen kann, und mir gefiel auch, wie die Stiege in die Dachluke eingelassen ist, eine fantastische Tischlerarbeit.
Auf dem Dachboden lag (noch eingerollt) ein roter Läufer, unter der Schräge stand ein Stapelbett. Klar, es ist stickig dort oben, auch die Junisonne hat es sich gut zwischen Gregs Kisten eingerichtet, aber wenn man gegen 20 Uhr alle drei Fensterluken aufreißt, ist es ab Mitternacht auszuhalten. Und ich arbeite sowieso bis in die Nacht.
Was nicht heißt, dass ich ausschlafen kann. Es ist Samstagfrüh und der Briefkastenschlitz klappert. Ein Zeitungsbote schiebt jeden Morgen das Käseblatt ins Haus. Ich erinnere mich daran, dass Greg gefragt hat, ob er das Abo in seiner Abwesenheit kündigen soll, weiß aber nicht mehr, was ich ihm geantwortet habe. Wahrscheinlich stand mir der Mund offen, weil ich dachte, dass es das Käseblatt kraft meiner Ablehnung nicht mehr geben kann. Ich hätte der Stadtzeitung gegönnt unterzugehen, aber sie hat nicht bloß überlebt, sie ist unverändert, dasselbe Layout, derselbe Mangel an Anspruch, der einen schon als Jugendlicher eingeschläfert hat, Missgeschicke statt Katastrophen, Lackschäden statt Diktatur, dazu die Festlichkeiten im Landkreis und andere Wochenendtipps. Was das helle, harmlose Herz eben so verkraftet.
Kann ich eigentlich nicht lesen, konnte ich noch nie. Aber man ist ja gezwungen, Zeitungen durchzublättern, wenn man Kaffee trinkt. Der Geist verlangt danach, auch die Finger. Im Lokalteil heute ein langes Einzelhandelsporträt, über eine junge Hutmacherin, die ihr Handwerk in Schottland gelernt hat und deshalb meint, Kopfbedeckungen seien hierzulande unterbewertet. Gewagte These im Zeitalter der Burka-Hysterie. Auf der Deutschland-Seite, die wirklich Deutschland heißt, ein Interview mit einem Soziologen, der als wichtiger Zeitdiagnostiker präsentiert wird. Er sagt, wir verhandelten alles im digitalen Raum, um nicht analog handeln zu müssen. Gähn. Wir seien mit Information, Meinung und Widersprüchen gestopfte Gänse. Das Projekt Individualisierung habe immer schon darauf abgezielt, dass sich der Mensch von den Mitmenschen abwendet. Das Gespräch liest sich, als hätten die Käseblattredakteure es nicht nur unzulässig gekürzt, sondern auch jede These vereinfacht.
Leserbriefe gibt es noch, aber höchstens zwei am Tag, die allermeisten Leser haben ihren bürgerlichen Namen abgelegt und füttern im Netz die Kommentarspalten. Hinten im Sportteil (immer noch so ausführlich) lese ich, dass in acht Tagen das Ortsderby steigt. Meine Rot-Weißen gegen die blaue Eintracht.
EinTracht Prügel, haben wir immer gerufen. Aber ins Stadion, warum nicht, schön auf dem Rad an der Ull entlang, könnte man machen. Jetzt klingelt aber erst mal mein Handy.
»Herr Schürtz.«
»Guten Morgen, Herr Ahrens.«
»Herr Schürtz, kommen Sie bitte auf die Baustelle.«
»Ich muss sowieso –«
»Baustelle, bitte. Ich bin selbst in fünf Minuten da.«
Es ist ja ein Zeichen von Stärke, wenn sich Menschen kurz fassen können, aber Hans-Peter Ahrens treibt die Kürze auf die Spitze, er kann nicht anders, als ständig den Supermarktleiter zu spielen, der seine Kassierer über die Telefonanlage ausruft und irgendwohin dirigiert. Er ist der geborene Gebieter. Soziale Kompetenz? Zero, null. Ich beeile mich trotzdem, warum auch nicht. Rasur, Aftershave, Zähne und Schuhe putzen, Ledertasche, los. Im Designeranzug auf Gregs Fahrrad – den Anblick gönne ich meinen neuen Nachbarn.
Das Hemd klebt mir am Rücken, als ich auf der Baustelle ankomme. Ahrens ist noch nicht da. Der Herr Investor taucht auch nach zehn Minuten nicht auf. Schließlich mache ich mir einen Spaß, schicke ihm eine SMS, ich würde mich ins Café Rose begeben, das nur zweihundert Meter entfernt liegt. »Bitte dort abholen«, schreibe ich wörtlich und freue mich sehr über den Satz, weil er Ahrens imitiert und gleichzeitig klingt, als könne ein verlorengegangenes Kleinkind selbst eine Forderung stellen. Sofort summt die Antwort:
»Nein!! Baustelle!«
Ha ha, Ahrens. Drei Ausrufezeichen. Grandios, wie er sein Denken sichtbar macht. Ich will überhaupt nicht ins Café Rose, was soll ich da, wo auf der Baustelle auch an diesem Samstag drei Handwerkertrupps arbeiten.
Was sagt der Tagesplaner? In Wohnung #3 nachsehen, ob die Trockenbauer die Nische in der Badezimmervorwand versetzt haben. Die Trockenbauer arbeiten so schlecht, dass ich mittlerweile jede ihrer Ausführungen einzeln prüfe. Mich kosten sie Nerven, Ahrens kosten sie Geld. Die Firma hat zwei Bautrupps, darunter einen rein albanischen, für den ich mit dem Leuchtstift Kreuze an die Wände malen muss, damit er nicht noch mehr Wand erneuert als nötig. Heute empfängt mich aber die deutsch-polnische Gesellschaft, drei Männer stehen vor dem Badezimmer und diskutieren.
»Tagchen«, rufe ich in die Runde. »Allt schick?«
»Wir können hinten nicht weiter in Haus 4.«
»Aber meinen Plan habt ihr gefunden, ja?«
»Wir haben diesen hier, Chef.«
»Nicht der, Leute, ich hab euch das neu aufgezeichnet und noch gestern Abend hier drangepinnt. Da hängt er doch.«
»Ist gut. Nehm’ wir den.«
»Besser is. Und warum könnt ihr in Haus 4 nicht weiter?«
»Kein Estrich.«
»Heute. Aber nächste Woche liegt da Estrich.«
»Da sind wir in Hamburg, Chef. Andere Baustelle, bessere Bezahlung.«
»Komm komm, Bezahlung. Jetzt erst mal die Nische hier in der Vorwand. Einfach mal Pläne lesen und Aufgabe umsetzen. Eine Nische, in der das Duschgel steht und nicht umkippt, okay?«
Ich drehe ab in Richtung Wohnungstür, rufe dabei Estrichleger Baschikowski an. Er quakt sofort los. Seine Zementsäcke seien vom letzten Gewitter aufgeweicht und er habe Wochenende und mit dem Zement könne er überhaupt nicht mehr arbeiten und warum der Materialkeller nicht dicht sei, wer ihm den Zement ersetze und wie da jetzt überhaupt noch Wasser etc.
Smartphone auf Abstand.
Mit Ahrens mache ich es ähnlich, denn unser aller Geldgeber hat das Treppenpodest erklommen und steht plötzlich vor mir, also strecke ich nickend die Hand aus und halte den Zeigefinger in die Luft, noch kein Handschlag möglich, heißt das, gleich, bin gleich bei Ihnen.
»Herr Baschi … nun hören Sie mir doch, Herr Baschikowski, ja, ich verstehe Sie ja in allem, den Keller seh ich mir sofort an, dann geh ich weiterhin von Dienstag aus, schönes Wochenen … ja, wiederhörn.«
Ich vermeide es, den Kopf zu schütteln. Ahrens nickt jovial. Er trägt sein Leinensakko mit den Hirschhornknöpfen, eine dunkelbraune Jeans, wirkt immer wie ein Außendienstler für Vintage und Landhausstil, es fehlt nur der süddeutsche Akzent.
»Passen Sie auf, Herr Schürtz, die Robinie.«
»Wie bitte?«
»Die Robinie. Die steht doch direkt vor der Terrasse vom Mittermeier. Das zweite Gutachten sagt …«
»Moment, welches zweite Gutachten?«
»Herr Mittermeier hat privat noch eins in Auftrag gegeben. Und da heißt es nun, der Baum ist krank und sollte weg.«
»Kann er auch. Ich war immer dafür, den wegzunehmen, da rennen Sie bei mir offene Ohren ein, Herr Ahrens.«
»Weiß ich ja. Aber dann dreht der Prinzipienreiter durch, der andere aus dem Untergeschoss.«
»Bartels.«
»Der will, na egal, wissen Sie, Herr Schürtz, die Frage ist eine andere.«
»Stellen Sie die Frage, Herr Ahrens.«
»Ich bin mit Mittermeier folgendermaßen verblieben: Wenn die Robinie nicht wegkommt, also wenn die Robinie vielmehr stehenbleibt und wir sein zweites Gutachten zerreißen, dass wir dann noch mal über seinen Protest wegen der Kellerparzellen nachdenken. Lange Rede: Zwei Quadratmeter reichen ihm hin.«
Mal stopp. Wo mir sowieso gerade der Mund zum Fischmaul wird. Was tue ich hier, in the town where I was born,in der Stadt, die ich nie wieder betreten wollte. Welche Art von Dienst? Ich leite ein Bauvorhaben für den Investor CMA (Christ Meckel Ahrens), zwei doppelgeschössige Townhouse-Riegel im Liebesgrund, mit insgesamt sechzehn teuren bis überteuerten Wohnungen, denen ein einziger Grundriss zugrunde liegt, je 124 auch familiengeeignete Quadratmeter, damit gar nicht erst Neid und Vergleichssucht aufkommen. Sogar die Fassaden sind identisch. Dazu guter Baugrund, etwas steinig wegen der Nähe zur alten Stadtmauer, aber tragfähig, auch das Grundwasser liegt tief genug. Ein Bau, der keinerlei Probleme aufwirft.
Es sei denn, man heißt Hans-Peter Arschloch und opfert jede Woche ein Stück Einheitlichkeit. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo Ahrens die Liebe zu den Eigentümern hernimmt, warum er sie als Investor überhaupt auf der Baustelle duldet, ob er mich mit seinem Kuhhandel-Chaos noch austesten oder schon für dumm verkaufen will. Und hab ich gerade gedacht, die Hirschhornknöpfe an seinem Janker verlangten nach einem süddeutschen Akzent? Ganz falsch. Da ist sogar das dämliche Stadtwappen drauf! Jeder einzelne Knopf ist senkrecht unterteilt, links der Löwe mit dem Faustkeil und den goldenen Bommeln an der Mütze, rechts drei Fichten, die davon zeugen, dass man einst die Tiefebene urbar gemacht hat, ohne sie zu kultivieren. Also stellt das Stadtmarketing jetzt schon Janker her! Und ausgerechnet Ahrens, ein Investor, der die Grundstücke im Dutzend kauft und damit die chronisch leere Stadtkasse weniger saniert als plündert, trägt das Wappen zur Schau.
Sie machen das schon, ohne Worte. Und das wird stimmen, ich mache das. Vergrößerung des Kellers für Mittermeier, 2qm, ist notiert. Aufgabenstellung: ein Motiv für den Eingriff zu finden, das alle anderen Eigentümer überzeugt. Mir gehen sofort die Kabelstränge durch den Kopf, der Verlauf der Lüftungsrohre, die Elektroleitungen, ich habe diese Baustelle in allen Dimensionen intus, kann sie in mir aufklappen wie eine Computergrafik. Ich muss auch daran denken, wie Mittermeier schon den Rohbau aufgehalten hat, indem er auf die Vergrößerung seiner Terrassentür drängte, damals hab ich ihn wenigstens verstanden, warum sollte sich ein Eigentümer im Parterre mit drei Metern Panorama gen Südwest begnügen, wenn Ahrens ihm vier Meter angeboten hat.
Aber die Kellerverschläge!? Was will Mittermeier auf seinen gewonnenen zwei Kellerquadratmetern lagern? Matratzen? Särge? Und warum dann das Baumgutachten? Nicht zu verstehen. Lässt sich Ahrens von Mittermeier korrumpieren, kennen die sich? Dass wir dann nochmal über die Kellerparzellen nachdenken. Wir! Vor allem du, Äitsch Pi Ahrens! Aber ich hätte es ja von Anfang an wissen müssen, dass man gerade den Chefs nicht entgegenkommen darf! Niemals hätte ich einen alten Kontakt in meiner Heimat als Unterkunft nutzen sollen, das war ja schon haargenau, was Ahrens sich von mir erhofft hat, deshalb schob er ja die schriftliche Zusage, mir ein Hotelzimmer zu zahlen, immer weiter hinaus, und ich hab sogar verhandeln müssen, dass sie die Bahntickets übernehmen, es ist …
Mein Name wird gerufen. Eine Stimme aus dem Parterre. Ahrens ist längst verschwunden. In einer Wohnungstür steht ein Handwerker, zwischen uns zwei Treppengeländer, die Stangen zerschneiden sein Gesicht. »Bin sofort bei Ihnen«, rufe ich hinab. Zunächst mal den Timer raus, Termine überblicken. Was soll heute noch. Was muss. Zwei Gespräche kann ich aufschieben, eines werde ich führen, weil es zu wichtig ist (mit dem Haustechniker über die Lüftungsanlage).
In dem Berliner Büro, für das ich viele Jahre lang gearbeitet habe, hing ein Comicstrip an der Wand. Ein Dompteur steckt seinen Kopf ins Löwenmaul und sagt: »Jeder kennt die Phasen, wo man bereit sein muss, sich zerreißen zu lassen.«
Derby
Am Himmel steht keine Wolke und auf der Fassade der Vereinskneipe steht jetzt Sportlerheim. Bevor ich den Eingang erreiche, kommt schon Gerwin auf mich zu. Er führt keinen Gehstock mit sich, sondern eine rote Krankenhauskrücke mit drei weißen Klebestreifen drauf.
Rot und weiß, klar, die Vereinsfarben.
Gerwin müsste jetzt um die siebzig sein.
»Micha Schürtz, haha, auch mal im Lande, wo steckst du denn jetzt.«
»In Berlin.«
»Und deine Haare hast du dagelassen.«
»Die sind schon lange ab.«
Er lacht, weil ihm meine Haare völlig egal sind. Während ich noch überlege, woran er mich überhaupt erkannt hat, sagt er: »Na, immer schön, wenn man wenigstens zum Derby ein paar alte Gesichter sieht.«
Mein altes Gesicht also. Ich muss ihm erst eine Hand, dann die andere auf die Schulter legen, damit er aufhört zu schnacken und ich mich an ihm vorbeischieben kann.
In der Vereinskneipe hängen zwei Großbildschirme, es läuft die Vorberichterstattung der Bundesliga, und ich bin unschlüssig, ob ich mir lieber Profifußball ansehen soll. Das Haus thront auf dem höchsten Punkt des Sportgeländes, die Blickachse ist toll: über die karminrote Tartanbahn vorbei an der blauen Hochsprungmatte durchs Tornetz aufs Fußballgrün.
Der Rasen hat sich gut gehalten. Ich bin alles andere als austrainiert, aber es juckt mich in den Füßen, und weil ich an der Tür herumlungere, wird mir ein Programmheft in die Hand gedrückt, acht Seiten, getackert.
Klar, von den Spielern kenne ich keinen einzigen mehr, aber als die Mannschaften auf den Platz kommen, merke ich, dass mir das Spiel nicht so egal ist, wie ich dachte. Ausgerechnet heute steigt das Derby, da hat Gerwin schon Recht, zu irgendeinem anderen Spiel wäre ich nicht hergekommen. Das Derby mit seiner Rivalität, die ich schon als Zehnjähriger zu spüren bekam. Derby heißt volle Kampfbereitschaft. Ich sehe mich grätschen und pflügen, als Manndecker, ich war mehrfach auf den Spielmacher der Blauen angesetzt. Alle meckerten pausenlos, die gelben Karten flogen nur so durch die Luft.
Ich kann jetzt auch die Tribüne sehen, die nicht mehr da ist. Gerade beim Derby ist sie immer prall gefüllt gewesen. Weiße Handläufe an den beiden Treppen, rote Tragebalken hielten das Dach. Vor zehn Jahren musste die Tribüne weichen, als neben dem Rasenplatz ein Kunstrasenplatz angelegt wurde.
Zweihundert Zuschauer, schätze ich, verteilen sich auch heute noch ums Feld. Ich bin gerade dabei, den Sportplatz zu umrunden, verenge aber in Höhe der Mittellinie die Augen. An der Balustrade zur Tartanbahn steht eine Bekannte, das heißt, mein Hirn sagt das, ich bin zu weit weg, habe aber einen Abdruck gespeichert von ihrer Körpergröße, Schulterhaltung, von dieser kleinen alten Frau. Sie trägt Strickjacke und einen Strohhut mit breiter Krempe, und sie hat einen Begleiter in meinem Alter, der links neben ihr steht, vielmehr hüpft er von einem Bein aufs andere. Einmal dreht sie den Kopf und da ist es klar, Helene Michelsen.
Ich stelle mich ihr zur Rechten, einen halben Meter entfernt, Blick aufs Spielfeld.
»Na, was treibt dich zum Fußball?«, frage ich.
Sie nimmt ihren Hut in die Hand.
»Du erkennst mich bestimmt nicht mehr.«
»Nur weil du jetzt Geld verdienst, Bursche?«
Sie sieht an mir herab, deshalb mache ich es auch. Schwarzes Oberhemd, Levi’s, meine Budapester von Forzieri. Ich nehme meine Ray Ban Aviator vom Kopf, setze sie auf, Goldrand mit grünen Gläsern, mehr Distanz geht nicht. Sie fängt an zu glucksen.
»Jung, du siehst bald aus wie’n Zuhälter.«
Das Brüstungsrohr der Balustrade umfassend lasse ich meinen Körper einmal nach hinten fallen, bis die Arme ausgestreckt sind. Indem ich wieder vorschnelle, rücke ich näher an Helene Michelsen heran.
»Wir haben zusammen bei der Post gearbeitet, ich und seine Mutter«, sagt sie unterdessen zu ihrem Begleiter, und nach einer längeren Pause:
»Ach, wir haben viel Spaß gehabt bei seiner Mutter.«
Das meint sie ernst. Sie hat sogar Recht damit. Zu mir sagt sie, ohne auf das Spielfeld zu deuten:
»Die 92 ist mein Enkel.«
Ein blonder Junge, 92 könnte sein Geburtsjahr sein. Absolut albern, die hohen Rückennummern, wie beim Rugby oder Eishockey.
»Mein Gott, was haben wir fürn Spaß gehabt bei deiner Mutter!«
Helene redet vor sich hin, jedenfalls kann sie mir nichts ins Gesicht sagen. Ist mir aber auch egal. »Wie lange ist es jetzt her, dass sie …«, und ich höre den Bruch, jetzt meint sie nicht mehr den Spaß, sondern Sigrids Tod.
Ich muss tatsächlich erst mal rechnen. Sie setzt ihren Hut wieder auf, rückt ihn zurecht. Siebzehn Jahre. Als ich es aussprechen will, wendet sie sich schon wieder an ihren Begleiter:
»Ihr Kaffeeservice, das Delfinbesteck von seiner Mutter, so was hast du noch nicht gesehn!«
Der Mann neben ihr brummt zustimmend, wie einer, der lieber Fußball gucken will.
»Die silbernen Kuchengabeln mit den Delfinen«, sagt sie, »wo die Griffe so wellenförmig zulaufen, und dann steigt der Delfin aus dem Wasser und der Griff, das ist seine Flosse.«
»Mensch, ich kann gar nicht glauben, dass du dich so gern an all das erinnerst, Helene. Dir ging es doch damals gar nicht so gut.«
Sofort macht sie dicht. Sagt kein Wort mehr.
Eine lange Minute.
Wir starren parallel aufs Spielfeld.
»Deine Geschwister sind nicht so kiebig. Grüß mal die Julia.«
»Wie bitte?«
Als hätte ich sie nicht verstanden. Kiebig? Meint sie nachtragend? Meine Schwester von Helene Michelsen grüßen? Ich verstehe sie tatsächlich nicht. Es kostet sie Mühe, ihren Satz zu wiederholen, warum auch sollte eine alte Frau etwas zweimal sagen, das sie bereits laut genug ausgesprochen hat? Als ich auf sie hinabsehe, bewegt sich fast unmerklich ihre Hutkrempe. Sie schüttelt den Kopf.
»Ach, lass man«, sagt sie.
Ich verabschiede mich, indem ich zweimal schnell hintereinander mit der flachen Hand auf die Balustrade schlage, und nehme danach Abstand von den Zuschauern, stelle mich bis zur Halbzeit hinter das Gästetor. Ein Spieler hat gefoult, wird dafür von einem Dritten geschubst, »Merde«, höre ich, »Halt die Fresse«, »Alter, so nicht«, aber das sind alles nur Erinnerungen. Heute keinerlei Rudelbildung, im Gegenteil, man hilft einander auf und entschuldigt sich. Man ist spielstärker geworden, athletischer auch, als wir es jemals waren, und eben: fair.
Zur Halbzeit steht es 0:2.
Na gut, die Zeiten ändern sich, denke ich, einen Moment lang bin ich sehr generös, aber dann kommt mir doch die Galle hoch. Was ist nur aus diesem Verein geworden und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Ist das die Vorbildfunktion der Lalala-Mannschaft, diese zwanghaft integrative und doch völlig haltungslose Nivea-Nutella-Nationalmannschaft? Wo ist denn der Derbykitzel hin, das Drama, wo ist der Spielzerstörer – ich muss mir eingestehen, dass mir etwas fehlt. Dass ich mir selbst fehle. Dass ich genau an dieser Stelle des Spiels gern einsteigen und aufräumen würde.
In der zweiten Halbzeit wird das Spiel noch lausiger. Ich bilde mir ein, dass es gerade die Last der rauen Derbys aus der Vergangenheit ist, unter der Rot-Weiß nun vollends verkrampft. Das Kassenhäuschen steht nicht oben am Parkplatz, sondern neben den Umkleiden, erst jetzt komme ich daran vorbei. Mit Vereinsrabatt kostet es drei Euro Eintritt, aber Rabatt ist mir genauso peinlich wie der ganze Besuch, ich zahle vier Euro fünfzig. Nach vollendeter Platzrunde gibt es vor der Vereinskneipe Bratwurst, immerhin, seit Jahrzehnten anzufassen mit dem perforierten Streifen, den man am Rand von der Pappe reißt. Es läuft die 72.Spielminute, als ich mir beim Schütteln der Senfflasche das Oberhemd einsaue. Es läuft die 85.Spielminute, als sich auf dem Spielfeld doch noch einer von unseren Rot-Weißen verletzt (ohne gefoult worden zu sein), woraufhin sich aus dem Schatten des Plexiglashäuschens eine Gestalt löst.
Es ist kein Einwechselspieler. Der hüftkranke Gerwin hat die Krücke zur Seite gestellt und wankt, von Arztkoffer und Eisbehälter flankiert, zur Unfallstelle. Herrje, dieses Wanken, stärker ist es geworden, und doch sehe ich mich selbst verletzt daliegen und wie Gerwin mir Eiswürfel aufs Knie packen will, aber sie sind alle geschmolzen, da hat er mir bloß Eiswasser übers ganze Bein gekippt. Ein bisschen schlecht wird mir davon, an die alte Verletzung zu denken. Eine Innenbanddehnung, ich hab danach immer wieder Probleme mit dem Knie bekommen.
In der Nachspielzeit fällt noch das 0:3, EinTracht Prügel genießt den Jubel in vollen Zügen, die Spieler verknäulen sich auf der Hochsprungmatte. Ich atme tief aus und kehre dem Sportplatz den Rücken. Der Schlusspfiff, peinigend lang, schrillt hinüber bis zu den Fahrradständern.
Eierlikör
Am Dachboden erkennt man normalerweise keine Menschen, Dachböden sind fürs Gerümpel, aber dieser hier ist bis in die letzte Ecke aufgeräumt. Identische Pappkisten, in drei Reihen und beschriftet. Irgendwas ist schief gegangen bei Greg.
Auf einer Kiste steht Küche, auf einer anderen Wandern. Wenn ich Ordnung halten könnte, würd ich’s genauso machen. Nach Themen, nicht chronologisch. Ich hätte gar keine andere Wahl. Die Frage ist, ob Küche überhaupt beim Suchen hilft. Eine Ecke ist voller Kisten mit Kinderspielzeug. Vermutlich das Spielzeug seines Sohnes. Oder aber Gregs eigene Zinn- und Plastiksoldaten, die amerikanischen Yankees, die Indianer, alles, womit wir vor Urzeiten die großen Schlachten nachgestellt haben.
Was fehlt, ist die Kiste mit dem Mist, den wir gemacht haben. Unsere abendlichen Anrufe bei den Lehrern, vor allem bei Lohse, dem Geschichtslehrer und Major der Reserve. Wir gaben ihm mitten in der Nacht Einberufungsbefehle: »De Russ steiht wedder vor Helmsteet«, »Major Lohse, rin ins Greuntüüch, de Elv steht auf sößdreeunsöbentig.«
Lohse sprach selbst gern Plattdeutsch im Unterricht, insofern lag es nahe, dass er uns irgendwann für den Telefonterror verdächtigte. Aber ernst wurde es erst, als wir das Schrotpulver herstellten und eines Nachts einen zwei Meter tiefen Krater in die Wiese hinter seinem Haus sprengten. Dabei sollte das bloß eine Probe sein, bevor wir mit größeren Sprengladungen in menschenleeres Gebiet fuhren, an die Ullwiesen oder hinter den Kanal.
Mikko, Greg, ich. Das Trio Infernale. Drei Jungs, ein Chemiebaukasten. In der elften Klasse wurde die Herstellung von Kaliumnitrat wichtiger als alles andere, wir konnten einfach niemanden mehr ernst nehmen, am allerwenigsten die Lehrer. Aber ich hatte auch keine Aufmerksamkeit für meine Familie übrig, nicht für meinen Vater, der morgens vor mir aus dem Haus ging und abends vor mir heimkehrte. Nicht für die Schwelgerei meiner Mutter, die sich mit ihren Freundinnen jeden Nachmittag ein Stück Torte reinschob.
Es kommt mir vor wie ein schlechter Witz, dass Helene Michelsen am Fußballplatz zuallererst vom Delfinbesteck spricht. Was wird meine Mutter wohl damit gemacht haben? Was macht man mit einem Delfinbesteck, wenn man tot ist. Man vererbt es, Helene. Alles ist an meine Schwester gegangen. Ich könnte diese Dinge gar nicht lagern, ich habe in Berlin kein ausgebautes Dachgeschoss, ich hab da noch nicht mal einen trockenen Keller.
Wenn man durch die Dachluke hinabsteigt, rückwärts, die Füße voran, knackt und knallt die Stiege wie feuchtes Kirschholz im Lagerfeuer. Aus Gregs Schlafzimmer führt eine erhöhte Glastür, die man mit einem Hebel noch zusätzlich hochdrücken muss, auf die Veranda (hab schon ein Foto davon gemacht, verwundert, dass jemand auf der Wetterseite mit Türhebel baut).
Die Veranda ist ein windgeschützter Kasten, Fliesen und Backsteinwände speichern die Wärme des Tages. Vom Kalkbruchsee ist nur das äußerste Westufer zu sehen, kaum mehr als eine Pfütze. Dahinter der Umriss des Turmes von Sankt Martini. Seit vier Jahrzehnten wird in dieser Gegend kein Stein mehr gehauen; Steinbruch, Kiesgrube und Kalkhafen sind nur alte Adelstitel, die verborgen liegen unter den Wohnstätten und Sammelstraßen. Am Kalkhafen gibt es zwischen Schachtelhalm und Ginsterbusch zumindest noch ein Café. An den weniger schroffen Hängen des Kalkbruchsees, ich habe ihn einmal umrundet, wachsen jetzt auch Erlen und Birken.
Ich mische mir eine Apfelschorle, zünde mir eine Zigarette an und hieve den dicken Buchkatalog auf den Tisch, aus dem ich noch ein paar Türklinken für die Innentüren der Eigentümer heraussuchen muss. Das Smartphone stört in der Hosentasche. Nachricht eingegangen, von meinem Bruder: