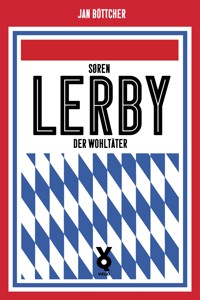9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der alternde Musiklehrer Mauss will es noch einmal wissen und seinen Schülern nicht länger bloß Wissen vermitteln. Er schart die Jugendlichen um sich, eröffnet ihnen im Unterricht ungewohnte Freiheiten. Und es ist zuallererst diese Freiheit, die Johannes Engler stutzig macht. Noch ist der Schulgutachter darum bemüht, jung zu wirken, noch sammelt er Beobachtungen – da hat er sich bereits in eine gerade volljährige Schülerin verguckt. Ein Armutszeugnis, ahnt er. Denn für Clarissa Winterhof dreht sich die Welt vor allem um den Selbstmord ihrer Mitschülerin. Nach und nach erschließt sie sich einen virtuellen Raum zum Trauern: Ihr Blog ist Abgesang und Ouvertüre, ein Ort, an dem die Lebenden und die Toten neu zusammenfinden. Auch Mauss und Engler begegnen sich darin wieder – und wie sich zeigt, als Helden einer ihnen kaum bekannten Geschichte. Drei Generationen, die Jahre, Jahrzehnte gelebten Lebens trennen. Erst dreistimmig erklingt «Das Lied vom Tun und Lassen», ein Lied von Freundschaft, Verlust und Neubeginn – welthaltig und voll untergründiger Spannung. «Böttchers Prosa ist hochunterhaltsam, ohne leichter Lesestoff zu sein. Immer wieder bleibt man an schönen Sätzen hängen, an zarten Pointen.» (Der Tagesspiegel)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Ähnliche
Jan Böttcher
Das Lied vom Tun und Lassen
Roman
Für Frank und für Meike
IImmanuel Mauss
1
Sie war früher zurückgekehrt als die anderen. Am dritten Tag der Sommerferien stand Clarissa Winterhof in meiner Küche, ich versuchte gerade ein Marmeladenglas zu öffnen, Kirsche aus dem letzten Jahr, der Deckel hatte sich festgefressen. Als ich zu ihr aufblickte, senkte sich bereits die Hand, mit der sie mich gegrüßt hatte. Ihr Gesicht war von der Fahrt erhitzt, darunter gebräunt, gesund. Ob ich Hilfe bräuchte, fragte sie.
Das Mädchen war durch die Bauerndiele ins Haus gekommen, jeder konnte dort hinein, ich schloss nie ab. In einer fernen Zeit hatten Pferde ihre Köpfe aus der großen Tür gestreckt, und der vollbeladene Transporter, den ich vor etwa einer Stunde in der Diele geparkt hatte, erinnerte daran, dass hier früher die Ernte eingefahren worden war.
Clarissas Fahrrad lehnte im Licht, vorn am Gartenzaun. Sie bestieg die Ladefläche des Transporters, konnte die Werkbänke nicht anheben, kein Stück, natürlich nicht. Sie sprang ab, ihre Sandalensohlen klatschten auf den Steinboden.
– Du hättest Laberdidi sehen sollen, sagte ich.
Der Hausmeister hatte die Werkbänke auf seine Rollhunde gehievt, vom Fahrstuhl bis hinaus auf den Parkplatz schoben wir sie gemeinsam. Ich wusste, Diederichs konnte nur mit einem Arm heben, hatte sich in diesem aber zwei unfassbar dicke Muskeln antrainiert. Sosehr er mir auch auf die Nerven fiel mit seinem Dauergerede über die großen Schulplagen– Maulwürfe, Graffiti, Raucherhof–, ihn diese Last einarmig stemmen zu sehen flößte mir Respekt ein.
Alle anderen Utensilien hatte ich bereits zuvor aus der Werkstatt geräumt, an diesem Morgen waren nur die drei Werkbänke übrig. Auf dem Parkplatz verabschiedete ich mich, indem ich dem Hausmeister einen weiteren unnützen Schlüssel meines Lebens in die Hand drückte, einen Schlüssel, der seit Jahren nicht mehr in Gebrauch gewesen war. Wie die Dielentür hatte ich den Werkraum nie abgeschlossen.
– Mach dir einen Tee, und ich hole Verstärkung. Das hatte ich sowieso vor, sagte ich.
Ohne mir zuzustimmen, ging Clarissa durch die Diele zurück ins Haus.
Am Morgen, als ich die Dorfstraße in Richtung Bahnhof gegangen war, um den Transporter vom Tischlermeister zu leihen, also abzuholen, hatte noch leichter Dunst über den Wiesen gelegen. Jetzt spürte ich, dass es heiß werden würde. Vom Anblick der üppig grünen Vorgärten wurde mir unwohl; es bekam mir auch nicht, dass ich mich vom Frühstücken hatte abhalten lassen.
In den Häusern am Straßenrand wohnten Menschen, die ich weitaus länger kannte als Ingo Singer. Doch zu ihm ging ich. Er wohnte auf der anderen Seite des Dorfes, hatte im Oktober den verfallenen Milchhof gekauft, den er nun Ziegel für Ziegel wieder zusammensetzte. Haupthaus, Nebenhaus, Stallungen und Scheune – ein Projekt, das viele Jahre in Anspruch nehmen würde. Singer war Sänger, ausgerechnet, und er hatte sich dem Dorf vorgestellt, indem er an einem der Weihnachtstage in seiner Ruine die Winterreise sang. Viele waren aus Neugier hingegangen, aber die einen fanden die Aktion zu zugig, die anderen eitel. Ein befremdeter Nachbar hatte Singer am nächsten Morgen ein Kirchengesangbuch vor die Tür gelegt, natürlich anonym.
Der schwere Stand des Neuankömmlings. Auch meine Frau und ich hatten dieses Bad im Misstrauen der anderen nehmen müssen, ein Fixierbad. Geradezu sträflich lange hatte ich keinen Kontakt zu Singer aufgenommen, nun aber, vier Tage zuvor, auf dem Bahnsteig zu ihm gesagt, ich könnte seine Hilfe brauchen, irgendwann, an einem dieser Julitage, vielleicht sehr bald schon, denn ich wartete auf eine Anweisung, eventuell käme sie schon morgen, wenn die Ferien anfingen, und Singer hatte geantwortet, auf jeden Fall, und nein, in die Diele stelle er die Werkbänke nicht mit mir, wennschon, dennschon, auf den Dachboden würde er sie tragen, wenn sie da hinaufsollten, und notfalls allein.
Herausgehört hatte ich neben der Bedürftigkeit nach gemeinsamer Arbeit auch die Hoffnung, dass ich mich umgekehrt einmal von ihm für Dienste verpflichten ließe, denn von denen gab es genügend, sehr viele, im Grunde unzählige. Ich stand jetzt vor seinem zweigeschossigen Haus und rief nach ihm. Klingel gab es keine. Wohl war das Dach inzwischen gedeckt, aber überall hatte Singer begonnen, Putz von den Wänden zu klopfen, dann jedoch aufgegeben, als hätte er nur Proben vom Mauerwerk nehmen wollen. Vieles hatte er angefangen, wenig zu Ende geführt, er wandte sich den Türen, dann den Fenstern, dann doch lieber den Stromleitungen zu und schließlich dem Wasseranschluss, bevor er wieder von vorn begann. Singer hatte sich in ein Hamsterrad der körperlichen Arbeit begeben, und nichts sprach dafür, dass er wieder heraussteigen würde.
Die aktuelle Baustelle lag im Saal; dort war er offenbar dabei, einen Schornstein abzureißen und neu zu mauern, im Ruß auf den Dielen machte ich frische Fußabdrücke aus. Ich ging ihnen nicht nach, rief noch einmal seinen Namen, rief Singer, er rief meinen zurück, Mauss. Es kam von draußen. Ich trat durch die billige Holztür in den Garten und fand ihn in einem Liegestuhl, ein Buch in der Hand.
Aha, man entspannt, dachte ich.
– Grüß dich, sagte Singer. Wird endlich Sommer, oder.
Es war widersinnig schwer, die Werkbänke auf meinen Dachboden hinaufzutragen, zumal die Absätze auf der dreiteiligen Treppe kaum zwei Treppenstufen breit waren: Man konnte die Last nicht abstellen, musste sie auf der Kante halten, dabei ständig den Kopf einziehen, und wenn Singer nicht die untere Position und somit den schwereren Part übernommen hätte, der Transport wäre sicher missglückt. Wie der Hausmeister war er wesentlich stärker als ich, allerdings auch über zehn Jahre jünger.
Als wir die dritte Werkbank anhoben, begannen meine Muskeln, die bis dahin nur geschmerzt hatten, regelrecht zu flattern. Ich spürte plötzlich, wie enttäuscht ich war über den Verlust der Schulwerkstatt und dass mir damit nicht bloß ein Raum, sondern ein Rückzugsort genommen worden war. Zuerst entziehen sie dir das Vertrauen und dann die Kräfte. Auf dem zweiten Treppenabsatz wurde mir schwarz vor Augen, ein Schatten huschte am Geländer vorbei. Clarissa tauchte so unerwartet auf wie vorher in der Küche, sie wollte mir oben helfen, das Gewicht emporzuziehen. Zu schwach, es ihr zu verbieten, konnte ich neben ihr doch letzte Energien mobilisieren:
– Hältst du durch?
Ihr Gesicht verzerrte sich vor Anstrengung. Kaum hoben wir die Werkbank, aber wir zogen sie doch dieses letzte Stück über die Kanten der Treppenstufen. Singer atmete laut. Ich hatte auch ihn an seine Grenzen geführt.
– Drecksdinger, sagte ich und: Den Rest machen wir nachher.
Clarissa krabbelte über die Bank zurück. Ich brauchte eine Weile, bis ich ihr folgen konnte.
– Dann bist du eine Schülerin von ihm, hörte ich Singer sagen, als ich in die Küche trat.
– Sie hat grad ihr Abi gemacht. Aber es ist schlechter als nötig.
Clarissa boxte mir kraftlos gegen den Oberarm. Ich hatte sie unter ihrem schwarzen Haarschopf nie so gebräunt gesehen.
– Was wirst du dort oben machen, Mauss.
– Dies und das. Meine Fahrräder vor allem.
– Er baut auch Instrumente, sagte Clarissa hämisch.
– Wenn du den Hof mal sehen willst, du kannst mich gern besuchen kommen, sagte Singer zu Clarissa.
– Vielleicht später. Ich will erst rüber ins Backhaus.
– Jetzt am Mittag nur mit Kopfhörern, rief ich ihr hinterher.
Clarissa ging durch die Mückennetztür auf die Veranda, die Holztreppen hinab, sie verschwand im Garten. Sie muss zeitig losgefahren sein, dachte ich, denn es waren mehr als zwanzig Kilometer aus der Stadt bis zu mir heraus: durch den Wald, über die Teufelsbrücke, dann immer am nördlichen Ufer des Kanals entlang. Nicht täglich, aber immer noch häufig legte ich diesen Weg selbst mit dem Rad zurück.
Singer stand am Tisch, die Arme verschränkt, Spuren von Ruß und Sägespäne auf seinen Shorts.
– Ist sie eine von denen, die im Winter hier bei dir waren, fragte er.
Ich nickte.
– Aber du siehst ja, die Musik ist wichtiger als der alte Mann.
– Na, hör mal. Ich meine, dass sie immer noch zu dir hier rauskommen. Gibt’s ein schöneres Kompliment für einen Lehrer?
– Verrückst du die Werkbänke oben noch kurz mit mir.
Singer bejahte, wir gingen hinauf.
– Clarissa könnte bei mir jobben. Also, keine Ahnung, nur wenn sie nichts zu tun hat.
– Ich denke, sie hat nicht mehr zu tun, als der Sommer ihr vorgibt.
Es war weniger mühsam, die Möbel auf der geraden Ebene zu tragen. Am Ende postierten wir sie dort, wo sie das meiste Licht aus den beiden Dachgauben einfingen, obgleich ich in der Schulzeit eher abends hier herumpütschern würde, bei elektrischem Licht.
Nach einem festen Händedruck verschwand Singer durch die Diele. Mein leerer Magen zog mich zurück in die Küche. Kaum hatte ich das Marmeladenglas geöffnet, schwirrten drei Fliegen drum herum. Ich schraubte es wieder zu, beobachtete ihre Reaktion. Sie flogen jetzt auch mich an, bevorzugt den Latz meiner blauen Arbeitshose, die ich manchmal im Unterricht getragen hatte, wenn ich direkt aus der Werkstatt kam. Ich blieb noch lange am Tisch sitzen, trank kalten Tee.
Die Sommer ähnelten sich hier draußen, noch immer hatte es ein paar Tage gebraucht, bis ich mich an den Ferienstatus gewöhnte. Vielleicht sah ich deshalb neben mir noch den Stapel Schulhefte liegen, den ich zuletzt abgetragen hatte. Wie sich unter dem kleinen Porzellankännchen ein Milchring gebildet haben konnte, verstand ich auch nicht.
Ein Flügel des Fensters, vor dem ich saß, war von rankendem Knöterich bedeckt, durch die andere Hälfte strömte Mittagslicht, floss mir über die Schulter, durch den Honig, hinab auf die Schachbrettfliesen. Ich hatte frei. Selbst wenn ich an diesem Tisch Tests zu korrigieren hatte, war die Küche der schönste Raum des Hauses. Diese Weitläufigkeit, die große, helle, ruhige Mitte des Raumes zog die Menschen an, fast jeder Besucher ließ sich, wenn er ankam, intuitiv hier nieder.
Jetzt im Sommer zog die Stille auch von draußen ein, mit Ferienbeginn waren die Leute fast alle ausgeflogen. Der Juli, das Dorf und ich – wir winkten ihnen hinterher und blieben zurück. Wie passend das war. Schuljahre waren Kreise, die der Juli schloss. Friedlich setzte er den Bleistift ab und gab: Ruhe.
Ich unternahm meine Reisen zumeist an Ostern und im Herbst, in den Sommerferien aber genügten mir die Kornfelder, die Spaziergänge zum Kanal, ich würde den Hund schwimmen lassen, die Hündin Claire, die ich an einem der nächsten Tage von den Beckers in Pflege nähme. Beckers wohnten schräg gegenüber, er war Fliesenleger, keine fünfundvierzig, seit mehr als zwei Jahren berufsunfähig wegen Staphylokokken im Knie, wollte sich aber den Jahresurlaub nicht nehmen lassen. Auch drängte ihn wohl seine Frau zu den gemeinsamen Reisen. Claire jedenfalls liebte meinen Garten, und vielleicht könnte sie mir sogar gegen die Maulwurfsgrillen helfen, die mir in diesem Jahr schon einige Salatköpfe zerfressen hatten.
Kein Ton kam aus dem Backhaus, Clarissa hatte Folge geleistet und die Kopfhörer aufgesetzt. Ich spürte schon jetzt den Muskelkater kommen, antizipierte ihn, schloss die Augen. Um die Mittagszeit verstummte auch der letzte Rasenmäher. Nur die Fliegen setzten unentwegt zur Landung an, hoben wieder ab.
Schlafen wollte ich nicht, es wäre mir sowieso nicht gelungen. Ich zog das Buch aus meiner Ledertasche, das ich am Morgen noch der Schulbibliothek entnommen hatte. Vor zwei Jahren hatte ein früherer Klassenkamerad es mir geschickt und sogar gewidmet, er musste mich entweder für einen Multiplikator oder für einen Deutschlehrer halten, beides irrtümlich.
Immer wieder rangierte ich alte Bücher in die Schulbibliothek aus, verschob sie, und dieses schien mir dafür prädestiniert zu sein. Seltsamerweise hatte ich das Buch vor sechs Wochen bei einem meiner Abiturienten auf dem Tisch entdeckt, und dieser hatte nach dem Unterricht davon zu erzählen begonnen. Eine Promotionsschrift: Die Unmöglichkeit, Wir zu sagen, ohne zu trauern, im Untertitel Konstrukte kollektiven Erzählens. Auf dem Vorsatzpapier prangte mittlerweile der Stempel des Fachbereichs Deutsch.
Es handelte sich um eine Untersuchung schöngeistiger Literatur, und zwar solcher, die ganz oder in Teilstücken in der ersten Person Plural verfasst war. Der Autor suchte Spuren – beim Chor im antiken Drama, in der Ideenlehre, vom präherderschen Menschen ging die Rede, von objektivierenden Gesetzessprachen. Ja gut, dachte ich, jedes Man war gleichsam ein Wir, und wenn man die Welt so allgemein betrachtete, schäumte sie natürlich zu allen Zeiten über vom Operator Wir, dem Wir-Faktor, der Staaten, Nationen, Systeme, Diskursgruppen, Familien, Fanmeilen oder Paare vertrat.
Immer noch flackerte in meiner Abneigung gegen die Wissenschaftssprache das schlechte Gewissen auf. Während meines Studiums vor fünfunddreißig Jahren hatte ich selbst in solchen akademischen Sätzen gedacht, geschrieben, gelebt. So verging die Zeit und hinterließ doch ihre Rückstände.
Mir schwirrten Kollektivgesellschaften im Kopf herum, lenkten mich heraus aus der Sprache, aus dem Buch. Wie oft man sich zusammentat im Leben und auseinanderging – eine Begegnung auf der Straße, im Konzertsaal, am Strand, diese Flüchtigkeit. Ich dachte an unsere Hausgemeinschaft, an die Hausbesetzeruntergruppen, an die diversen Bands und Orchester, in denen ich zu Studienzeiten gespielt hatte. Keine Freundschaft, kein Mitmusiker, keine einzige Telefonnummer war geblieben, nur Namen: Claas, der lange Gräfe, Knalli, Alistair.
Ich hatte das Buch zugeklappt, aus den Händen gelegt, auf die Küchenbank. Aber nun starrte ich in die Gemeinschaft der Espressobohnen, wie sie da in der kleinen elektrischen Mühle lagen und Kaffeepulver werden sollten. Ich schob sie mit dem Zeigefinger hin und her. Ihr Bohnen. Wir Gruppen. Wir Knallis. Wir Gepaarten, Befruchteten, Bestäubten. Ein Leben lang kämpfend, weil uns zwei andere ausgedacht hatten.
Während ich den Kaffee mahlte, Wasser in den Sockel der Edelstahlkanne füllte, das Pulver in den Filtereinsatz häufte, die Kanne auf den Fuß schraubte, während all dieser Handgriffe, die darauf hinführten, dass das Wasser erhitzt wurde und zu kochen begann, stieg auch in mir Hitze auf.
Clarissa stand wieder in der Küche, ich hatte sie nicht hereinkommen hören. Ihr zu sagen, sie solle sich nicht so anschleichen, hatte ich mir abgewöhnt, so wie ich im Grunde alle Vorschriften, die nicht fruchteten, gegenüber meinen Schülern fallengelassen hatte.
Sie fläzte sich in einen der beiden Korbstühle, schlug die Beine übereinander, ihre staubige Sandale tanzte vor mir in der Luft.
– Nimmst du eigentlich wieder den Hund, fragte sie.
– Ja, morgen wahrscheinlich. Du hast geweint.
Sie sah mich kurz an.
– Da war wieder so eine krasse Platte.
– Kaffee?
– Weiß nicht.
– Dann erzähl mal, wie’s war in Frankreich.
– Großartig. Ich hab doch alles geschrieben.
– Viel Unsinn hast du geschrieben.
Sie lächelte über das Wort. Clarissa hatte nicht etwa eine Postkarte geschickt, sondern auf einer Internetseite eine Art Tourtagebuch geführt, jeden Tag ihrer Reise für die Allgemeinheit dokumentiert. Sie ahnte, dass ich alles gelesen hatte, verkniff sich wohl Fragen, die mir Kritik an ihrem Blog gestattet hätten.
– Und du hast den Werkstattschlüssel abgegeben, ja?
– Heute Morgen.
– Dass du hier so locker sitzen kannst. Ist doch Schikane, das alles, und du lässt dir das auch noch gefallen. Das versteh ich nicht, Manuel.
– Komm, lass mal sein.
Weiter kam ich nicht, denn ich hätte ihr widersprechen müssen und hatte keine Lust dazu. Eigentlich waren Clarissas Eltern jetzt dran, sich mit ihr zu beschäftigen. Ich wusste nicht einmal, ob dem Mädchen damit geholfen war, dass ich sie noch in dieses Haus einließ. Ich stand auf, um nach Keksen zu suchen. In den Tiefen des Bodenschranks fand sich ein eingeschweißter Fertigkuchen, an dessen Kauf ich mich nicht erinnerte. Manchmal ließ Frau Wittkowski etwas zurück, meine Haushälterin, die ich mir nur noch einmal in der Woche leistete. Ich mochte solchen Kuchen nicht. Als die Kanne zu stottern und zu meckern begann, nahm ich sie vom Feuer und goss uns Kaffee ein.
– Trink. Tut gut.
Lächeln konnte sie wieder. Ich staunte, wie viel Gewicht Clarissa innerhalb des letzten Jahres verloren hatte. Ihr dickes, dunkles Haar, das sie nicht kämmte, nur mit der Hand zum Seitenscheitel formte, hatte mehr Gesicht verdient, dachte ich, weniger Wangenknochen.
Ich fragte, ob sie mit dem Rad zurückfahren wolle. Sie könne es ja auch mit in den Zug nehmen. Als keine Antwort kam, bot ich an, sie zum Bahnhof zu bringen. Da sprang sie auf und stapfte auf die Toilette, um sich die verlaufene Wimperntusche aus dem Gesicht zu wischen.
Es war nichts Neues, dass Clarissa kam und ging und jedes Gespräch verweigerte. Ich hatte ihr einmal aufgezeigt, dass sie ihrem Gegenüber dadurch immer eine Antwort schuldig blieb. Aber was hatte ich da gesagt! Schuldig– sie war ausgeflippt. Wenn sie jemandem aus dem Weg gehe, sei das allein ihre Sache, sie wolle überhaupt nicht auf andere wirken, wie also könne sie schuldig sein.
So ging das manchmal. Erst unterbrach sie ein Gespräch und lief davon, dann verhinderte sie, dass man wieder anknüpfte. Es wirkte wie ein pubertärer Reflex, den andere Schüler längst abgelegt hatten.
Wir gingen mittlerweile auf der Dorfstraße in Richtung Bahnhof, sie hatte trotz der Wärme ihre pinkfarbene Strickjacke übergezogen, ein schreckliches Ding. Der Boden ihres Rucksacks war übersät von dunklen Tintenflecken, und ich dachte daran, dass Clarissas Nicht-auf-andere-wirken-Wollen noch einen zweiten Aspekt hatte, der auch ihre Freundinnen und Freunde betraf. Sie waren alle keine Poser, sie fanden sich nicht allzu toll, spiegelten sich nicht im See und nicht in der Bahnfensterscheibe. Selbstdistanz als Tugend – damit hatten sie mich beeindruckt und für sich eingenommen. Ich fand immer schon, dass jeder Witz ebenso vom Timing wie von der Zurücknahme des Erzählenden lebte. Insofern, das blieb bestehen, hatte ich eine Menge Spaß mit ihnen gehabt.
Nur wie befremdlich war es gewesen, dass manche Schüler nicht damit aufhören konnten, witzig zu sein. Als dieses schöne Jahr schrecklich wurde, wie beschämend wurde da ihre Ironie. Vor den Momenten, in denen die bekannten Gesichter ihr wie verzerrte Masken erschienen, war Clarissa geflohen. Sie hatte Fehler gemacht, mehr noch, sie scheute sich nicht, diese Fehler zu suchen, und dabei hatte ihr die gute Laune der Freunde im Weg gestanden. So viel wusste ich. Womöglich war sie deshalb früher von der gemeinsamen Reise zurückgekehrt.
Sie in Gedanken, ich in Gedanken, zwischen uns ihr klappriges Fahrrad. Die Lichtkabel waren mit Hautpflastern am Rahmen befestigt. Wir überschritten die einzige Kreuzung, der man die hundertzwanzig Jahre alten Katzenkopfsteine gelassen hatte. Aus der Beethovenstraße kam uns die Tochter der alten Frau Nenning entgegen, sie trug zwei Sechserpacks großer Wasserflaschen, die unter der Plastikfolie quietschten. Unser Garagenkrämer hatte zweimal in der Woche geöffnet, er verkaufte nur Einzelflaschen, aber alles, was man ihm zur Bestellung aufgab, besorgte er aus dem Supermarkt. Wir grüßten einander, Frau Nenning hatte früher mit Marianne im Dorfchor gesungen. Zu fast jedem hier führte ein Lebensfaden, manche davon waren sehr dünn, derjenige zu den Nennings war im Grunde so dünn, dass man ihn als abgerissen bezeichnen konnte.
– Ich weiß nicht mal mehr ihren Vornamen, sagte ich zu Clarissa. Aber aus dem Flaschenquietschen müsste man mal was basteln.
Sie sah mich an.
– Findest du nicht? Wär doch was als Grundrhythmus.
Sie band sich ihre Strickjacke mit dem Stoffgürtel zu, ging zum Automaten und zog sich eine Fahrkarte. Ich erinnerte mich daran, dass Clarissa einmal von Geldsorgen gesprochen hatte. Ich sagte, dass ich bei Ingo Singer nachfragen könne, ob er Arbeit für sie habe.
– Meinst du, ich komm jetzt jeden Tag hier raus?
– Das könntest du.
– Warum hast du das vorhin gesagt, Manuel.
– Was.
– Dass mein Abi schlechter ist als nötig.
– Ist es das nicht?
– Wenn du so was sagst, denk ich immer, du hast überhaupt nichts kapiert.
Ich wollte sie zum Abschied in den Arm nehmen, ließ es aber lieber bleiben, fragte stattdessen noch einmal:
– Hältst du durch?
Clarissa zog die Schultern hoch, sie sprach nicht mit mir, wir verabredeten kein Treffen, bis der Zug eingefahren war. Als er wieder anrollte, antwortete sie doch, nickte durch die Scheibe. Sie würde durchhalten.
Das Dorf hatte eigentlich keinen Bahnhof verdient, es lag nur zufällig an einer Trasse zwischen zwei Oberzentren. Ich ging hinüber auf den sandigen Bahndamm jenseits der beiden Gleise, wo Schafgarbe und Wicken wuchsen. Ein Messer fehlte, ich riss an den dicken Stängeln, holte eine Nachtkerze mitsamt Wurzeln aus dem Boden. Blauviolett leuchteten die Glockenblumen, dazu ein wenig Unkraut, als Grün. Ich nahm mir Zeit, den Strauß zu ordnen. Dann ging ich, die Blüten gen Boden gerichtet, zurück ins Dorf, bog in die Beethovenstraße ein, eine Sackgasse, an deren Ende das Sportgelände lag. Der Fußweg zwischen den beiden Fußballplätzen, so kam man zum Abzweiger des Kanals, einem Bewässerungsgraben, aus dem die Kinder von montags bis donnerstags ihre Bälle fischten, wenn ihnen die Torschüsse missglückt waren, aber nicht heute. Das dünne Straußgras fühlte sich hier seidig an, seine rote Blüte wurde noch ausgemalt von der Abendsonne, und ich drang bis zur Südseite des Friedhofs vor, wo das Wasser aus einem Rohr fiel und über zwei Stufen abwärts, nicht rauschend, aber auch nicht nur plätschernd, sich an die Friedhofsmauer schmiegte, um die Ecke und hinabfloss bis ins Auffangbecken, an dem die Gießkannen befüllt wurden.
Der Eingang zum Friedhof lag unten am Waldrand, ich aber stieg über die niedrige Feldsteinmauer, immer betrat ich den Gottesacker an dieser Stelle, von hinten, von Süden, es war der kürzeste Weg zu Mariannes Grab.
– Blumen der Saison, sagte ich und legte die Bahndammgewächse vor den Stein.
Mach dir doch nichts vor, Manuel. Juliruhe! In unserer schönen Küche wird sich in diesen Ferien keine Juliruhe einstellen, und dieser Jahrgang von Schülern beschreibt auch keinen Kreis, der sich schließt wie jeder andere.
Ich wäre gern erst einmal angekommen, Marianne.
Sie schwieg, entschuldigte sich nicht. Ob sich bei mir jemals ein Mensch entschuldigen würde?
Seit dem Winter kam ich zwei- bis dreimal in der Woche hierher, um ihr mein Herz auszuschütten. Und so wusste auch Marianne, dass am 14.Dezember ein junger Mensch gestorben war, zum ersten Mal in meinen dreißig Lehrjahren hatte sich ein Mädchen, das ich unterrichtete, das Leben genommen. Eine frische Wunde, so groß wie unsere leerstehende Küche, du hast ja recht, meine Liebe, größer noch, groß wie unser Garten. Es gab ein frisches Wir, diese Schülergruppe, die letzte, um die es besonders schade war, die mich eingenommen hatte und jetzt ausblieb, sich erholte von dem Leistungsanspruch, den auch ich stellte, stellen musste. Saskia, Max, der Frickler Ying und Clarissa Winterhof. Wie ein spukhaftes Wesen hatte sie dagestanden, mitten in der Küche, als wäre sie selbst dem Totenreich entstiegen und hätte sich materialisiert.
Na ja, spukhaft oder nicht – sie sprach einfach über mich hinweg –, warum denkst du, ist sie hergekommen, deine Clarissa, hast du sie gefragt, ist sie jetzt endgültig zur Büßerin geworden, dafür hat sie ja schon immer ein Faible gehabt. Sie macht doch den Eindruck, als hätte sie eine Strafe anzunehmen für ihre schwachen Noten.
– Hör doch auf, Marianne.
Ich sah mich um, aber kein Mensch hatte mich laut reden hören. Meine Frau schwieg beleidigt, immerhin.
– Tausch dich aus mit mir, aber quassel nicht irgendwas daher.
Das hatte ich geflüstert. Ich drehte mich um die eigene Achse. Um mich herum Grabsteine, eckig und oval, mancher hoch, andere breit, protzig. Im schattigen Abseits die Familiengräber. Weil das Gelände zum Wald hin abfiel, konnte man den Friedhof vom Grab meiner Frau aus gut überblicken. An einer Stelle erodierte der Hang, einige Gräber hatten verlegt werden müssen. Dieser Gemeinschaft widmete die Doktorarbeit, die ich vorhin zur Hand genommen hatte, kein Kapitel. Dabei bewohnten die Toten sogar ihre eigenen Höfe, von Mauern umhegt, sie fassten sich in der Erde an den knochigen Händen, tauschten ihre Schicksale aus. Meret Kugler gehörte jetzt dazu. Das Mädchen lag nicht hier, aber was machte es schon, wo sie sich zum großen Schlaf bettete. Sie waren alle verbunden, unterhielten sich miteinander, sie war eine Freundin von Marianne geworden, jedenfalls dachte ich das manchmal.
Die Vögel sangen. Licht wurde von Südwesten durch die hohen Kiefernstämme gesiebt. So wie ich vorhin in der Küche nur noch mit halber Kraft an mein wissenschaftliches Studium hatte glauben können, kam es mir jetzt vor, als hätte es all die vergangenen Schuljahre nicht gegeben, oder nur als unwesentliches Vorspiel dieses Sommers. Ich sah hinauf in die Baumkronen. Die blaue Farbe darüber verblasste. Würde ich bis zum Schluss in der Uhr unterwegs sein, in Runden, Schuljahren, Wiederholungen, synchron zu den Zeigern? Oder ging es schon bergab, waren das unter mir die Trümmer der Uhren, waren es Geröll und Bergkristall, ein Quarzfeld, auf dem ich mich gehen ließ, bis es mich endgültig hinabführte an die Pforte, durch die ich den Friedhof zum letzten Mal betrat und neben meiner Frau ins Gras fiel.
Dort unten stand sie, die Pforte, schlug verunsichert auf und zu, weil Wind aufgekommen war. Auch knarzte der Stamm einer Kiefer.
Warum denkst du, ist sie hergekommen, deine Clarissa. Hast du sie gefragt, warum sie vor ihren Freunden zurückkehrt.
Nein, das hatte ich nicht. Ich dachte an ihren Vater, Doktor Winterhof, der mich lange vor ihren miserablen Abschlussklausuren kontaktiert hatte. Ich kannte ihn von Elternabenden: ein reicher Mann, Softwareunternehmer, zudem mit zwei Aufsichtsratsposten ausgestattet. Sicher hatte Winterhof sein Kind in den neunzehn vergangenen Jahren weniger gesehen als andere Väter das ihre, bestimmt schlief er höchstens fünf Stunden pro Nacht, weil immer die Arbeit und die im gleichen Käfig befindliche Karriereleiter auf ihn warteten. Jetzt konnte er diese Leiter eigentlich nur noch hinunterfallen. Er hatte sich am Telefon nach Clarissa erkundigt, mit sonorer Stimme, weder dumpf noch fokussiert. Und doch, in einem Punkt ähnelte er ihr, es verwundert mich, Marianne, dass er so aufgeschlossen wirkte gegenüber den eigenen Fehlern. Er wusste, dass seine Tochter unter ihm gelitten hat, einmal sprach er es sogar aus. Gerade dadurch kam er mir zu nah, und ich bleibe dabei, Winterhof ist von seiner Sorge weniger erfüllt als ergriffen. Ich hätte mit ihm geredet, wenn er sich nicht so gern hätte reden hören, aber das bringt wohl seine berufliche Stellung mit sich, er räuspert sich ständig, um danach bestimmter zu klingen, professioneller, Winterhof ist es gewohnt, Fragen, wenn überhaupt, nur einmal zu stellen, und ich habe ihm gesagt, wie sehr ich Clarissas Nachdenklichkeit schätze, ihre Art zu trauern, dass sie dabei absolut integriert ist in ihren Freundeskreis. Einer, der anruft und es ernst meint, hätte doch nachgehakt.
Ach, es ging ihm gar nicht um sein Kind.
Ich hörte meine Frau lachen. Ein Glucksen. So senil war ich nicht, dass ich mit meiner toten Frau sprach. Sie sprach mit mir. Ich konnte es ihr nicht abgewöhnen.
Und dann hast du Herrn Doktor Winterhof noch gesagt, wie sehr du den Entschluss seiner Tochter respektierst, ein freiwilliges soziales Jahr einzulegen. Auch um zur Besinnung zu kommen. Und er: Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Was ist daran so lustig, Marianne.
Ich überblickte den Friedhof: die knallroten Plastikgehäuse abgebrannter Lichter, weiße und gelbe Nelken in langstieligen Vasen, akkurat geharkte Beete neben wucherndem Efeu. Eine grasgrüne Plastikkanne mit einem lächerlich großen Gießkopf.
Du kannst das seinlassen, Marianne, du brauchst nicht wieder damit anzufangen.
Aber sie lachte, meine Frau, sie war farbig gewesen unter den Farben, ein Sponti, rote Haare, wallende Umhänge, Armreife, sie wehte vorbei, sie flog auf mich zu, sie begann zu summen, eine Melodie zu singen, ein Volkslied, dessen Verse ihr nicht einfielen, mir nicht einfielen, drang deutlich an mein Ohr. Ein Hippie war sie gewesen, als wir zusammentrafen. Das Leben meiner Frau – und dies wird mich immer schmerzen, wenn ich an sie denke – war geradezu gegensätzlich zu meinem verlaufen, und je öfter ich auf dem Friedhof stand, desto verständlicher wurde mir, dass meine Verwandlung zu spät gekommen war. Als sie noch auf den Gräbern tanzte, über den Doktrinen flog und auf jegliche Konvention spuckte, damals, als sie noch abwinkte, wenn ihr jemand zu viele politische Floskeln aneinanderreihte, hatte ich den in Sachfragen der Revolution gewissenhaften und sprachgenauen Hausbesetzer abgegeben. Marianne nannte mich verknöchert, ich wehrte mich nicht dagegen. Ich wollte in den Achtzigern ein Linker sein um jeden Preis, aber ich war vor allem hart gewesen, zu mir, auch zu den Schülern. Das besetzte Haus mit seinem Plenum und seiner Kreidetafel war unsere einzige gemeinsame Station gewesen, bevor sie das Bauernhaus von ihrem geschiedenen Vater erbte und wir hierher zogen. Ohne das Dorf hätte unsere Liebe, die so sehr auf Gegensätzlichkeit beruhte, nicht gehalten. Das Dorf und sein Binnendruck hatten uns erst zusammengeschweißt.
Marianne flog weiter. Immer bunt und mit Melodien auf den Lippen. Ein Paradiesvogel. Sie hatte mich noch in den gespenstisch kalten Jahren vor der deutschen Einheit, als ich Kohl hasste und an Marx nicht mehr glauben konnte, heiter vorangetrieben. Sie war es, die erkannte, dass die Proteste spielerischer werden mussten und dass es kein Verbrechen war, regionale Produkte zu bevorzugen. Ihr gelang es manches Mal, mir das Verhalten von Schülern zu erklären, und wenn ich Machtmittel anwenden wollte, gab sie mir die nötige Gelassenheit, es nicht zu tun.
Wir waren ein Chiasmus, so viel kann man sagen, Marianne. Als ich dich zu pflegen begann, kreuzten sich unsere Wege. Meiner Verknöcherung entwuchs eine Blüte, die du nicht mehr sehen konntest. Ich wollte dir etwas zurückgeben, ich wollte dir ein Rückhalt sein. Weil ich so vieles von dir gelernt hatte.
Doch du lachtest mich aus. Mit den Schülern kam ich immer besser klar, zu Hause aber machte ich keinen Stich. Marianne zog sich zusammen, verhärtete, verlor in ihrer Krankheit den Respekt vor anderen. Am Ende wurde sie vor Schmerzen bitter. Als mir neue Kräfte erwuchsen, schwand ihre Lebenslust. Es hing zusammen, musste zusammenhängen.
Ich ging nicht direkt nach Hause, nahm den Schlenker durch den Wald zum Kanal. Seine Deiche verströmten nach diesem ersten heißen Tag schon jenen schweren Teergeruch, wie man ihn vom Straßenbau kennt. Auf der südlichen Deichkrone verlief ein Sandweg, der kilometerlang mit kleinen Steinen und dunklem Glaskies bedeckt war. Weder Hundepfoten noch Fahrradreifen litten unter diesem Splitt, der größte Vorteil aber war, dass der Weg auch jetzt im Hochsommer befahrbar blieb, während man auf den Sandwegen ständig zum Absteigen gezwungen war. Vielleicht ließ es sich auch barfuß gehen, ich hatte es nie probiert. Manchmal joggte ich hier. Einmal im Monat. War ich damit ein Jogger? Vierundzwanzig Wochenstunden, dreizehn in Englisch und elf in Musik – damit war ich ohne Zweifel ein Lehrer. Ich setzte mich auf meine angestammte Holzbank, legte die Arme zu den Seiten auf der Rückenlehne ab. Der Kanal war ein langer orange-violetter Spiegel, erstreckte sich auf beiden Seiten bis zum Horizont.
Ein Grab auf dem dörflichen Friedhof. Damit war man Witwer. Ein einziges Lauteninstrument, das immer noch unfertig war nach acht Jahren. Damit war man kein Lautenbauer. Ein Backhaus voller Vinyl. Damit war man Plattensammler gewesen. Ein Laptop mit Leuchtdioden. Damit war man dabei. So drückten es die Schüler aus. Ich ging mit der Zeit, auf einer Höhe mit ihr, ich hielt Schritt, hatte mich fit gemacht. Gut so. Wer schon fit war, musste nicht mehr so oft joggen.
Einzelne Krähen flogen herüber, und ich dachte, wie wenig sich die Vögel darum scherten, ob sie über Gräbern schwebten oder über Feuchtwiesen. Not caring about the nastiness of how you died and where you fell. Schön wäre das gewesen, hätte Chandler recht behalten und die Erinnerung erlösche im Moment des Todes. Aber so ist es nicht. Marianne war aktiver als zu Lebzeiten, sie sprach zu mir, sie sprach mir zu, seit Jahren.
Mein Blick aber: schattenlos. Das Wasser fast unbewegt. Ferienwasser. Der Sommer kam, er fing jetzt richtig an. Nirgendwo konnte man sich die Haut verbrennen wie am Kanal. Ich hatte kürzlich eine alte Sonnenmilchflasche gefunden, sie musste aus dem letzten Jahr stammen, als mich die Schüler im Bauernhaus besucht hatten und oft zum Schwimmen hierher gegangen waren. Ich ging nicht mit, weil ich fürchtete, dass sich mindestens eines der Mädchen im Bikini vor mir genieren würde. Und doch, ich hätte gern einmal überprüft, ob wenigstens das stimmte.
2
Ich bin noch kein alter Sack und wie stets mit dem Fahrrad zur Schule gekommen. Ich betrete in Klickschuhen und Radfahrerdress das Lehrerzimmer, die Sonnenbrille auf dem Kopf. Der ältere Kollege, ein Physiklehrer namens Grote, kommt auf mich zu, Kaffeetasse auf Untertasse, er fragt mich vor versammelter Belegschaft, ob ich nicht meinen Beruf verfehlt hätte, ob mir die Wege zur Schule und nach Hause wichtiger seien als die Pädagogik selbst. Er zögert einen Augenblick, als wäre ihm die Situation peinlich, und fragt dann, ob ich nicht Radrennprofi werden wolle.
Ein blöder Spruch in drei Teilen, der keinen außer Grote zu amüsieren schien. Aber er wollte sich einfach nicht dafür entschuldigen. Ich baute mich vor ihm auf, jedenfalls im Traum, ich träumte oft von dieser Szene, hörte ihn dann, den Kollegen Grote, der nicht müde wurde zu betonen, dass er für seine Leistungen im Bereich Jugend forscht schon lange mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet gehöre. Die Ehrung blieb aus, sein Vater war während der braunen Jahre ein hohes Tier gewesen, wir wussten es alle. Aber das wäre eine ganz andere Geschichte, es gab ja so viele Geschichten. Ich stellte mir sogar einmal im Halbschlaf vor, dass Grote mit seinen Schülern vor allem an der Weiterentwicklung von Sprengstoffen forschte, irgendwo in den Katakomben des Schulgebäudes.
Um ehrlich zu sein, Grote war nur der berühmte Tropfen, satt hatte ich sie alle, satt in ihrer Geballtheit, der man sich – anders als dem Plenum oder den verschiedenen Hausgruppen früher – niemals durch Aufstehen, Türschließen und Musikhören entziehen konnte. Wenn ich also einen Einschnitt setzen müsste, den Beginn des Tauwetters, wie ich meine zweite Amtszeit manchmal scherzhaft nenne, genau bestimmen, dann wäre es das Jahr 2003, als ich mich dauerhaft aus dem Lehrerzimmer verabschiedete.
Ich saß zunächst in der Cafeteria. Der einzige Nachteil war, dass ich fortan vom Gratiskaffee der Kollegen abgeschnitten war. Ansonsten gab es nichts zu bereuen. Manchmal setzte sich ein Kollege, der Pausenaufsicht hatte, zu mir. Die junge Frau Sandmann, heute Rektorin der Schule, unternahm nach drei Wochen einen halbherzigen Versuch, mich zurückzugewinnen. Seitdem hat mich keiner der Kollegen je wieder auf meinen Rückzug angesprochen. Im Lehrerzimmer fanden für mich nur noch die Fachkonferenzen statt, also die langweiligsten Stunden des Schulalltags, die seit der Privatisierung nur zahlreicher und dabei immer bürokratischer geworden waren.
Damals mochten die Kollegen mich kauzig genannt haben. Ich hatte vielleicht andere pädagogische Vorstellungen als sie, wichtiger war ihnen aber, dass ich bei allem Hang zum gruppendynamischen Arbeiten noch den Ruf eines strengen, fordernden Lehrers besaß. Ich war einer, den man sich so oder so leisten konnte, anwesend oder abwesend, ich stellte keine Gefahr für sie dar und auch nicht für den Ruf der Schule.
Das änderte sich, als mit dem jungen Referendar Freisler aus heiterem Himmel ein Gesprächspartner zu mir herabfiel. Freisler polarisierte, und während er mich sofort anzog, schienen andere Lehrer sich bald an der Wand entlangzuschieben, um ihm nur nicht zu nah zu kommen.
Der Referendar mietete über die Schule eine Diskothek an und veranstaltete dort die Talentschmiede. Wir sahen begeisterten Schülern beim Singen, Tanzen, Rappen und Plattenauflegen zu. Club-der-toten-Dichter-Stimmung. Junge Bleichgesichter begannen zu glühen, noch die schüchternsten gingen aus sich heraus, wobei Freisler die Struktur des Wettbewerbs nur aus Showgründen nutzte. Der Referendar kannte vor den Schülern keine Scham, gab sich auch vor den Erwachsenen aufreizend offen, er schloss niemanden aus. Im zweiten Halbjahr initiierte er ein interaktives Musicalmärchen, das erste und letzte seiner Art. Freisler hatte fünfzehn Schüler an von der Firma Winterhof gesponserte Rechner gesetzt, von wo aus sie Animationen in Gang brachten, die auf einem riesigen und einigen kleineren Bildschirmen gezeigt wurden. Abgesehen von den Bildschirmen blieb die Bühne leer. Investor, Direktorium und Elternräte fühlten sich um ein Liveerlebnis betrogen. Vorher hatten sie nur nach Luft geschnappt, jetzt schnappten sie über. Noch vor Ende des Referendariats wurde Freisler abgesägt.
Seine Schüler waren ohne Ausnahme schockiert, ob in Klassenstufe sieben oder elf. Keiner von ihnen konnte begreifen, dass ein solcher Lehrer nicht übernommen wurde. Ich ließ mir noch einmal erklären, was sie so großartig an ihm fanden, es war überhaupt die Phase, in der ich gut zuhörte, und so bekam ich ein bisschen von der Beliebtheit ab, die dem geschassten Referendar galt.
Meinen Pausenort hatte ich zuvor von der Cafeteria in die Halle verlegt, wo wir regelmäßig zusammenstanden. Für unsere Gespräche musste ich Freisler dankbar sein, denn er öffnete mir die Augen für ein Dilemma, das ich allein nicht hatte erfassen können. Es bestand, verkürzt gesagt, darin, deutsche Schüler zu unterrichten, aber ein amerikanisches Menschenbild im Kopf zu haben. Es war kein Geheimnis, dass die angelsächsische Welt weniger innere Zerstörung erfahren hatte, natürlich war dort das freiere Denken entstanden: Rhizome, Netzstrukturen, die fließenden Wechsel zwischen Ernsthaftigkeit und Entertainment. Marianne und ich waren oft in Amerika gewesen, meine Frau liebte den Süden, ich liebte die Filme und Literatur der Ostküste. Jeden Tag zeigte sich aufs Neue, ob nun in der Schule, im Stadtbild, in den Medien oder der Kunst, wie verliebt wir Deutschen in das waren, was wir schon hatten. Was wir suchten, waren vor allem verlässliche Strukturen; das Außerordentliche blieb uns fremd. Wir konnten die Dinge anordnen, wenn sie uns jemand hinschmiss, wir konnten anderen Nationen beibringen, wie man Müll trennte und von den Straßen und Wiesen fernhielt – aber wir konnten nicht jonglieren, nicht vor Publikum improvisieren, nichts auf spielerische Weise entwickeln.
Über das erfolgreiche deutsche Ingenieurswesen ging Freisler hinweg, wenn er so dozierte, er zielte auf den kommunikativen Bereich ab, auf den täglichen Umgang miteinander, auch auf die Künste. Gern und oft zitierte er Zeilen von Robert Frost, das Gleichnis vom Pionier, der im Wald von zwei Wegen den weniger ausgetretenen eingeschlagen hatte. And that has made all the difference. Freisler zeigte mir auf, was mich erwartete, wenn ich weiterhin auf dem breiten Weg bliebe: mehr Licht, weniger Gegenverkehr, keinerlei Überraschungen.
Der schmalere Weg aber führte in den Wald, wurde immer nur schmaler; von Zweigen überdacht, würde auch ich irgendwann zwischen den Blättern die neue Sonne am Himmel leuchten sehen. Das ist immer noch Freisler, beinahe O-Ton. Die neue Sonne hieß für ihn Internet.
Das Netz habe uns eine neue Generation gebracht und mit ihr die Chance, Menschen zu erziehen, die netzartig dachten, freier, ungezähmter. Das Erzählen, sagte der junge Lehrer, stelle Denkstrukturen nach, oder ehrlicher noch, es stelle sie überhaupt dar. Und es entstünden neue Denkstrukturen, da sei er sich ganz sicher. Wir könnten jetzt zu den Amerikanern aufschließen, in kreativer Hinsicht.
In seinen erregten Momenten wurde Freisler manchmal zur Karikatur, wie ja auch der schmale Waldpfad nicht recht zur neuen Sonne passen wollte, aber das sah ich damals nicht, oder ich sah darüber hinweg, und was waren Momente des Zweifels gegen die Mittel und Formate der digitalen Welt, gegen die Chance, die Schüler auf diesem Wege wieder zu erreichen.
Ich war schon lange nicht mehr glücklich gewesen mit meinem Unterricht.
Bald darauf stand ich mit einigen Jungen und Mädchen in der Pausenhalle, es gab ja keinen Grund, dort wegzugehen. Irgendeiner von ihnen brachte mir zu Beginn der großen Pause einen Milchkaffee, oder ich brachte den Schülern welchen mit. Es war ein bizarrer Standort, er lag auf dem untersten Niveau der Halle, so tief, dass er keine Aussicht zuließ, im Gegenteil, er war einsichtig von allen Seiten, eine Angriffsfläche für Blicke, für Hohn und Häme, die in den folgenden Jahren über mir und den zu mir stehenden Schülern ausgeschüttet wurden.
Max, Saskia, Ying, Clarissa und die anderen, die jetzt Abitur gemacht hatten, unterrichtete ich seit ihrem zehnten Schuljahr in Englisch. Ich erinnere mich, dass mir anfangs nicht wohl dabei war, als sie mich umringten. Mit mir dazustehen hieß, sich abzusondern, da machte ich mir nichts vor. Das Gerede des eigenen Jahrgangs zu überhören, ohne arrogant zu werden – das war für die Kinder eine ständige Prüfung, und meine Verantwortung erhöhte es auch. Ich achtete vor allem darauf, dass unser Kreis offen blieb. Die einzige Regel lautete: Wer hinzukommt, ist dabei. Ein paar Zwölftklässler gehörten auch zur Gruppe, nicht halbherzig, aber doch weniger verbindlich als die Jüngeren. In der elften Klasse wählten Max, Clarissa und Ying meinen Musikkurs, unser Kontakt verfestigte sich.
Ich hatte nie bloß frontal unterrichtet, ich will meine Rolle nicht herunterspielen. Aber wie gesagt, einige Lorbeeren hätten Freisler gebührt. Ein paar Jahre zuvor hatte ich Schüler gepiesackt, die kein Interesse an Fuge oder Kontrapunkt zeigten. Nun kritisierte ich solche, die sich ohne eigene Einbildungskraft ausbilden lassen wollten und allein für Prüfungspunkte paukten. Die Schüler, die Freisler noch gekannt hatten, wussten um dessen Einfluss auf meinen Sinneswandel. Kein Lehrer nahm das Netz so ernst wie ich.
Um meinen Rechner mit Software auszustatten, kamen erstmals zwei Schüler zu mir ins Bauernhaus. Marianne war bereits bettlägerig. Wir sprachen damals oft darüber, dass ich Gesellschaft brauchte, und doch war sie immer über meine Bedürfnisse hinweggegangen. Wenn ihr in der Krankheit überhaupt irgendetwas heilig war, dann ihre Ruhe, die sie unsere Privatsphäre nannte. Sie hatte mir vor Jahren die Hälfte des Hauses übertragen, aber es war eben doch ihres geblieben, und so brachten mir zwei Schüler und eine Computerinstallation die schwersten Vorwürfe ein; sie sagte, indem ich gegen ihren Willen Besuch empfinge, behandelte ich sie bereits wie eine Tote.
Ich nahm Kaffee und einen Krug Zitronenwasser mit in den Garten, um die Hundstage zu begrüßen. Der Wetterbericht hatte eine Hitzewelle vorausgesagt. Halb acht, die Sonne stand erstaunlich hoch. Der Rechner zugeklappt auf dem Tisch unter der Weide. Ich wischte über das Gehäuse, es war nicht feucht. Marianne hatte mich oft arglos genannt. Nicht der Tau wäre ihre Sorge gewesen, aber niemals hätte sie etwas Wertvolles über Nacht draußen stehenlassen. Weltvertrauen, meine Frau hatte es einst besessen, aber es war ihr verschüttgegangen. Die Angst war seine Kehrseite. Solange man geistig dazu in der Lage war, musste man sich da nicht wehren gegen die politisch wie medial geschürte Paranoia, diese Wachturmmentalität? Ich war ungerecht. Marianne suchte den Geschwüren in ihrem Körper etwas gegenüberzustellen, sie hatte am Ende unter Todesangst gelitten. Angst vor den Menschen, vor Dieben und Verbrechern. Es stimmte und konnte nicht stimmen, das Leben, das sie gelebt hatte, sprach dagegen, es war widersinnig und schwer mit anzuhören gewesen.
– Weltvertrauen!
Ich rief das Wort hinaus in die Morgenluft unseres Gartens. Die Türen offen, der Rechner draußen. Ich machte ein paar Übungen, die ich in einem Qigong-Kurs erlernt hatte, aber schon lange nicht mehr korrekt ausführte.
Ich lächelte vor mich hin, die Übungen waren lächelnd durchzuführen. Von Vertrauen war leicht reden hier auf dem Dorf, wo die Leute für sich sein wollten. Kaum jemand käme auf die Idee, das Grundstück eines anderen zu betreten, ohne um Erlaubnis gefragt zu haben. Vielleicht hatte mancher sogar ein Gewehr hinter der Haustür stehen, das er abends unters Bett legte. Wir waren so etwas wie der Mittlere Westen von Deutschland. Die Hunde schlugen schnell an. Das war Mariannes Stimme. Oho, feierte sie, ohoooo, du und Weltvertrauen.
Heute würde ich den Hund von Beckers in Pflege nehmen, sonst hatte ich nichts vor. Das Qigong bestärkte mich darin, möglichst wenig geschehen zu lassen. Nachzudenken. Zeuge zu sein, wie etwas sackte, in mich einsackte. Lächelnd. Nicht schon im Kaffeesatz lesen. Vielleicht die Werkstatt auf dem Dachboden herrichten. Mehr nicht für heute, für morgen, für die gesamten Sommerferien. Der Ablauf der kommenden Tage durfte sich gleichen, er glich sich doch zu Schulzeiten auch.
Ich trank meinen Kaffee und zog die Halme, die zwischen den Betonplatten hervorsprossen, mit den nackten Zehen heraus. Ich hätte nicht mehr sagen können, wann ich den Rechner eingeschaltet hatte. Unbedacht, bedenkenlos, so machten es auch die Kinder.
Das Backhaus stand recht weit vom Haupthaus entfernt, man musste sich durch einen Parcours aus Birken und Weiden schlängeln, deren Äste und Zweige fast bis zum Boden reichten. Ich beschnitt die Weiden nicht mehr. Die Haarpracht des letzten Baumes, er stand eigentlich viel zu nah am Gebäude, zerteilte ich zum Mittelscheitel, um den direkten Weg zum Eingang zu nehmen.
Das Backhaus duftete nach Holz und Vinyl und schlafendem Staub. Sein Name stammte aus der Zeit, da hier für das gesamte Dorf gebacken worden war. Das Gebäude hatte eine fast quadratische Grundfläche; um die Fußleisten der vier Wände zog sich die Schallplattenraupe. Später war ein Mittelwall entstanden, irgendwann ein zweiter. Um auf die andere Seite zu gelangen, wo die Abhörstation mit den schmalen mannshohen Boxen stand, musste man zweimal einen großen Schritt tun. Und damit waren noch lange nicht alle Platten erfasst – auf den Querbalken des Dachgestühls standen wie auf einer Galerie reihum noch einmal knapp achthundert Alben, die ich kaum noch auflegte. Eine große Holzleiter lehnte an der Wand, die hatte ich seit Monaten nicht ausgeklappt.
Ich würde all diese Schallplatten bald verkaufen müssen, wenn ich das gesamte Anwesen halten wollte. Die Alternative war, die westliche Abseite des Haupthauses zu vermieten. Das konnte ich Marianne eigentlich nicht antun. Hier im Kapuzenpullover stehend, mit nackten Füßen im stillen Halbdunkel, wurde ich vom Backhaus noch immer überwältigt wie ein Erfinder. Ich konnte mich dieser geordneten Pracht und Macht der Töne nicht entziehen. Als gäbe es keine Lücken in meiner Sammlung, strahlte sie eine vollkommene Stabilität aus: Hier konnte nichts umfallen, nichts wegrutschen, die Platten übten Druck auf die Wände und die Balken aus, nicht umgekehrt. Sie waren der Brustkorb des Backhauses, die Mittelgänge seine Rippen.
Meine Klassikabteilung war eher schmal, dafür hatte ich in den Achtzigern viel Rock und Punk gekauft, später immer mehr Country, etwas Blues. Ich besaß bestimmt dreihundert Bootlegs, darunter absolute Raritäten. Nur amerikanische und karibische Folkmusic besorgte ich mir bis heute, allerdings unter der Auflage, höchstens zwei Platten im Monat zu kaufen. Innerhalb der einzelnen Abteilungen ordnete ich alphabetisch. Von Acuff, Bright Eyes, Cash, Drake und Dylan hin zu Waits, Williams und Van Zandt. Über den Boxen hing in großen Buchstaben ein Satz aus Twin Peaks, der auf die Titelmelodie anspielte: How many times have I asked you not to disturb the guests with this record. Die Schüler hatten das aufgehängt, mir gefiel der Trotz, auch wenn er meinem Musikhören heute nicht mehr vorausging.
Ich war mir sicher gewesen, dass vor dem Plattenspieler herumliegen würde, was Clarissa sich am vorigen Tag angehört hatte, sah mich aber getäuscht. Nur in der linken Bodenreihe war ein Album herausgezogen oder nicht sorgfältig zurückgesteckt worden. Das Cover ragte in den Raum. Eine andere Schülerin hatte einmal erzählt, dass ihr Vater zu Hause mit ihr kommuniziere, indem er Bücher, die sie lesen sollte, nicht herauslegte, sondern in seiner Bibliothek nur ein kleines Stück aus dem Regal zog.
Clarissa bot mir Mahlers Vertonungen der Kindertodtenlieder an. Eines davon war auf Merets Beerdigung vorgelesen worden, aber die lag nun ein halbes Jahr zurück. Ich nahm die Plattenhülle zur Hand, darauf die Anmerkung, Rückert habe mehr als vierhundert Gedichte auf seine verstorbenen Kinder verfasst. Die vertonten Gedichte waren abgedruckt. Oft denk ich, sie sind nur ausgegangen. Bald werden sie wieder nach Haus gelangen. Der Tod des Mädchens und die Urlaubstour seiner ehemaligen Mitschüler, hier überschnitten sich zwei Kreise; ich konnte mir vorstellen, dass Clarissa über diesen Zeilen die Tränen gekommen waren.