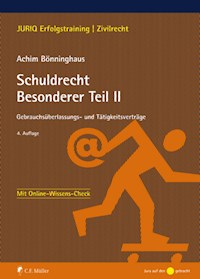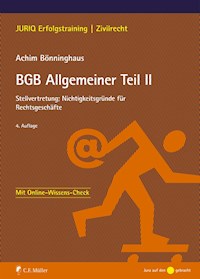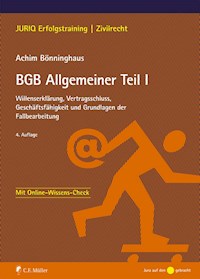
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Inhalt: Das Skript vermittelt im ersten Teil zunächst die Grundlagen der zivilrechtlichen Fallbearbeitung und erleichtert so die optimale Umsetzung der anschließend dargestellten Rechtsthemen in einer Klausur. Anschließend werden die Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften, der im Zivilrecht zentrale Begriff der Willenserklärung (Elemente, Abgrenzung, Zustandekommen, Abgabe, Zugang, Auslegung, Wirksamkeitshindernisse usw.) sowie das Zustandekommen von Verträgen (Antrag, Annahme, Einigungsmängel usw.) besprochen. Die Neuauflage behandelt zudem in einem eigenen Teil die Geschäftsfähigkeit. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
BGB Allgemeiner Teil I
Willenserklärung, Vertragsabschluss, Geschäftsfähigkeitund Grundlagen der Fallbearbeitung
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-7767-4
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2018 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript ist der erste Teil von zwei Bänden, die dem Allgemeinen Teil des BGB gewidmet sind. Der Allgemeine Teil des BGB beschäftigt sich mit einer Fülle zivilrechtlicher Grundfragen, denen im Examen wie in der Praxis überragende Bedeutung zukommt. Allerdings hat der Gesetzgeber den Stoff nicht unter Examensgesichtspunkten geordnet, sondern andere Gliederungsprinzipien walten lassen. Aber welche Vorschrift des Allgemeinen Teils muss denn nun in einer Klausur wo angesprochen und geprüft werden? Es gehört zu meinen täglichen Beobachtungen als Repetitor im Zivilrecht, dass der Transfer der abstrakten Grundregeln des Allgemeinen Teils in die gutachterliche Fallbearbeitung erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Insbesondere Aufbaufragen bereiten nicht nur den Anfängern mit Recht großes Kopfzerbrechen. Das Anliegen dieser Skriptenreihe besteht deshalb darin, den Stoff möglichst so aufzubereiten, wie er in einer Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen orientiert, gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung folgt daher den gedanklichen Schritten im Rahmen einer Klausurprüfung und nicht der Gliederung des Gesetzgebers. Das Skript will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden stets von den Tatbeständen aus behandelt, die in der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen erleichtern naturgemäß das Verständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Zu diesem Ansatz gehört es auch, viele Regeln des Allgemeinen Teils anderen Sachzusammenhängen zuzuordnen, in denen sie sich besser erfassen lassen und in der Klausur behandelt werden. So werden zum Beispiel die Bestimmungen zu Verbrauchern und Unternehmern (§§ 13, 14) im Allgemeine Schuldrecht im Zusammenhang mit den Regelungen über Verbraucherverträge behandelt, die Regeln über Verein und Stiftung in den §§ 21 ff. BGB gehören in die Darstellung des Gesellschaftsrechts und die Regeln über Sachen und Tiere in den §§ 90–103 BGB in die Skripte zum Sachenrecht. Dieses Skript beschäftigt sich mit den Grundlagen der Rechtsgeschäftslehre und behandelt ausführlich die Willenserklärung und den Vertragsschluss. Hinzugekommen ist aus Platzgründen seit der 3. Auflage die Darstellung der Geschäftsfähigkeit, die vorher im zweiten Band BGB Allgemeiner Teil II integriert war. Außerdem erschien es mir sinnvoll, den ersten Band der Skripte zum Zivilrecht mit einer Einführung in die Grundlagen der Anspruchsprüfung und Grundfragen der zivilrechtlichen Fallbearbeitung zu beginnen.
Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs ist. Die Brisanz der „Allgemeinen Themen“ bleibt bis zum Examen erhalten und hat sich keineswegs in den unteren Semestern „erledigt“.
Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann ein Skript auch gar nicht leisten. Betrachten Sie die Fußnoten eher als persönliche Leseempfehlungen. Oft wird auf den „Palandt“ verwiesen, da er in Referendariat und Praxis eine überragende Bedeutung hat. Ich empfehle Ihnen daher, dieses Werk frühzeitig zu nutzen und sich an die abgekürzte Schreibweise zu gewöhnen. Das gilt übrigens auch für die zitierte BGH-Rechtsprechung. Ich würde mich freuen, wenn Sie einige der zitierten Entscheidungen durcharbeiten[1]. Urteile gehören in vielen Bereichen faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Außerdem sind die Begründungen meistens so gut formuliert, dass sie zugleich der Wiederholung von bestimmten Themen dienen können.
Bei der Neuauflage habe ich viele Zuschriften verarbeiten können, für die ich mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte. Indem ich die Institute Geschäftsfähigkeit und Stellvertretung nicht nur im Zusammenhang mit der Willenserklärung und dem Vertragsschluss, sondern auch in einer geschlossenen Einheit dargestellt habe, mag es hier und da zu Wiederholungen kommen. Diese sind durchaus gewünscht und tragen hoffentlich zum besseren Verständnis und Behalten bei. Weitere Anregungen sind immer willkommen.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser [email protected].
Frankfurt am Main, im August 2018
Achim Bönninghaus
Anmerkungen
Die in diesem Skript in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 55, 191, 286, 415
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. Teil„Ein Rundflug“
A.Sinn und Zweck eines juristischen Gutachtens
B.Wie geht das?
I.Erfassen des Sachverhalts
II.Gliederung
III.Auffinden der Anspruchsgrundlage
IV.Prüfungsreihenfolge der Anspruchsgrundlagen
1.Hauptgliederung
2.Untergliederungen
a)Primäransprüche vor Sekundäransprüchen
b)Unmittelbare Ansprüche vor abgeleiteten Ansprüchen
c)Unmittelbare Haftung vor abgeleiteter Haftung
d)Verschuldensunabhängigkeit vor Verschuldensabhängigkeit
e)Tatbestandliche Logik
V.Darstellung aller Anspruchsgrundlagen im Gutachten?
VI.Die Anspruchsprüfung
1.Anspruch entstanden?
a)Rechtsfähigkeit der Beteiligten
b)Die Anspruchsvoraussetzungen
c)Rechtshindernde Einwendungen
2.Anspruch erloschen?
3.Anspruch durchsetzbar?
a)Fälligkeit
b)Einreden
C.Wie schreibe ich es auf?
I.Gesetz ernst nehmen
II.System abbilden
III.Präzision im Ausdruck/Exakte Zitierweise
IV.Übersichtliche Struktur
V.Obersatz und Ergebnis
VI.Keine logischen Widersprüche
VII.Richtig wichtig
VIII.Keine „Wissensleier“
IX.„Nagelprobe“
X.Auswertung der „Musterlösung“
2. TeilDie Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
A.Rechtsgeschäft und Privatautonomie
B.Definition des Rechtsgeschäfts
I.Willenserklärung
II.Zusätzliche Elemente
1.Weitere Willenserklärung(en)
2.Sonstige Erfordernisse
III.Abgrenzungen
1.Geschäftsähnliche Handlung
2.Realakte
C.Einteilung von Rechtsgeschäften
I.Einseitige und mehrseitige Rechtsgeschäfte
II.Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte
1.Verpflichtungsgeschäfte
2.Verfügungsgeschäfte
3.Hintergrund: Trennungs- und Abstraktionsprinzip
III.Entgeltliche und unentgeltliche Rechtsgeschäfte
IV.Kausale und abstrakte Rechtsgeschäfte
D.Aufbau von Rechtsgeschäften
I.Zustandekommen von Rechtsgeschäften durch wirksame Willenserklärung(en)
1.Einseitige Rechtsgeschäfte
2.Verträge
II.Wirksamkeitserfordernisse von Rechtsgeschäften
III.Wirksamkeitshindernisse bei Rechtsgeschäften
3. TeilDie Willenserklärung
A.Überblick
I.Begriff
II.Elemente einer Willenserklärung
1.Subjektiver Tatbestand: der Wille
a)Handlungswille
b)Erklärungsbewusstsein, Rechtsbindungswille
c)Geschäftswille
2.Objektiver Tatbestand: Erklärung eines Geschäftswillens
III.Notwendigkeit der Auslegung
IV.Prüfungsreihenfolge
B.Die Abgabe einer Willenserklärung
I.Abgabetatbestand
1.Empfangsbedürftige und nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen
2.Abgabe einer nicht empfangsbedürftigen Willenserklärung
3.Abgabe einer empfangsbedürftigen Willenserklärung
II.Abgabe bei zufälliger Kenntnisnahme?
III.Auswirkungen fehlenden Handlungswillens
IV.Sonderfall: „Abhandengekommene“ Willenserklärung
C.Zugang (bei Empfangsbedürftigkeit)
I.Empfangsbedürftigkeit der Willenserklärung
II.Zugang bei Abgabe unter Abwesenden, § 130 Abs. 1 S. 1
1.Abgabe unter Abwesenden
2.Grundregeln für den Zugang
a)Zugang durch Kenntnisnahme
b)Zugang vor oder sogar ohne Kenntnisnahme
3.Zustellungshindernisse und Treuwidrigkeit des Erklärenden
4.Verständnisprobleme des Empfängers
5.Zugangsvereitelung durch den Empfänger
a)Grundsatz der Rechtzeitigkeitsfiktion
b)Zugangsfiktion bei vorsätzlicher oder grundloser Zugangsvereitelung
6.Übungsfall Nr. 1
III.Zugang bei Abgabe unter Anwesenden
1.Abgabe unter Anwesenden
2.Gespeicherte Willenserklärungen
3.Übungsfall Nr. 2
4.Nicht gespeicherte Willenserklärungen
IV.Hilfspersonen beim Zugang
1.Zugang bei Auftreten eines Empfangsvertreters
a)Der Empfangsvertreter
b)Zugangsregeln
c)Empfangsvertretung ohne Vertretungsmacht
2.Zugang bei Auftreten eines Empfangsbotens
a)Empfangsbote und Erklärungsbote
b)Zugangsregeln
3.Übungsfall Nr. 3
V.Zugang bei Geschäftsunfähigkeit des Adressaten, § 131 Abs. 1
1.Geschäftsunfähigkeit des Adressaten
2.Wirkung des § 131 Abs. 1
VI.Zugang bei beschränkter Geschäftsfähigkeit des Adressaten, § 131 Abs. 2
1.Beschränkte Geschäftsfähigkeit des Adressaten
2.Wirkung des § 131 Abs. 2
a)Grundregel
b)Ausnahmen nach § 131 Abs. 2 S. 2
3.Verhältnis von § 131 Abs. 2 zu § 108 Abs. 1
D.Die Auslegung
I.Der Ausgangspunkt im Gutachten
II.Die Auslegungsregeln
1.Auslegung empfangsbedürftiger Willenserklärungen, §§ 133, 157
a)Grundregel
b)Sonderfall: Falsa demonstratio
2.Auslegung nicht empfangsbedürftiger Willenserklärungen, § 133
III.Schweigen als Willenserklärung
1.Tatbestand des Schweigens
2.Ausnahme: Schweigen mit Erklärungswert
a)Erklärungswert kraft Gesetzes
b)Erklärungswert kraft vertraglicher Vereinbarung
c)Schweigen auf kaufmännisches Bestätigungsschreiben
E.Nichtigkeitsgründe in Bezug auf Willenserklärungen
I.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden, § 105 Abs. 1
1.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden
2.Wirkung des § 105 Abs. 1
II.Vorübergehende Störung der Geistestätigkeit, § 105 Abs. 2
1.Voraussetzungen
2.Wirkung des § 105 Abs. 2
III.Tatbestände der §§ 116–118
1.Willensvorbehalt, § 116
2.Scheingeschäft, § 117
3.Scherzerklärung, § 118
IV.(Schuldlos) Unerkannt fehlendes Erklärungsbewusstsein
1.Schritt: Auslegung
2.Schritt: „Lehre vom potentiellen Erklärungsbewusstsein“
3.Übungsfall Nr. 4
V.Widerruf, § 130 Abs. 1 S. 2
4. TeilDas Zustandekommen von Verträgen
A.Überblick
I.Vertrag als Anspruchsgrundlage
II.Verträge als Instrument der Verfügung über Rechte
III.Definition
B.Der Antrag (§ 145)
I.Abgabe und Zugang des Antrags
II.Auslegung
1.Abgrenzung zum einseitigen Rechtsgeschäft
2.Abgrenzung zur invitatio ad offerendum
3.Abgrenzung zum Gefälligkeitsverhältnis
III.Mindestinhalt: „essentialia negotii“
1.Beteiligte Personen
2.Vertragsgegenstand
a)Begründung eines Schuldverhältnisses
b)Verfügung über ein Recht
3.Genauigkeit
C.Die Annahme
I.Regelfall
II.Annahme nach § 151
III.Übungsfall Nr. 5
IV.Sonderfall: Zuschlag gem. § 156
D.Bestand des Angebots zum Zeitpunkt der Annahme
I.Erlöschen des Angebots nach § 146
1.Ablehnung
2.Fristablauf und ähnliche Erlöschensgründe
II.Fälle des §§ 153
III.Fälle des § 156 S. 2
E.Der Einigungsmangel (Dissens)
I.Der offene Einigungsmangel, § 154
II.Der versteckte Einigungsmangel, § 155
1.Formen des versteckten Einigungsmangels
2.Abgrenzungsfragen
a)Irrtum i.S.d. § 119 Abs. 1
b)Abgrenzung zur „falsa demonstratio“
3.Folgen des versteckten Einigungsmangels
5. TeilGeschäftsfähigkeit
A.Überblick
I.Funktion der Regeln zur Geschäftsfähigkeit
II.Geschäftsunfähigkeit und beschränkte Geschäftsfähigkeit
1.Geschäftsunfähigkeit
a)Altersabhängige Geschäftsunfähigkeit
b)Altersunabhängige Geschäftsunfähigkeit
2.Beschränkte Geschäftsfähigkeit
a)Minderjährige nach Vollendung des 7. Lebensjahres
b)Volljährige Personen unter Betreuungsvorbehalt, § 1903
III.Die gesetzlichen Vertreter
1.Vertretungsberechtigte Personen
a)Vertretung Minderjähriger
b)Vertretung volljähriger, nicht voll geschäftsfähiger Personen
2.Ausübung gemeinschaftlicher Vertretungsmacht der Eltern
3.Beschränkungen der Vertretungsmacht
a)Vertretungsverbote
b)Genehmigungsvorbehalte
B.Wirkungen der Geschäftsunfähigkeit
I.Geschäftsunfähigkeit des Erklärenden (§ 105 Abs. 1)
II.Geschäftsunfähigkeit des Erklärungsempfängers (§ 131 Abs. 1)
III.Sonderfall des § 105a
1.Tatbestandsvoraussetzungen
a)Vertragsschluss eines volljährigen Geschäftsunfähigen
b)Geschäft des täglichen Lebens
c)Geringwertige Mittel
d)Bewirken von Leistung und ggf. vereinbarter Gegenleistung
e)Ausnahmetatbestand (§ 105a S. 2)
2.Rechtsfolgen
a)Grundsatz
b)Sonderfall: Mangelhafte Leistung
C.Verträge mit beschränkt Geschäftsfähigen (§§ 107, 108)
I.Wirkung der §§ 107, 108
II.Einwilligungsvorbehalt, § 107 (§ 1903 Abs. 3)
1.Rechtlich vorteilhafte Geschäfte
2.Korrekturen
a)Wirtschaftlich generell „ungefährliche“ rechtliche Nachteile
b)Neutrale Geschäfte
3.Übungsfall Nr. 6
III.Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, §§ 107, 182, 183
1.Rechtsnatur
2.Umfang
3.Übungsfall Nr. 7
4.Sonderfall: § 110
a)Funktion des § 110
b)Tatbestand
5.Übungsfall Nr. 8
6.Sonderfälle der §§ 112, 113
a)Fall des § 112: Selbstständiger Betrieb eines Erwerbsgeschäfts
b)Fall des § 113: Eingehung eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
IV.Genehmigung des gesetzlichen Vertreters, §§ 108, 182, 184
1.Genehmigungssystem des § 108
2.Übungsfall Nr. 9
D.Einseitige Rechtsgeschäfte mit beschränkt Geschäftsfähigen
I.Einseitiges Rechtsgeschäft durch beschränkt Geschäftsfähigen, § 111
1.Grundregel der §§ 107, 111
2.Fall des § 111 S. 2
II.Einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber beschränkt Geschäftsfähigen, § 131 Abs. 2
1.Allgemeine Regel des § 131 Abs. 2
2.Sondertatbestand des § 109 Abs. 1 S. 2
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Brox, Hans/Walker, Wolf-Dietrich
Allgemeiner Teil des BGB, 41. Aufl. 2017
Faust, Florian
Bürgerliches Gesetzbuch Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2018
Leenen, Detlef
BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre, 2. Aufl. 2015
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 26. Aufl. 2017
Münchener Kommentar zumBürgerlichen Gesetzbuch
Band 1 (Allgemeiner Teil), 7. Aufl. 2015(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Palandt, Otto
Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl. 2018 (zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 1Lernprozesse und Lernmotivation
Gerade beim Lernen setzen wir uns schnell unter hohen Leistungsdruck, haben hohe Erwartungen an uns. Das Ziel, also die Prüfung, ist weit entfernt, wir sehen häufig nicht, was wir schon erreicht haben, sondern nur das, was wir noch nicht geschafft haben – gemessen an der noch großen Distanz bis zum Ziel „Examen“. Es dauert häufig viele Wochen bis Monate bis wir eine Rückmeldung in Form einer Zensur erhalten. Das fördert leider nicht unsere unmittelbare Lernmotivation und unser aktuelles Lernverhalten.
Unser Gehirn lernt durch Erfolge und durch Misserfolge und möchte gerade in unangenehmen Stresssituationen (langweiliger Stoff, Leistungsdruck) „pfleglich“ behandelt werden. Durch positive Rückmeldungen, Anerkennung und Belohnungen werden wir darin bekräftigt, bestimmte Tätigkeiten weiter (intensiver, besser) auszuüben. Diesen Umstand können Sie nutzen.
Durch entsprechende Zielsetzungs-, Feedback- und Verstärkungsmechanismen kann man sich motivieren bzw. auch neu eingeübte Lernprozesse verstärken. Sie können Lernfortschritte und Erfolge auch nach kurzen Lernphasen und Zeitabschnitten deutlicher wahrnehmen.
Lerntipps
Planen Sie herausfordernde aber realistische Ziele!
Ein Ziel befindet sich am Ende eines Weges. Am besten Sie planen Etappenziele. Stellen Sie sich z. B. vor, was genau Sie nach vier Wochen, einer Woche, an diesem Tag, bis zur ersten Pause erreicht haben wollen. Fragen Sie sich, woran Sie Ihr erfolgreiches Lernen festmachen wollen. Und wie Sie den Erfolg überprüfen (lassen) wollen. Setzen Sie sich klare, anspruchsvolle aber realistische Lernziele anhand eines individuellen Lernplanes. Fordern Sie sich ruhig (positiver leistungsförderlicher Stress), aber erzeugen Sie keinen zu hohen Erwartungsdruck und damit so genannten leistungshemmenden Dis-Stress. Nutzen Sie einen Wochenplaner – mit Stundenplan wie in der Schule – und machen Sie sich eine Tagesplanung einschließlich Pausen, Freizeitaktivitäten, Haushalt etc.
Setzen Sie sich positive Anreize!
Da Sie sich gut kennen, werden Sie recht leicht eigene Vorstellungen zur Belohnung entwickeln. Sie können sich materiell verstärken, z. B. mit dem Download eines neuen Songs oder dem Kauf neuer Schuhe, die Sie schon immer haben wollten. Da diese Art von Verstärkern schnell an finanzielle Grenzen stoßen können, sollten Sie sie für besondere Gelegenheiten nutzen. Andere Verstärker können Lesen, Fernsehen, Klavier spielen, Musik hören, ein Nickerchen, der Kneipenbesuch, das Kino, Sport und sogar der ungeliebte Abwasch sein. Machen Sie doch erst einmal eine Ideensammlung, welche Verstärker für Sie attraktiv sein könnten.
Körperliche Betätigung ist ein optimaler Verstärker!
Körperliche Aktivitäten sind für Lernende eine optimale Verstärkungsmöglichkeit. Als Ausgleich zum langen Sitzen braucht es in besonderem Maße Bewegung. Bewegung ist dann Abwechslung, Erholung und Ausgleich. Wenn Sie sich körperlich bewegen, wird einerseits das Stresshormon Adrenalin abgebaut, andererseits wird das „Glückshormon“ Serotonin verstärkt ausgeschüttet. Sportliche Betätigung führt zu körperlicher Ermüdung und fördert einen besseren Schlaf.
Belohnen Sie sich mit Konzept!
Mit Ihren Verstärkern und Belohnungen sollten Sie am besten abwechslungsreich und erfinderisch sein. Es sollte kleine und größere Belohnungen geben, gemessen an dem Anspruchsniveau der Zielsetzungen oder der Dauer der Lernphasen. Hier orientieren Sie sich an der Zielplanung. Das Anspruchsniveau ist ganz individuell zu betrachten. Die Belohnungen sollten direkt nach Zielerreichung erfolgen können, also z. B. nach eineinhalb Stunden, fünf geschriebenen Seiten, sieben bearbeiteten Fällen, am Ende eines erfolgreichen Tages.
Überprüfen Sie Ihren Erfolg und verhalten Sie sich konsequent!
Ist das angestrebte Ziel erreicht, muss sofort die Belohnung eingetauscht werden, damit das Gehirn den Zusammenhang zwischen Zielerreichung in der Sache und gutem Gefühl abspeichert. Ist das Ziel nicht erreicht, dann darf es keine Belohnung geben. Es ist dann wichtig, sich genauer damit zu beschäftigen, warum Sie das Ziel nicht erreicht haben. Dadurch nehmen Sie eine Analyse vor, aus der Sie die erforderlichen Veränderungen ableiten können.
Keine Belohnung – was dann?
Falls Sie sich über längere Zeit (mehrere Tage) nicht mehr belohnen konnten, dann sollten Sie eine Analyse vornehmen. Wahrscheinlich werden Sie sehr schnell merken, an welchen Stellen Schwächen oder Stärken Ihres Lernsystems zu finden sind. Die Analyse sollte sich sachlich an Ihrem Lernsystem und auch an Ihrem Lernverhalten orientieren. Es sollte keine „persönliche Selbstgeißelung“ sein. Das setzt Ihr Gehirn unter negativen emotionalen Stress, und das können Sie beim Lernen und in der Phase der Prüfungsvorbereitung am wenigsten gebrauchen.
Reflektieren Sie Ihr Lernverhalten bei Misserfolg!
Eine Kurzanalyse und Reflexion soll Ansatzpunkte für mögliche Veränderungen liefern. Dafür einige Leitfragen:
•
Ist mein eigener Leistungsanspruch zu hoch?
•
Habe ich insgesamt (zeitmäßig) zu wenig gearbeitet?
•
Zuviel an Ablenkung?
•
Wie habe ich es geschafft, das Lernen zu vermeiden?
•
Nehme ich mein Lernen ernst genug?
•
Mache ich es mir zu bequem?
•
Mangelnde Konsequenz in der Planung und im Einhalten des Lernpensums, der Belohnung?
•
Bin ich zu großzügig im Belohnen?
•
Gab es unerwartete Ereignisse, die mich behindert haben?
•
Habe ich zuviel gearbeitet? Warum?
•
Bin ich zu erschöpft? Woran liegt das?
•
Habe ich zu wenig behalten und verstanden trotz vieler Arbeit?
•
Ist der Stoff zu schwer?
•
Gab es (emotional) hemmende Gründe (in der Familie, bei Freunden, wegen Geldsorgen)?
•
Wer oder was könnte mir bei Schwierigkeiten helfen?
Erkennen Sie Ihr persönliches Vermeidungsverhalten!
Sie kennen das vielleicht: Bevor es mit dem Lernen losgeht – Zeitung lesen, noch einmal zur Toilette gehen, Blumen gießen, etwas aus dem Kühlschrank holen, noch schnell etwas einkaufen gehen . . . Wir versuchen unangenehme Tätigkeiten vor uns her zu schieben. Hierdurch vermeiden wir, uns in eine vermeintlich aversive Situation zu begeben. Durch das Vermeidungsverhalten entziehen wir uns der Arbeit und belohnen uns für Verzögerungen. Das hat zur Folge, dass wir lernen, die primär angestrebte Tätigkeit immer öfter zu vermeiden. Betrachten Sie Ihr Vermeidungsverhalten und seine Auswirkungen einmal genauer! Kurzfristig hilft es, vermeintlichen Stress (Aversion) abzubauen, langfristig kann das Ganze Ihnen wirklich über den Kopf wachsen.
Bauen Sie Vermeidungsverhalten Schritt für Schritt ab!
Der riesige Berg an Arbeit, der vor uns liegt, lässt uns häufig ausweichen. Man geht Dinge nicht an, weil man die Befürchtung hat, den Überblick zu verlieren oder sie insgesamt nicht bewältigen zu können („Wie soll ich das denn alles schaffen?“). Hier entsteht negativer Stress für unser Gehirn. Damit ist Vermeidungsverhalten erst einmal (emotional) vernünftig. Nur in der Sache kommen Sie nicht weiter.
Folgende Tipps können weiterhelfen:
•
Bei Lernproblemen das Pensum anfänglich bewusst reduzieren.
•
Den Lernstoff in für Sie überschaubare Lerneinheiten portionieren.
•
Die einzelnen Lerneinheiten in angenehme Mengen- und Zeiteinheiten unterteilen.
•
Besonders angenehme Anfangstätigkeiten finden.
•
Strenge Disziplin, d. h. striktes, selbst auferlegtes Verbot von Vermeidungsverhalten.
•
Sitzen bleiben. Wenn Sie nicht mit der Arbeit beginnen können, notieren, was Sie eigentlich arbeiten wollen, was Ihnen schwierig erscheint, welche Aspekte behindern, welche vielleicht sogar Freude machen könnten.
1. Teil„Ein Rundflug“
A.Sinn und Zweck eines juristischen Gutachtens
B.Wie geht das?
C.Wie schreibe ich es auf?
1
Bevor wir mit der eigentlichen Erarbeitung der Fragen rund um das Zustandekommen von Rechtsgeschäften beginnen, möchte ich mit Ihnen einen kurzen Rundflug über das anspruchsvolle Gebiet der zivilrechtlichen Fallbearbeitung unternehmen. Dieser Ausflug soll Ihnen eine allgemeine Orientierung bei der Bearbeitung zivilrechtlicher Klausuren bieten. Insofern reichen die folgenden Ausführungen weit über das Thema dieses Skripts hinaus. Sie passen aber gut hierher, weil sich dieses Skript mit einem allgemeinen Grundlagenthema, der Rechtsgeschäftslehre, beschäftigt. Außerdem soll Ihnen die mit unserem Ausflug verbundene Horizonterweiterung helfen, die herausragende Bedeutung der Rechtsgeschäftslehre in der zivilrechtlichen Fallbearbeitung zu erkennen. Um diesen Zusammenhang hervorzuheben und die Wiedererkennung zu vereinfachen, ist der Begriff „Rechtsgeschäft“ in diesem Abschnitt stets fett markiert.
1. Teil „Ein Rundflug“ › A. Sinn und Zweck eines juristischen Gutachtens
A.Sinn und Zweck eines juristischen Gutachtens
2
Lesen Sie die nachfolgend genannten Vorschriften parallel im Gesetzestext mit.
Ein Rechtsanwalt oder Richter verdient sein Geld mit juristischen Bewertungen. Er muss einen Sachverhalt anhand unserer Rechtsordnung bewerten, um eine ihm gestellte Frage nach der bestehenden Rechtslage zu beantworten. Diese Frage hat in der Praxis einen handfesten Hintergrund: Eine Person will etwas von einer anderen haben. Auch bei der Erstellung von Verträgen für einen Mandanten geht es vornehmlich darum, durchsetzbare Ansprüche zu begründen oder – umgekehrt – auszuschließen. Der Jurist muss sich stets mit der Frage nach dem Bestehen und der Durchsetzbarkeit von Ansprüchen befassen.
Ein Anspruch ist das Recht einer Person, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1[1]). Man spricht auch von „Forderung“ (§ 241 Abs. 1) oder „Schuldverhältnis im engeren Sinne“, vgl. § 362 Abs. 1.[2]
Den Anspruchsinhaber nennen wir Gläubiger, den Anspruchsgegner Schuldner, vgl. § 241 Abs. 1.
Vom Anspruch sind die sog. Obliegenheiten zu unterscheiden. Diese begründen anders als der Anspruch kein Recht auf ein Tun oder Unterlassen, lösen bei ihrer Verletzung auch keinen Schadensersatzanspruch aus § 280 aus, sondern führen „nur“ zu einem Rechtsverlust oder sonstigen Rechtsnachteil der mit der Obliegenheit belasteten Person[3] (z.B. Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB).
3
Der Mandant eines Rechtsanwalts bzw. die Parteien in einem Zivilprozess interessieren sich regelmäßig nicht für abstrakte Rechtsfragen. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Anspruch im Ergebnis tatsächlich besteht und ob dieser notfalls mit Hilfe der Zwangsvollstreckung durchgesetzt werden kann. Um einen Anspruch zwangsweise durchsetzen zu können, muss er offiziell „tituliert“, d.h. als Grundlage und Rechtfertigung für eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme festgestellt werden. Diese Feststellung wird nach § 704 Abs. 1 ZPO grundsätzlich in Form einer gerichtlichen Verurteilung getroffen.[4] Jede juristische Aufgabe ist deshalb immer auch mit Blick auf eine (vorgestellte) gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Ziel der „Titulierung“ eines Anspruchs zu bearbeiten.
4
In der Klausur wird diese Aufgabenstellung geübt. Dabei ist nicht immer nach bestimmten Ansprüchen gefragt. Die Frage ist häufig allgemeiner formuliert, etwa: „Was kann A von B verlangen?“ oder „Wie ist die Rechtslage?“. Dies entspricht dem Beginn von Mandantengesprächen in der täglichen Anwaltspraxis. Da hat es der Zivilrichter übrigens einfacher. Er bekommt stets nur ein ganz bestimmtes Begehren zur Entscheidung gestellt (vgl. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) und ist an diese Aufgabenstellung gebunden (vgl. § 308 Abs. 1 ZPO). Der Anwalt muss hingegen herausfinden, ob und unter welchen Umständen der Mandant etwas von einer Person fordern und gerichtlich durchsetzen kann oder ob der Mandant umgekehrt einer anderen Person etwas zu leisten hat.
Das in der Klausur anzufertigende Gutachten bereitet den Rat des Rechtsanwalts bzw. das Urteil des Richters vor. Um Fehlentscheidungen zu vermeiden, muss das Gutachten die Sach- und Rechtslage vollständig würdigen. Auf der anderen Seite muss es sich auf das Wesentliche beschränken, um den Leser (den Korrektor Ihrer Klausur!) nicht zu ermüden und seine Aufmerksamkeit für die gesamte Darstellung zu erhalten. Die Laune des Korrektors soll schließlich nicht von positiver Neugier in überdrüssige Gereiztheit umschlagen.
Anmerkungen
§§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
Medicus/Petersen Allgemeiner Teil des BGB Rn. 75; Palandt-Ellenberger Einl. v. § 241 Rn. 3; Petersen „Die Entstehung und Prüfung von Ansprüchen“, JURA 2008, 180 unter Ziff. I.
Palandt-Ellenberger Einl. v. § 241 Rn. 13.
Weitere Vollstreckungstitel finden Sie im Katalog des § 794 Abs. 1 ZPO.
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das?
B.Wie geht das?
5
Überlegen wir uns vor diesem Hintergrund nun, wie Sie bei einer Klausur am besten vorgehen.
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das? › I. Erfassen des Sachverhalts
I.Erfassen des Sachverhalts
6
Notwendige Grundlage für jede halbwegs sinnvolle Bearbeitung ist die genaue Erfassung des Sachverhalts. In der Klausur wird Ihnen ein „fertiger“ Tatbestand präsentiert. Er soll das Ergebnis des Parteienvortrags sein, so wie ihn der Richter bzw. Rechtsanwalt für seine endgültige Entscheidung verwenden müsste. Es besteht also keine Möglichkeit mehr, den Sachverhalt zu ergänzen. Wovon der Sachverhalt berichtet, ist geschehen; wovon der Sachverhalt schweigt, ist nicht geschehen oder nicht nachweisbar.
7
Lesen Sie den Sachverhalt mehrmals durch. Erstellen Sie bei komplizierten Sachverhalten eine – übersichtliche! – Fallskizze, für deren Gestaltung Sie sich bestimmte Symbole ausdenken (zum Beispiel Linien zur Kennzeichnung einer Vertragsbeziehung, Pfeile zur Kennzeichnung von Ansprüchen, etc.) und die Sie immer gleichbleibend verwenden. Bei zeitlich gestreckten Abläufen empfiehlt sich auch die Erstellung einer chronologischen Zeittabelle.
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das? › II. Gliederung
II.Gliederung
8
Ausgangspunkt der Falllösung ist immer die auf den Sachverhalt bezogene Fallfrage des Klausurstellers.
Lautet die Fallfrage ganz allgemein: „Wie ist die Rechtslage?“, dann ist nach den Ansprüchen aller Beteiligten untereinander gefragt. Der Sachverhalt ist daher zunächst in Zweipersonenverhältnisse zu gliedern, so dass er zu der konkreteren Fallfrage: „Welche Ansprüche hat die eine Partei gegen die andere?“ führt.[1]
Diese Fallfrage ist wiederum so zu untergliedern, dass sie einer ganz konkreten Fallfrage entspricht, nämlich: „Kann die eine Partei von der anderen eine bestimmte Leistung verlangen?“
Die maßgebliche Fragestellung für die Gliederung lautet: Wer will was von wem woraus?
Kommen verschiedene Ziele in Betracht, ist die Darstellung weiter nach den verschiedenen Anspruchszielen zu untergliedern (z.B. Herausgabe, Schadensersatz, etc.).[2]
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das? › III. Auffinden der Anspruchsgrundlage
III.Auffinden der Anspruchsgrundlage
9
Die so konkretisierte Fallfrage ist nun zu beantworten, d.h. es ist zu prüfen, ob das Begehren des Anspruchstellers mit rechtlichen Mitteln durchsetzbar ist. Das setzt einen Anspruch voraus, dessen Rechtsfolge dem Begehren des Anspruchstellers inhaltlich entspricht. Außerdem muss dieser Anspruch auch (gerichtlich) durchsetzbar sein.
Um das herauszufinden, gehen Sie von der gewünschten Rechtsfolge aus und suchen nach passenden Anspruchsgrundlagen.[3]
Ist nach Ersatz einer bestimmten Schadensposition gefragt, suchen Sie nach Anspruchsgrundlagen, deren Rechtsfolge eine Verpflichtung zum Schadensersatz anordnen, z.B. §§ 122 Abs. 1, 179 Abs. 1 Var. 2, 280 Abs. 1, 678, 823 Abs. 1.
Am Anfang ist es hilfreich, sich die gesetzlichen Anspruchsgrundlagen in der eigenen Textausgabe mit einer bestimmten Farbe zu markieren.
Anspruchsgrundlagen können durch Rechtsgeschäft (vgl. § 311 Abs. 1), durch Gesetz oder durch Gewohnheitsrecht[4] begründet werden. Gesetzliche Anspruchsnormen erkennt man beispielsweise an den folgenden Formulierungen:
„ … hat zu / ist zu (ersetzen o.Ä.) …“, vgl. z.B. § 122 Abs. 1;
„ … kann verlangen …“, vgl. z.B. § 280 Abs. 1 S. 1;
„ … ist verpflichtet …“, vgl. z.B. § 823 Abs. 1.
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das? › V. Darstellung aller Anspruchsgrundlagen im Gutachten?
V.Darstellung aller Anspruchsgrundlagen im Gutachten?
20
Meistens können sich aus einem Sachverhalt mehrere Anspruchsgrundlagen ergeben, die inhaltlich auf dieselbe Rechtsfolge gerichtet sind.
Mieter M beschädigt fahrlässig die Fensterscheibe in der von ihm gemieteten Wohnung seines Vermieters V. Hier bestehen Schadensersatzansprüche des V aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 einerseits und § 823 Abs. 1 andererseits. Schadensersatzansprüche aus §§ 989, 990 können hingegen nicht entstanden sein, da diese einen Herausgabeanspruch des V aus § 985 (sog. „Vindikationslage“) zum Zeitpunkt der Beschädigung voraussetzen. Wegen der aus dem Mietvertrag folgenden Besitzberechtigung des M bestand aber gem. § 986 Abs. 1 S. 1 zum Zeitpunkt der Beschädigung kein Herausgabeanspruch aus § 985.
21
Ihr Gutachten ist grundsätzlich nur vollständig, wenn alle auf die geforderte Rechtsfolge gerichteten Ansprüche geprüft worden sind. Durch die Bejahung einer Anspruchsgrundlage ist „die Luft noch nicht raus“.
Häufig stellen sich im Hinblick auf weitere Anspruchsgrundlagen schwierige Konkurrenzfragen, die Sie in der Klausur beantworten sollen, nämlich: Bestehen die Anspruchsgrundlagen nebeneinander im Sinne einer Anspruchskonkurrenz oder verdrängt die eine Anspruchsgrundlage die andere? Besteht eine Konkurrenz, stellt sich die nächste Frage: Ist die Konkurrenz selbstständig oder beeinflusst die eine Grundlage die andere?
Insbesondere in Anwaltsklausuren kommt folgender Aspekt hinzu: Ein bestimmter Anspruch kann für den Mandanten vorteilhafter sein als andere konkurrierende Ansprüche, etwa weil er einer anderen Verjährungsfrist unterliegt oder weil damit ein für den Mandanten günstigerer Gerichtsstand[11] begründet werden kann.
22
Dabei verlangt niemand von Ihnen, dass Sie alle Ansprüche in der gleichen Ausführlichkeit darstellen. Es kommt auf die richtige Gewichtung an. Häufig äußern die Parteien im Sachverhalt Rechtsauffassungen oder betonen bestimmte Fakten (versteckte Hinweise des Klausurstellers), so dass Sie gehalten sind, sich mit diesen Punkten in jedem Fall ausführlich auseinanderzusetzen. Ist die Zeit knapp, können Sie die Erörterung konkurrierender und für das Ergebnis inhaltlich nicht mehr erheblicher Ansprüche auf ein eben noch verständliches Mindestmaß zurückführen, indem Sie die konkurrierenden Ansprüche mit kurzer, urteilsartiger Begründung des Ergebnisses erwähnen, z.B. bei § 823 Abs. 2 nach Bejahung des § 823 Abs. 1, bei § 1007 nach § 985 oder bei der Haftung des fahrzeugführenden Halters aus § 18 StVG nach § 7 Abs. 1 StVG.[12] Sie zeigen dem Korrektor damit zum einen, dass Ihnen diese Ansprüche geläufig sind, und zum anderen, dass Sie Ihre Darstellung auf das Wesentliche konzentrieren.
23
Wie bei jedem Grundsatz gibt es vom Gebot vollständiger Erörterung Ausnahmen:
Zum einen kann Ihnen nach dem Bearbeitervermerk die Prüfung bestimmter Ansprüche erlassen sein. Dann müssen Sie sich natürlich an die Vorgaben des Bearbeitervermerks halten. Zum anderen sind in der schriftlichen Ausarbeitung solche Ansprüche nicht mehr zu erwähnen, deren Voraussetzungen offensichtlich nicht vorliegen. Sätze wie:
„Vertragliche Ansprüche bestehen nicht, weil im vorliegenden Fall gar kein Vertrag geschlossen wurde.“
gehören also nicht ins Gutachten.
1. Teil „Ein Rundflug“ › B. Wie geht das? › VI. Die Anspruchsprüfung
VI.Die Anspruchsprüfung
24
I.Anspruchsentstehung
1.Rechtsfähigkeit von Gläubiger und Schuldner (wenn nicht nur natürliche Personen. Wahlweise Prüfung inzident im Rahmen der eigentlichen Anspruchsvoraussetzungen)
2.Anspruchsvoraussetzungen
3.Rechtshindernde Einwendungen
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
z.B. Erfüllung (§ 362), Erfüllungssurrogate (§§ 364 Abs. 1, 372, 378, 389, 397)nachträgliche Leistungsbefreiung nach § 275, Rücktritt (arg. ex. § 346 Abs. 1)
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
25
Kommen wir nun zu den Kategorien der einzelnen Anspruchsprüfung. Die Anspruchsprüfung soll im Ergebnis die Frage nach der Durchsetzbarkeit eines bestimmten Anspruches beantworten.
Die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs setzt voraus,
1.
dass der Anspruch entstanden ist (vgl. § 199 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 , Abs. 4),
2.
dass der Anspruch jetzt immer noch besteht, also zwischenzeitlich nicht erloschen ist (z.B. gem. §§ 362 Abs. 1, 364 Abs. 1, 389, 397 Abs. 1) und
3.
dass der gerichtlichen Durchsetzbarkeit des bestehenden Anspruchs sonst nichts im Wege steht.
Jede Anspruchsgrundlage ist vom Rechtsanwalt bzw. Richter – in der Klausur also von Ihnen – stets auf diese Art und Weise zu prüfen.
1.Anspruch entstanden?
26
Die Einstiegsfrage lautet: Ist der Anspruch (z.B. des A gegen den B) überhaupt entstanden?
Um diese Frage zu beantworten, sind gedanklich folgende Punkte zu prüfen:
a)Rechtsfähigkeit der Beteiligten
27
Damit eine Partei gegen eine andere Partei einen Anspruch, d.h. das Recht haben kann, ein bestimmtes Tun oder Unterlassen zu fordern (§ 194 Abs. 1), müssen diese Parteien rechtsfähig sein.
Der Begriff der Rechtsfähigkeit meint die Fähigkeit, Träger eigener Rechte und Pflichten zu sein.[13]
Nur wer rechtsfähig ist, kann als Gläubiger einen Anspruch haben und nur wer rechtsfähig ist, kann als Schuldner zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtet sein.
Bei Anspruchsbeziehungen zwischen Menschen („natürliche Personen“) müssen Sie in der Klausur zur „Rechtsfähigkeit“ keine Ausführungen machen. Sie ist selbstverständlich gegeben. Entgegen manchen Ausführungen in Übungsklausuren hat übrigens die Kaufmannseigenschaft eines Menschen nach §§ 1 ff. HGB mit seiner Rechtsfähigkeit nichts zu tun!
In allen anderen Fällen (juristische Personen, Personenverbände) können Sie das Thema „Rechtsfähigkeit“ entweder in einem ersten Prüfungspunkt gesondert darstellen oder aber inzident im Rahmen der Voraussetzungen der als erstes konkret zu prüfenden Anspruchsgrundlage erörtern (z.B. beim Zustandekommen eines Vertrages bei der Prüfung eines vertraglichen Primäranspruchs). Haben Sie die Rechtsfähigkeit einmal festgestellt, müssen Sie darauf bei der Prüfung konkurrierender Ansprüche nicht noch einmal gesondert eingehen. Dieser Punkt darf also keinesfalls stur wiederholt werden – eine Wiederholung ist überflüssig.
Geht es in der Klausur um die Begutachtung der Erfolgsaussichten einer Klage, müssen Sie die Rechtsfähigkeit der Parteien bereits im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung unter dem Gesichtspunkt der Parteifähigkeit (vgl. § 50 Abs. 1 ZPO) erörtern.
aa)Personen
28
Der Begriff der „Person“ ist der vom Gesetzgeber im BGB gewählte Oberbegriff,[14] dem die „natürlichen Personen“[15] (§§ 1 ff.) und „juristischen Personen“[16] (§§ 21 ff.) untergeordnet werden. Eine Legaldefinition des Personenbegriffes existiert nicht. Aus dem Zusammenhang zwischen den vom Gesetzgeber verwendeten Begriffen und den Regelungen der §§ 1 ff. folgt aber, dass der Gesetzgeber unter dem Begriff „Person“ ein rechtsfähiges Subjekt versteht.[17]
29
Da unsere Rechtsordnung von Menschen für Menschen gemacht wird, sind Menschen selbstverständlich rechtsfähig. Dies wird von unserer Rechtsordnung vorausgesetzt. Die allgemeine Vorschrift des § 1 regelt (nur) den Beginn der Rechtsfähigkeit des Menschen, nämlich ab „Vollendung der Geburt“. Vollständig geborene Menschen sind juristisch gesprochen also „natürliche Personen“.
30
Daneben gibt es die „juristischen Personen“. Hierbei handelt es sich um die Zusammenfassung von Personen („Mitglieder“) und/oder Gegenständen zu einer Organisation, deren Rechtspersönlichkeit erst durch bestimmte, für jeden Typ besonders festgelegte Rechtsakte des öffentlichen Rechts oder Privatrechts erzeugt wird.[18] Aufgrund ihrer „juristisch erzeugten“ Persönlichkeit ist die juristische Person rechtsfähig.
Zu den juristischen Personen gehören insbesondere der eingetragene Verein (§ 21), die Stiftung (§ 80), Körperschaften, Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts (vgl. § 89), die GmbH (§ 13 Abs. 1 GmbHG), die Aktiengesellschaft (§ 1 Abs. 1 AktG), die Kommanditgesellschaft auf Aktien (§ 278 Abs. 1 AktG) und die eingetragene Genossenschaft (§ 17 Abs. 1 GenG).
bb)Rechtsfähige Personenverbände
31
Neben den natürlichen und juristischen Personen kennt unsere Rechtsordnung (vgl. § 14 Abs. 2, § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO, § 7 Nr. 3 MarkenG) schließlich noch rechtsfähige Personengesellschaften. Es handelt sich dabei um Zusammenschlüsse, die selbst keine „juristische Personen“ sind.[19] Personengesellschaften entstehen durch Rechtsgeschäft, nämlich den Gesellschaftsvertrag und werden unter bestimmten Voraussetzungen kraft Gesetzes (z.B. §§ 123, 124 HGB für die OHG) oder im Wege richterlicher Rechtsfortbildung (z.B. Außen-GbR[20]) weithin wie juristische Personen behandelt und sind als Kollektiv insoweit mit eigener Rechtsfähigkeit ausgestattet.
Rechtsfähige Personengesellschaften sind insbesondere (vgl. § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO): die offene Handelsgesellschaft (vgl. §§ 123, 124 HGB), die Kommanditgesellschaft (§§ 161 Abs. 2, 123, 124 HGB), die Partnerschaftsgesellschaft (§ 7 Abs. 2 PartGG i. V. m. § 124 HGB), die Vor-GmbH,[21] die Vor-AG[22] und die nach außen als Einheit am Rechtsverkehr teilnehmende BGB-Gesellschaft (§ 124 HGB analog[23]).Hinzu kommen weitere rechtsfähige Personenverbände ohne eigene Rechtspersönlichkeit, nämlich die Wohnungseigentümergemeinschaft (§ 10 VI WEG) und der nicht eingetragene Verein (§ 54).[24]
Eine Vertiefung der (schwierigen) Frage nach der juristischen Eigenpersönlichkeit der Personenverbände hilft in der Fallbearbeitung an diesem Prüfungspunkt nicht weiter.[25] Entscheidend ist die Anerkennung der Rechtsfähigkeit für das konkret zu prüfende Schuldverhältnis durch den Gesetzgeber oder durch (richterliche) Rechtsfortbildung.
Die Rechtsfähigkeit einer juristischen Person oder eines (rechtsfähigen) Personenverbandes ist anhand der jeweiligen Norm zu begründen, die die Rechtsfähigkeit beschreibt (z.B. § 13 Abs. 1 GmbHG für die GmbH, §§ 123, 124 HGB für die OHG). Gibt der Sachverhalt dazu Anlass, ist in diesem Zusammenhang auch auf die wirksame Errichtung der juristischen Person bzw. des Personenverbandes einzugehen.
Zur Begründung der Rechtsfähigkeit der Außen-GbR sollten Sie auf § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO, § 191 Abs. 2 Nr. 1 UmwG verweisen und die Argumentation der h.M., insbesondere des BGH,[26] in ihren wesentlichen Grundzügen knapp darstellen. Wegen § 54 gilt dies für den nicht eingetragenen Verein entsprechend. Bei der „Vor-GmbH“ bzw. „Vor-AG“ müssen Sie die (richterrechtlichen) Grundsätze zur Rechtsfähigkeit dieser Gesellschaften präsentieren.
b)Die Anspruchsvoraussetzungen
32
Die Entstehung eines konkreten Anspruchs ist an besondere tatsächliche Voraussetzungen gebunden, die sich aus der jeweiligen Anspruchsgrundlage ergeben. Es handelt sich um diejenigen Tatsachen, die die gewünschte Leistungspflicht nach Maßgabe der von Ihnen gerade geprüften Anspruchsgrundlage unmittelbar auslösen. Anspruchsgrundlagen können sich zum einen aus einem Rechtsgeschäft ergeben, das auf Begründung eines Anspruchs gerichtet ist. § 311 Abs. 1 verlangt dafür regelmäßig ein Rechtsgeschäft in Form eines Vertrages (z.B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Werkvertrag).
Anspruchsvoraussetzung für einen vertraglichen Primäranspruch ist also eine vertragliche Vereinbarung, die auf Begründung des geprüften Anspruchs gerichtet ist. Die im Gesetz aufgeführten Normen zur Typisierung der verschiedenen Vertragsarten sind keine Anspruchsgrundlagen – es handelt sich ja eben gerade nicht um ein gesetzliches Schuldverhältnis. Dies kann nicht oft genug betont werden. Bei Primäransprüchen aus atypischen Verträgen (z.B. Lizenzvertrag oder Theateraufführungsvertrag) bringen seitenlange Ausführungen zur Bestimmung des Vertragstyps nichts: Es kommt allein auf die Verpflichtung aus der konkreten Vereinbarung an! Der Anspruch folgt „aus Vertrag“ und nicht „aus § X“.[27] Haben Sie einen Vertrag, der unproblematisch einem Vertragstyp des BGB entspricht, wäre es allerdings unklug, auf das entsprechende Normzitat zu verzichten und einen stichwortverliebten Korrektor damit zu irritieren. Deswegen empfiehlt sich regelmäßig folgende Formulierung (am Beispiel eines Kaufpreiszahlungsanspruches): Anspruch „aus Kaufvertrag gemäß § 433 Abs. 2“.[28]
33
Es gibt nach der Formulierung des § 311 Abs. 1 aber auch Ansprüche aus anderen Rechtsgeschäften, die keine Verträge sind, sondern einseitige Rechtsgeschäfte.
Ansprüche aus Auslobung gem. § 657 oder Vermächtnis gem. §§ 1939, 2147, 2174.
34
Ansprüche werden außerdem durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht begründet.
Gesetzliche Ansprüche aus §§ 122, 179, 280 ff., 546, 546a Abs. 1, 604, 681, 683, 684 S. 1, 812 ff., 823 ff., 861 f., 985 ff., 1004 Abs. 1, 2018 ff.;Unterlassungsansprüche nach den Grundsätzen des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnisses als gewohnheitsrechtliche Ausprägung von § 242.
35
Jede dieser möglichen Anspruchsgrundlagen hat ihre eigenen Voraussetzungen, die Sie Schritt für Schritt durchgehen.
Bei der Prüfung der jeweils einschlägigen Anspruchsvoraussetzungen können Sie auf Tatbestandsmerkmale stoßen, die mittels sog. „Hilfsnormen“ ausgefüllt werden müssen.
Hilfsnormen sollen uns bei der Anwendung von Tatbeständen helfen, indem sie Tatbestandsmerkmale definieren oder beschreiben.[29]
Der Tatbestand des Anspruchs aus § 288 Abs. 1 S. 1 lautet: „Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen.“ Zum Tatbestand des gesetzlichen Zinsanspruchs aus § 288 Abs. 1 S. 1 gehört also auch das Merkmal des Verzugs. Wann Verzug eintritt, ergibt sich aus der Hilfsnorm des § 286.
Außerdem hat uns § 288 Abs. 1 S. 1 noch keine Auskunft darüber gegeben, wie hoch der Verzugszinssatz denn eigentlich ist. Hier hilft § 288 Abs. 1 S. 2: „Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.“ Es stellt sich eine weitere Frage: Was ist der „Basiszinssatz“? Hier hilft wiederum § 247.
c)Rechtshindernde Einwendungen
36
Wenn Sie nun alle Prüfungspunkte abgearbeitet haben, liegen die Voraussetzungen der jeweiligen Anspruchsgrundlage im Ergebnis entweder vor oder nicht. Liegen die Voraussetzungen vor, ist der Anspruch möglicherweise dennoch nicht entstanden. Es gibt nämlich Tatbestände, die die Entstehung des Anspruchs ausnahmsweise verhindern können. Man nennt diese Tatbestände „rechtshindernde Einwendungen“ (des Schuldners/Beklagten).[30] Um sich diesen Begriff besser merken zu können, müssen Sie sich Folgendes vor Augen führen:
Der Zivilrichter ermittelt im Prozess die relevanten Tatsachen nicht von Amts wegen. Vielmehr müssen die Prozessparteien dem Richter den Sachverhalt „liefern“. Für bestimmte Tatsachen ist der Kläger verantwortlich, für andere der Beklagte. Man nennt dies die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast.
Im Grundsatz gilt: Jede Partei muss diejenigen Tatsachen darlegen und im Streitfalle beweisen, die ihr günstig sind. Gelingt einer Partei der Beweis nicht, wird die ihr günstige Tatsache bei der Bewertung nicht berücksichtigt.
Die Anspruchsvoraussetzungen muss folglich der Kläger darlegen und ggfs. beweisen. Bei den rechtshindernden Tatsachen handelt es sich dagegen um Ausnahmen von der regelmäßigen Entstehung des Anspruchs. Also muss diese im Prozess welche Partei darlegen und beweisen? Richtig, der Beklagte – denn ihm sind diese anspruchsverhindernden Tatsachen günstig. Er wendet die rechtshindernden Tatsachen im Prozess gegen den anspruchsbegründenden Klägervortrag ein, indem er sie seinerseits dem Richter vorträgt.
Einwand fehlender Vertretungsmacht eines Vertreters bei Vertragsschluss (§ 177 Abs. 1), Einwand der Formnichtigkeit (§ 125 S. 1), Einwand der Sittenwidrigkeit (§ 138), Einwand anfänglicher Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1), Einwand der Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund zur Leistung nach § 814, Einwand bestehender Besitzberechtigung nach § 986, Einwand bestehender Duldungspflicht nach § 1004 Abs. 2, Einwand einer vereinbarten Haftungsbeschränkung.
In der Klausur müssen Sie nicht zwingend erst alle Anspruchsvoraussetzungen prüfen, um überhaupt ein Wort zu rechtshindernden Einwendungen verlieren zu können. Sie können rechtshindernde Einwendungen auch vorziehen, um überflüssige Ausführungen zu vermeiden oder weil es aus Gründen der Verständlichkeit und der Systematik geboten ist.
Prüfen Sie beispielsweise einen Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung wegen Leistungsverzögerung im Rahmen eines Grundstückskaufvertrages aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286, gehört die Frage nach der Form(nichtigkeit) des Kaufvertrages nach § 125 S. 1 i.V.m. § 311b Abs. 1 S. 1 bereits zum ersten Prüfungspunkt „Schuldverhältnis“. Der Abschluss des Kaufvertrages begründet grundsätzlich ein Schuldverhältnis als erste Voraussetzung des § 280 Abs. 1. Der begründete Einwand einer Formnichtigkeit macht den Kaufvertrag aber unwirksam und verhindert so die Entstehung des geprüften Schadensersatzanspruches. Die weiteren Anspruchsvoraussetzungen müssten dann nicht mehr geprüft werden.
2.Anspruch erloschen?
37
Als Zwischenergebnis Ihrer bisherigen Prüfung ist der Anspruch nun entweder entstanden oder nicht. Wenn er entstanden ist, stellt sich die weitere Frage, ob der Anspruch jetzt noch besteht. Er könnte ja in der Zwischenzeit wieder erloschen sein. Schuld daran wären entweder Rechtsgeschäfte (z.B. Aufrechnung gem. § 389, Erlassvertrag gem. § 397) oder gesetzliche Einwendungstatbestände, die sinngemäß die Rechtsfolge anordnen: Dieser Anspruch besteht jetzt nicht mehr – drastisch gesprochen: Der Anspruch wird „vernichtet“.
Welche Partei muss im Prozess solche rechtsvernichtenden Tatsachen darlegen und beweisen? Natürlich der beklagte Schuldner, denn ihm sind diese Tatsachen günstig. Man nennt sie deshalb rechtsvernichtende Einwendungen (des Schuldners/Beklagten).[31]
38
Solche rechtsvernichtenden Tatbestände erkennen Sie zum einen an folgenden Formulierungen:
„Das Schuldverhältnis erlischt, wenn …“, vgl. z.B. §§ 362 Abs. 1, 364 Abs. 1, 389, 397;
„… der Schuldner wird befreit …“, vgl. z.B. § 378.
Andere rechtsvernichtende Wirknormen sind nach ihrem Wortlaut nicht so eindeutig zu erkennen. Die rechtsvernichtende Wirkung bestimmter Umstände zeigt sich häufig erst indirekt. Wir werden in dieser Skriptenreihe im jeweiligen Sachzusammenhang darauf zurückkommen.
Ein wirksam ausgeübter Rücktritt vernichtet die bisherigen vertraglichen Primäransprüche. Wenn ein Verkäufer beispielsweise von einem Kaufvertrag zurücktritt, kann er den Kaufpreis nicht mehr gem. § 433 Abs. 2 verlangen. Diese Folge ergibt sich indirekt aus § 346 Abs. 1: Wenn der Kaufpreis bereits gezahlt worden wäre, müsste er wieder zurückerstattet werden (§ 346 Abs. 1). Daraus folgt für den Fall, dass der Preis noch nicht gezahlt wurde, erst recht: Der Verkäufer kann die Zahlung des Kaufpreises nach einem wirksamen Rücktritt nicht mehr verlangen. Der Gesetzgeber hielt dies für so selbstverständlich, dass er uns in der Begründung seiner Regelungen zur Schuldrechtsreform mitgeteilt hat, diese Wirkung müsse man nicht eigens in § 346 Abs. 1 aussprechen.[32]
3.Anspruch durchsetzbar?
39
Wenn Sie nun festgestellt haben, dass der einmal entstandene Anspruch immer noch besteht, ist bald alles geschafft. Der Anspruchssteller ist fast am Ziel, aber eben nur fast. Sein Anspruch nützt ihm nichts, wenn dieser sich nicht gerichtlich durchsetzen lässt.
a)Fälligkeit
40
Der Richter darf den Beklagten grundsätzlich nur zu fälligen Leistungen verurteilen. Die Zivilprozessordnung (ZPO) erlaubt Ausnahmen nur in engen Grenzen (vgl. §§ 257–259 ZPO). Der Anspruch ist grundsätzlich also erst dann gerichtlich durchsetzbar, wenn er auch fällig ist.
Der Begriff der Fälligkeit meint allgemein den Zeitpunkt, ab dem der Gläubiger (im Prozess: der Kläger) die aufgrund seines Anspruchs geschuldete Leistung verlangen kann.[33]
Im Zweifel kann der Gläubiger die Leistung sofort verlangen (§ 271 Abs. 1). Abweichende Fälligkeitstermine können vertraglich vereinbart, also durch Rechtsgeschäft geschaffen werden:
„Zahlung in 14 Tagen“, „Zahlung nach Rechnungserhalt“.
Fälligkeitstermine können sich auch aus dem Gesetz ergeben:
§§ 556b Abs. 1, 579, 587, 604, 614, 641, 1361 Abs. 4, 1585 Abs. 1, 1612 Abs. 3.
Schließlich können sich solche Ausnahmen mangels vertraglicher oder gesetzlicher Regeln auch aus „den Umständen“ entnehmen lassen (vgl. § 271 Abs. 1):
Der Vermieter von Wohnräumen muss eine Kaution des Mieters im Zweifel noch nicht bei Beendigung des Mietverhältnisses zurückzahlen, sondern erst dann, wenn feststeht, ob ihm noch Ansprüche gegen den Mieter zustehen. Zur Feststellung seiner Ansprüche stehen dem Vermieter regelmäßig 3–6 Monate zur Verfügung.[34]
b)Einreden
41
Der Richter bzw. Rechtsanwalt – in der Klausur sind Sie das – hat bis hierher die Frage beantwortet, ob dem Gläubiger (im Prozess: Kläger) ein fälliger Anspruch zusteht und der Schuldner (im Prozess: Beklagter) – leider – leisten muss, d.h. etwas zahlen, unterlassen, herausgeben muss oder was sonst auch immer Inhalt des Anspruchs sein mag.
Das Gesetz gibt dem Schuldner aber noch eine „Notbremse“ an die Hand, die nur er betätigen darf: ein Leistungsverweigerungsrecht. Der Gesetzgeber begründet über entsprechende Tatbestände solche Leistungsverweigerungsrechte. Dem Schuldner steht es frei, sich auf dieses Recht zu berufen. Der Richter kann ihm diese Entscheidung nicht abnehmen. Man nennt diese Leistungsverweigerungsrechte auch Einreden.[35]
Bei den „Einreden“ muss der Schuldner „reden“, er muss sich auf diese Einrederechte berufen. Hat der Schuldner nicht „geredet“, hat er von seinem Leistungsverweigerungsrecht also keinen Gebrauch gemacht, bleibt dem Richter nichts anderes übrig, als ihn zur Leistung zu verurteilen.
Hat der Schuldner nach dem Ihnen vorliegenden Sachverhalt die Einrede nicht erhoben, prüfen Sie den Einredetatbestand trotzdem durch und weisen ggfs. darauf hin, dass die Einrede noch geltend gemacht werden könnte.[36] Dies kann nämlich auch noch im späteren Prozess geschehen.
Überlegen Sie einmal selbst, wer die Darlegungs- und Beweislast für die wirksame Erhebung einer Einrede trägt: Kläger oder Beklagter?
Die Darlegungs- und Beweislast für Einredetatbestände und für die Tatsache, dass der Schuldner sie erhoben hat (!) trägt – wer?
Je nach Wirkungsweise der Einreden unterscheiden wir zwischen zwei Einredearten.
aa)Peremptorische Einreden
42
Einredetatbestände können dem Schuldner ein dauerhaftes Leistungsverweigerungsrecht geben (sog. „peremptorische Einreden“, vgl. auch § 813 Abs. 1 S. 1).[37] Macht der Schuldner von einer solchen Einrede Gebrauch, geht für den Gläubiger nichts mehr. Er hat zwar einen Anspruch, kann ihn aber nicht mehr durchsetzen. Der Anspruch besteht rechtlich zwar noch, ist faktisch aber verloren.[38] Sie erkennen diese Einredetatbestände an der Formulierung
„… kann/ist berechtigt zu verweigern …“
Verjährung (Einredetatbestand: § 214[39]), Einrede der ungerechtfertigten Bereicherung (Einredetatbestand: § 821), Arglisteinrede (Einredetatbestand: § 853), Einrede der beschränkten Minderjährigen- bzw. Erbenhaftung (Einredetatbestände: §§ 1629a, 1973, 1975, 1990), Anfechtbarkeitseinrede (Einredetatbestand: § 2083).
bb)Dilatorische Einreden
43
Andere Einredetatbestände geben dem Schuldner nur ein vorübergehendes Leistungsverweigerungsrecht (sog. „dilatorische Einreden“).[40] In den entsprechenden gesetzlichen Einredetatbeständen wird diese Einschränkung an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Die Formulierungen lauten dann:
„… kann/ist berechtigt zu verweigern, bis/solange …“
Zurückbehaltungsrechte aus §§ 273, 320, 348, Einreden des Bürgen aus §§ 770, 771.
Bei den Zurückbehaltungsrechten sieht das Gesetz einen besonderen prozessualen Ausgang vor. Der Richter darf die Klage bei Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts nicht abweisen, sondern muss den beklagten Schuldner gleichwohl verurteilen – aber nicht uneingeschränkt. Die Verurteilung erfolgt nur zu einer Leistung Zug-um-Zug gegen Erbringung der Gegenleistung durch den klagenden Gläubiger (vgl. §§ 274 Abs. 1, 322 Abs. 1). Im Ergebnis also nur ein halber Triumph für den Kläger.