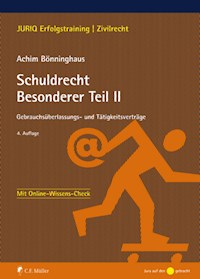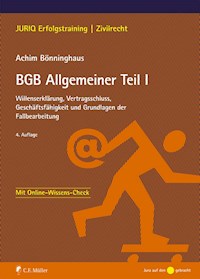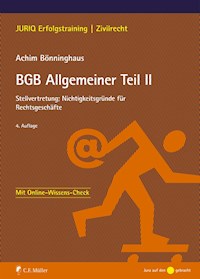
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Inhalt: Nach einer kurzen Einführung wird im zweiten Teil des Skripts die Stellvertretung behandelt (Vertragsschluss durch Vertreter, Vollmachten, Missbrauch der Vertretungsmacht, Insichgeschäfte, Vertretungsmacht aufgrund Rechtsscheins usw.). Anschließend werden die allgemeinen Wirksamkeitshindernisse (Verletzung von Formvorschriften, Anfechtung usw.) sowie Möglichkeiten zur Verwirklichung unwirksamer Rechtsgeschäfte (Umdeutung, Bestätigung usw.) dargestellt. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
BGB Allgemeiner Teil II
Stellvertretung; Nichtigkeitsgründe für Rechtsgeschäfte
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9176-2
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript ist der zweite Teil von zwei Bänden, die dem Allgemeinen Teil des BGB gewidmet sind. Der Allgemeine Teil des BGB beschäftigt sich mit einer Fülle zivilrechtlicher Grundfragen, denen im Examen wie in der Praxis überragende Bedeutung zukommt. Allerdings hat der Gesetzgeber den Stoff nicht unter Examensgesichtspunkten geordnet, sondern andere Gliederungsprinzipien walten lassen. Aber welche Vorschrift des Allgemeinen Teils muss denn nun in einer Klausur wo angesprochen und geprüft werden? Aufbaufragen bei der Bearbeitung und Darstellung von Themen des Allgemeinen Teils bereiten nicht nur den Anfängern – mit Recht! – großes Kopfzerbrechen. Das Anliegen dieser Skriptenreihe besteht deshalb darin, den Stoff möglichst so aufzubereiten, wie er in einer Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen orientiert, gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung folgt daher den gedanklichen Schritten im Rahmen einer Klausurprüfung und nicht der Gliederung des Gesetzgebers. Das Skript will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden stets von den Tatbeständen aus behandelt, die in der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen erleichtern naturgemäß das Verständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß beschränkt. Zu diesem Ansatz gehört es auch, viele Regeln des Allgemeinen Teils anderen Sachzusammenhängen zuzuordnen, in denen sie sich besser erfassen lassen und in der Klausur behandelt werden. So werden zum Beispiel die Bestimmungen zu Verbrauchern und Unternehmern (§§ 13, 14) im Allgemeinen Schuldrecht im Zusammenhang mit den Regelungen über Verbraucherverträge behandelt, die Regeln über Verein und Stiftung in den §§ 21 ff. BGB gehören in die Darstellung des Gesellschaftsrechts und die Regeln über Sachen und Tiere in den §§ 90–103 BGB sowie die §§ 135–137 BGB in die Skripte zum Sachenrecht. Während wir uns im ersten Band ausführlich mit der Willenserklärung, dem Vertragsschluss und der Geschäftsfähigkeit beschäftigt haben, widmen wir uns in diesem Skript den übrigen Tatbeständen des Allgemeinen Teils zur Wirksamkeit von Rechtsgeschäften.
Viele dieser Normen sind aufgrund ihrer abstrakten Darstellung offenbar nicht so fest im Gedächtnis verwurzelt, so dass sie häufig übersehen werden. Deshalb werde ich die Nichtigkeit nach §§ 134, 138 in diesem Band im Überblick behandeln und in den anderen Bänden – immer wieder – bei der Darstellung der Rechtsgeschäfte erörtern, bei denen die Themen im Examen typischerweise auftauchen (z. B. Missbrauch der Vertretungsmacht, Kauf, Miete, Darlehen, Bürgschaft, verlängerter Eigentumsvorbehalt und kollidierende Globalzession sowie im Bereicherungsrecht).
Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs ist. Die Brisanz der „Allgemeinen Themen“ bleibt bis zum Examen erhalten und hat sich keineswegs in den unteren Semestern „erledigt“.
Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann ein Skript auch gar nicht leisten. Betrachten Sie die Literaturangaben eher als persönliche Leseempfehlungen. Oft wird auf „den Palandt“ verwiesen, da er in Referendariat und Praxis eine überragende Bedeutung hat. Ich empfehle Ihnen daher, dieses Werk frühzeitig zu nutzen und sich an die abgekürzte Schreibweise zu gewöhnen. Das gilt übrigens auch für die zitierte BGH-Rechtsprechung.[1] Ich würde mich freuen, wenn Sie möglichst viele der zitierten Entscheidungen durcharbeiten. Urteile gehören in vielen Bereich faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Außerdem sind die Darstellungen meistens so gut aufbereitet, dass sie zugleich der Wiederholung von bestimmten Themen dienen können.
Bei der Neuauflage habe ich viele Zuschriften verarbeiten können, für die ich mich herzlich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte. Weitere Anregungen sind immer willkommen.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an den Verfasser unter [email protected].
Frankfurt am Main, im Juli 2019 Achim Bönninghaus
Anmerkungen
Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 198, 277, 451
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinführung
A.Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
B.Das Zustandekommen von Rechtsgeschäften
C.Die Wirksamkeitserfordernisse
D.Die Wirksamkeitshindernisse
2. TeilDie Stellvertretung
A.Einführung
I.Aktive und passive Vertretung
II.Prüfungsreihenfolge und Aufbau in der Klausur
1.Unterscheidung zwischen Vertretung und Vertretungsmacht
2.Aufbaufragen
B.Offenkundigkeitsprinzip
I.Grundregel beim Vertretergeschäft
II.Handeln unter fremdem Namen
1.Eigengeschäft
2.Vertretergeschäft
III.Unternehmensbezogenes Rechtsgeschäft
IV.Geschäft für den, den es angeht
V.Übungsfall Nr. 1
C.Vertretungsmacht
I.Gesetzliche Vertretungsmacht/Organstellung des Vertreters
1.Funktion der gesetzlich angeordneten Stellvertretung
2.Gesetzliche Vertretung nicht voll geschäftsfähiger Personen
3.Organe
II.Vertretungsmacht durch Vollmacht
1.Erteilung der Vollmacht (§ 167)
2.Erlöschen der Vollmacht
a)Erlöschen nach Maßgabe des Grundverhältnisses (§ 168 S. 1)
b)Bedingung, Befristung
c)Tod des Bevollmächtigten
d)Widerruf (§ 168 S. 2, 3)
e)Anfechtung, § 142 Abs. 1
f)Verzicht des Bevollmächtigten
3.Umfang
III.Verbot des Insichgeschäfts, § 181
1.Insichgeschäft
2.Analoge Anwendung bei Umgehungsgeschäften
3.Ausnahmen
a)Gestattung durch Einwilligung
b)Gestattung durch Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag
c)Gestattung kraft Gesetzes
d)Ungeschriebene Ausnahme
IV.Missbrauch der Vertretungsmacht
1.Grundsatz
2.Ausnahmen
a)Evidenter Missbrauch ohne Schädigungsabsicht
b)Kollusion
V.Vertretungsmacht aufgrund entstandenen Rechtsscheins
1.Wirkung der Rechtsscheinstatbestände
2.Grundstruktur der Rechtsscheinstatbestände
3.Fiktion einer fortbestehenden Außenvollmacht (§§ 170, 173)
a)Wirksam erteilte Außenvollmacht vor Vornahme des Vertretergeschäfts
b)Erlöschen der Außenvollmacht vor Vornahme des Vertretergeschäfts
c)Keine Nachricht über Erlöschen der Vollmacht
d)Gutgläubigkeit des Dritten bei Vornahme des Rechtsgeschäfts, § 173
e)Übungsfall Nr. 2
4.Fiktion einer kundgegebenen Innenvollmacht (§§ 171, 173)
a)Kundgabe einer so nicht bestehenden Innenvollmacht
b)Kein Widerruf der Kundgabe vor Vornahme des Vertretergeschäfts, § 171 Abs. 2
c)Gutgläubigkeit des Dritten bei Vornahme des Rechtsgeschäfts mit dem Vertreter, § 173
5.Fiktion einer durch Urkunde belegten Innenvollmacht (§§ 172, 173)
a)Vorlage einer Vollmachtsurkunde durch den Vertreter vor oder bei Vornahme des Rechtsgeschäfts
b)Keine Rückgabe oder Kraftloserklärung der Urkunde vor Vornahme des Vertretergeschäfts, § 172 Abs. 2
c)Aushändigung der Vollmachtsurkunde an Vertreter
d)Gutgläubigkeit des Dritten bei Vornahme des Rechtsgeschäfts mit dem Vertreter, § 173
6.Duldungs- und Anscheinsvollmacht
a)Auftreten als bevollmächtigter Vertreter („Rechtsscheinstatbestand“)
b)Alternativ: Rechtsschein auch aus anderen Gründen („Rechtsscheinstatbestand“)
c)Verantwortlichkeit des Vertretenen für rechtsscheinbegründendes Vertreterhandeln („Zurechenbarkeit“)
d)Gutgläubigkeit des Dritten bei Vornahme des Rechtsgeschäfts mit dem Vertreter, § 173 analog („schutzwürdiges Vertrauen“)
D.Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht, § 177
I.Art und Wirkung der Genehmigung
II.Reaktionsmöglichkeiten des Vertragspartners
1.Aufforderung nach § 177 Abs. 2
2.Widerruf nach § 178
E.Einseitiges Rechtsgeschäft mit Vertreter ohne Vertretungsmacht
I.Einseitiges Rechtsgeschäft durch Vertreter
1.Wirkung der §§ 164 Abs. 1, 180
2.Sonderfall des § 174
II.Einseitiges Rechtsgeschäft gegenüber Vertreter, §§ 164 Abs. 3, 180
F.Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht, § 179
I.Einführung
II.Anspruchsentstehung
1.Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht
a)Vertragsschluss und keine Unwirksamkeit aus sonstigen Gründen
b)Ohne Vertretungsmacht
2.Verweigerung der Genehmigung i.S.d. § 177 Abs. 1
3.(Kein) Ausschluss nach § 179 Abs. 3
a)Kenntnis oder Kennenmüssen des anderen Teils vom Mangel der Vertretungsmacht, § 179 Abs. 3 S. 1
b)Beschränkte Geschäftsfähigkeit des Vertreters und Handeln ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, § 179 Abs. 3 S. 2
4.Anspruchsinhalt
a)Kenntnis des Vertreters vom Mangel der Vertretungsmacht, § 179 Abs. 1
b)Keine Kenntnis des Vertreters vom Mangel der Vertretungsmacht, § 179 Abs. 2
III.Weitere Prüfung
IV.Weitere Anwendungsfälle
3. TeilAllgemeine Wirksamkeitshindernisse von Rechtsgeschäften
A.Verletzung eines gesetzlichen Formgebots, § 125 S. 1
I.Gesetzliche Formgebote
II.Folgen bei Verletzung der Form
1.Grundsatz der Nichtigkeit
2.Sonderfall: Unwirksamkeit einer Befristung
3.Heilung des Formmangels
4.Treuwidrige Berufung auf den Formmangel
III.Formzwecke
1.Informations-, Klarstellungs- und Beweisfunktion
2.Warnfunktion
3.Beratungsfunktion
IV.Art der vorgeschriebenen Form
1.„Ausdrückliche Form“
2.Textform (§ 126b)
a)Lesbare Erklärung
b)Abgabe auf einem dauerhaften Datenträger
c)Nennung des Erklärenden
d)Erkennbarkeit des Erklärungsabschlusses
3.Schriftform (§ 126)
a)Eigenhändige Unterschrift des Ausstellers
b)Einheitliche Urkunde
4.Elektronische Form (§ 126a)
a)Elektronisches Dokument unter Hinzufügung des Namens
b)Qualifizierte elektronische Signatur
c)Einverständnis des anderen Teils?
5.Öffentliche Form
a)Notarielle Beurkundung
b)Öffentliche Beglaubigung (§ 129)
V.Maßgeblicher Zeitpunkt
VI.Umfang des Formerfordernisses
1.Bestimmung der formbedürftigen Willenserklärungen bei Verträgen
2.Grundsatz der umfassenden Formbedürftigkeit
3.Ausnahmen
4.Erweiterungen auf andere Rechtsgeschäfte
5.Übungsfall Nr. 3
VII.Bestimmtheit des Urkundeninhalts
1.„Andeutungsformel“
2.Form und falsa demonstratio–Regel
B.Verletzung einer vertraglich vereinbarten Form
I.Wirkung einer Formklausel
II.Aufhebung der rechtsgeschäftlich bestimmten Form
1.Formularmäßige Formklausel
2.Individualvertraglich vereinbarte Formklausel
C.Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen Verbotsgesetz, § 134
I.Subsidiarität des § 134
II.Voraussetzungen eines Verbotsgesetzes
1.Rechtsnorm (Art. 2 EGBGB)
2.Verbotscharakter
3.Verbot bestimmter Rechtsfolgen eines Rechtsgeschäfts
4.Adressatenkreis
5.Subjektiver Tatbestand
III.Umfang der Nichtigkeit
D.Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen die guten Sitten, § 138
I.Einleitung zur Systematik des § 138
1.Generalklausel
2.Subsidiarität
3.Objektiver und subjektiver Tatbestand
II.Wucher, § 138 Abs. 2
1.Objektiver Tatbestand
a)Gegenseitiger Vertrag
b)Auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung
c)Weitere objektive Umstände auf Seiten des Bewucherten
2.Subjektiver Tatbestand
3.Umfang der Nichtigkeitsfolge
III.Wucherähnliches Rechtsgeschäft, § 138 Abs. 1
1.Kein Fall des § 138 Abs. 2
2.Auffälliges Missverhältnis bei einem gegenseitigen Vertrag
3.Verwerfliche Gesinnung des Begünstigten
4.Umfang der Nichtigkeitsfolge
IV.Weitere wichtige Fallgruppen des § 138 Abs. 1
1.„Kriminelle“ Verträge
2.„Knebelungswirkung“
3.Überforderung eines Teils aufgrund strukturellen Ungleichgewichts
E.Nichtigkeit wegen Anfechtung, § 142 Abs. 1
I.Einführung
II.Die Anfechtungswirkungen
1.Regelfall (§ 142 Abs. 1)
2.Ausnahmen von der Rückwirkung
3.Anfechtung nichtiger Geschäfte
III.Anfechtungserklärung
1.Inhalt der Anfechtungserklärung
a)Anfechtungswille und angefochtenes Rechtsgeschäft
b)Begründung
c)Bedingungs- und Befristungsfeindlichkeit
2.Erklärungsempfänger
a)Anfechtungsgegner bei Verträgen
b)Anfechtungsgegner bei einseitigen Rechtsgeschäften
IV.Allgemeine Wirksamkeitshindernisse
V.Anfechtungsrecht nach § 119 Abs. 1 wegen Irrtums
1.Irrtum
2.Ausdrucksfehler bei Abgabe („Erklärungsirrtum“, § 119 Abs. 1 Fall 2)
a)„Technische“ Ausdrucksfehler
b)Fehlendes Erklärungsbewusstsein
3.Fehler bei Vollzug der Übermittlung, § 120
a)Bedeutung des § 120
b)Einschaltung eines Übermittlers
c)Unrichtige Übermittlung
4.Fehlerhafte Wahl des richtigen Ausdrucksmittels (Inhaltsirrtum), § 119 Abs. 1 Fall 1
5.Sonderfall Rechtsfolgeirrtum
6.Sonderfall Kalkulationsirrtum
a)verdeckter Kalkulationsirrtum
b)offener Kalkulationsirrtum
7.Erheblichkeit des Irrtums
8.Beschränkung des Anfechtungsrechts nach § 242
9.Ausschlussfrist (§ 121)
a)Regelfrist (§ 121 Abs. 1)
b)Höchstfrist (§ 121 Abs. 2)
10.Abgrenzungen
a)Verhältnis zu §§ 116-118
b)Verhältnis zur falsa demonstratio
VI.Fehlerhafte Vorstellung über verkehrswesentliche Eigenschaften des Vertragsgegenstandes (Eigenschaftsirrtum), § 119 Abs. 2
1.Überblick
2.Eigenschaften einer Person oder Sache
3.Verkehrswesentlichkeit
4.Erheblichkeit des Irrtums und Ausschlussfrist
5.Abgrenzung zu besonderen Gewährleistungsregeln
6.Übungsfall Nr. 8
VII.Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (§ 123 Abs. 1 Var. 1)
1.Überblick
2.Irrtum und arglistige Täuschung
a)Täuschung durch aktives Tun
b)Täuschen durch Unterlassen
3.Rechtswidrigkeit
4.Kausalität
5.Arglist
6.Person des Täuschenden
a)Nicht empfangsbedürftige Willenserklärungen
b)Empfangsbedürftige Willenserklärungen
7.Beschränkungen des Anfechtungsrechts nach § 242
8.Ausschlussfrist
a)Regelfrist (§ 124 Abs. 1)
b)Höchstfrist (§ 124 Abs. 3)
VIII.Anfechtung nach § 123 Abs. 1 Var. 2
1.Drohung
2.Kausalität
3.Widerrechtlichkeit
4.Subjektiver Tatbestand
5.Ausschluss des Anfechtungsrechts
6.Konkurrenzen
a)Anfechtung nach § 119
b)Verhältnis zu § 138
c)Gewährleistungsansprüche
d)Haftung aus Culpa in Contrahendo (§§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2)
e)Haftung aus unerlaubter Handlung
7.Inhaber des Anfechtungsrechts
IX.Die Bestätigung (§ 144)
X.Schadensersatz aus § 122
1.Einführung
2.Anspruchsentstehung
a)Nichtige Willenserklärung nach § 118 oder Nichtigkeit wegen Anfechtung nach §§ 119, 120 (§ 142 Abs. 1)
b)Anspruchsberechtigung und -verpflichtung
c)(Kein) Ausschluss nach § 122 Abs. 2
d)Vertrauensschaden i.S.d. § 122 Abs. 1
e)Art und Umfang des Schadensersatzes
f)Kappungsgrenze des § 122 Abs. 1 a.E.
3.Weitere Prüfung
4.Analoge Anwendung?
4. Teil(Teil-)Verwirklichung eines unwirksamen Rechtsgeschäfts
A.Aufrechterhaltung eines wirksamen Teils, § 139
I.Subsidiarität des § 139
1.Verdrängende Spezialnorm
2.Verdrängende Auslegung einer anderen Norm
3.Verdrängende Vereinbarung
II.Teilnichtigkeit eines einheitlichen Rechtsgeschäfts
1.Nichtigkeit
2.Betroffenheit eines Teils eines ganzen Rechtsgeschäfts
III.Folgen
B.Umdeutung (§ 140)
I.Funktion
II.Objektive Voraussetzungen
1.Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts
2.Erfüllung der Wirksamkeitsvoraussetzungen eines Ersatzgeschäfts
3.Keine weiterreichenden Wirkungen des Ersatzgeschäfts
III.Subjektive Voraussetzungen
C.Bestätigung (§ 141)
I.Tatbestand
II.Wegfall des Nichtigkeitsgrundes
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Brox, Hans/Walker, Wolf-Dietrich
Allgemeiner Teil des BGB, 42. Aufl. 2018
Faust, Florian
Bürgerliches Gesetzbuch Allgemeiner Teil, 6. Aufl. 2018
Leenen, Detlef
BGB Allgemeiner Teil: Rechtsgeschäftslehre, 2. Aufl. 2015
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 26. Aufl. 2017
Münchener Kommentar zumBürgerlichen Gesetzbuch
Band 1 (Allgemeiner Teil), 8. Aufl. 2018(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Palandt, Otto
Bürgerliches Gesetzbuch, 78. Aufl. 2019 (zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 2Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen
In jedem Beruf ist der Arbeitsplatz ein sehr wichtiger Einflussfaktor auf unsere Leistung, natürlich auch während des Studiums. Günstige oder ungünstige Arbeitsbedingungen entscheiden mit darüber, wie wohl wir uns fühlen, ob wir uns gut konzentrieren können oder schnell ermüden. Vielleicht wird es jetzt etwas unbequem für Sie, weil Sie sich an bestimmte Grundregeln gewöhnen müssen, Ihren Schreibtisch aufräumen, Ihre Arbeitsplatzergonomie verändern. Alle Tipps und Hinweise werden Ihnen aber das Lernleben erleichtern.
Lerntipps
Arbeiten Sie immer an einem festen Arbeitsplatz!
Wenn Sie einmal am Schreibtisch, dann auf dem Sofa und später im Bett lernen, dann ist das zwar bequem und abwechslungsreich, nur es wird Ihnen schwer fallen, die richtigen Funktionen zu erkennen. Was ist Arbeit, was ist Freizeit, was lenkt mich ab etc.? Bei Pausen- und Freizeittätigkeiten wird der Schreibtisch verlassen. Dies sollten Sie konsequent auch beim Essen, Telefonieren mit Freunden, Musik hören, Computer spielen einhalten. Der Freizeitbereich wird dadurch für Sie attraktiver.
Machen Sie einen Arbeitsplatz-Check bevor Sie loslegen!
Der Schreibtisch ist nur für die Arbeit bestimmt. Überprüfen Sie Ihren Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn auf sachfremde Gegenstände – die können ablenken, Sie an Ihr Hobby erinnern. Sie möchten dann am liebsten das tun, was mehr Spaß macht und Sie von den vermeintlich unangenehmen Dingen abhält. Suchen Sie erst alle arbeitsrelevanten Unterlagen zusammen, damit Sie Ihre Arbeit nicht immer wieder unterbrechen. Sie fangen sonst die Arbeit stets wieder neu an. Das hört sich alles sehr diszipliniert an. Es verbessert aber Ihre Arbeitsmoral und damit gleichzeitig Ihren raren Freizeitausgleich.
Unterscheiden Sie konsequent Arbeit und Freizeit!
Der Freizeitbereich sollte so abgeschirmt sein, dass Sie dort nur die angenehmen, entspannenden und ausgleichenden Dinge tun – und das mit gutem Gewissen. Sie haben es sich ja mit Disziplin verdient. Auch hier bitte konsequent bleiben. Falls Ihnen z. B. ein Fachbuch in die Hände fällt, so sollten Sie es von dort entfernen. Entscheiden Sie sich bewusst – entweder weiter auf dem Sofa entspannen oder an den Schreibtisch gehen und es dort lesen. Ein Fachbuch im Bett zu lesen, führt nicht selten zu schlechterem Behalten oder sogar Schlafstörungen.
„Ergonomisieren“ Sie Schreibtisch und Schreibtischstuhl!
Richten Sie Ihre Büromöbel so ein, dass Sie gesundheitliche Schäden vermeiden und vorzeitige Ermüdungen verhindern. Dazu folgende Hinweise:
•
Arbeitsplatte ca. 75 cm hoch einstellen, so dass Unterarme im aufrechten Sitz locker aufliegen können.
•
Sitzhöhe so einstellen, dass bei aufgestellten Füßen, die Oberschenkel waagerecht ausgerichtet sind und ohne Druck aufliegen.
•
Wählen Sie einen Stuhl mit fester Rückenlehne, damit Sie sich häufig anlehnen können, das Gesäß weit nach hinten.
•
Licht von vorne oder seitlich, d. h. bei Rechtshändern von links.
•
Arbeitsmittel wie Schreibgeräte liegen für den direkten Zugriff bereit.
•
Gleiches gilt für Gesetzestexte, Lehrbücher und Nachschlagewerke.
•
Am besten in Reichweite eine Pin-Wand für Merkzettel mit Regeln, Terminen, Notizen.
Optimieren Sie auch den PC-Arbeitsplatz!
•
Monitor so aufstellen, dass sich weder Licht noch Fenster darin spiegeln.
•
Möglichst wenig Helligkeitsunterschiede zwischen Raumlicht und Monitorhelligkeit.
•
Höhe des Monitors: Mittelachse des Monitors knapp unter Augenhöhe des Betrachters.
•
Entfernung zwischen Monitor und Auge mindestens 30 cm, Schriftgröße auf 120 bis 150% anpassen
•
Brillenträger benötigen eventuell eine sog. „Computerbrille“, also eine Lesebrille für eine etwas größere Distanz.
Multimedia kann das Lernen beeinträchtigen!
PC oder Notebook sind aus Lernsituationen kaum wegzudenken und stellen eine große Hilfe dar. Bitte beachten Sie aber auch folgende Hinweise:
•
Aus (heruntergeladenen) Texten am Bildschirm zu lernen, ist ungünstig, da die jeweils vorherigen Seiten und die folgenden nicht sichtbar sind. Damit fehlt uns eine Gesamtorientierung zum Beispiel zum schnellen Vor- und Zurückblättern wie in einem Skript oder Buch.
•
Wenn z. B. bei einer Lernsoftware stets neue Seiten aufgerufen werden, dann ist das zwar interessant und animierend, das Kurzzeitgedächtnis wird aber zu stark beansprucht. Uns fehlt die manchmal zwar langweilige, aber lerntechnisch wichtige Redundanz der Inhalte.
•
Die Augenermüdung am Bildschirm ist insgesamt größer als beim Buchlesen, deshalb sind spezielle sehr einfache Augenentspannungsübungen (z. B. mit Akupressur) sinnvoll.
•
Viele nutzen den PC dazu, um sich in einer Pause abzulenken oder sich zu belohnen. Problematisch ist, dass sich das frisch gelernte Material noch im Kurzzeitspeicher des Gehirns befindet und noch nicht verankert ist. Für ein PC-Spiel wird jetzt dort sehr viel Arbeitspeicher in Anspruch genommen und das „alte“ Lernmaterial rausgeworfen. Schade, oder? Aber etwa 30 Minuten nach der Lerneinheit geht es wieder, die Lerndaten sind dann auf der „Lernfestplatte gespeichert“.
•
Auch Hintergrundmusik belegt den Arbeitsspeicher. Werden unterschiedliche Sinneskanäle bedient, konkurrieren sie miteinander. Lesen erfolgt zum Beispiel über inneres Mitsprechen und Musik hindert an diesem Mitsprechen.
•
Also schalten Sie ab, auch wenn Musik angenehme Emotionen auslöst und grundsätzlich motivierend und lernförderlich wirken kann. Am besten hören Sie Musik in Ihrer Erholungspause.
Die Bibliothek: Eine weitere Möglichkeit zwischen Arbeit und Freizeit zu differenzieren!
Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn der Wohnbereich beengt ist und eine Differenzierung durch verschiedene Räume schwer möglich ist. Denken Sie daran, dass das Lernen nicht auf Ihren Wohnbereich beschränkt sein muss. In einem Lesesaal oder einer Bibliothek lässt es sich vielleicht sogar besser lernen, wenn man dazu neigt, sich von der Arbeit abzulenken – hier herrscht eher „Arbeitsatmosphäre“.
Auch in der Bibliothek abschirmen!
Die Universitätsbibliothek verfügt meist über stille Arbeitsbereiche, Sie können auch in öffentliche Bibliotheken gehen. Meist sind dort auch Getränkeautomaten, Kopierer etc. vorhanden. Falls Sie viele Freunde und Bekannte haben, sollten Sie die Institutsbibliothek vielleicht meiden. Ein Schwätzchen ist gut, zu viel Ablenkung addiert sich aber schnell zu einem Nachmittag ohne Lernen – und das kann frustrieren. Suchen Sie sich einen entlegenen und schwer einsehbaren Bereich. Setzen Sie sich mit dem Rücken zum Zugangsbereich.
Lernen Sie, arbeitshemmende Kontaktmöglichkeiten zu vermeiden. Man kann sich für einen gemeinsamen Kaffee, ein gemeinsames Essen verabreden. Das hat die angenehme Nebenwirkung, dass Sie eine schöne Perspektive für die anstehende Arbeitspause haben. Also fleißig arbeiten und sich dann für sein Lernverhalten belohnen.
Das „Kleinbüro“ in die Bibliothek mitnehmen und einrichten!
Wählen Sie möglichst stets den gleichen Arbeitsplatz, damit Sie sich nicht immer wieder eingewöhnen müssen und Sie das Gefühl bekommen „das ist mein Arbeitsplatz“. Richten Sie sich ein transportables „Kleinbüro“ ein, das in Ihre Aktentasche oder einen Rucksack passt. In diesem mobilen Büro sollten enthalten sein: Schreibbuch oder Ringbuch mit diversen Einlagen, Schreibgeräte nebst Ersatz, diverse Karteikarten, Schnellhefter mit Unterlagen, Schmierzettel für Zwischennotizen, falls zulässig und vorhanden, ein Notebook. Auch Kleingeld für Automaten, Schließfächer, Snacks.
1. TeilEinführung
A.Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
B.Das Zustandekommen von Rechtsgeschäften
C.Die Wirksamkeitserfordernisse
D.Die Wirksamkeitshindernisse
1. Teil Einführung › A. Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
A.Funktion und Struktur von Rechtsgeschäften
Mit der Funktion und dem Zustandekommen von Rechtsgeschäften haben wir uns bereits im ersten Band zum Allgemeinen Teil des BGB ausführlich beschäftigt. Die nachfolgenden Ausführungen dienen einer kurzen Wiederholung der wesentlichen Prinzipien.
Lesen Sie bei der Durcharbeitung dieses Skripts unbedingt die einschlägigen Normen in einem aktuellen Gesetzbuch parallel mit!
1
Mit dem Rechtsgeschäft kann eine Person nach ihrem Willen rechtlich verbindliche „Wirkungen“ (vgl. § 158[1] BGB) schaffen, also zum Beispiel Ansprüche begründen, aufheben, abtreten, Verträge anfechten, kündigen oder durch Rücktritt auflösen, Eigentum übertragen, etc. Mit dem Rechtsgeschäft macht eine Person von ihrer Privatautonomie Gebrauch. Es besteht aus mindestens einer Willenserklärung; je nach Rechtsgeschäft können noch weitere Elemente notwendig sein, um den gewünschten Erfolg herbeizuführen.
Das Rechtsgeschäft ist ein Tatbestand aus einer oder mehrerer Willenserklärungen, die allein oder in Verbindung mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist.
Die Wirkungen eines Rechtsgeschäfts werden in unserer Rechtsordnung als verbindlich anerkannt, weil sie gewollt sind – oder anders gesagt: weil sie das Ergebnis einer privatautonomen Selbstbestimmung sind.
2
Wirkungen löst ein Rechtsgeschäft regelmäßig nur aus, wenn verschiedene Voraussetzungen erfüllt sind, die je nach Art und Inhalt des konkreten Rechtsgeschäfts variieren können. Bei der Prüfung eines konkreten Rechtsgeschäfts ordnen wir die verschiedenen Voraussetzungen bestimmten Prüfungskategorien zu, die wir in eine logische Reihenfolge bringen. Wir unterscheiden gedanklich zwischen drei Kategorien: das Zustandekommen eines Rechtsgeschäfts, seine besonderen Wirksamkeitserfordernisse sowie besondere Wirksamkeitshindernisse. Diese Kategorien werden in dieser Reihenfolge gedanklich geprüft.
Zwischen dem Zustandekommen und der Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts ist streng zu unterscheiden. Wir beginnen mit dem Zustandekommen eines Rechtsgeschäfts. Erst wenn das Rechtsgeschäft zustande gekommen ist, steht fest, was gewollt ist. Erst wenn feststeht, was inhaltlich gewollt ist, wissen wir, ob und welche besonderen Wirksamkeitserfordernisse und -hindernisse für dieses Rechtsgeschäft bestehen.
Das Zustandekommen des Rechtsgeschäfts ist logisch daher an erster Stelle zu prüfen. Sodann folgen die Wirksamkeitserfordernisse und -hindernisse.[2]
In der Klausur müssen Sie selbstverständlich nur solche Wirksamkeitserfordernisse und -hindernisse erörtern, zu deren Erwähnung der Fall Anlass gibt. Keinesfalls sind alle erdenklichen Tatbestände aufzuführen. Außerdem macht die Erörterung von Wirksamkeitserfordernissen nur Sinn, wenn das Rechtsgeschäft überhaupt noch wirksam werden könnte. Steht die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts (etwa wegen unheilbaren Formmangels) von Anfang an fest, müssen Sie auf etwaige Wirksamkeitserfordernisse (z.B. Genehmigung nach § 177 Abs. 1) nicht eingehen.
[Bild vergrößern]
Anmerkungen
§§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
Dem Gesetz lässt sich die systematische (Prüfungs-)Struktur von Willenserklärung und Rechtsgeschäft nicht eindeutig entnehmen, so dass verschiedene Aufbauvorschläge existieren, die allesamt vertretbar sind. Bei der Prüfung von Willenserklärung und Rechtsgeschäft folgt dieses Skript wie auch der erste Band dem z.B. von Leenen in seinem Lehrbuch zum BGB AT vertretenen Aufbau. Dieser hat sich in meiner langjährigen Praxis als Repetitor als der günstigste Weg erwiesen, um alle Prüfungsschritte gedanklich sauber abzuschichten und möglichst nahe und widerspruchsfrei (!) am Gesetzestext zu arbeiten.
1. Teil Einführung › B. Das Zustandekommen von Rechtsgeschäften
B.Das Zustandekommen von Rechtsgeschäften
3
Zunächst ist zu fragen, ob und welches konkrete Rechtsgeschäft überhaupt zustande gekommen ist. Ein Rechtsgeschäft existiert als rechtserheblicher Tatbestand in dem Moment, in dem es zustande gekommen ist.[1] Ein einmal zustande gekommenes Rechtsgeschäft bezeichnen wir auch dann als ein Rechtsgeschäft, wenn es unwirksam ist.[2]
4
Bei einseitigen Rechtsgeschäften bedarf es zur Festlegung von Art und Inhalt dieses Rechtsgeschäfts nur einer Willenserklärung (z.B. Anfechtung, Kündigung, Rücktritt, Widerruf, Aufrechnung, Auslobung gem. § 657, die Eigentumsaufgabe nach § 959 oder das Testament).
Ein einseitiges Rechtsgeschäft kommt durch eine darauf gerichtete und als solche wirksame Willenserklärung zustande. Eine Willenserklärung ist wirksam, wenn sie abgegeben wurde, wenn sie bei Empfangsbedürftigkeit auch zugegangen ist und wenn keine Gründe vorliegen, die eine Willenserklärung nichtig machen.[3]
In hier vorgestellten Aufbau[4] wird daher gedanklich zwischen der Wirksamkeit einer Willenserklärung und der Wirksamkeit eines Rechtsgeschäfts unterschieden.
Diese in den gesetzlichen Tatbeständen angelegte (feine) Unterscheidung wird von Vielen aber häufig auch gedanklich und sprachlich zusammengefasst, indem Fragen der Wirksamkeit einer Willenserklärung zugleich als Fragen der Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts bezeichnet werden.[5]
Beide Darstellungsweisen sind vertretbar und werden nie zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es ist eher eine Frage, welche gedankliche Prüfungsreihenfolge dem Gesetzeswortlaut am nächsten kommt und zu einer möglichst einfachen und klaren Abschichtung der Themen führt. Deswegen wurde dem hier vorgestellten Ansatz der Vorzug gegeben.
Das Rechtsgeschäft „Kündigung des zwischen V und M bestehenden Mietvertrages durch den Mieter M“ kommt durch eine Kündigungserklärung zustande, also eine Erklärung, die den Willen erkennen lässt, dass das Mietverhältnis durch den Mieter M für die Zukunft beendet werden soll. Das Rechtsgeschäft „Kündigung“ ist – ob wirksam oder unwirksam – mit der Kündigungserklärung zustande gekommen. Die Kündigungsbefugnis des Erklärenden hat mit dem Zustandekommen dieses Rechtsgeschäfts nichts zu tun, sondern betrifft die Frage seiner Wirksamkeit.[6]
Sie beginnen die Prüfung eines einseitigen Rechtsgeschäfts mit seinem Zustandekommen, also mit der entsprechenden Willenserklärung. So startet beispielsweise die Prüfung des einseitigen Rechtsgeschäfts „Kündigung“ oder „Anfechtung“ mit dem Punkt „Kündigungserklärung“ bzw. „Anfechtungserklärung“.
5
Geht es um ein Rechtsgeschäft in Form eines Vertrages (z.B. Kauf, Übereignung, Abtretung), gilt die aus §§ 147, 151 S. 1 Hs. 1 folgende Grundregel: Der Vertrag kommt erst durch Annahme des Antrags zustande.
Erst wenn Antrag (Angebot) und Annahme wirksam vorliegen und den inhaltlichen sowie zeitlichen Anforderungen genügen, ist der Vertrag zustande gekommen. Erst die so erzielte Einigung legt Art und Inhalt des vertraglichen Rechtsgeschäfts fest.[7]
Aus dem Kaufangebot alleine können sich die Vertragspartner, der Kaufgegenstand und der Kaufpreis noch nicht verbindlich ergeben. Denn der Adressat des Angebots könnte das vorgeschlagene Geschäft ja gänzlich ablehnen (kein Vertragsschluss, vgl. § 146 Var. 1) oder aber Änderungswünsche haben (noch kein Vertragsschluss, vgl. § 150 Abs. 2). Was gelten soll, entscheidet erst die verbindliche Einigung über alle erheblichen Punkte.
Anmerkungen
So bereits das RG in RGZ 68, 322, 324, wonach das „äußere Zustandekommen“ eines Rechtsgeschäfts von seiner „inneren“ Wirksamkeit zu trennen ist.
Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 3.
Zur Wirksamkeit von Willenserklärungen siehe die Darstellung im Skript „„BGB AT I“ unter Rn. 97 ff.
Siehe Fußnote 2.
Vgl. etwa Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 3, wo sämtliche Aspekte, die die Wirksamkeit von Willenserklärung und Rechtsgeschäft betreffen, unter dem Begriff „Wirksamkeitsvoraussetzungen“ zusammengefasst werden.
Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 27, 28.
Ausführlich zum Zustandekommen von Verträgen siehe Skript „BGB AT I“ Rn. 238 ff.
1. Teil Einführung › C. Die Wirksamkeitserfordernisse
C.Die Wirksamkeitserfordernisse
6
Obwohl das Rechtsgeschäft zustande gekommen ist und damit existiert, werden die mit ihm verfolgten Rechtsfolgen („Wirkungen“) noch nicht unbedingt ausgelöst. Das Rechtsgeschäft kann wirkungslos, d.h. unwirksam sein. Wir unterscheiden streng zwischen dem Zustandekommen eines Rechtsgeschäfts und seiner Wirksamkeit.[1]
Je nach Art des Rechtsgeschäfts und der an ihm beteiligten Personen kennt das Gesetz zunächst besondere Wirksamkeitserfordernisse.
Wirksamkeitserfordernisse werden durch solche Normen begründet, die die Wirksamkeit eines konkret zustande gekommenen Rechtsgeschäfts von weiteren Voraussetzungen abhängig machen.
7
Das Fehlen eines Wirksamkeitserfordernisses führt nicht zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts, sondern zu seiner schwebenden Unwirksamkeit.[2] Das Rechtsgeschäft kann noch keine Wirkungen entfalten, weil es noch nicht wirksam ist. Es kann aber noch wirksam werden.
•
Fehlende Einwilligung des gesetzlichen Vertreters im Fall von § 107;
•
Fehlende Vertretungsmacht bei Vertretergeschäft in Fällen der §§ 177, 180 S. 2, 3;
•
Fehlende Realakte wie die Übergabe i.S.d. § 929 S. 1, die Eintragung im Grundbuch i.S.d. § 873 Abs. 1.
8
Diese gesetzlichen Wirksamkeitserfordernisse („Rechtsbedingungen“) sind von den rechtsgeschäftlichen Bedingungen i.S.d. § 158zu unterscheiden.
Die durch ein Rechtsgeschäft geschaffene Bedingung i.S.d. § 158 setzt die Wirksamkeit dieses Rechtsgeschäfts logisch voraus. Ansonsten würde diese Bedingung noch nicht gelten. Die Geltung der Bedingung gehört zum Inhalt des Rechtsgeschäfts und ist sozusagen seine erste Rechtsfolge. Das Rechtsgeschäft ist im Fall des § 158 Abs. 1 also notwendigerweise wirksam – das Rechtsgeschäft entfaltet aber vor Bedingungseintritt noch keine weiteren inhaltlichen Wirkungen.[3]
Anmerkungen
Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 3, 27 f.
Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 31 f.
Palandt-Ellenberger Überbl. v. § 104 Rn. 32, Einf. v. § 158 Rn. 8; Leenen „Willenserklärung und Rechtsgeschäft“, JURA 2007, 721, 722 f. unter Ziff. II 3.
1. Teil Einführung › D. Die Wirksamkeitshindernisse
D.Die Wirksamkeitshindernisse
9
Je nach Art und Inhalt des Rechtsgeschäfts und der an ihm beteiligten Personen können außerdem besondere Wirksamkeitshindernisse bestehen.
Wirksamkeitshindernisse werden durch solche Normen begründet, die zur Nichtigkeit eines konkret zustande gekommenen Rechtsgeschäfts führen.
Anders als die Wirksamkeitserfordernisse fällen die Wirksamkeitshindernisse das endgültige Urteil über die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts, indem sie es für nichtig (= endgültig unwirksam) erklären. Das Rechtsgeschäft ist von Anfang an dauerhaft gegenüber jedermann unwirksam.[1] Wirksamkeitshindernisse können sich auch aus Gesetz oder einem vorher (wirksam!) geschlossenen Vertrag ergeben.
•
Gesetzliche Nichtigkeitsanordnungen in §§ 111 S. 2, 3, 125 S. 1, 134, 138, 142 Abs. 1, 174 S. 1, 180 S. 1, 248 Abs. 1, 388 S. 2, 494 Abs. 1, 925 Abs. 2;
•
fehlende Gestaltungsbefugnis bei Ausübung eines Gestaltungsrechts, also Anfechtung ohne Anfechtungsrecht, Kündigung ohne Kündigungsgrund, Rücktritt ohne Rücktrittsrecht;
•
Verstoß gegen vertraglich vereinbartes Formerfordernis (vgl. Auslegungsregel in § 125 S. 2).
10
Bestimmte Vorschriften sehen eine abgeschwächte Form der Unwirksamkeit vor, nämlich eine „relative Unwirksamkeit“. Die Besonderheit besteht hier darin, dass das Geschäft nur gegenüber bestimmten Personen unwirksam ist, gegenüber allen anderen Personen aber wirksam.[2]
•
Veräußerungsverbote nach §§ 135, 136,
•
vormerkungswidrige Verfügung, § 883 Abs. 2.
Die Anwendungsfälle gehören thematisch ins Sachenrecht und werden dort behandelt.
11
Wir werden uns in diesem Skript mit den allgemeinen Wirksamkeitserfordernissen und -hindernissen von Rechtsgeschäften beschäftigen, die im ersten Band noch nicht behandelt wurde. Es geht um folgende Themen: Stellvertretung (§§ 164 ff.), Formvorschriften (§ 125), Verbots- oder Sittenwidrigkeit (§§ 134, 138) und Anfechtung (§§ 119 ff.). Abschließend betrachten wir die Reichweite der Nichtigkeit (§ 139), die Umdeutung nach § 140 und die Bestätigung nach § 141.
Die Wirksamkeitshindernisse des Allgemeinen Teils werden aus Gründen der besseren Verständlichkeit und zur Verdeutlichung ihrer Examensrelevanz nicht nur hier im Allgemeinen, sondern auch in den anderen Skripten bei den konkreten Rechtsgeschäften, wo sie im Examen typischerweise auftauchen, kurz wiederholt.[3]
Anmerkungen
Schreiber „Die Nichtigkeit von Verträgen“, JURA 2007, 25 ff. unter Ziff. I.
Medicus/Petersen Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 493; Schreiber JURA 2007, 25 ff. unter Ziff. I.
So werden beispielsweise Formfragen beim Kauf (§ 311b Abs. 1), Miete (§§ 550, 568), Bürgschaft (§ 766) oder Auflassung (§ 925) angesprochen und dadurch wiederholt.
2. TeilDie Stellvertretung
A.Einführung
B.Offenkundigkeitsprinzip
C.Vertretungsmacht
D.Vertragsschluss durch Vertreter ohne Vertretungsmacht, § 177
E.Einseitiges Rechtsgeschäft mit Vertreter ohne Vertretungsmacht
F.Haftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht, § 179
2. Teil Die Stellvertretung › A. Einführung
A.Einführung
2. Teil Die Stellvertretung › A. Einführung › I. Aktive und passive Vertretung
I.Aktive und passive Vertretung
12
Nach § 164 Abs. 1 S. 1 „wirkt eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, unmittelbar für und gegen den Vertretenen.“ Dies beschreibt den Fall der „aktiven“ Stellvertretung. Da das BGB auch den „Vertreter“ ohne Vertretungsmacht kennt (vgl. §§ 177 ff.), spielt die Vertretungsmacht als solche für den Definition des „Vertreters“ keine Rolle.[1]
(Aktiver) Vertreter ist, wer eine eigene Willenserklärung im fremden Namen abgibt.[2]
Hinter dem Definitionsmerkmal der „eigenen“ Willenserklärung steckt die Abgrenzung zum Erklärungsboten. Dieser überbringt lediglich eine fremde Erklärung und fungiert sozusagen als Transportmittel. Aus diesem Grunde kommt es beim Boten im Hinblick auf § 105 Abs. 1 nicht auf dessen Geschäftsfähigkeit an[3], sondern nur auf die Geschäftsfähigkeit der Person, deren Erklärung der Bote übermittelt. Im Fall der (aktiven) Stellvertretung stammt die Willenserklärung hingegen vom Vertreter, die Wirkungen des Rechtsgeschäfts sollen nach der Erklärung des Vertreters aber den Vertretenen treffen, in dessen Namen gehandelt wird. Der Vertreter ist diejenige Person, die beim Rechtsgeschäft selbständig tätig wird. Der Vertretene handelt selbst nicht. Ihn treffen aber unter den weiteren Voraussetzungen des Vertretungsrechts unmittelbar die Wirkungen des Vertreterhandelns. Man nennt diese Selbstständigkeit des Vertreters auch Repräsentationsprinzip.[4]
Daher sind beim Vertretergeschäft die Geschäftsfähigkeit und die sonstigen Wirksamkeitsfragen seiner Willenserklärung gem. §§ 116 ff. in Bezug auf die Person des Vertreters zu prüfen. So kommt es beispielsweise bei der Frage der Geschäftsfähigkeit auf die Geschäftsfähigkeit des Vertreters an und nicht auf die Geschäftsfähigkeit des Vertretenen.
13
§ 164 Abs. 3 beschreibt den Fall der „passiven“ Stellvertretung oder auch „Empfangsvertretung“. Danach soll die vorstehende Wirkung des § 164 Abs. 1 „entsprechend“ gelten, wenn eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärungdessen Vertreter gegenüber erfolgt. Mit der „passiven“ Empfangsvertretung haben wir uns bereits im 1. Band im Zusammenhang mit dem Zugang einer Willenserklärung beschäftigt.[5]
Entscheidend ist, ob die Hilfsperson die fremde Willenserklärung als selbständiger Repräsentant entgegennimmt (dann Empfangsvertreter) oder nur zur Weiterleitung an den Adressaten (dann Bote)[6].
Eine Person ist dann als Empfangsvertreter anzusehen, wenn sie ausdrücklich zu verstehen gibt oder nach den sonstigen Begleitumständen (§ 164 Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 S. 2) davon auszugehen ist, die Person nehme die inhaltlich an den Vertretenen gerichtete Willenserklärung als Repräsentant für diesen wie in eigenen Angelegenheiten entgegen und nicht nur zur Weiterleitung an diesen.[7]
Im Falle eines Vertragsschlusses durch einen Vertreter handelt dieser im Hinblick auf die eigene Erklärung als aktiver Vertreter und im Hinblick auf die Gegenerklärung als passiver Vertreter. Hier genügt es, wenn Sie die Voraussetzungen der Vertretung anhand der eigenen Erklärung des Vertreters herausarbeiten. Liegt danach ein Vertretergeschäft vor (und kein Botenhandeln), müssen Sie auf die passive Stellvertretung nicht mehr gesondert eingehen. Wer als Vertreter einen Vertrag schließt, ist immer auch als Empfangsvertreter in Bezug auf die Gegenerklärung des Vertragspartners anzusehen.[8]
Bei der Empfangsvertretung sind die Abgrenzungsfragen daher vor allem beim einseitigen Rechtsgeschäft zu behandeln. Und hier gilt: Hatte die beim Empfang der fremden Willenserklärung tätige Hilfsperson nach dem Sachverhalt Vertretungsmacht, können Sie sich kurz fassen und die Empfangsvertretung ohne Weiteres bejahen.[9] Problematisch sind also allein die Fälle, wo eine Hilfsperson ohne Vertretungsmacht aufgetreten ist. Hier kommt es auf eine saubere Abgrenzung anhand der oben aufgeführten Definition an.
14
Verfügt der Vertreter nicht über die erforderliche Vertretungsmacht, gilt § 177 Abs. 1 bzw. § 180. §§ 177, 180 sprechen jedoch nicht mehr von der „Wirksamkeit der Willenserklärung“. Vielmehr hängt nach § 177 Abs. 1„die Wirksamkeit eines Vertrages“, den jemand ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen schließt, von der Genehmigung des Vertretenen ab. Und § 180 S. 1 spricht davon, dass bei einem „einseitigen Rechtsgeschäft“ die Vertretung ohne Vertretungsmacht „unzulässig“ ist.
Warum stellt das Gesetz in § 164 auf „die Willenserklärung“, in § 177 hingegen auf „den Vertrag“ bzw. in § 180 auf das „einseitige Rechtsgeschäft“ ab?
Der Grund dafür besteht darin, dass § 164 Abs. 1 die Voraussetzungen für ein wirksames Vertretergeschäft abstrakt beschreibt und die Wirksamkeitsfragen in den folgenden Vorschriften näher präzisiert werden, und zwar je nachdem, ob der Vertreter einen Vertrag schließt (vgl. §§ 177 – 179) oder an einem einseitigen Rechtsgeschäft beteiligt ist (vgl. §§ 174, 180).[10] Die Unvollständigkeit des § 164 Abs. 1 zeigt folgendes simples
Der mit ausreichender Vertretungsmacht ausgestattete V gibt im Namen des A gegenüber dem abwesenden B ein schriftliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über einen PKW zum Preis von 5000 € ab. Das Angebotsschreiben geht dem B aber nicht zu.
Hier wird das Angebot mangels Zugangs gar nicht wirksam (§ 130 Abs. 1 S. 1), obwohl V die Erklärung getreu dem Wortlaut des § 164 Abs. 1 S. 1 innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des A abgegeben hat. Das Angebot kann mangels Zugangs gar nicht „unmittelbar für und gegen den Vertretenen (A) wirken“, wie es § 164 Abs. 1 S. 1 beschreibt.
Nehmen wir noch folgendes weiteres Beispiel hinzu:
Der mit ausreichender Vertretungsmacht ausgestattete V erklärt im Namen des Arbeitgebers A dem Arbeitnehmer B per eMail die Kündigung des Arbeitsvertrages. Auch hier entfaltet die Kündigungserklärung keine unmittelbaren Wirkungen, da die Kündigung wegen Formmangels nach §§ 125 S. 1, 623, 126 Abs. 1 von Anfang an unheilbar nichtig ist.
Die beiden Beispiele zeigen, dass die Regelung des § 164 Abs. 1 S. 1 nicht isoliert gesehen werden kann, sondern die Vorschrift ihren Sinn und Zweck erst im Zusammenspiel mit anderen Vorschriften über Willenserklärungen im Speziellen (z.B. § 130 Abs. 1 S. 1) und Rechtsgeschäfte im Allgemeinen (z.B. § 125 S. 1) erreicht.
2. Teil Die Stellvertretung › A. Einführung › II. Prüfungsreihenfolge und Aufbau in der Klausur
II.Prüfungsreihenfolge und Aufbau in der Klausur
1.Unterscheidung zwischen Vertretung und Vertretungsmacht
15
Aus der Unvollständigkeit des § 164 Abs. 1 S. 1 und der im Gutachten notwendigen Zusammenschau mit anderen Regeln sind wichtige Rückschlüsse für den Aufbau zu ziehen.
Zunächst ist bei der jeweiligen Willenserklärung zu prüfen, ob überhaupt ein Rechtsgeschäft mit Beteiligung eines Vertreters vorliegt. Die Vertretungsmacht spielt dabei noch keine Rolle. Erst auf der weiteren Ebene der Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts ist der Frage nachzugehen, ob der handelnde Vertreter über die erforderliche Vertretungsmacht verfügte.
16
Für den Vertragsschluss folgt dies aus §§ 177, 178, der § 164 ergänzt. Das Gesetz bringt in § 177 Abs. 1 zum Ausdruck, dass ein Vertrag sogar durch das Handeln eines vollmachtlosen Vertreters geschlossen werden kann, und zwar zwischen dem Vertretenen und dem Geschäftspartner. Der Vertrag ist dann allerdings noch nicht wirksam, sondern bedarf gem. § 177 Abs. 1 zu seiner Wirksamkeit noch der Genehmigung des Vertretenen. Das ist auch unmittelbar einsichtig, da es der Privatautonomie widerspricht, wenn man unbefugt Verträge mit unmittelbarer Wirkung für und gegen Dritte schließen könnte. Aber: Der Vertrag ist auch bei der Vertretung ohne Vertretungsmacht bereits als äußerlicher Regelungstatbestand zwischen dem Vertretenen (nicht Vertreter!) und dem anderen Geschäftspartner zustande gekommen. Der Vertretene – und nicht die Person des Vertreters – stehen nach dem Inhalt der Vereinbarung als Vertragspartner fest. Nur weil der Vertrag bereits derart zustande gekommen ist, kann „der Vertrag“ – und damit die in der Vereinbarung getroffenen Regelungen – Gegenstand einer rückwirkenden Genehmigung i.S.d. §§ 177, 182, 184 sein. Deshalb scheitern weder Abgabe noch Zugang von Angebot und Annahmeerklärung daran, dass ein eingeschalteter Vertreter keine Vertretungsmacht hat.[11] Der BGH hat das einmal sehr anschaulich am Beispiel eines mündlichen Vertragsschlusses durch einen Vertreter ohne Vertretungsmacht wie folgt formuliert (Hervorhebungen nur hier)[12]:
„Auch das einem vollmachtlosen Vertreter mündlich oder fernmündlich unterbreitete Angebot ist unter Anwesenden abgegeben. Für die Abgabe unter Anwesenden ist entscheidend, dass das Angebot an jemanden gerichtet ist, der es vernehmen und – entsprechend dem Erfordernis des § 147 Abs. 1 S. 1 BGB – sofort annehmen kann. Nicht anders als der berechtigte vernimmt auch der vollmachtlose Vertreter das Angebot und kann sogleich die Annahme erklären. Der Vertrag ist damit geschlossen. Beim Abschluß durch einen vollmachtlosen Vertreter ist er allerdings bis zur Genehmigung durch den Vertretenen schwebend unwirksam (§ 177 Abs. 1 BGB). Verweigert dieser die Genehmigung, ist die Unwirksamkeit endgültig. Die Genehmigung des Vertrages gehört jedoch – wie insbesondere § 182 Abs. 2 BGB zeigt – nicht mehr zum Tatbestand des Abschlusses, setzt diesen vielmehr voraus. Ein noch nicht abgeschlossener Vertrag könnte nicht genehmigt werden. Wäre bei Einschaltung eines vollmachtlosen Vertreters die Offerte stets an den (abwesenden) Vertretenen und nicht an den (anwesenden) Vertreter gerichtet, würde § 177 Abs. 1 BGB nur für den Fall der Aktivvertretung gelten. Eine derartige Einschränkung ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Sie wäre auch mit den Bedürfnissen der Praxis nicht zu vereinbaren. Könnte der (abwesende) Vertretene den (durch die Annahmeerklärung des vollmachtlosen Vertreters abgeschlossenen) Vertrag nicht durch formlose (vgl. BGHZ 125, 218, 222 ff) Genehmigung in Kraft setzen, müßte er ihn vielmehr erst durch eine – von ihm selbst oder einem bevollmächtigten Vertreter abzugebende, unter Umständen formbedürftige – Annahmeerklärung zustande bringen, würde das Verfahren in vielen Fällen umständlicher, zeitaufwendiger und teurer. Allerdings geht mit dem Zugang der Willenserklärung bei dem vollmachtlosen Vertreter das Übermittlungsrisiko auf den Vertretenen über. Das ist indessen unbedenklich, weil es der Vertretene in der Hand hat, etwaigen Mißbräuchen dadurch den Boden zu entziehen, dass er die Genehmigung des Geschäfts verweigert.“
17
Aus §§ 164, 177 Abs. 1 ergeben sich beim Vertragsschlussdurch einen Vertreter folglich zwei alternative Wirksamkeitserfordernisse: Entweder verfügt der Vertreter über die erforderliche Vertretungsmacht. Dann wirkt der Vertragsschluss – so wie es § 164 Abs. 1 beschreibt – unmittelbar für und gegen den vertretenen Vertragspartner.[13] Verfügt der Vertreter jedoch nicht über ausreichende Vertretungsmacht, ist der Vertrag zwar geschlossen, er kann aber erst unter den Voraussetzungen der §§ 177, 178 durch die Genehmigung des Vertretenen wirksam werden (ausführlich unter Rn. 147 ff.).
18
Beim einseitigen Rechtsgeschäft gibt es folgende Varianten: Der Vertreter nimmt das Rechtsgeschäft im fremden Namen vor (aktive Vertretung) oder ist an ihm nur als Empfangsvertreter beteiligt (passive Vertretung). Für beide Varianten gilt, dass das einseitige Rechtsgeschäft in Bezug auf den Vertretenen zustande kommt. Auch hier ist die Wirksamkeit dieses Rechtsgeschäfts davon gedanklich zu trennen:
Verfügte der Vertreter über die erforderliche Vertretungsmacht wirkt das Rechtsgeschäft unmittelbar für und gegen die vertretene Person, sofern alle sonstigen Voraussetzungen für die Wirksamkeit erfüllt sind.
Fehlt die erforderliche Vertretungsmacht, ist das Rechtsgeschäft nach § 180 S. 1 grundsätzlich nichtig. Ausnahmsweise kann es aber unter den Voraussetzungen des § 180 S. 2 und 3 schwebend unwirksam sein und entsprechend §§ 177, 178 durch Genehmigung wirksam werden (ausführlich unter Rn. 158 ff.).
2.Aufbaufragen
19
Ob ein Vertretergeschäft vorliegt, ob jemand also eine Willenserklärung „im Namen eines anderen“ (vgl. § 164 Abs. 1 S. 1) abgeben hat, ist nach dem eben Gesagten zwingend bei der Bestimmung des Inhalts der Willenserklärung zu untersuchen. Ob jemand als Vertreter handelt, richtet sich nach dem erkennbaren Auftreten und ist im Zweifel durch Auslegung der Willenserklärung zu bestimmen. Mit diesem sogenannten „Offenkundigkeitsprinzip“ beschäftigen wir uns unter Rn. 22 ff.
Beim einseitigen Rechtsgeschäft, bei dem ein Vertreter nur als Empfangsvertreter beteiligt ist, wird die Offenkundigkeit zunächst beim Zugang der vom ihm entgegengenommenen Willenserklärung bearbeitet.
20
Die Behandlung der Offenkundigkeit ist grundsätzlich von der Frage der Vertretungsmacht zu trennen. Denn die Vertretungsmacht betrifft ja die nachgelagerte Frage der Wirksamkeit des Rechtsgeschäftes (§ 177 Abs. 1 bzw. § 180!). Beim Vertragsschluss hat die Prüfung der Vertretungsmacht bereits bei dem Angebot bzw. der Annahme eines Vertreters also eigentlich nichts zu suchen. Entsprechendes gilt beim einseitigen Rechtsgeschäft eines Vertreters.
Trotzdem wird die Vertretungsmacht häufig bei der jeweiligen Willenserklärung des Vertreters mitgeprüft, indem die Voraussetzungen des § 164 Abs. 1 S. 1 einschließlich der Vertretungsmacht „am Stück heruntergebetet“ werden. Die kompakte Formulierung des § 164 Abs. 1 verleitet dazu. Dieser Ansatz hat insbesondere beim Vertragsschluss durch einen Vertreter so seine Tücken.[14] Denn meistens gelingt den Bearbeitern bei fehlender Vertretungsmacht der Übergang zu § 177 BGB nicht. Dieser setzt ja einen Vertragsschluss voraus. Und um den zu bejahen, muss man nicht nur die eine Willenserklärung des Vertreters, sondern sowohl Angebot als auch Annahme fertig geprüft haben.
21
Es empfiehlt sich folgender Mittelweg:
Verfügt der Vertreter nach dem Sachverhalt unproblematisch über die für das Rechtsgeschäft erforderliche Vertretungsmacht, macht es wenig Sinn, hierauf in einem gesonderten Prüfungspunkt „Wirksamkeit“ einzugehen. Sie können dann bei der Vertretererklärung direkt alle Voraussetzungen des § 164 Abs. 1 „am Stück“ prüfen und damit auch die Frage der Vertretungsmacht erledigen.
Im Falle des Vertragsschlusses durch einen Vertreter könnten Sie auch nach Prüfung der Einigung kurz darauf hinweisen, dass die Einigung keiner Genehmigung nach § 177 bedarf, da der bzw. die beteiligten Vertreter innerhalb der ihm/ihnen zustehenden Vertretungsmacht handelten und die Vertretungsmacht kurz begründen.
Besteht hingegen die Möglichkeit, dass die Vertretungsmacht bei Abschluss des Vertrages bzw. bei Vornahme des einseitigen Rechtsgeschäftes überschritten wurde oder sogar jegliche Vertretungsmacht fehlte, empfehle ich Ihnen dringend, das Thema Vertretungsmacht – so wie es § 177 bzw. § 180 vorschreibt – getrennt erst nach dem Vertragsschluss bzw. beim einseitigen Rechtsgeschäft nach der Willenserklärung als Wirksamkeitsfrage zu erörtern und auf diesen separaten Punkt am Anfang kurz hinzuweisen. Dazu folgendes
K erteilt dem S den Auftrag und die Vollmacht, in seinem Namen beim Händler V eine Waschmaschine für maximal 500 € zu erwerben. S erscheint bei V und legt seine Vertretung offen. V ist rhetorisch derart begabt, dass er den S für Maschinen eines höheren Preisniveaus begeistert. V bietet den Abschluss eines Vertrages über eine Maschine des Modells „LavoStar 999“ zu einem tatsächlich günstigen Sonderpreis von 700 € an. S meint, dass er sich dies noch überlegen und kurz Rücksprache mit K halten müsse. V sagt, er reserviere die Maschine für den Rest des Tages. S verlässt den Laden. Da S den K nicht erreichen kann, meldet er sich am selben Tag nicht mehr. Obwohl S mit K immer noch nicht gesprochen hat, teilt er dem V nach zwei Tagen durch Nachricht auf dessen Mailbox mit, er sei mit dessen Angebot einverstanden. S befürchtete, dass dem K das Schnäppchen sonst entgehen werde. K meldet sich endlich am folgenden Tag bei S. Er ist trotz des höheren Preises begeistert und stimmt dem Geschäft durch Erklärung gegenüber S zu. S meldet sich telefonisch bei V.
V lässt den S wissen, er habe mit seinem Anruf nicht mehr gerechnet und die Maschine anderweitig verkauft. Zu dem Sonderpreis könne er das Modell „LavoStar 999“nicht noch einmal anbieten.
Kann K von V trotzdem Übereignung und Übergabe einer Maschine des Modells „LavoStar 999“ zum Preis von 700 € verlangen?
Bei Wahl des hier vorgeschlagenen Lösungsansatzes könnte die Lösung folgendermaßen lauten:
Als Anspruchsgrundlage kommt hier einzig ein Kaufvertrag zwischen K und V in Betracht. Zwischen K und V müsste also ein Kaufvertrag zustande gekommen sein, der den V zur Übereignung und Übergabe einer Waschmaschine des Modells „LavoStar 999“ gegen Zahlung eines Kaufpreises von 700 € gem. § 433 Abs. 1 verpflichtet.
Der Abschluss eines solchen Kaufvertrages erfordert zwei übereinstimmende, fristgerecht mit Bezug aufeinander abgegebene Willenserklärungen, Angebot und Annahme.
Hier hat zunächst der V ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages über eine Waschmaschine zum Preis von 700 € abgegeben. Aus den Umständen ergab sich von Anfang an, dass sein Gegenüber S das Geschäft nicht im eigenen Namen, sondern als Vertreter des K vornehmen wollte. Wegen der Offenlegung des Vertreterhandelns war die Erklärung des V aus Sicht des S so zu verstehen, dass das Angebot inhaltlich auf einen Vertragsschluss mit K und nicht mit S selber gerichtet war. Die Erklärung ist durch Vernehmung des anwesenden S zugegangen, der hier als Abschlussvertreter und damit auch als Empfangsvertreter des K aufgetreten ist.
Ob S dabei auch zur Vertretung des K berechtigt war, ist nach § 177 eine Frage der Wirksamkeit des von S möglicherweise im Namen des K geschlossenen Vertrages. § 177 setzt damit den Vertragsschluss voraus und bringt zum Ausdruck, dass der Zugang der dabei ausgetauschten Erklärung nicht an Mängeln der Vertretungsmacht scheitert.
S seinerseits hatte gegenüber V im Namen des K die Annahme dieses Angebots erklärt. Diese Annahmeerklärung ging dem V auch ohne dessen Vernehmung zu, da die Erklärung im Machtbereich des V auf dessen Mailbox gespeichert wurde und unter normalen Umständen spätestens am nächsten Tag die Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand. Die Annahme deckte sich vollständig mit dem Angebot, so dass kein Dissens besteht.
Möglicherweise ist das Angebot des V aber durch Ablauf der Annahmefrist nach § 146 Var. 2 erloschen, so dass die von S verspätet erklärte Annahme den Vertrag nicht zustande gebracht hätte, sondern gem. § 150 Abs. 1 als neues Angebot anzusehen wäre. Nach § 147 Abs. 1 S. 1 kann der einem Anwesenden gemachte Antrag nur sofort angenommen werden. Da auch ein vollmachtloser Vertreter einen Vertrag schließen kann, ist bei den Annahmefristen des § 147 auf den Vertreter abzustellen, auch wenn er ohne Vertretungsmacht handelt. Das dem anwesenden V gegenüber erklärte Angebot des H konnte also nur sofort angenommen werden. „Sofort“ bedeutet im Unterschied zu „unverzüglich“ i.S.d. § 121 Abs. 1, dass auch schuldlose Verzögerungen den Antrag erlöschen lassen. Dem wird die erst nach zwei Tagen erklärte Annahme nicht gerecht. Zwar kann man hier durchaus annehmen, dass der V dem S eine Fristverlängerung i.S.d. § 148 gewährt hat, indem er dessen Wunsch nach einer Überlegungsfrist nicht widersprochen, sondern die Maschine für den Rest des Besuchstags „reserviert“ hat. Das Angebot war damit bei Ablauf des Besuchstages erloschen und konnte durch die Erklärung des S nicht mehr angenommen werden. Ein Vertrag ist damit nicht zustande gekommen.“
Die Lösung ist schlank und führt zum eigentlichen Punkt: Der Vertragsschluss scheitert an der verspäteten Annahmeerklärung. Auf die fehlende Vertretungsmacht kommt es für die Lösung gar nicht an. Es gibt keinen Vertrag, den K nach § 177 Abs. 1 hätte genehmigen können.
Anmerkungen
Leenen BGB AT § 4 Rn. 75 ff.; Häublein JURA 2007, 728 ff.
Leenen BGB AT § 4 Rn. 68.
Diese spielt indirekt nur bei der Abgrenzung von Erklärungs- und Empfangsboten eine Rolle, vgl. Skript „BGB AT I“ unter Rn. 165 ff.
Palandt-Ellenberger Einf. v. § 164 Rn. 2.
Skript „BGB AT I“ Rn. 156 ff.
Siehe im Skript „BGB AT I“ unter Rn. 158 ff.
Häublein „Entbehrlichkeit von Vertretungsmacht für das Zustandekommen von Verträgen bei Beteiligung eines Vertreters“, JURA 2007 728, 729 unter Ziff. II 1 („kurzer und knackiger“ Aufsatz – sehr lesenswert!).
Siehe im Skript „BGB AT I“ unter Rn. 160.
Siehe im Skript „BGB AT I“ a.a.O.
Lesenswert dazu Leenen BGB AT § 9 Rn. 66 ff. und Häublein JURA 2007, 728 ff.
Siehe dazu ausführlich im Skript „BGB AT I“ unter Rn. 162 ff.
BGH NJW 1996, 1062 ff. unter Ziff. B II 2 a.
Vorausgesetzt, dass keine anderen Wirksamkeitsdefizite bestehen (z.B. §§ 125, 134 oder 138).
Ausführlich und sehr lesenswert dazu Häublein JURA 2007, 728 ff. und Leenen JURA 2007, 721 ff., dort unter Ziff. V.
2. Teil Die Stellvertretung › B. Offenkundigkeitsprinzip
B.Offenkundigkeitsprinzip
22
[Bild vergrößern]
2. Teil Die Stellvertretung › B. Offenkundigkeitsprinzip › I. Grundregel beim Vertretergeschäft
I.Grundregel beim Vertretergeschäft
23
Will jemand als Vertreter im Namen eines anderen einen Vertrag oder ein einseitiges Rechtsgeschäft vornehmen, muss sich aus seiner Willenserklärung ergeben, dass nicht er, sondern ein anderer Vertragspartner sein soll. Es geht um die Offenkundigkeit des Vertreterhandelns, also des Handelns „im fremden Namen“ i.S.d. § 164 Abs. 1. Die Offenlegung des Vertreterhandelns kann einmal ausdrücklich geschehen oder sich aus den Umständen ergeben, § 164 Abs. 1 S. 2. Ob ein Eigengeschäft des Handelnden oder ein Vertretergeschäft vorliegt, ist also nach allgemeinen Auslegungsregeln gemäß §§ 133, 157 zu ermitteln.[1]
S soll im Namen seines Freundes A dessen Oldtimer beim Spezialisten B zur Überholung bringen. S kennt sich mit derartigen Sachen bestens aus und tut dem A den Gefallen gerne. S glaubt, der A habe dem B sein Erscheinen als Vertreter angekündigt, was in Wirklichkeit nicht der Fall war. S fährt mit dem Oldtimer zur Werkstatt des B. Auf dem Gelände des B sagt S: „Dieser Wagen soll komplett überholt werden. Sie wissen ja Bescheid. Wenn was ist, können Sie mich gerne anrufen. Ich kenne mich ein bisschen aus. Hier sind mein Name und meine Telefonnummer. Wann kann der Wagen wieder abgeholt werden?“ B sagt die Überholung zu und kündigt die Fertigstellung zum Ende der nächsten Woche an. S fährt mit dem Taxi nach Hause. Nachdem S dem A den Fertigstellungstermin genannt hat, kümmert er sich nicht mehr darum. Er ist sehr überrascht, als B nach einem Monat wütend bei ihm anruft und die Abholung des Wagens Zug-um-Zug gegen Zahlung von 15 000 € verlangt. Ist zwischen S und B überhaupt ein Vertrag zustande gekommen?