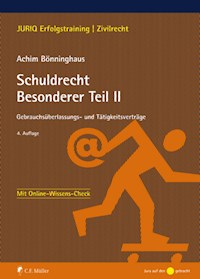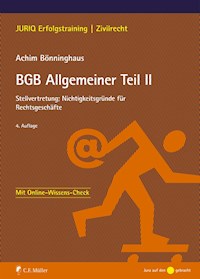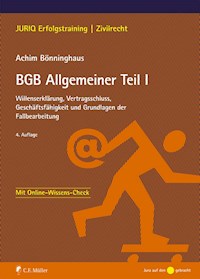19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Der Inhalt: Gegenstand des Skripts ist die Darstellung der Grundbegriffe der Rechte an Sachen sowie des Schutzes von Besitz und Eigentum (Beseitigungs-, Herausgabe- und Unterlassungsansprüche sowie Eigentümer-Besitzer-Verhältnis). Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sachenrecht I
Schutz von Besitz und Eigentum
von
Achim Bönninghaus
3., neu bearbeitete Auflage
Begründet von
Dr. Markus Ritter †
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9425-1
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2018 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre sachenrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
In diesem Skript werden wir uns ausführlich mit den Anspruchsgrundlagen zum Schutz von Besitz und Eigentum befassen. Der Schwerpunkt liegt im Finden und Aufbau dieser Anspruchsgrundlagen. Hinsichtlich der einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen kommt es zunächst einmal darauf an, das Basiswissen und das Grundverständnis hierfür zu schaffen. Außerdem will ich Ihnen die einschlägigen Klausurschemata vermitteln, die Ihnen eine Orientierung bei der Anspruchsprüfung geben sollen. Dieses Skript findet seine notwendige Ergänzung im zweiten Band mit dem Untertitel „Erwerb von Besitz und Eigentum“. Dort werden wir uns ausführlich mit den Veränderungen in der Besitz- und Eigentumslage befassen, die im Rahmen der hier behandelten Anspruchsgrundlagen meist ausführlich zu erörtern sind.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Köln, im Juli 2018
Achim Bönninghaus
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 102, 184, 232, 302, 369
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilDer Eigentums- und Besitzschutz im Überblick
A.Allgemeines zur Einführung
I.Eigentum und Besitz
II.Vorgehensweise in der sachenrechtlichen Klausur
B.Überblick zum Eigentumsschutz
I.Schutz vor Eigentumsstörungen
II.Schutz vor Besitzentziehung
III.Ersatz bei unbefugter Nutzung
IV.Ersatz bei Beschädigung und Unmöglichkeit der Herausgabe
V.Schutz bei unberechtigter Verfügung
VI.Schutz vor Unrichtigkeit des Grundbuchs
C.Überblick zum Besitzschutz
I.Schutz vor Entziehung des Besitzes
1.Possessorischer Besitzschutz (§§ 861, 869)
2.Petitorischer Besitzschutz
II.Schutz vor Besitzstörung
2. TeilDie Anspruchsgrundlagen zum Eigentumsschutz
A.Schutz vor Eigentumsstörungen nach § 1004
I.Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1
1.Anspruchsentstehung
a)Eigentum des Anspruchstellers
b)(Aktuelle) Beeinträchtigung des Eigentums
c)Störereigenschaft des Anspruchsgegners
d)Keine Duldungspflicht (§ 1004 Abs. 2)
e)Umfang der Beseitigungspflicht (§ 1004 Abs. 1 S. 1)
f)(Keine) Anfängliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1)
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a)Wegfall der Beeinträchtigung
b)Erfüllung
c)Änderungen auf Störerseite
d)Sonstige Ausschlussgründe
3.Durchsetzbarkeit
4.Konkurrenzen mit anderen Anspruchsgrundlagen
II.Unterlassungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 2
1.Anspruchsentstehung
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
III.Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 S. 2
1.Anspruch aus direkter Anwendung des § 906 Abs. 2 S. 2
a)Anspruchsentstehung
b)Rechtsvernichtende Einwendungen
c)Durchsetzbarkeit
2.Der nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch nach § 906 Abs. 2 S. 2 analog
IV.Anwendung des § 1004 auf andere absolute Rechte
1.Entsprechende Anwendung kraft Verweises
2.Analoge Anwendung
V.Übungsfall Nr. 1
B.Der Herausgabeanspruch aus § 985
I.Anspruchsentstehung
1.(Aktuelles) Eigentum des Anspruchstellers
a)Grundregel
b)Besonderheiten im Prozess
2.(Aktueller) Besitz des Anspruchsgegners
a)Grundregel
b)Besonderheiten im Prozess
3.(Kein) Recht zum Besitz
a)Eigenes Recht zum Besitz (§ 986 Abs. 1 S. 1, 1. Fall)
b)Abgeleitetes Besitzrecht (§ 986 Abs. 1 S. 1, 2. Fall)
c)Drittwirkung obligatorischer Besitzrechte, § 986 Abs. 2
4.Inhalt des Herausgabeanspruchs aus § 985
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
1.Zurückbehaltungsrecht des Besitzers nach § 1000
2.Verjährung
IV.Gegenrechte des Besitzers wegen Verwendungen
1.Anspruch aus § 994 Abs. 1
a)Anspruchsentstehung
b)Rechtsvernichtende Einwendungen
c)Durchsetzbarkeit
2.Anspruch aus §§ 994 Abs. 2
a)Anspruchsentstehung
b)Keine rechtsvernichtenden Einwendungen und Durchsetzbarkeit
3.Anspruch aus § 996
4.Anspruch aus §§ 999, 994, 996
5.Konkurrenzen der Verwendungsersatzansprüche mit anderen Ersatzansprüchen
a)Verhältnis zu vertraglichen Abwicklungsregeln
b)Verwendungsersatzansprüche bei Besitzerlangung durch Vertrag mit einem Dritten
c)Verhältnis zur GoA
d)Anwendbarkeit der §§ 951, 812 ff
V.Übungsfall Nr. 2
VI.Konkurrenzen zwischen § 985 und anderen Ansprüchen
1.Zu §§ 861, 1007, 812 ff. und §§ 823 ff., 249 Abs. 1
2.Zu vertraglichen Rückabwicklungsansprüchen
C.Nutzungsersatzansprüche des Eigentümers
I.Der Anspruch aus § 987 (ggf. i.V.m. § 990)
1.Anspruchsentstehung
a)Nutzungsziehung durch den Besitzer
b)Vindikationslage im Zeitpunkt der Nutzungsziehung
c)Besitzer bösgläubig oder auf Herausgabe verklagt
d)Keine Beschränkung durch § 991 Abs. 1
e)Anspruchsinhalt
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
II.Der Anspruch aus § 988
1.Anspruchsentstehung
a)Nutzungsziehung durch den Besitzer
b)Vindikationslage
c)gutgläubiger und unverklagter Besitzer
d)Unentgeltliche Besitzerlangung
e)Rechtsfolgenverweis auf §§ 818 ff
2.Rechtsvernichtende Einwendungen/Durchsetzbarkeit
III.Der Anspruch aus § 993
IV.Konkurrenzen
1.Verhältnis zum Bereicherungsrecht
2.Verhältnis zur GoA
D.Schadensersatzansprüche im EBV, §§ 989–992
I.Problemstellung und Konkurrenzfragen
1.Verhältnis der §§ 280 ff. zu den Schadensersatzansprüchen aus §§ 989 ff.
a)Anwendbarkeit der §§ 280 Abs. 1, 2, 286 im EBV
b)Anwendbarkeit des § 281 im EBV
c)Anwendbarkeit des § 283 im EBV
d)Anwendbarkeit des § 284 im EBV
e)Anwendbarkeit des § 285 im EBV
2.Anwendbarkeit der §§ 823 ff. im EBV
a)Grundsatz: Sperrwirkung des § 993
b)Gesetzliche Ausnahme § 992
c)Nicht geregelte Ausnahme Fremdbesitzerexzess
II.Anspruch aus § 989
1.Anspruchsentstehung
a)Vindikationslage zur Zeit des haftungsbegründenden Ereignisses
b)Rechtshängigkeit der Vindikationsklage zum Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses
c)Verschlechterung/Untergang der Sache oder sonstige Herausgabeunmöglichkeit
d)Verschulden des unrechtmäßigen Besitzers
e)Schaden des Eigentümers
2.Rechtsvernichtende Einwendungen/Durchsetzbarkeit
III.Anspruch nach §§ 990, 989
1.Anspruchsentstehung
a)Vindikationslage zur Zeit des haftungsbegründenden Ereignisses
b)Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses
c)Verschlechterung/Untergang/Herausgabeunmöglichkeit/Verschulden
d)Schaden des Eigentümers
2.Rechtsvernichtende Einwendungen/Durchsetzbarkeit
IV.Anspruch aus § 992 i.V.m. §§ 823 ff.
1.Anspruchsentstehung
a)Voraussetzungen des §§ 992
b)Tatbestand des § 823 Abs. 1
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
V.Ansprüche gegen den redlichen und unverklagten Besitzer
1.Sonderfall: Deliktischer Besitzer
2.Sonderfall: Fremdbesitzerexzess des Besitzmittlers
3.Sonstiger Fremdbesitzerexzess
VI.Zusammenfassung zu den Konkurrenzen
1.Zusätzliche Anspruchsgrundlagen bei Vorsatz
2.Anwendung des § 823 bei Fremdbesitzerexzess
3.Analoge Anwendung des § 991 Abs. 2
4.Problemfall: Anwendung des § 823 auf den (nur) bösgläubigen Besitzer?
5.Zusammenfassende Übersicht zur Anwendbarkeit der allgemeinen Vorschriften im EBV
E.Der Grundbuchberichtigungsanspruch (§ 894)
I.Anspruchsentstehung
1.Unrichtigkeit des Grundbuchs
2.Unmittelbare Beeinträchtigung des Anspruchstellers
3.Verpflichteter
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
1.Verjährung
2.Zurückbehaltungsrechte
a)Zurückbehaltungsrecht aus § 273
b)Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 analog
3.Arglisteinwand
IV.Konkurrierende Ansprüche
F.Grundbuchverfahren nach § 22 GBO
G.Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs (§ 899)
H.Übungsfall Nr. 3
I.Schutz vor unberechtigter rechtsgeschäftlicher Verfügung
J.Schadensersatzansprüche
K.Erlösherausgabeansprüche
I.Anspruch aus §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667
II.Anspruch aus § 816 Abs. 1
3. TeilBesitz und Besitzschutz
A.Possessorischer Anspruch bei Besitzentziehung
I.Anspruch auf Herausgabe aus § 861
1.Anspruchsentstehung
a)Früherer umittelbarer Besitz des Anspruchstellers
b)Unmittelbarer oder mittelbarer Besitz des Anspruchsgegners
c)Besitzentzug beim Anspruchsteller durch verbotene Eigenmacht, § 858 Abs. 1
d)Fehlerhafter Besitz des Anspruchsgegners, § 858 Abs. 2
e)Kein Anspruchsausschluss nach § 861 Abs. 2
2.Keine rechtsvernichtenden Einwendungen
a)Erlöschen des Anspruchs nach § 864 Abs. 1, Abs. 2
b)§ 864 Abs. 2 analog im Falle der petitorischen Widerklage
3.Durchsetzbarkeit
II.Anspruch des mittelbaren Besitzers auf Herausgabe aus §§ 869, 861
B.Anspruch auf Beseitigung einer Besitzstörung, § 862
I.Anspruchsentstehung
1.Der Anspruchsteller ist unmittelbarer Besitzer
2.Besitzstörung beim Anspruchsteller durch verbotene Eigenmacht, § 858 Abs. 1
3.Der Anspruchsgegner ist Störer
4.Kein Ausschluss nach § 862 Abs. 2
II.Keine rechtsvernichtenden Einwendungen
1.Erlöschen des Anspruchs nach § 864 Abs. 1, Abs. 2
2.§ 864 Abs. 2 analog im Falle der petitorischen Widerklage
III.Durchsetzbarkeit
C.Besitzwehr, § 859 Abs. 1
D.Petitorischer Besitzschutz nach § 1007 Abs. 1
I.Anspruchsentstehung
1.Anspruchsteller war Besitzer einer beweglichen Sache
2.Besitz des Anspruchsgegners
3.Der Anspruchsgegner war bei Besitzerwerb im Hinblick auf sein Besitzrecht bösgläubig
a)Objektiv fehlendes Besitzrecht
b)Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis hiervon
4.Kein Ausschluss nach § 1007 Abs. 3 S. 1
II.Keine rechtsvernichtenden Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
1.Verjährung
2.Zurückbehaltungsrecht
E.Petitorischer Besitzschutz nach § 1007 Abs. 2
I.Anspruchsentstehung
1.Anspruchsteller war Besitzer einer beweglichen Sache
2.Besitz des Anspruchsgegners
3.Dem Anspruchsteller ist der Besitz gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhandengekommen
4.Kein Ausschluss nach § 1007 Abs. 2 S. 1 Hs. 2 und 3
5.Kein Ausschluss nach § 1007 Abs. 2 S. 2
6.Kein Ausschluss nach § 1007 Abs. 3 S. 1
II.Keine rechtsvernichtenden Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
F.Deliktischer Besitzschutz
G.Besitzschutz im Bereicherungsrecht
H.Übungsfall Nr. 4
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bamberger/Roth
Bürgerliches Gesetzbuch, Band 2, 3. Aufl. 2012(zitiert: Bamberger/Roth-Bearbeiter)
Baur/Stürner
Sachenrecht, 18. Aufl. 2009
Bönninghaus
Schuldrecht Allgemeiner Teil I, 3. Aufl. 2014
Bönninghaus
Schuldrecht Besonderer Teil I, 3. Aufl. 2015
Habersack
Examens-Repetitorium Sachenrecht 8. Aufl. 2016(zitiert: Habersack Sachenrecht)
Medicus/Petersen
Bürgerliches Recht, 26. Aufl. 2017
Münchener Kommentar zumBürgerlichen Gesetzbuch
Band 8 (Sachenrecht), 7. Aufl. 2017(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Aufl. 2018(zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Prütting
Sachenrecht 36. Aufl. 2017
Westerhoff
Schuldrecht Besonderer Teil III, 2. Aufl. 2015
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 9Allgemeine Hinweise zur Prüfungsvorbereitung
Wenn noch Zeit bis zur Prüfung ist, haben Sie ausreichend Raum für eine Langzeitplanung. Termine für mündliche Prüfungen, Klausuren und Examensarbeiten sind stets langfristig bekannt. Da durch die Prüfung per se Stress erzeugt wird, sollten Vorbereitung und Zeitplanung optimal gestaltet sein. Sie schaffen sich damit Lernvoraussetzungen, die Ihnen ein Gefühl von Überblick und Beeinflussbarkeit vermitteln („Herr der Lage sein“). In einem solchen Lernklima können Sie in Ruhe, aber zügig und konzentriert arbeiten. Die folgenden Lerntipps geben Hinweise, was Sie bei Ihren Planungen für die Monate vor der Prüfung bis zum Tag X berücksichtigen können.
Lerntipps
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Arbeitsmittel und Lernvoraussetzungen! Nachdem Sie sich vergewissert haben, ob Sie die erforderlichen formalen Prüfungsvoraussetzungen erfüllt haben (Praktika, Seminarscheine, Bewertungspunkte, Termine für Anmeldefristen), verschaffen Sie sich als Erstes einen Überblick darüber, welche Arbeitsmittel benötigt werden.
–
Welche Bücher, Artikel, Skripte müssen gelesen sein? Stellen Sie sich für jedes Fach eine Literaturliste auf.
–
Beschaffen Sie sich die relevanten Arbeitsmittel so früh wie möglich.
–
Tauschen Sie sich mit früheren Examensabsolventen aus.
–
Bringen Sie in Erfahrung, welche Lern- und Arbeitszeiten (Tage, Wochen) für die einzelnen Fächer voraussichtlich benötigt werden.
–
Organisieren Sie sich eine Arbeitsgruppe.
–
Überlegen Sie gut, wo Ihr Arbeitsplatz sein soll, der eine Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und dabei kurze Wege gut ermöglicht.
–
Wählen Sie ein für Sie geeignetes Repetitorium aus.
Machen Sie sich für jedes Fach eine langfristige Zeitplanung, gegebenenfalls zeitlich versetzt oder bei Bedarf überlappend.
Verteiltes Lernen mit Wiederholungen hat eine sehr hohe Lerneffektivität!
Die Effekte von verteiltem Lernen werden in Lernthema 4 (Lernen, Behalten, Erinnern) ausführlich beschrieben. Teilen Sie die zur Verfügung stehende Zeit pro Fach so ein, dass Sie den Stoff mindestens dreimal bearbeiten können. Sie sollten mehrere Vorbereitungsphasen einplanen.
1. Aneignungsphase
Lernen
2. Vertiefungsphase
Wiederholen und Ergänzen
3. Überprüfungsphase
Schlusswiederholung
4. Evt. Sicherheitsüberprüfung
Sicherheitsabfrage zur Beruhigung
5. Freier Tag vor der Prüfung
Entspannung
Zwischen den Phasen brauchen Sie einen Zeitpuffer für Unvorhergesehenes (s.a. „Jokertage“) und freie Zeit. Generell verkürzen sich die aufeinanderfolgenden Phasen. Wieviel Zeit Sie konkret für welche Phase brauchen, hängt von Ihren bisherigen Kenntnissen, Ihren Ansprüchen, den Lernzielen und anderen Variablen ab. Sie benötigen von der Gesamt-Netto-Lernzeit circa: Aneignungsphase 40%, Vertiefung 25%, Überprüfung 10–15%, Sicherheit unter 5%, Zeitpuffer/“Jokertage“ 20%. Halten Sie sich in Ihrer Planung halbe und ganze Tage, z.B. am Wochenende frei. Planen Sie auch Urlaub mit ein. Vor der Prüfung sollte es noch einen freien Tag zur Erholung geben. Jede Woche und jeder Tag mündet in den einzelnen Phasen in einen Wochen- bzw. Tagesplan. Hier sind Pausen, Entspannungs- und „Belohnungszeiten“ ebenfalls eingeplant.
Für die Aneignungsphase brauchen Sie die meiste Zeit!
In einem Plan legen Sie für diese Phase fest, wie viele Tage und Wochen für die einzelnen Fächer erforderlich sein werden. Es werden alle Inhalte und Fächer einmal gründlich durchgearbeitet. Aktenordner werden gefüllt und Karteikarten angelegt. Halten Sie schriftlich fest, welche Themen, Inhalte oder Artikel Ihnen schwierig erscheinen. Holen Sie Zusatzinformationen zu den schwierigen Themen ein. Fragen Sie Mitlernende oder im Repetitorium. In der Aneignungsphase haben Sie den Großteil der Lerninhalte bearbeitet und weitgehend verstanden.
In der Vertiefungsphase wiederholen Sie!
Da Sie nun alle Inhalte durchgearbeitet haben, fällt es Ihnen leichter Zusammenhänge zu sehen, Querverbindungen herzustellen und kritische Stellungnahmen vorzunehmen. Diese Phase dient der Wiederholung und Vertiefung. Die erarbeiteten Lerninhalte werden zunehmend stabiler im Gedächtnis integriert.
Anfangs kann diese Phase auch eine Frustphase sein, es wird meist deutlich, welche Lücken noch bestehen. Das ist ganz normal, da das Wissen reaktiviert werden muss und nach jedem Lernen ein Vergessensprozess einsetzt. Bewahren Sie Ruhe, bleiben Sie am Ball und achten Sie nun besonders auf Ihre Vermeidungsstrategien. Arbeiten Sie Ihre früher angelegte Schwierigkeiten-Liste ab und erstellen Sie, falls erforderlich, eine neue komprimierte Frage-Liste für die nächste Phase.
In der Überprüfungsphase polieren Sie Ihr Wissen noch einmal auf!
Planen Sie auch für diesen Zeitraum (wenige Tage vor der Prüfung) die zeitliche Reihenfolge und Lerndauer in Ihre Wochen- und Tagesplanung inkl. Pausen und Entspannungszeiten ein. In diesem Arbeitsblock werden Tage vor der Prüfung die einzelnen Inhalte nochmals wiederholt und vertieft oder nur noch – zur Beruhigung – überprüft.
Planen Sie feste Jokertage ein!
Da Ihr gesamtes Lernsystem Ihnen möglichst viel Sicherheit – in der Unsicherheit – bieten soll, planen Sie Freiräume für Unvorhergesehenes ein. Diese nicht absehbaren Ereignisse können z.B sein: Erkrankung, verzögerte Buchlieferung, Veränderungen in der Arbeitsgruppe, Lernprobleme, Auto gibt den Geist auf.
Planen Sie deshalb feste Jokertage in den Terminkalender ein. Diese Tage sind für Sie frei verfügbar, aber fest terminiert. Falls es einmal zu Verzögerungen kommen sollte, dann können Sie auf diese Zeitreserve zurückgreifen, die Planung bleibt bestehen, es entsteht kein Stress. Jokertage geben Sicherheit und Zuversicht. Die nicht aufgebrauchten Jokertage können Sie mit gutem Gewissen als Belohnungsbonus für die Freizeit verwenden.
Wochen und Tage durchplanen!
Um mehrwöchige Lernphasen sinnvoll im Detail zu überwachen und zu steuern, sollten Sie aus dem Gesamtphasenplan jeweils für die anstehende Woche einen Wochenplan erstellen. Der Wochenplan besteht wie ein Stundenplan in der Schule aus Schulzeiten inkl. Wochenende.
Im Wochenplan sollten enthalten sein:
Arbeitseinheiten
–
vorgegebene feste Termine, Seminare, Vorlesungen, Repetitorium
–
Verteilung der einzelnen Lernfächer
–
Zeiten in der Lerngruppe
Freizeitblöcke
–
feststehende Freizeittermine: Sport, Klavier, Tanzen.
–
Sonstige Verpflichtungen und Vereinbarungen: Eltern, Freunde, Hausarbeit in der WG
Wichtig: Haben Sie genügend freie Zeit geplant? Haben die Freizeitwünsche im Gegenteil ein Übergewicht, dass das Lernen beeinträchtigt? Sind Jokertage berücksichtigt?
Dieser Wochenplan gibt Ihnen Orientierung für mehrere Tage. Sie sollten jedoch auch jeden Tag zeitlich und inhaltlich in einem Tagesplan strukturieren:
–
Arbeitsbeginn festlegen
–
Festtermine beachten
–
sinnvolle Reihenfolge der Tätigkeiten festlegen
–
(Kurz-)Pausen planen
–
Freizeit einplanen
Das mag sich ein wenig zwanghaft anhören, ist jedoch bei umfangreichem Lernpensum unerlässlich.
Nutzen Sie den freien Tag vor der Prüfung nur für Ihre Lust und Laune!
Viele Lernende machen den Fehler, bis zur letzten Minute zu lernen. Meist ist das ein angstbeflügeltes Vermeiden von Anspannung. Machen Sie sich deutlich, dass Sie prüfungsbezogen jetzt nichts mehr aktiv angehen können. Einen Lernzuwachs kann es nicht mehr geben, es kommt eher zu stressbedingten Lernblockaden. Das ist auch das Schwierigste an diesem Tag. Sie warten passiv auf ein wichtiges Ereignis und sind diesem quasi „ausgeliefert“. Da ist es normal, dass man sich auch von Panikattacken anderer Lernender beeindrucken lässt.
Aber Sie vergeuden Energie, die Sie besser in der Prüfung einsetzen können. Werden Sie in eine andere Richtung aktiv. Tun Sie etwas für Ihre Lust und Laune und lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit mit Ihren Aktivitäten weg von der Prüfung und Prüfungsinhalten: Kinobesuch, Sport, Sauna, Wandern – je nach Ihrem Wunsch.
Am Tag danach ist es häufig noch nicht ganz vorbei!
Sie haben sich jetzt sehr lange auf einen Punkt hin vorbereitet und sollten auch darüber informiert sein, was danach passieren kann, besonders nach Abschlussexamina. Wenn man sehr lange angespannt auf ein Ziel hinarbeitet kann es vorkommen, dass man danach nicht mehr so richtig froh ist. Das schockiert einen, da man ja alles glücklich überstanden hat. Das ist aber ganz normal. Das Verhalten ist als Entlastungsdepression bekannt. Kurze Zeit später ist alles wieder im Lot. Und dann genießen Sie die freie Zeit nach der Prüfung.
1. TeilDer Eigentums- und Besitzschutz im Überblick
A.Allgemeines zur Einführung
B.Überblick zum Eigentumsschutz
C.Überblick zum Besitzschutz
1
Wenn man sich in ein neues Rechtsgebiet einarbeitet, ist es hilfreich, wenn man sich gleich zu Beginn einen groben Überblick verschafft. Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen einen ersten Einstieg in das Sachenrecht ermöglichen.
[Bild vergrößern]
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › A. Allgemeines zur Einführung
A.Allgemeines zur Einführung
2
Nach § 903 S. 1 kann der Eigentümer mit seiner Sache „nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen“. Das Eigentum ist nach der in § 903 S. 1 gegebenen Beschreibung das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache. Diese Herrschaft umfasst die Herrschaft über die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse einer Sache.
Sachen sind nach § 90 zunächst körperliche Gegenstände.[1] Tiere sind nach der Gesetzesdefinition keine Sachen, werden aber in rechtlicher Hinsicht wie Sachen behandelt (§ 90a).
Von der Verfassung wird das Eigentumsrecht nach Art. 14 GG gewährleistet und geschützt. Das BGB gestaltet den Inhalt und Schutz in den §§ 903 ff. näher aus. Dabei muss der Gesetzgeber auch die Belange der Allgemeinheit beachten sowie die Interessen der Personen berücksichtigen, die mit fremden Eigentumsrechten in Berührung kommen. Dieser Interessenausgleich ist bereits in § 903 S. 1 angelegt, wenn es dort heißt,
„ … soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, … “.
Das Eigentum wird also nicht vorbehaltlos gewährt, sondern unterliegt Beschränkungen.
3
Das Eigentum ist ein Recht, aber noch kein Anspruch gegen eine bestimmte Person. Erst aus der Verletzung des Eigentumsrechts entstehen Ansprüche gegen den (oder die) Verletzer des Eigentums. Die Aufgabe der Ansprüche aus §§ 894,[2]985, 1004 sowie der in § 924 aufgezählten Vorschriften besteht darin, das Eigentumsrecht und die damit gem. § 903 verbundene Sachherrschaft gegen verschiedene Eingriffe zu verteidigen. Man kann auch sagen: Das Eigentumsrecht wird mit Hilfe dieser Ansprüche im Einzelfall „verwirklicht“.[3] Man spricht deshalb auch von „dinglichen Ansprüchen“, weil sie ein mit einer Sache verbundenes Recht („dingliches Recht“), nämlich das Eigentum, im konkreten Fall zur Geltung bringen.[4] Ergänzt wird dieser Schutz durch sekundäre[5] Nutzungs- und Schadensersatzansprüche (z.B. §§ 987 ff. und § 823 Abs. 1).
Aus dem Eigentumsrecht erwachsen also im Einzelfall Ansprüche, die durch verschiedene Normen im Gesetz besonders begründet werden. Es handelt sich dabei folglich um gesetzliche Schuldverhältnisse. Jedes Rechtssubjekt (Mensch, juristische Person, rechtsfähige Personengesellschaft) kann Schuldner dieser Ansprüche werden, sobald es fremdes Eigentum verletzt. Deshalb bezeichnet man das Eigentum auch als „absolutes“ Recht: Es ist von jedermann zu beachten und löst bei Missachtung Abwehr- und ggf. Ersatzansprüche aus.[6]
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › A. Allgemeines zur Einführung › I. Eigentum und Besitz
I.Eigentum und Besitz
4
Das Eigentum begründet nach § 903 das Recht, mit einer Sache nach Belieben zu verfahren und andere von jeder Einwirkung auszuschließen. Es zählt nach Art. 14 GG zu den Grundrechten und wird zivilrechtlich umfassend gegen unbefugte Eingriffe geschützt.
5
Bei dem Besitz, der im allgemeinen Sprachgebrauch mitunter mit dem Eigentum verwechselt wird, handelt es sich lediglich um die tatsächliche Sachherrschaft. Demgemäß wird der unmittelbare Besitz nach § 854 Abs. 1 allein durch die Erlangung der tatsächlichen Gewalt (Ausnahme der fiktive Erbenbesitz nach § 817 und der fingierte Besitz nach § 855) erworben. Auch der Besitz räumt dem Inhaber Abwehrrechte gegen unbefugten Eingriff Dritter ein.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › A. Allgemeines zur Einführung › II. Vorgehensweise in der sachenrechtlichen Klausur
II.Vorgehensweise in der sachenrechtlichen Klausur
6
In Ihren Prüfungsklausuren geht es regelmäßig um die Prüfung von Ansprüchen. Ausgehend von der konkreten Fallfrage ist daher die grundlegende Überlegung:
Wer will – von wem – was – warum – woraus?
Die saubere Prüfung der Frage nach dem „Warum?“ (in sachenrechtlichen Klausuren also was ist passiert, welche Art von Eingriff in Eigentum und/oder Besitz liegt vor?) führt Sie zu den in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen (Woraus?) und damit zum sicheren Einstieg in die Lösung der Klausur. Ausgehend von dieser Grundüberlegung ist die nachfolgende Darstellung des Themas eng an den jeweiligen Eingriffstatbeständen und damit an dem zu untersuchenden Anspruchsziel orientiert.
Um Ihnen den Einstieg in die sachenrechtlichen Klausuren zu erleichtern, werden wir uns im 1. Teil zunächst einen allgemeinen Überblick über das System des Eigentums- und Besitzschutzes erarbeiten. Im 2. Teil werden wir die verschiedenen Eingriffe und die Schutzmöglichkeiten anhand der klausurtypischen Anspruchsgrundlagen im Einzelnen behandeln.
Anmerkungen
Im Gegensatz zu unkörperlichen Gegenständen wie Forderungen oder Immaterialgüterrechten (Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht, etc.).
Achtung: § 894 gilt nicht nur bei unrichtig eingetragenem Grundstückseigentum, sondern auch bei anderen unrichtig eingetragenen „beschränkten“ Grundstücksrechten.
Habersack Sachenrecht Rn. 64 ff.
Palandt-Herrler Einl. v. § 854 Rn. 2; Habersack Sachenrecht Rn. 64 ff.; Medicus/Petersen Bürgerliches Recht Rn. 436.
Die Ansprüche aus §§ 894, 985, 1004 lassen sich durchaus als eigentumsrechtliche Primäransprüche begreifen, die bei Leistungsstörung (z.B. Verzögerung) Sekundäransprüche auslösen, vgl. Medicus/Petersen Bürgerliches Recht Rn. 436.
Palandt-Herrler Einl. v. § 854 Rn. 2.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz
B.Überblick zum Eigentumsschutz
7
Dieser folgende Überblick soll Ihnen nur einen ersten Überblick über die sachenrechtlichen Ansprüche im Verhältnis zu den vertraglichen, quasivertraglichen und deliktischen Ansprüchen geben, da in diesem Skript enorm viele Anspruchsgrundlagen dargestellt werden. In den folgenden Teilen werden alle im Rahmen des Überblicks erwähnten Ansprüche im Einzelnen genau dargestellt und ausführlich erläutert.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz › I. Schutz vor Eigentumsstörungen
I.Schutz vor Eigentumsstörungen
8
Gegen eingetretene Eigentumsstörungen kann sich der Eigentümer mit dem Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1 zur Wehr setzen. Sind zukünftige Störungen zu erwarten, kann der Eigentümer nach § 1004 Abs. 1 S. 2 auf Unterlassung klagen und damit den Eingriff in sein Eigentum bereits im Vorfeld verhindern.
Gartenliebhaber E hat von V ein Grundstück erworben und für viel Geld bepflanzt. A betreibt auf dem Nachbargrundstück einen Reitstall. E stellt eines Tages fest, dass ein Pferd durch seine Bepflanzung geritten ist und dadurch ein Teil der Pflanzen zerstört wurde. Verkäufer V teilt ihm mit, dass A bereits in der Vergangenheit ständig über das Grundstück geritten ist, obwohl V ihm dies untersagt hatte. Nunmehr erfährt E, dass A beabsichtigt, am kommenden Wochenende mit einer ganzen Reitgesellschaft den „neuen Reitweg“ (über das Grundstück des E) einzuweihen. Gegen diesen drohenden Eingriff in sein Eigentum kann E den A gem. § 1004 Abs. 1 S. 2 auf Unterlassung verklagen und dabei im Wege einer einstweiligen Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) bei Gericht auch vorläufigen Rechtsschutz beantragen.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz › II. Schutz vor Besitzentziehung
II.Schutz vor Besitzentziehung
9
§ 985 schützt den Eigentümer davor, dass ihm der Besitz durch einen Dritten unrechtmäßig entzogen oder vorenthalten wird. Demgemäß kann der Eigentümer von dem nichtberechtigten Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. Die Vorschrift richtet sich nicht nur gegen den unrechtmäßigen Besitzer einer beweglichen Sache, sondern auch gegen den unrechtmäßigen Besitzer eines Grundstücks.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz › IV. Ersatz bei Beschädigung und Unmöglichkeit der Herausgabe
IV.Ersatz bei Beschädigung und Unmöglichkeit der Herausgabe
13
Auch hier ist im Ausgangspunkt danach zu unterscheiden, ob die negative Einwirkung auf die Sache von einem berechtigten oder unberechtigten Besitzer oder von einem Nichtbesitzer verursacht wurde.
14
Hat ein berechtigter Besitzer den Schaden verursacht, richtet sich die Frage nach Vertragsrecht (insbesondere § 280) und nach Deliktsrecht (§§ 823 ff.).
Mieter M verursacht in der von Eigentümer V gemieteten Wohnung einen Zimmerbrand. Hierdurch und durch die Löscharbeiten wird die Wohnung erheblich beschädigt. M schuldet dem V Schadensersatz wegen Verletzung seiner Sorgfaltspflichten aus dem Mietvertrag (§§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 und aus § 823 Abs. 1 wegen Eigentumsverletzung. Die Vorschriften des EBV sind nach ganz h.M. nicht anwendbar.[2]
15
Der Nichtbesitzer haftet nach Deliktsrecht (§§ 823 ff.). Die Vorschriften des EBV sind auch hier nicht anwendbar.
A, der seinem Nachbarn N den neuen Mercedes missgönnt, zerkratzt den Lack des Fahrzeugs. Eine Haftung des A aus § 280 Abs. 1 kommt hier wegen Fehlens einer schuldrechtlichen Sonderverbindung zwischen A und N nicht in Betracht. A schuldet dem N aber wegen der Eigentumsverletzung Schadensersatz nach § 823 Abs. 1. Daneben hat sich A auch noch nach § 303 StGB strafbar gemacht (vorsätzliche Sachbeschädigung) und muss dem N auch nach § 823 Abs. 2 i.V.m. § 303 StGB (Schutzgesetzverletzung) Schadensersatz leisten.
16
War der Schädiger unberechtigter Besitzer, sind wiederum die Regeln des EBV, hier die §§ 989, 990, 991 Abs. 2, 992 einschlägig.
B hat das Fahrrad des E gestohlen und beschädigt es bei einem Verkehrsunfall. Er haftet insoweit auf Schadensersatz nach den §§ 989 ff.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz › V. Schutz bei unberechtigter Verfügung
V.Schutz bei unberechtigter Verfügung
17
Eine unberechtigte Verfügung liegt vor, wenn jemand ohne Berechtigung eine fremde Sache an einen anderen übereignet, diese mit einem Recht belastet (z.B. verpfändet), oder ein bestehendes Recht durch Rechtsgeschäft aufhebt oder inhaltlich verändert.
Der Nichtberechtigte N veräußert eine dem E gehörende Sache (Wert 1000 €) an den gutgläubigen G für 1100 €. Ist N, z.B. als Mieter berechtigter Besitzer gewesen, richtet sich die Ersatzpflicht für den Sachwert nach Vertrags- und Deliktsrecht. Für die Erlösherausgabe sind die Vorschriften über die GoA (§§ 677 ff.) und die §§ 812 ff. einschlägig.
18
War N nichtberechtigter Besitzer, so ist dem E der Sachwert nach §§ 989 ff. (ggf. auch nach § 687 Abs. 2, 678[3]) zu ersetzen. Die Erlösherausgabeansprüche, die in den §§ 987 ff. nicht geregelt sind, richten sich nach den §§ 687 Abs. 2, 681 S. 2, 667 und nach § 816 Abs. 1 S. 1.
Eigentümer E hat seinem Bekannten B sein Fahrrad geliehen, der es unbefugt an N vermietet. Dieser veräußert es ohne Zustimmung des E an den gutgläubigen G.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › B. Überblick zum Eigentumsschutz › VI. Schutz vor Unrichtigkeit des Grundbuchs
VI.Schutz vor Unrichtigkeit des Grundbuchs
19
Gibt das Grundbuch die sachenrechtliche Rechtslage unzutreffend wieder, so besteht die Gefahr, dass ein Dritter nach § 892 zu Lasten des Eigentümers von der zu unrecht eingetragenen Person das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Recht an dem Grundstück erwerben kann.
E ist Eigentümer eines Grundstücks. N ist aber zu Unrecht als Eigentümer im Grundbuch eingetragen.
Der Eigentümer kann sich hiergegen mit dem Grundbuchberichtigungsanspruch nach § 894 wehren. Für den einstweiligen Rechtsschutz steht ihm die Möglichkeit der Eintragung eines Widerspruchs gegen die Richtigkeit des Grundbuchs nach § 899 zu.
Anmerkungen
Das Gesetz sieht eine Mieterhöhung nur unter den Voraussetzungen der §§ 557 ff. vor.
Näheres dazu bei der Darstellung des EBV im 2. Teil Rn. 233.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › C. Überblick zum Besitzschutz
C.Überblick zum Besitzschutz
20
Auch der Besitz als die rein tatsächliche Herrschaft über eine Sache wird gegen unberechtigte Eingriffe geschützt.
1. Teil Der Eigentums- und Besitzschutz im Überblick › C. Überblick zum Besitzschutz › II. Schutz vor Besitzstörung
II.Schutz vor Besitzstörung
23
Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er nach § 862 Abs. 1 S. 1 von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Störungen zu besorgen, so kann er nach § 862 Abs. 1 S. 2 auf Unterlassung klagen.
M hat eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemietet. In der Wohnung über ihm wohnt der Musiker Toni Trommel (T), der abends, vorzugsweise ab 23 Uhr mit voller Lautstärke für seinen nächsten Auftritt mit seiner Band „The roaring Fifties“ übt. Hier liegt eine Besitzstörung durch verbotene Eigenmacht vor. M kann von T nach § 862 verlangen, dass die nächtliche Ruhestörung unterbleibt.
2. TeilDie Anspruchsgrundlagen zum Eigentumsschutz
A.Schutz vor Eigentumsstörungen nach § 1004
B.Der Herausgabeanspruch aus § 985
C.Nutzungsersatzansprüche des Eigentümers
D.Schadensersatzansprüche im EBV, §§ 989–992
E.Der Grundbuchberichtigungsanspruch (§ 894)
F.Grundbuchverfahren nach § 22 GBO
G.Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs (§ 899)
H.Übungsfall Nr. 3
I.Schutz vor unberechtigter rechtsgeschäftlicher Verfügung
J.Schadensersatzansprüche
K.Erlösherausgabeansprüche
24
Wie Sie gesehen haben, schützt das Gesetz den Eigentümer umfassend gegen Eingriffe in sein Eigentum. Wir wollen uns nunmehr mit den Anspruchsgrundlagen näher befassen, mit denen das Gesetz den Schutz des Eigentums verwirklicht.
2. Teil Die Anspruchsgrundlagen zum Eigentumsschutz › A. Schutz vor Eigentumsstörungen nach § 1004
A.Schutz vor Eigentumsstörungen nach § 1004
25
Den Rechtsschutz des Eigentümers vor drohenden und bereits eingetretenen Eigentumsstörungen gewährt § 1004.
26
§ 1004 ist Grundlage für zwei inhaltlich verschiedene Ansprüche, nämlich den Anspruch auf Beseitigung einer bereits eingetretenen Eigentumsbeeinträchtigung (§ 1004 Abs. 1 S. 1) und den Anspruch auf Unterlassung weiterer Beeinträchtigungen (§ 1004 Abs. 1 S. 2). Die Anspruchsvoraussetzungen ergeben sich aus dem Tatbestand des § 1004. Auf ein Verschulden kommt es bei beiden Ansprüchen nicht an.
Hieraus ergibt sich auf der Rechtsfolgenseite ein zentrales Klausurproblem, nämlich die Abgrenzung des Anspruchs aus § 1004 Abs. 1 S. 1 zu den Schadensersatzansprüchen wegen Eigentumsverletzung, die, anders als § 1004 Verschulden voraussetzen.
Das Problem bei § 1004 Abs. 1 S. 1 besteht u.a. darin, die Rechtsfolgen des Anspruchs so einzugrenzen, dass die Vorschrift nicht zu einem verschuldensunabhängigen Schadendersatzanspruch umfunktioniert wird.
Wir beginnen mit dem Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1. Die zu prüfenden Punkte können Sie dem nachfolgenden Schema entnehmen.
Für dieses Prüfungsschema gilt dasselbe wie für alle noch folgenden: Es wurden alle denkbar relevanten Prüfungspunkte und Probleme dargestellt, damit Sie einen Gesamtüberblick über die Probleme erhalten. In der Klausur dürfen Sie aber natürlich nicht „sklavisch“ alle Punkte erwähnen und abhandeln, sondern müssen gerade den Schwerpunkt auf die Prüfungspunkte setzen, die im jeweiligen Fall von Relevanz sind. Dies gilt natürlich auch für alle anderen noch folgenden Prüfungsschemata in diesem Skript!
2. Teil Die Anspruchsgrundlagen zum Eigentumsschutz › A. Schutz vor Eigentumsstörungen nach § 1004 › I. Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1
I.Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 S. 1
27
I.Anspruchsentstehung
1.Eigentum des Anspruchstellers
2.Aktuelle Beeinträchtigung des Eigentums
a)Abgrenzung zu anderen dinglichen Abwehransprüchen
aa)Kein Fall der Besitzentziehung oder -vorenthaltung (dann § 985)
bb)Kein Fall der Beeinträchtigung durch unrichtige Grundbuchlage (dann § 894)
cc)Kein Fall eines Vollstreckungseingriffs (dann § 771 ZPO)
b)Beeinträchtigung des Eigentums
Eigentumserwerb an der störenden SacheRn. 36
aa)Ausgangspunkt
Beeinträchtigung der rechtlichen HerrschaftsmachtRn. 4043
bb)Besonderheiten bei Grundstücken
Grenzüberschreitende ImmissionenRn. 46
„Negative“ Beeinträchtigungen / Vorenthaltung von StoffenRn. 47
„Ideelle“ BeeinträchtigungenRn. 48
3.Störereigenschaft des Anspruchsgegners
a)Handlungsstörer
aa)Unmittelbarer Handlungsstörer
bb)Mittelbarer Handlungsstörer
b)Zustandsstörer
4.Keine Duldungspflicht, § 1004 Abs. 2
a)Vertragliche Duldungspflicht
b)Gesetzliche Duldungspflicht (z.B. §§ 904–906, 912, 917)
c)Duldungspflicht aus § 242 (nachbarliches Gemeinschaftsverhältnis)
5.Umfang: Beseitigung der Beeinträchtigung
Beseitigung von FolgebeeinträchtigungenRn. 70
6.(Keine) Anfängliche Unmöglichkeit
II.Rechtsvernichtende Einwendungen, insbesondere
1.Wegfall der Beeinträchtigung
2.Erfüllung, § 362
3.Änderungen auf Störerseite
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
1.Anspruchsentstehung
a)Eigentum des Anspruchstellers
28
Zentrale Voraussetzung des Beseitigungsanspruchs nach § 1004 Abs. 1 S. 1 ist das Eigentum des Anspruchstellers, aus dem sich der Anspruch ableitet. Zunächst müssen Sie in der Klausur also feststellen, ob der Anspruchssteller Eigentümer der Sache ist, in Bezug auf welche er eine Beeinträchtigung geltend macht, die er beseitigt haben möchte.[1]
Sie müssen (nur) die Eigentümerstellung des Anspruchstellers prüfen. Wer früher einmal vor diesem die Eigentumsposition innehatte, ist nur dann interessant, wenn Sie einen rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb des Anspruchstellers (z.B. nach § 929) untersuchen müssen und dabei auf die Verfügungsbefugnis des Veräußerers eingehen. Diese erfordert ja grundsätzlich dessen Eigentum. Sie gehen an dieser Stelle also in der Chronologie „eine Station zurück“. Eine chronologische Darstellung der Eigentumslage, die mit einer anderen Person als dem Anspruchsteller startet, sollten Sie daher nur dann vornehmen, wenn der Sachverhalt über eine längere Kette von Erwerbsvorgängen berichtet und Sie eine verschachtelte Inzidentprüfung (bei der Verfügungsbefugnis des jeweiligen Veräußerers) vermeiden wollen.
Ergeben sich im Sachverhalt keine Anhaltspunkte für den Eigentumserwerb des Anspruchstellers, ist auf die Eigentumsvermutung des § 891 (bei Grundstücken) und des § 1006 (bei beweglichen Sachen) zurückzugreifen. Sodann ist – je nach Angaben im Sachverhalt – die Möglichkeit eines Eigentumsverlustes des Anspruchsstellers zu untersuchen.
29
Weil die Ansprüche aus § 1004 der Verteidigung des Eigentumsrechts im Einzelfall dienen, können sie nach allgemeiner Ansicht nicht isoliert abgetreten werden.[2] Sie stehen immer nur dem jeweiligen Eigentümer zu. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass dieser sein Eigentum nicht verteidigen, sein Eigentumsrecht also nicht „verwirklichen“ könnte. Sein Eigentum wäre wertlos. Die Ansprüche nach § 1004 werden daher auch als „dingliche Ansprüche“ bezeichnet, da sie untrennbar mit dem dinglichen Recht, hier dem Eigentum, verbunden sind. Der jeweilige Eigentümer kann aber eine andere Person nach § 185 Abs. 1 ermächtigen, den Anspruch aus § 1004 im eigenen Namen geltend zu machen.[3]
Dieselben Grundsätze gelten auch für die Ansprüche aus § 985 und § 894, die ebenfalls „untrennbar“ mit der Position des Eigentums verbunden sind.
30
Im Falle von Miteigentum ist nach § 1011 jeder Miteigentümer zur Geltendmachung des Anspruchs berechtigt.
b)(Aktuelle) Beeinträchtigung des Eigentums
aa)Abgrenzung zu den anderen dinglichen Abwehransprüchen
31
Lesen Sie bitte die Vorschrift des § 1004 Abs. 1 parallel im Gesetz mit!
§ 1004 Abs. 1 S. 1 grenzt den Anwendungsbereich des Beseitigungsanspruchs vom Herausgabeanspruch aus § 985 durch seinen Wortlaut ab: § 1004 greift danach ein, wenn das Eigentum „in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes“ beeinträchtigt wird. Für die Abwehr einer vollständigen Besitzentziehung oder -vorenthaltung ist dagegen der Anspruch aus § 985 einschlägig.
Eine Konkurrenz besteht allerdings in den Fällen, in denen sich die Beeinträchtigung nicht in der Besitzentziehung bzw -vorenthaltung erschöpft. Wird etwa der Besitz nur teilweise entzogen, greift § 985 hinsichtlich der Teilentziehung und § 1004 in Bezug auf die damit verbundene Störung des verbliebenen Besitzes.[4] Gleiches gilt in den Fällen, wenn der unberechtigte Besitzer das Eigentum zusätzlich beeinträchtigt, in dem er zum Beispiel die Sache auch benutzt: Dann ist in Bezug auf die Herausgabe des unberechtigten Besitzes § 985 anzuwenden und in Bezug auf die Untersagung der Nutzung § 1004.[5]
32
Besteht die Beeinträchtigung von Grundstückeigentum darin, dass das Eigentum oder eine Belastung des Eigentums (z.B. mit einer Grundschuld) im Grundbuch falsch ausgewiesen ist, geht der Grundbuchberichtigungsanspruch aus § 894 dem Anspruch aus § 1004 vor.[6]