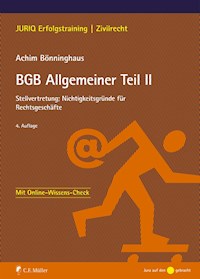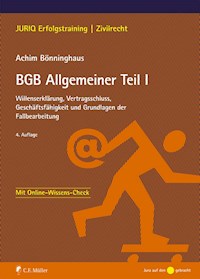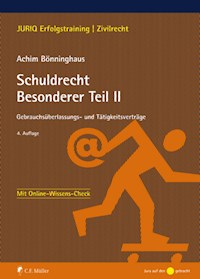
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Inhalt: Gegenstand des Skripts ist die Darstellung der verschiedenen rechtlichen Formen der Gebrauchsüberlassung sowie der Tätigkeitsverträge mit ihren Bezügen zum Allgemeinen Teil des BGB und zum Allgemeinen Schuldrecht. Im 1. Teil werden Miete, Pacht, Leihe und Darlehen behandelt. Der 2.Teil widmet sich dem Dienstvertrag, dem Behandlungsvertrag, dem Auftrag sowie der Geschäftsbesorgung und ihr ähnlichen Verträgen. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Schuldrecht Besonderer Teil II
Schuldrecht Besonderer Teil II
Gebrauchsüberlassungs- und Tätigkeitsverträge
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9056-7
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 6221/1859-599Telefax: +49 6221/1859-598
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2021 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript beschäftigt sich in seinem ersten Teil mit den Verträgen, die auf eine nur vorübergehende Überlassung eines Gegenstandes zum Zwecke des befristeten Gebrauchs gerichtet sind. Ausführlich werden Miete, Leihe sowie das Darlehen behandelt, wobei Pacht, Leasing und die sonstigen Finanzierungshilfen an passender Stelle zusätzlich berücksichtigt werden. Im zweiten Teil widmen wir uns den tätigkeitsbezogenen Verträgen, nämlich dem Dienstvertrag, dem Auftrag und Geschäftsbesorgungsvertrag mit seinen verwandten Verträgen wie dem Makler- und Verwahrungsvertrag sowie dem Behandlungsvertrag als Sonderform des Dienstvertrages.
Wie immer werden die wesentlichen Ansprüche wie im Gutachten in der Schrittfolge „Anspruch entstanden?“, „Anspruch erloschen?“ (= „rechtsvernichtende Einwendungen“) und „Anspruch durchsetzbar?“ dargestellt. Im Laufe des Skripts und der gesamten Skriptenreihe mag es dabei zu Wiederholungen einzelner Punkte kommen – dies ist durchaus gewollt. Wenn Sie nach dem Durcharbeiten dieses Bandes die einzelnen Prüfungspunkte „im Schlaf herunterbeten“ können, haben die Wiederholungen ihr Ziel erreicht. Das einem Kapitel jeweils vorangestellte Prüfungsschema soll Ihnen als Orientierungshilfe und „Checkliste“ für die gedankliche Durchprüfung des betreffenden Anspruchs dienen. Aber Achtung: Keineswegs müssen in der Klausur alle Punkte schriftlich abgearbeitet werden – was offensichtlich irrelevant ist, hat in der schriftlichen Ausarbeitung nichts zu suchen.
Die in den Fußnoten nachgewiesene Rechtsprechung des BGH ist durchaus als Leseempfehlung zu verstehen. Um das Nacharbeiten zu erleichtern, haben wir uns um eine möglichst genaue Angabe der Fundstelle innerhalb der Entscheidung bemüht.[1]
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an mich unter [email protected]. Bei der Neuauflage konnte ich viele Zuschriften berücksichtigen, für die ich mich wieder herzlich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte.
Köln, im Januar 2021
Achim Bönninghaus
Anmerkungen
Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik. „Entscheidungen“) abrufen.
Codeseite
JURIQ Erfolgstraining –die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 108, 142, 228, 621, 709
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilGebrauchsüberlassungsverträge
A.Der Mietvertrag
I.Wirksamer Mietvertrag
1.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 535
a) Vertragspartner
b) Mietsache
c) Hauptleistungspflichten gem. § 535/Abgrenzungen
d) Beginn des Mietverhältnisses
2.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
a) Allgemeine Wirksamkeitserfordernisse
b) Allgemeine Wirksamkeitshindernisse
II.Primäranspruch des Mieters gem. § 535 Abs. 1
1.Anspruchsentstehung
a) Wirksamer Mietvertrag und Anspruchsumfang
b) Änderungen in der Person des Anspruchsinhabers bzw. Schuldners
c) Eintritt eines vereinbarten Anfangstermins
d) Besondere Anspruchsvoraussetzung: Mangel
e) (Keine) Anfängliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1)
f) Weitere rechtshindernde Einwendungen (nur in Bezug auf Gewährleistungspflicht)
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a) Erfüllung und Erfüllungssurrogate
b) Nachträgliche Leistungsbefreiung nach § 275
c) Fristablauf
d) Eintritt einer auflösenden Bedingung
e) Kündigung/Rücktritt/Widerruf
3.Durchsetzbarkeit
a) Fälligkeit
b) Einreden
4.Übungsfall Nr. 1
III.Primäranspruch des Vermieters gem. § 535 Abs. 2
1.Anspruchsentstehung
a) Wirksamer Mietvertrag
b) Änderungen in der Person des Anspruchsinhabers bzw. Schuldners
c) Sonstige Voraussetzungen/rechtshindernde Einwendungen
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a) Erfüllung und Erfüllungssurrogate
b) Nachträglicher Wegfall gem. § 326 Abs. 1 S. 1 und § 537 Abs. 2
c) Nachträglich begründete Minderung (§ 536)
d) Beendigung des Mietverhältnisses
e)Auswirkungen der Corona-Krise auf den Mietanspruch
3.Durchsetzbarkeit
a) Fälligkeit
b) Einreden
4.Übungsfall Nr. 2
IV.Rechte des Mieters bei Mängeln
1.Anspruch auf Mängelbeseitigung, § 535 Abs. 1 S. 2
a) Anspruchsgrundlage
b) Prüfung
2.Aufwendungsersatz bei/Vorschuss für Selbstvornahme aus § 536a Abs. 2
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
3.Minderung der Miete
a) Wirkungen des § 536
b)Kein Ausschluss
4.Schadensersatzanspruch aus § 536a Abs. 1
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
d) Konkurrenzen
5. Aufwendungsersatzanspruch aus § 284 i.V.m. § 536a Abs. 1
6.Kündigungsrecht, § 543 Abs. 2 Nr. 1
a) Gewährleistungspflichtiger Mangel
b) Erfolgloser Fristablauf
c) (Kein) Ausschluss nach § 543 Abs. 4 S. 1
d) (Keine) Verwirkung (§ 242)
7.Übungsfall Nr. 3
V.Sonstige Ansprüche des Mieters
1.Aufwendungsersatz aus § 539 Abs. 1
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
2.Anspruch auf Duldung der Wegnahme, § 539 Abs. 2
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
3.Ansprüche auf Zustimmung
4.Rückerstattung im Voraus entrichteter Miete (§ 547)
5.Allgemeine Schadensersatzansprüche
VI.Sonstige Ansprüche des Vermieters
1.Unterlassungsanspruch aus § 541
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
2.Vornahme von Schönheitsreparaturen
3.Anspruch auf Sicherheitsleistung
a) Vertraglicher Anspruch
b) Gesetzliche Anspruch auf Sicherheitsleistung
c) Rückgabe einer geleisteten Sicherheit
4.Anspruch auf Rückgabe der Mietsache, § 546
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
5.Entschädigungsanspruch aus § 546a Abs. 1
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
6.Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung
a) Anspruchsgrundlagen
b) Pflichtverletzung
c) Besonderheiten
VII.Vermieterpfandrecht
1.Entstehung des Vermieterpfandrechts
a) Wirksamer Mietvertrag über Räume oder Grundstücke
b) Forderung des Vermieters
c) Pfändbare, bewegliche Sache des Mieters
d) „Einbringen“ durch den Mieter
2.Erlöschen des Vermieterpfandrechts
a) Entfernung der Sache, § 562a
b) Sonstige Erlöschensgründe
3.Schutz und Geltendmachung
VIII. Beendigung des Mietvertrages durch Kündigung
1.Kündigungserklärung
2.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
a) Allgemeine Regeln
b) Insbesondere: Formnichtigkeit
3.Kündigungsbefugnis
a) Allgemeines
b) Ordentliche Kündigung
c) Außerordentliche Kündigung
4.Keine Verlängerung
B.Der Pachtvertrag
I.Abgrenzung vom Mietvertrag
II.Regelung mit Ausnahme der Landpacht
1.Verweis auf Mietrecht
2.Besonderheiten
III.Landpacht (§ 585)
C. Leihe
I.Wirksamer Leihvertrag
1.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 598
a) Allgemeine Regeln und notwendiger Inhalt
b) Abgrenzung zu anderen Verträgen
c) Abgrenzung zum Gefälligkeitsverhältnis
2.Wirksamkeit des Vertrages
II.Ansprüche des Verleihers
1.Rückgabeanspruch des Verleihers aus § 604
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
2.Unterlassungsanspruch analog § 541
3.Anspruch auf Erhaltung aus § 601 Abs. 1
4.Ansprüche wegen Pflichtverletzung
a) Anspruchsgrundlagen
b) Pflichtverletzung
c) Besonderheiten
III.Ansprüche des Entleihers
1.Anspruch auf Erstattung von Verwendungen, § 601 Abs. 2
a) Anspruchsentstehung
b) Rechtsvernichtende Einwendungen
c) Durchsetzbarkeit
2.Anspruch auf Duldung der Wegnahme, § 601 Abs. 2 S. 2
3.Schadensersatzanspruch aus § 600
a) Anspruchsentstehung
b) Weitere Prüfung
4.Schadensersatzansprüche wegen sonstiger Pflichtverletzungen
a) Anspruchsgrundlagen
b) Haftungsprivileg
5.Übungsfall Nr. 4
D. Darlehen
I.Systematik
1.Darlehensarten
2.Verbraucherdarlehen
a)Entgeltliches Darlehen (§ 491 Abs. 2)
b) Persönlicher Anwendungsbereich der §§ 491 ff.
c)Ausnahmen, § 491 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 2
d) Analoge Anwendung der §§ 491a ff
II.Wirksamer Darlehensvertrag
1.Einigung mit Inhalt nach § 488
2.Wirksamkeit des Vertrages
III.Primäranspruch des Darlehensgebers (§ 488 Abs. 1 S. 2)
1.Anspruchsentstehung
a) Wirksamer Darlehensvertrag
b) Inanspruchnahme des Darlehens
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a) Erfüllung und Erfüllungssurrogate
b) Widerruf bei Verbraucherdarlehensvertrag (§ 495)
c) Sonstige
3.Durchsetzbarkeit
a) Fälligkeit des Rückzahlungsanspruches
b) Fälligkeit des Zinsanspruches
c) Einreden
IV.Sekundäransprüche des Darlehensgebers
1.Anspruchsgrundlagen
2.Besonderheiten beim Verbraucherdarlehensvertrag
a) Ausgangspunkt
b) Zinsregelung in § 497
V.Ansprüche des Darlehensnehmers
1.Primäranspruch gem. § 488 Abs. 1 S. 1
2.Sekundäransprüche
VI.Besondere Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträge
1.Grundvoraussetzung der §§ 506 ff
2.Entgeltliche Finanzierungshilfen i.S.d. § 506
a) Teilzahlungsgeschäft i.S.d. §§ 506 Abs. 3, 507 f.
b) Entgeltliche Nutzungsverträge mit Abnahme- oder Ausgleichspflicht, § 506 Abs. 2
c) Entgeltlicher Zahlungsaufschub (§ 506 Abs. 1 Var. 1)
3.Ratenlieferungsvertrag i.S.d. § 510
2. TeilTätigkeitsverträge
A.Der Dienstvertrag
I.Wirksamer Dienstvertrag
1.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 611
a)Vertragsschluss
b)Abgrenzungen
2.Wirksamkeitsvoraussetzungen
a)Allgemeine Regeln
b)Verbots- und sittenwidriger Dienstvertrag (§§ 134, 138)
c)Nichtigkeit wegen Anfechtung (§ 142 Abs. 1)
II.Der Primäranspruch des Dienstberechtigten
1.Anspruchsentstehung
a)Wirksamer Dienstvertrag
b)Art und Inhalt der Tätigkeit
c)Sonstige Voraussetzungen
d)(Keine) Anfängliche Unmöglichkeit
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a)Erfüllung und Erfüllungssurrogate
b)Nachträgliche Leistungsbefreiung (§ 275)
c)Tod des Dienstverpflichteten
d)Fälle der §§ 281 Abs. 4, 355
e)Beendigung des Dienstvertrages
3.Durchsetzbarkeit
a)Fälligkeit
b)Einreden
III.Der Primäranspruch des Dienstverpflichteten
1.Anspruchsentstehung
a)Wirksamer Dienstvertrag
b)Sonstige Voraussetzungen
c)Anfängliche Unmöglichkeit der Dienstleistung (§ 326)
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a)Erfüllung und Erfüllungssurrogate
b)Sonderfall des § 300 Abs. 2
c)Nachträgliche Unmöglichkeit der Dienstleistung
3.Durchsetzbarkeit
IV.Beendigung des Dienstvertrages für die Zukunft
1.Fristablauf/Eintritt einer auflösenden Bedingung
a)Befristung
b)Eintritt einer auflösenden Bedingung
2.Kündigung
a)Wirkung der Kündigung
b)Ausübung durch Kündigungserklärung
c)Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
d)Kündigungsbefugnis
e)Aufhebungsvertrag
f)Stillschweigende Verlängerung, § 625
V.Sekundäransprüche bei Pflichtverletzungen
VI.Übungsfall Nr. 5
B.Behandlungsvertrag
I.Rechtsnatur und Abgrenzungen
1.Rechtsnatur
2.Abgrenzungen
a)Abgrenzung zum freien Dienstvertrag
b)Abgrenzung zum Werkvertrag
c)Abgrenzung zur GoA
d)Abgrenzung zur hoheitlichen Tätigkeit
II.Die Parteien des Behandlungsvertrages
1.Der Behandelnde
2.Der Patient
III.Form
IV.Die Pflichten der Vertragsparteien
1.Pflichten des Behandelnden
a)Hauptleistungspflichten
b)Nebenleistungs- und Nebenpflichten
2.Pflichten des Patienten
a)Hauptleistungspflichten
b)Mitwirkungspflichten
V.Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler
1.Beweislast für Behandlungsfehler
a)Realisierung des allgemeinen Behandlungsrisikos
b)Fehlender Nachweis der Patientenaufklärung und Einwilligung
c)Nichtdokumentation
2.Vermutung des Vertretenmüssens
3.Kausalitätsvermutungen
a)Fehlende Befähigung
b)Grober Behandlungsfehler
c)Einfacher Befunderhebungs- und sicherungsfehler
C.Auftragsvertrag
I.Abschluss eines wirksamen Auftrages
1.Einigung auf einseitige Leistungspflicht gem. § 662
a)Vertragsschluss
b)Abgrenzungen
2.Wirksamkeitsvoraussetzungen
II.Primäranspruch des Auftraggebers, § 662
1.Anspruchsentstehung
a)Wirksamer Auftrag
b)Art und Inhalt der Tätigkeit
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a)Allgemeine Regeln
b)Beendigung des Auftrages
3.Durchsetzbarkeit
III.Übungsfall Nr. 6
IV.Nebenleistungspflichten
1.Herausgabepflicht, § 667
2.Informationspflichten, § 666
V.Pflichten des Auftraggebers
1.Allgemeines
2.Aufwendungsersatz gem. § 670
a)Aufwendungen
b)Umfang
VI.Pflichtverletzungen
1.Allgemeines
2.Haftungserleichterungen beim Auftrag?
D.Geschäftsbesorgungsvertrag und ähnliche Verträge
I.Geschäftsbesorgung i.S.d. § 675
1.Einheitstheorie
2.Trennungstheorie
II.Rechte und Pflichten der Parteien
III.Abgrenzungen zu weiteren Vertragstypen
1.Beratungs- und Auskunftserteilungsverträge
2.Zahlungsdienstverträge, §§ 675c ff.
3.Verwahrungsvertrag, §§ 688 ff.
4.Maklervertrag, §§ 652 ff.
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bamberger, Heinz Georg/Roth, Herbert
Bürgerliches Gesetzbuch, Band 1, 4. Aufl. 2018
Bönninghaus, Achim
BGB Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2018
Bönninghaus, Achim
BGB Allgemeiner Teil II, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Allgemeiner Teil II, 4. Aufl. 2020
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Besonderer Teil I, 4. Aufl. 2019
Jünger, Jean-Martin
Arbeitsrecht, 4. Aufl. 2020
Looschelders, Dirk
Schuldrecht Besonderer Teil, 10. Aufl. 2015
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 27. Aufl. 2019
Palandt, Otto
Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Aufl. 2020 (zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Schade, Lutz
Handels- und Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2017
Tipps vom Lerncoach
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 6Methoden zum besseren Lernen und Behalten
Viele Lernende stellen sich die Frage, wie sie den umfangreichen Lernstoff noch besser aufnehmen, verstehen und wiedergeben können. In einem ersten Schritt geht es in den Lerntipps um die Erkenntnisse der Lernforschung zum Thema „Lernkanäle“. Dann erhalten Sie praktische Tipps zu einer speziellen Lesemethode und einem System des Wiederholungslernens.
Lerntipps
Viele Aufnahmekanäle führen zum Lernen!
Die häufigsten Lernkanäle sind Lesen (Text), Sehen (natürliche Situationen, Abbildungen), Hören (Vorlesung, Diskussion) und Handeln (selbst aufschreiben, anderen erzählen). Über die genaue Nutzungseffektivität der Lernkanäle gibt es wenig gesicherte Erkenntnisse. Dennoch gibt es einen Vorteil, wenn Sie unterschiedliche Kanäle für gleiche Lerninhalte nutzen. Die unterschiedlichen Aufnahmemodi erlauben unterschiedliche Orte der Abspeicherung des gleichen Lerninhalts im Gehirn. Der Lerngegenstand wird dem Gehirn damit zum einen „plastischer“, und beim Erinnern haben wir zum anderen mehr als eine Zugriffsmöglichkeit auf das Gelernte.
Folgende Tipps dazu zusammengefasst:
•
Wenn es nur irgendwie geht, machen Sie sich den Stoff auf unterschiedlichen Kanälen zugänglich.
•
Wichtige Begriffe, Definitionen sollten gelesen, gesprochen, geschrieben, gehört und in einen Sinnzusammenhang gebracht werden.
•
Sprechen Sie Fragen und Antworten vor sich hin – denken Sie laut!
•
Schreiben Sie sich Lernmaterial auf (z.B. Karteikarten).
•
Lesen Sie nach bestimmten Methoden (z.B. SQ3R-Methode).
•
Nutzen Sie eLearning.
•
Hören Sie Argumente, Querverbindungen von Studienkollegen, Dozenten.
SQ3R – Sie werden sich wundern!
Sie erinnern sich an den letzten Roman, den Sie gelesen haben. Drama, Liebe, Spannung, Unterhaltung … . Einen Roman beginnt man üblicherweise vorn zu lesen, häufig folgt er einem Zeitstrahl, hat Höhepunkte, lebendige Charaktere, erzeugt bei Ihnen Erlebniswelten mit Gefühlen und persönliche Identifikationsmöglichkeiten. Ein Fachbuch greift nicht auf die stilistischen Mittel eines Romanautors zurück, sondern benutzt den „roten Faden der Sachlogik“. Trotz allem lesen viele Lernende Fachbücher und -artikel wie Romane von vorne bis hinten (und damit häufig ohne Höhepunkt).
Die Ergebnisse des Lernforschers Robinson (Erfinder der Wunderformel SQ3R) zeigen:
•
Mit der Romanlesemethode wird bei Fachtexten nur die Hälfte des Gelesenen inhaltlich aufgenommen.
•
Das nochmalige Durchlesen nach dieser Methode erbringt kaum Verbesserungen.
Fachtexte müssen mit besonders dafür entwickelten Lesetechniken erarbeitet werden. Dafür wurde die Methode SQ3R von Robinson entwickelt. Obwohl sich das kompliziert anhört, ist die Methode aber einfach anzuwenden und sehr effektiv.
Survey – Verschaffen Sie sich den Überblick!
Lesen Sie nicht, sondern erforschen Sie grob, was auf Sie zukommt.
Bei einem Buch, Artikel oder Text können Sie z.B. folgendermaßen vorgehen:
•
Titel, Überschriften und Unterüberschriften, Inhaltsverzeichnis lesen
•
Zusammenfassungen, Umschlagtexte eines Buches lesen
•
Abbildungen, Tabellen und ihre Überschriften ansehen
•
Texthervorhebungen gegebenenfalls überfliegen.
Diese Phase dauert nur wenige Minuten. Das weitere Lesen ist nicht mehr orientierungslos, sondern trifft auf eine sinnvolle Struktur. Es wird eine Erwartungshaltung und Neugier erzeugt, welche die Aufnahmebereitschaft begünstigt.
Question – Stellen Sie sich Fragen!
Sie sollten sich jetzt immer noch bremsen mit dem Lesen. Es wurde eine Erwartungshaltung bei Ihnen erzeugt, es tauchen Fragen in Ihrem Kopf auf, Ihr Gehirn ist auf aktive Suche umgeschaltet. Stellen Sie sich jetzt Fragen, die Sie bei Bedarf auch aufschreiben können:
•
Was stelle ich mir unter diesem Thema vor?
•
Was weiß ich bereits von dem Stoff? Was über den Autor?
•
Welche Kapitel und Überschriften werden genannt?
•
Welche unbekannten Fachbegriffe tauchen auf?
•
Welche Verbindungen sehe ich zu anderen Themen?
•
Welche spezifischen Fragen tauchen auf?
Sie werden schneller vorgegebene Strukturen des Textes erkennen, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden können. Sie lernen immer spezifischer Ihre Sachfragen zu stellen, um diese später gezielter zu beantworten.
Read – Lesen Sie jetzt gründlich Abschnitt für Abschnitt!
Sie sind jetzt gut vorbereitet. Lesen den Text bitte langsam und konzentriert durch und beachten Sie folgende Hinweise:
•
Erkennen Sie die vorgegebene Struktur des Textes, beachten Sie Gliederungshierarchien und ordnen Sie danach ein, was Haupt- und Unterpunkte sind.
•
Schlagen Sie unbekannte Fachbegriffe direkt nach und klären Sie diese im Kontext.
•
Beachten Sie grafische Hervorhebungen im Text besonders (fett, kursiv, Einrückungen).
•
Beachten Sie auch sprachliche Hervorhebungen („wesentlich, von zentraler Bedeutung, kritisch ist, wie oben erwähnt, im Gegensatz zu ...“).
•
Finden Sie die Hauptaussagen der einzelnen Abschnitte.
•
Heben Sie zusätzlich für Sie Wesentliches hervor durch Markierungen im Text oder am Seitenrand mit Bemerkungen (z.B. „Theorie, Vergleiche, Kritik, Ergebnis, Bezug“).
•
Lassen Sie sich anfangs nicht davon verwirren, Sie werden später derartige Worthinweise und Kernideen dann immer schneller finden.
Nach dem Lesen eines Abschnittes machen Sie eine kleine Pause von 3 Minuten.
Recall – Wiederholen Sie und fassen Sie jeden Abschnitt schriftlich zusammen!
Nachdem Sie einen Abschnitt gelesen haben, sind Sie in der Lage, die wesentlichen Inhalte ohne Vorlage wiederzugeben. Sie können die Kernaussagen im Geiste wiederholen. Bei komplexeren Lerninhalten sollten Sie sich aber schriftliche Notizen machen.
Gehen Sie wie folgt vor:
•
Schreiben Sie die wichtigsten Begriffe, Kerngedanken kurz auf und gebrauchen Sie dabei Ihre eigenen Formulierungen.
•
Beantworten Sie die unter „Question“ gestellten spezifischen Fragen.
•
Erstellen Sie eigenständig Tabellen, Abbildungen, Gliederungen und Schemata, um komplizierte Inhalte zu veranschaulichen.
Auf diese – erst einmal zeitaufwändige Weise – haben Sie nun eine aussagekräftige Sammlung wesentlicher Inhalte, die Sie möglichst gut auffindbar in Aktenordnern oder auf Karteikarten für die spätere Verwendung dokumentieren können. In der Vorbereitung der Prüfungen und Arbeitsgruppensitzungen können Sie gezielter darauf zurückgreifen.
Review – Wiederholen Sie den gesamten Text mündlich!
Jetzt kommt die Zusammenschau in einer mündlichen Wiederholung. Gehen Sie dafür noch einmal alle Überschriften, Gliederungen, Hervorhebungen und Notizen (zügig) durch, um gut auf Ihre mündliche Nacherzählung vorbereitet zu sein. Stellen Sie sich nun mündlich die wesentlichen Aussagen des Textes vor. Sie können dabei auch Vergleiche, Querverbindungen zu anderen Texten oder ähnlichen Theorien herstellen.
Üben Sie die SQ3R Methode!
Erarbeiten Sie jetzt einen einfachen nicht allzu langen Text nach der SQ3R Methode. Sie werden bei häufigerer Anwendung merken, dass diese Arbeitstechnik genial einfach ist, dank Robinson.
SurveyErforschen, Überblick gewinnen: Titel, Kapitel, Überschriften, Zusammenfassungen
QuestionFragen stellen: Was weiß ich bislang zum Thema, Autor?Was möchte ich gerne wissen?
ReadLangsames Lesen des Textes/Abschnitts mit Hervorhebungen und Bemerkungen
RecallWiederholen und schriftliches Zusammenfassen der wichtigsten Inhalte mit eigenen Formulierungen
ReviewNacherzählen und Wiederholen des gesamten Textes mit Querverbindungen, Kritik
Die SQ3R Methode hilft vor allem beim Erlernen von Zusammenhangswissen.
Wiederholen Sie auch Ihr Faktenwissen (z.B. Definitionen) mit System!
Sie kennen vom Vokabellernen vielleicht, dass es für einen aktiven Wortschatz besonders günstig ist, Vokabeln nach individueller Schwierigkeit z.B. auf Karteikarten zu lernen und nicht nach Kapiteln. Erstellen Sie sich analog eine differenzierte Lernkartei für Definitionen, die Sie so regelmäßig wiederholen können. Vielleicht eignet sich das grundlegende Wiederholungssystem auch für Schemata. Probieren Sie es aus!
•
Jede neue Definition wird auf eine kleine Karteikarte (ca. 7 x 10 cm) geschrieben. Auf der einen Seite ist der Begriff, auf der anderen Seite die Definition.
•
Je nach subjektiv empfundener Schwierigkeit werden die Karten in fünf unterschiedliche Pakete eingeteilt.
•
Nehmen Sie einen Karteikasten mit fünf möglichst unterschiedlich großen Fächern.
•
Die schwierigsten Karten kommen in das kleinste, die leichtesten in das größte Fach. Sie brauchen auf jeden Fall fünf unterschiedlich schwierige Karteipakete (können auch nummeriert sein).
•
Täglich werden zehn Definitionen wiederholt, indem aus jedem Fach zwei Karten vom Anfang des Stapels abgefragt werden.
•
Wird die Definition gut beherrscht, so wandert sie nach hinten in das nächst größere (leichtere) Fach.
•
Die schlecht beherrschten Definitionen wandern ins nächst schmalere (schwierigere) Fach.
•
„Mittelprächtig“ beherrschte bleiben im gleichen Fach, wandern jedoch wieder ans Ende des Stapels.
Auf diese Weise wiederholen Sie die noch nicht erlernten Definitionen häufiger. Wenn Sie täglich konsequent zehn Definitionen in zehn Minuten wiederholen würden, hätten Sie in einem Vierteljahr ca. 900 Definitionen präsent.
Online-Wissens-Check statt Karteikasten!
Alternativ hierzu können Sie auch den zu diesem Skript gehörenden kostenlosen Online-Wissens-Check nutzen. Dabei nutzen Sie gleich mehrere „Lernkanäle“. Sie beantworten einfach die dort gestellten Wiederholungsfragen, erhalten direktes feedback zum Wissensstand und sehen tagesaktuell Ihren individuellen Lernfortschritt. Einfach anmelden unter www.juracademy.de/skripte/login. Den user code finden Sie auf der Codeseite nach dem Vorwort zu diesem Skript.
1. Teil Gebrauchsüberlassungsverträge
1. TeilGebrauchsüberlassungsverträge
A.Der Mietvertrag
B.Der Pachtvertrag
C. Leihe
D. Darlehen
1. Teil Gebrauchsüberlassungsverträge › A. Der Mietvertrag
A.Der Mietvertrag
1
Das Mietrecht ist im BGB im 2. Buch: „Recht der Schuldverhältnisse“ unter Titel 5: „Mietvertrag, Pachtvertrag“ (§§ 535 ff. BGB) geregelt. Diese Regelungen sind – der üblichen Gliederungsstruktur des BGB folgend – in einem „Allgemeinen Teil“ (Untertitel 1: „Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse“) und zwei „Besondere Teile“ (Untertitel 2: „Mietverhältnisse über Wohnraum“ und Untertitel 3: „Mietverhältnisse über andere Sachen“) zusammengefasst. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt der Vorschriften auf der Wohnraummiete, wenn Sie so wollen im „Besonderen Teil 1“. Insoweit verfolgt der Gesetzgeber in erheblichem Maße soziale, wohnungs- und wirtschaftspolitische Ziele.
Da die Vorschriften zur Wohnraummiete einen großen Raum einnehmen, ist es bei der Gesetzesanwendung von besonderer Bedeutung, dass Sie sich vorher klarmachen, ob Sie ein Wohnraummietverhältnis oder ein „Mietverhältnis über andere Sachen“ begutachten. Wenn letzteres der Fall ist (z.B. Mietvertrag über Gewerberäume oder Anmietung eines PKW), scheidet eine direkte Anwendung der Vorschriften des 2. Untertitels (§§ 549–577a) erst einmal aus. Diese Vorschriften können nur über den „Umweg“ eines Verweises in den §§ 578 ff. zur Anwendung kommen. Aus dem „Besonderen Mietrecht“ sind dann nur die §§ 578 ff. i.V.m. mit den dort in Bezug genommenen Vorschriften sowie die Regeln des „Allgemeinen Teils“ (§§ 535–548) anzuwenden.
2
Wie bereits im ersten Band zum Besonderen Schuldrecht werden wir auch das Mietrecht anhand der wichtigen (und klausurrelevanten) Ansprüche durcharbeiten. Wir beginnen mit den Primäransprüchen und sehen uns dann die spezifischen mietrechtlichen Sekundäransprüche an. Alle Ansprüche gehen wir im klassischen Prüfungsschema „Anspruch entstanden“, „Anspruch erloschen“ und „Anspruch durchsetzbar“ durch.
Betrachten Sie die nachfolgenden Prüfungsschemata als Gliederungsvorschlag und „Checkliste“ für das gedankliche Durchprüfen des betreffenden Anspruchs. Keineswegs müssen in der Klausur alle Punkte schriftlich abgearbeitet werden – was nach dem Klausursachverhalt offensichtlich irrelevant ist, hat in der schriftlichen Ausarbeitung nichts zu suchen.
1. Teil Gebrauchsüberlassungsverträge › A. Der Mietvertrag › I. Wirksamer Mietvertrag
I.Wirksamer Mietvertrag
I.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 535
SoftwarenutzungRn. 9
II.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen (z.B. §§ 108, 134, 138, 142 Abs. 1, 177)
hier ausgewählte Probleme:
Wucherischer MietvertragRn. 21 ff.
Anfechtung nach Überlassung des MietobjektsRn. 24 ff.
3
Notwendige Voraussetzung für die Entstehung der mietvertraglichen Primäransprüche ist der Abschluss eines wirksamen Mietvertrages. Wie bei jedem Vertrag ist die Prüfung in zwei Schritten vorzunehmen: Zustandekommen des Vertrages durch Angebot und Annahme und Wirksamkeit des Vertrages, d.h. Bestehen etwaiger Wirksamkeitserfordernisse und Nichtbestehen etwaiger Wirksamkeitshindernisse.[1]
1.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 535
4
Es gelten die allgemeinen Regeln zum Vertragsschluss durch Angebot und Annahme.[2] Ein Mietvertrag ist dann geschlossen, wenn die zwischen den Parteien konkret vereinbarten Hauptleistungspflichten dem Typus des § 535 entsprechen. Dabei müssen sich die Vertragspartner zumindest über die sog. „essentialia negotii“ einig werden.
Unter den „essentialia negotii“ eines Vertrages versteht man diejenigen Punkte, über die die Parteien bei Vertragsschluss eine Einigung erzielen müssen, da diese Punkte weder durch dispositive Gesetzesvorschriften noch durch eine ergänzende Vertragsauslegung (§§ 133, 157) festgelegt werden können. Ein Vertrag kann nur zustande kommen, wenn diese Punkte nach der Einigung bestimmt oder zumindest eindeutig bestimmbar sind.[3] Auch § 154, der die Rechtsfolgen des offenen Dissenses regelt, ist auf die essentialia negotii nicht anwendbar, da nach § 154 der Vertrag nur „im Zweifel“ nicht geschlossen ist. Fehlt aber eine Einigung über die vertragswesentlichen Punkte, kann der Vertrag auf jeden Fall nicht geschlossen sein (sog. „Totaldissens“)[4].
a) Vertragspartner
5
Zu den essentialia des Mietvertrages gehört zunächst die Festlegung der Personen, die als Vermieter und Mieter Rechte und Pflichten übernehmen sollen. Dabei können auf einer oder beiden Seiten auch mehrere Personen stehen, also ein Vertrag mit mehreren Vermietern oder Mietern geschlossen werden. Denkbar ist ein Mietvertrag auch als echter Vertrag zugunsten eines Dritten i.S.d. § 328.
Stehen auf einer Seite mehrere Personen, sind diese hinsichtlich der sie aus dem Vertrag treffenden Pflichten in der Regel Gesamtschuldner (§ 427) und hinsichtlich der Rechte Mitgläubiger i.S.d. § 432.
b) Mietsache
6
Zu den essentialia des Mietvertrages gehört ferner die Festlegung des Mietobjekts. Anders als bei der Pacht[5] bezieht sich der Mietvertrag nur auf Sachen i.S.d. §§ 90, 90a.
Da § 93 nur die Einräumung dinglicher Sachenrechte betrifft, können auch einzelne wesentliche Bestandteile zum Gegenstand eines Mietvertrages gemacht werden.[6]
Vermietung einzelner Räume in einem Haus zu Wohnzwecken, Vermietung einer Hauswand als Plakatfläche zu Werbezwecken, Vermietung einer Garage auf einem Grundstück.
7
Entgegen ihres engeren Wortlauts ist die Auslegungsregel des § 311c auch auf Mietverträge anzuwenden, so dass im Zweifel das Zubehör eines Mietobjekts (§§ 97, 98) ebenfalls vermietet wird.[7]
V vermietet dem M ein Wohnhaus. Der Mietvertrag erstreckt sich beispielsweise auf den Briefkasten oder die auf dem Dach des Hauses angebrachte Satellitenempfangsanlage.[8]
8
Bei der Vermietung von Räumen erstreckt sich das Recht des Mieters auf Gemeinschaftsflächen und -räume des Hauses sowie gemeinschaftlich genutzte Gebäudeteile.[9] Allerdings steht dem Mieter hier nur ein Mitbenutzungsrecht zu.
Bei der Vermietung einer Wohnung gehören daher der Eingangsbereich, Hausflur, Aufzug oder das Treppenhaus zum Mietobjekt dazu und sind mitvermietet.
9
Ob eine Vereinbarung über die Möglichkeit einer Softwarenutzung als Mietvertrag anzusehen ist, hängt unter anderem davon ab, ob man die vereinbarte „Zugriffsmöglichkeit“ auf ein Computerprogramm als Gewährleistung des Gebrauchs einer „Sache“ qualifizieren kann.
Das Einordnungsproblem stellt sich bei den sog. „ASP“-Verträgen.[10] Bei diesen stellt der Anbieter auf einem Server Software bereit und gestattet seinem Vertragspartner, diese Software für eine begrenzte Zeit über Schnittstellen und Datenleitungen, insbesondere über das Internet „von außen“ zu nutzen. Anders als beim Kauf eines Datenträgers mit der Software verbleibt die Software also auf dem Server des Anbieters.
Stellt man auf das im Softwareprogramm verkörperte „geistige Werk“ (vgl. §§ 2 Abs. 1 Nr. 1, 69a ff. UrhG) ab, gelingt die Einordnung als Mietvertrag nicht: ein geistiges Immaterialgut ist keine Sache i.S.d. § 90. Die Möglichkeit der Nutzung von Immaterialgütern wird im Wege eines Lizenzvertrages eingeräumt (siehe z.B. §§ 31 ff. UrhG).
Der Buchautor gewährt dem Verleger mittels eines Lizenzvertrages das Recht, sein Werk zu vervielfältigen (= Druck) und zu verbreiten (Vertrieb der Druckexemplare).
Ist hingegen die Möglichkeit der Nutzung des Servers mit Computerprogramm die entscheidende Leistung des Anbieters, geht es um die Gewährung des Gebrauchs einer beweglichen Sache (Server), so dass ein Mietvertrag in Betracht kommt. Die Einordnung geschieht nicht anders als bei sonstigen Sachen, die ein geistiges Werk speichern („Werkträgern“), etwa Diskette, DVD oder Buch: Geht es den Parteien gerade darum, (nur) das körperliche Werkexemplar (Server, Diskette, Buch, DVD, etc.) zu nutzen, liegt eine Sachnutzung vor.[11] Soll der Vertragspartner hingegen in die Lage versetzt werden, das geistige Werk unabhängig von dem konkreten Exemplar zu nutzen, scheidet ein Mietvertrag aus. Der ASP-Vertrag im Beispiel stellt bei Entgeltlichkeit folglich einen Mietvertrag dar.[12]
c) Hauptleistungspflichten gem. § 535/Abgrenzungen
10
Ferner müssen die Parteien die sie treffenden Hauptleistungspflichten – und damit den Vertragstyp – festlegen. Wenn die Parteien einen Mietvertrag schließen, einigen sie sich auf die in § 535 typisierten Hauptleistungspflichten. Ob das der Fall ist, richtet sich nach dem Inhalt der Einigung, der ggf. durch Auslegung gem. §§ 133, 157 zu ermitteln ist.
Wenn Sie die Vereinbarung der vertragsschließenden Personen auslegen und dahin untersuchen, ob sie sich tatsächlich auf den Vertragstyp „Mietvertrag“ verständigt haben, sind unter Umständen Ausführungen zu anderen verwandten Vertragstypen notwendig. Sehen wir uns die wichtigsten Abgrenzungsfälle an:
aa)Leihe
11
Von der Leihe unterscheidet sich der Mietvertrag vor allem dadurch, dass der Entleiher kein Entgelt zu entrichten hat.
bb)Pacht
12
Von der Pacht unterscheidet sich der Mietvertrag dadurch, dass er sich nur auf eine Sache i.S.d. §§ 90, 90a beziehen kann (siehe oben unter Rn. 6) und kein Fruchtziehungsrecht kennt, vgl. § 581 Abs. 1 S. 1. Die Abgrenzung stellt sich insbesondere bei der Vermietung von Räumen zu gewerblichen Zwecken. Von einem Pachtverhältnis ist nur auszugehen, wenn die zu überlassenden Räume für einen bestimmten gewerblichen Betrieb nicht nur geeignet, sondern auch so eingerichtet und ausgestattet sind, dass sie alsbald für den Betrieb mit Gewinn benutzt werden können (vgl. § 99 Abs. 1).[13]
M möchte mit V einen Vertrag schließen, der ihn in die Lage versetzt, bestimmte Räume des V für den Betrieb einer Kneipe zu nutzen. Soll der V dem M nicht nur die Räume, sondern auch das gesamte Inventar zur Verfügung stellen, mit dem sich eine Kneipe betreiben lässt (Tische, Stühle, Theke, Schankanlage, etc.), ist von einem Pachtvertrag auszugehen.
cc)Mietkauf
13
Kann oder will ein Interessent den Kaufpreis für eine Sache nicht sofort aufbringen und ist er sich auch nicht sicher, ob er die Sache tatsächlich dauerhaft behalten möchte, bevorzugt er in der Regel den Abschluss eines Mietvertrages mit Kaufoption, kurz: „Mietkauf“. Durch die vereinbarte Kaufoption wird dem Mieter das Recht eingeräumt, durch einseitige Erklärung das Mietverhältnis fristlos zu beenden und die Sache zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, wobei die bisher gezahlten Mieten ganz oder teilweise auf den Kaufpreis angerechnet werden.
M möchte gerne, dass seine Tochter das Klavierspiel erlernt. Da er nicht sicher ist, ob seine Tochter wirklich Gefallen am Klavier findet, scheut er den Kauf eines solchen Instruments. Mit dem Händler V vereinbart er deshalb, dass er ein neues Klavier erst einmal mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten zu einem bestimmten Zins mietet. Nach Ablauf der 12 Monate kann das Mietverhältnis mit einer Frist von drei Monaten ordentlich gekündigt werden. M darf ab dem 12. Monat außerdem jederzeit entscheiden, ob er das Klavier zu einem festgelegten Preis kauft, wobei 50 % der bis dahin gezahlten Mietraten auf den Kaufpreis angerechnet werden.
Bis zur Ausübung der Kaufoption findet auf den Vertrag Mietrecht Anwendung, auf den durch Option wirksam gewordenen Kaufvertrag Kaufrecht.[14] Tritt als Vermieter/Verkäufer ein Unternehmer auf und schließt der Mieter/Käufer den Vertrag als Verbraucher oder Existenzgründer, ist außerdem an die Anwendung des § 506 Abs. 2 zu denken (siehe dazu unten unter Rn. 498 ff.).
dd)Leasing
14
[Bild vergrößern]
Der Begriff des „Leasingvertrages“ ist Ihnen im Alltag sicher schon häufig begegnet. Allein ein Blick in die Angebote von Kfz-Händlern genügt, um festzustellen, dass der Leasingvertrag beim Erwerb teurer Güter eine wichtige Rolle spielt. Eine ausführliche gesetzliche Regelung erfährt das „Leasing“ trotz seiner praktischen Bedeutung nicht. Es handelt sich folglich um einen im BGB nicht typisierten Vertrag, dessen Ausgestaltung und Variation allein der privatautonomen Vereinbarung der Parteien zu entnehmen ist. Allerdings muss es ja irgendwelche anerkannten Merkmale für den Typ „Leasing“ geben – sonst würden wir diesen Begriff schließlich nicht verwenden.
Der „Leasingvertrag“ zeichnet sich dadurch aus, dass der Leasinggeber dem Leasingnehmer das Leasingobjekt gegen einen regelmäßig in Raten zu zahlenden Betrag („Leasingrate“) überlässt, aber – anders als der Vermieter – keinerlei Instandhaltungspflicht übernimmt.[15] Dem Gewährleistungsinteresse des Leasingnehmers wird zum Ausgleich dafür in der Weise Rechnung getragen, dass der Leasinggeber dem Leasingnehmer die Ansprüche abtritt, die dem Leasinggeber aus seinem Kaufvertrag mit dem Lieferanten des Leasingobjekts wegen Mängeln oder gegen sonstige Dritte etwa aus unerlaubter Handlung zustehen (sog. „leasingtypische Abtretungskonstruktion“).[16]
Die Abtretung der kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte geht ins Leere, wenn der Lieferant mit dem Leasinggeber – wirksam! – einen Gewährleistungsausschluss vereinbart hatte. Da Lieferant und Leasinggeber regelmäßig als Unternehmer i.S.d. § 14 handeln, findet § 476 Abs. 1 S. 1 keine Anwendung. Wenn der Leasingnehmer als „Verbraucher“ handelt, könnte man die Einschaltung des Leasinggebers als unzulässige Umgehung eines Verbrauchsgüterkaufs i.S.d. § 476 Abs. 1 S. 2 zwischen Lieferant und Leasingnehmer ansehen und dem Lieferanten eine Berufung auf den Gewährleistungsausschluss versagen. Dies wird jedoch abgelehnt, da der Leasingnehmer mit dem Lieferanten gar keinen Kaufvertrag schließen wollte, sondern aus wirtschaftlichen Gründen eine Nutzung der Sache über den Leasingvertrag mit Ratenzahlung bevorzugte.[17] Der Leasingnehmer bleibt bei Mängeln aber nicht rechtlos: Geht die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen gegen den Lieferanten ins Leere, ist der – in der Praxis durch AGB geregelte – Ausschluss der eigenen Gewährleistungshaftung des Leasinggebers nach § 307 Abs. 1 S. 1 unwirksam. Dann haftet der Leasinggeber selbst wieder nach §§ 535 ff.[18]
Ist der Leasinggeber selbst Hersteller, scheidet eine Abtretung von Gewährleistungsansprüchen ausnahmsweise aus – hier gibt es außer dem Leasinggeber ja keinen Lieferanten.
15
Der Leasingvertrag wird überwiegend als „atypischer Mietvertrag“ angesehen, so dass zur Ausfüllung von Regelungslücken oder bei unwirksamen Regelungen Mietrecht angewendet werden kann.[19] Der Leasingvertrag kann (muss aber nicht) mit einer Kaufoption („Übernahme zum Restwert“) verbunden sein, die der Leasingnehmer am Ende der vereinbarten Laufzeit ausüben kann und wodurch im Anschluss an den Leasingvertrag ein Kaufvertrag zwischen den Parteien wirksam wird.
16
Der Leasingvertrag kennt verschiedene Varianten. Die häufigsten sind das „Finanzierungsleasing“ und das „Operating-Leasing“.
Die Unterscheidung zwischen beiden Varianten ist wichtig, da die in § 506 Abs. 2 i.V.m. § 506 Abs. 1 in Bezug genommenen Regelungen (insbesondere Form und Widerrufsrecht!) nur auf Finanzierungsleasingverträge Anwendung finden. Für das „Operating-Leasing“ gelten diese Regelungen hingegen nicht.
Beim „Finanzierungsleasing“ vereinbaren die Parteien eine feste Laufzeit (ggf. mit Verlängerungsoption) und legen die Pflichten des Leasingnehmers so fest, dass im Ergebnis die eigenen Aufwendungen des Leasinggebers zum Erwerb des Leasingobjekts vollständig ausgeglichen werden und der Leasinggeber seinen kalkulierten Gewinn erzielen kann, ohne einen weiteren Leasingvertrag abschließen zu müssen (sog. „volle Amortisation“).[20] Dieses Ziel wird typischerweise dadurch erreicht, dass der Leasingnehmer neben den Leasingraten am Ende der Leasingzeit außerdem zur Abnahme des Leasingobjekts zum Restwert verpflichtet wird oder aber – neben der Rückgabe der Sache – eine Ausgleichszahlung in Höhe der Differenz zwischen vereinbartem Restwert und einem tatsächlichen Minderwert schuldet.[21] Der Leasinggeber verwertet in der zweiten Variante das zurückgegebene Leasingobjekt selbst. Er erhält somit durch die gezahlten Leasingraten, die Ausgleichszahlung des Leasingnehmers und den Verkaufserlös aus der Weiterveräußerung sein für die Anschaffung der Sache eingesetztes Kapital wieder zurück und erzielt zusätzlich seinen kalkulierten Gewinn.
Beim „Operating-Leasing“ ist der Vertrag demgegenüber gerade nicht darauf angelegt, dass der Leasinggeber allein durch diesen Vertrag seine volle Amortisation erreicht. Vielmehr gelingt ihm das nur durch ein mehrfaches Verleasen.[22] Nach Abschluss des ersten Leasingvertrages wird das Leasingobjekt zurückgegeben und erneut an einen anderen Leasingnehmer verleast. Man erkennt das „Operating-Leasing“ daran, dass die Vertragslaufzeit gar nicht fest vereinbart wird und ein jederzeitiges Kündigungsrecht ohne volle Wertersatzpflicht des Leasingnehmers besteht oder die Vertragslaufzeit so kurz bemessen ist, dass eine Amortisation in dieser Zeit nicht erreicht werden kann.[23]
d) Beginn des Mietverhältnisses
17
Der Beginn des Mietverhältnisses gehört ebenfalls zu den wesentlichen Punkten, über die die Parteien eine Einigung erzielen müssen. Das Datum, an dem das Mietverhältnis starten soll, muss also zumindest in eindeutig bestimmbarer Weise festgelegt werden.
V vereinbart mit M, das Mietverhältnis beginne „mit Übergabe des Mietobjekts“. Zwar ist das Datum hier nicht kalendermäßig bestimmt. Jedoch lässt sich dieses anhand des Termins der tatsächlich erfolgten Übergabe eindeutig festlegen.[24]
18
Zumindest der Vermieter[25] schuldet eine kontinuierliche Erfüllung seiner Leistungspflichten. Deshalb begründet der Mietvertrag ein sog. „Dauerschuldverhältnis“. Eine exakte zeitliche Festlegung der Dauer des Mietverhältnisses gehört jedoch nicht zu den essentialia negotii. Den Parteien steht es frei, das Mietverhältnis zu befristen, also einen Endtermin festzulegen. Der Mietvertrag kann auch auf unbestimmte Zeit geschlossen werden, vgl. § 542. Fehlt eine Angabe zur Mietzeit, ist der Vertrag im Zweifel auf unbestimmte Zeit geschlossen.[26]
2.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
a) Allgemeine Wirksamkeitserfordernisse
19
Nachdem Sie unter Berücksichtigung der vorstehenden Kriterien die Vereinbarung eines Mietvertrages mit den Pflichten gem. § 535 festgestellt haben, müssen Sie als nächstes die Wirksamkeit dieses Vertrages untersuchen. Dabei kommen zum einen die Wirksamkeitserfordernisse in Betracht, also die Tatbestände, die die schwebende Unwirksamkeit des Vertrages aussprechen.[27] Sie denken hier insbesondere an § 177 beim Vertragsschluss durch einen Vertreter und an die §§ 107, 108 bei Beteiligung eines beschränkt Geschäftsfähigen.
b) Allgemeine Wirksamkeitshindernisse
20
Die Wirksamkeitshindernisse sprechen die endgültige Unwirksamkeit des Vertrages aus. Sie prüfen gedanklich die allgemeinen Regeln durch.[28]
Eine Formnichtigkeit kommt – anders als beim Finanzierungsleasingvertrag[29] – bei Mietverträgen nicht in Betracht, da sie formfrei geschlossen werden können.
Das Formgebot des § 550 für auf mehr als ein Jahr befristete Mietverträge sieht bei Verletzung keine Nichtigkeit des Mietvertrages, sondern nur der Befristungsvereinbarung vor.
Von den allgemeinen Wirksamkeitshindernissen sind v.a. der sittenwidrige Mietvertrag, insbesondere der Mietwucher (§ 138) und die Anfechtung (§ 142 Abs. 1) hervorzuheben.
aa)Mietwucher (§ 138 Abs. 2)
21
Nach § 138 Abs. 2 ist ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen, nichtig.[30]
Ein „auffälliges Missverhältnis“ zwischen Leistung und Gegenleistung i.S.d. § 138 Abs. 2 liegt vor, wenn die vom Schuldner zu erbringende Leistung um 100 % oder mehr über dem Wert der Gegenleistung liegt (sog. „Grenze des Doppelten“).[31]
Daran hält man auch beim Mietvertrag grundsätzlich fest. Grundsätzlich liegt also beim Mietvertrag ein wucherisches Missverhältnis vor, wenn die vereinbarte Gesamtmiete die ortsübliche Miete für vergleichbare Mietobjekte um mehr als 100 % übersteigt.[32] Entscheidend sind die Verhältnisse bei Vertragsschluss und nicht die spätere Entwicklung.[33] Bei der Vermietung von Wohnräumen wird die Grenze wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit des Mieters – erheblich niedriger angesetzt. Hier liegt ein auffälliges Missverhältnis bereits dann vor, wenn die Miete die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr als 50 % übersteigt.[34]
In subjektiver Hinsicht muss der Wucherer die Schwächen auf Seiten des bewucherten „ausgebeutet“ haben. Nicht nur beim auffälligen Missverhältnis, sondern auch in der Rechtsfolge des Mietwuchers differenzieren wir nach Mietverträgen über Wohnraum und Mietverhältnissen über andere Sachen:
Bei Mietverträgen über Wohnraum führt der Wuchertatbestand dazu, dass die wucherische Miete durch die angemessene Vergleichsmiete ersetzt und der Mietvertrag mit dieser „Ersatzmiete“ gilt.[35] Der Vertrag ist also nicht insgesamt nichtig. Diese Korrektur der von § 138 angeordneten Gesamtnichtigkeit dient dem Schutz des Wohnraummieters, der andernfalls sein Besitzrecht an der Wohnung verlöre und zur Herausgabe der geräumten Wohnung verpflichtet wäre (§ 985 bzw. § 812 Abs. 1 S. 1). Bereits zu viel gezahlte Miete kann er aus § 812 Abs. 1 S. 1 zurückfordern, da in Höhe der Differenz zwischen vereinbarter und tatsächlich geschuldeter Miete von Anfang an keine Zahlungspflicht bestand.
Bei sonstigen Mietverträgen bleibt es hingegen dabei, dass der Vertrag nach § 138 Abs. 2 insgesamt nichtig ist.[36] Der Mieter kann seine Mietzahlungen nach §§ 812 Abs. 1 S. 1, 817 S. 1 zurückfordern. Umgekehrt kann der Vermieter die dem Mieter überlassene Mietsache nach § 985 bzw. § 812 Abs. 1 S. 1 herausverlangen. § 817 S. 2 steht dem Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 nicht entgegen, da die Sittenwidrigkeit nicht in der Überlassung des Mietobjekts als solcher begründet ist, sondern in der anstößigen Vereinbarung einer unangemessen hohen Miete als Entgelt für die Nutzungsmöglichkeit der Sache.
bb)Wucherähnlicher Mietvertrag (§ 138 Abs. 1)
22
Weil das subjektive Merkmal des „Ausbeutens“ in § 138 Abs. 2 sowohl Vorsatz in Bezug auf das Missverhältnis als auch in Bezug auf die Zwangslage oder sonstige Schwäche des anderen Teils erfordert, lässt es sich in der Praxis selten nachweisen. Deswegen arbeitet man zusätzlich mit der Fallgruppe des „wucherähnlichen Geschäfts“, die systematisch § 138 Abs. 1 zugeordnet wird. Danach können gegenseitige Verträge, auch wenn der Wuchertatbestand des § 138 Abs. 2 nicht in allen Voraussetzungen erfüllt ist, als wucherähnliche Rechtsgeschäfte nach § 138 Abs. 1 sittenwidrig sein, wenn zwischen Leistung und Gegenleistung objektiv ein auffälliges Missverhältnis besteht und außerdem mindestens ein weiterer Umstand hinzukommt, der den Vertrag bei Zusammenfassung der subjektiven und objektiven Merkmale als sittenwidrig erscheinen lässt.[37] Dies ist insbesondere der Fall, wenn eine verwerfliche Gesinnung des Begünstigten hervorgetreten ist, weil er etwa die wirtschaftlich schwächere Position des anderen Teils bewusst zu seinem Vorteil ausgenutzt oder sich zumindest grob fahrlässig der Erkenntnis verschlossen hat, dass sich der andere nur unter dem Zwang der Verhältnisse auf den für ihn ungünstigen Vertrag eingelassen hat. Der entscheidende Punkt besteht beim wucherähnlichen Geschäft also zunächst darin, dass eine grobe Fahrlässigkeit des Begünstigten in subjektiver Hinsicht genügt.
23
Liegt ein „auffälliges Missverhältnis“ i.S.d. § 138 Abs. 2 vor, begründet dies eine – widerlegbare – Vermutung für die erforderliche verwerfliche Gesinnung, also für eine bewusste oder zumindest grob fahrlässige Ausnutzung eines den Vertragspartner in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Umstands.[38]
Die Vermutung für ein verwerfliches Vorgehen des Begünstigten kann durch die Umstände des Einzelfalls widerlegt werden.
Wenn der Vermieter über die tatsächliche Vergleichsmiete irrte und überhöhte Werte angenommen hatte, die ein Missverhältnis ausschließen, scheitert die Wirksamkeit des Mietvertrages nicht an § 138 Abs. 1.[39]
Die Tatbestände des Mietwuchers nach § 138 Abs. 1 und 2 werden ergänzt durch den – insoweit subsidiär anzuwendenden[40] – § 134 i.V.m. § 5 WiStG (Verbot der Mietpreisüberhöhung). Danach ist es verboten, vorsätzlich oder leichtfertig für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit verbundene Nebenleistungen unangemessene Entgelte zu fordern, sich versprechen zu lassen oder anzunehmen. Nach § 5 Abs. 2 WiStG liegt ein unangemessen hohes Entgelt grundsätzlich vor, wenn es „infolge Ausnutzung eines geringen Angebots an vergleichbaren Räumen“ vereinbart wird und die ortsüblichen Mieten für vergleichbare Räume um mehr als 20 % übersteigt. Zwischen dem Wohnungsmangel und der Vereinbarung der überhöhten Miete muss ein Kausalzusammenhang in der Weise bestehen, dass sich der Mieter auf die überhöhte Miete nur deshalb eingelassen hat, weil er trotz eigenen Bemühens keine vergleichbare Wohnung zu angemessenen Konditionen finden konnte und deshalb auf die gemietete Wohnung angewiesen war.[41]