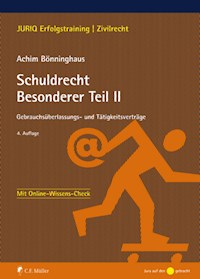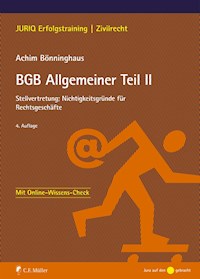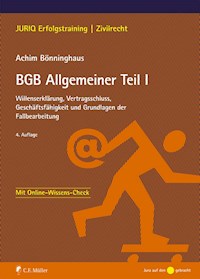20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Inhalt: Gegenstand des Skripts ist die Darstellung des Kauf-, Werk- und Reisevertragsrechts und der Schenkung mit Bezügen zum Allgemeinen Teil des BGB und zum Allgemeinen Schuldrecht. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Schuldrecht Besonderer Teil I
Kauf-, Werk-, Reisevertrag und Schenkung
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9167-0
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.dewww.cfmueller-campus.de
© 2019 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt den Kauf-, Werk- und Schenkungsvertrag sowie den Pauschalreisevertrag. Jedes Rechtsgebiet wird anhand der sich aus diesen Verträgen ergebenden Primäransprüche und der wichtigsten Sekundäransprüche erörtert, sofern sie durch die Regelungen im Besonderen Teil geprägt sind. Wegen der übrigen Sekundäransprüche aus dem Allgemeinen Schuldrecht möchte ich auf die Darstellung im Skript „Schuldrecht Allgemeiner Teil II“ verweisen.
Jeder Anspruch wird wie im Gutachten in der Schrittfolge „Anspruch entstanden?“, „Anspruch erloschen?“ (= „rechtsvernichtende Einwendungen“) und „Anspruch durchsetzbar?“ dargestellt. Im Laufe des Skripts und der gesamten Skriptenreihe mag es dabei zu Wiederholungen einzelner Punkte kommen – dies ist durchaus gewollt. Das einem Kapitel jeweils vorangestellte Prüfungsschema soll Ihnen als Vorschlag und „Checkliste“ für die gedankliche Durchprüfung des betreffenden Anspruchs dienen. Aber Achtung: Keineswegs müssen in der Klausur alle Punkte schriftlich abgearbeitet werden – was offensichtlich irrelevant ist, hat in der schriftlichen Ausarbeitung nichts zu suchen.
Wie Sie dem Inhaltsverzeichnis vielleicht schon entnommen haben, nimmt die Darstellung des Kaufrechts einen wesentlichen Teil dieses Bandes ein. Dies entspricht der überragenden Bedeutung dieses Rechtsgebiets in der juristischen Ausbildung. Der Kaufvertrag gehört in den ersten Semestern zum Prototyp des schuldrechtlichen Vertrages, anhand dessen allgemeine Themen der Rechtsgeschäftslehre, des Schuldrechts sowie die sich aus dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip ergebenden Konsequenzen erläutert werden. Diese Relevanz behält das Kaufrecht bis hin zum Examen, da die Rechtsprechung des BGH zu Problemen des reformierten Schuldrechts insbesondere anhand kaufrechtlicher Fälle Stellung bezieht und die Entscheidungen des BGH daher nicht selten als Muster für Examensfälle dienen. Wegen der strukturellen Parallelen des Leistungsstörungsrechts konnte die anschließende Darstellung des Werkvertrages knapper ausfallen. Die relativ ausführliche Behandlung des Reisevertrages mag auf den ersten Blick überraschen, da das Reiserecht nach häufiger Ansicht in der Ausbildung keine nennenswerte Rolle zu spielen scheint. Der berühmte „Mut zur Lücke“ bezieht sich daher gerne auf die reiserechtlichen Vorschriften. Dies ist nun leider auch Ihren Prüfern bekannt, weshalb dieser Mut nicht selten im schriftlichen oder mündlichen Teil des Examens auf die Probe gestellt wird. Das Reisevertragsrecht eignet sich wegen seiner ungeheuer dichten und komplexen Regelungsstruktur kaum für eine schnelle Erfassung im Ernstfall. Die vorliegende Darstellung gibt Ihnen hoffentlich eine hilfreiche Orientierung über dieses Rechtsgebiet, das der Gesetzgeber jüngst umfassend überarbeitet hat.
Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind. Das Skript kann das Schrifttum nicht vollständig belegen – und soll dies auch gar nicht. Betrachten Sie die Literaturangaben und die in den Fußnoten außerdem zitierten Urteile[1] und Aufsätze als persönliche Leseempfehlung.
Auf geht's – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an die C.F. Müller GmbH, Waldhofer Str. 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen. Oder Sie wenden sich direkt an mich unter [email protected]. Bei der Neuauflage konnte ich viele Zuschriften berücksichtigen, für die ich mich wieder herzlich bei allen Leserinnen und Lesern bedanken möchte.
Frankfurt, im Januar 2019
Achim Bönninghaus
Anmerkungen
Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 92, 141, 264, 302, 343, 392, 425, 455, 571, 612, 620
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilDer Kaufvertrag
A.Wirksamer Kaufvertrag
I.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 433 oder § 453
1.Die Grundtypen des Kaufvertrages
2.Sachkauf gem. § 433
a)Hauptleistungspflichten
b)Besondere Auslegungsfragen
c)Wichtige Varianten des Sachkaufes
3.Rechtskauf/Kauf über sonstige Gegenstände (§ 453)
a)Forderungskauf
b)Kauf sonstiger Rechte
c)Kauf sonstiger Gegenstände
II.Wirksamkeitsvoraussetzungen
1.Allgemeine Tatbestände
2.Besondere Formerfordernisse
a)Formnichtigkeit beim Grundstückskaufvertrag (§ 311b Abs. 1 S. 1)
b)Formnichtigkeit besonderer Verbraucherkaufverträge
B.Der Primäranspruch des Käufers (§ 433 Abs. 1)
I.Anspruchsentstehung
1.Wirksamer Kaufvertrag
2.Weitere Anspruchsvoraussetzungen
3.(Keine) Anfängliche Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1)
a)Nichtexistenz/Untergang des verkauften Gegenstandes
b)Rechtliches Unvermögen des Verkäufers
c)Anfängliche Unmöglichkeit (nur) der Mängelbeseitigung
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
1.Erfüllung und Erfüllungssurrogate
2.Nachträgliche Leistungsbefreiung nach § 275
3.Leistungsbefreiung nach § 300 Abs. 2
4.Sonstige Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
IV.Nebenleistungspflichten des Verkäufers
V.Pflichtverletzung
VI.Übungsfall Nr. 1
C.Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2)
I.Anspruchsentstehung
1.Wirksamer Kaufvertrag
a)Vertragsschluss mit Inhalt nach § 433 (ggf. i.V.m. § 453)
b)Wirksamkeitsvoraussetzungen
2.Sonstige Voraussetzungen/Einwendungen
3.Ausschluss nach § 326 Abs. 1 S. 1 wegen anfänglicher Unmöglichkeit
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
1.Erfüllung und Erfüllungssurrogate
2.Wegfall nach § 326 Abs. 1 S. 1 wegen nachträglicher Unmöglichkeit
a)Grundregel des § 326 Abs. 1 S. 1 (Ohne Leistung kein Geld)
b)(Kein) Fall der „qualitativen Teilunmöglichkeit“ (§ 326 Abs. 1 S. 2)
c)Ausnahme nach § 446
d)Sonderregel beim Versendungskauf (§ 447)
e)Exkurs: Haftung Dritter und Drittschadensliquidation
f)Allgemeine Ausnahme nach § 326 Abs. 2 S. 1 Var. 1
3.Leistungsbefreiung des Käufers nach § 300 Abs. 2
4.Sonstiges
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
a)Zurückbehaltungsrechte
b)Verjährung
IV.Übungsfall Nr. 2
D.Die Rechte des Käufers bei Mängeln nach § 437
I.Mangel und maßgeblicher Zeitpunkt
1.Sachmangel, § 434
a)Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 1
b)Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 1
c)Sachmangel nach § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2
d)Montagefehler (§ 434 Abs. 2 S. 1)
e)Mangelhafte Montageanleitung (§ 434 Abs. 2 S. 2)
f)Falschlieferung (§ 434 Abs. 3 Var. 1)
g)Mankolieferung (§ 434 Abs. 3 Var. 2)
2.Rechtsmangel, § 435
3.Maßgeblicher Zeitpunkt
a)Sachmangel
b)Rechtsmangel
4.Besonderheiten beim Rechtskauf
II.Ausschluss der Gewährleistung
1.Gesetzlicher Haftungsausschluss
a)Ausschluss nach § 442
b)Ausschluss nach § 445
2.Vertragliche Haftungsausschlüsse
a)Vereinbarung über Haftungsausschluss
b)Wirksamkeit des Haftungsausschlusses
III.Der Anspruch auf Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439
1.Anspruchsentstehung
a)Wirksamer Kaufvertrag
b)Mangel
c)(Kein) Wirksamer Gewährleistungsausschluss
d)Inhalt des Nacherfüllungsanspruchs
e)Ausschluss nach § 275 Abs. 1
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
a)Allgemeine Einwendungstatbestände
b)Unverhältnismäßigkeit der Kosten, § 439 Abs. 4
3.Durchsetzbarkeit
a)Fälligkeit
b)Einreden
IV.Der Kostenerstattungsanspruch aus § 439 Abs. 2
1.Eigene Anspruchsgrundlage
2.Umfang
V.Rücktrittsrechte des Käufers wegen eines Mangels
1.Rücktrittsrecht aus §§ 437 Nr. 2, 323
a)Wirksamer Kaufvertrag
b)Mangel
c)(Kein) Wirksamer Gewährleistungsausschluss
d)Durchsetzbarkeit des Nacherfüllungsanspruches
e)Erfolgloser Ablauf einer angemessenen Frist
f)Entbehrlichkeit der Fristsetzung
g)Rücktrittsausschluss nach § 323 Abs. 5 S. 2
h)Rücktrittsausschluss nach § 323 Abs. 6
i)Rücktrittsausschluss nach §§ 438 Abs. 4, 218
2.Rücktrittsrecht aus §§ 437 Nr. 2, 326 Abs. 5
VI.Minderungsrecht des Käufers wegen Mangels
VII.Schadensersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels
1.Schadensersatz „neben“ der Leistung aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1
a)Abgrenzung zum Schadensersatz statt der Leistung
b)Abgrenzung zum Schadensersatz aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286
c)Anspruchsentstehung
d)Weitere Prüfung
2.Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281
a)Anspruchsentstehung
b)Weitere Prüfung
3.Schadensersatzanspruch statt der Leistung aus §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 283
a)Abgrenzung zu §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281
b)Abgrenzung zu §§ 437 Nr. 3, 311a Abs. 2
c)Bezugspunkt des Vertretenmüssens
d)Schadensberechnung
e)Fälligkeit
f)Einreden
4.Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 437 Nr. 3, 311a Abs. 2
a)Abgrenzung zu §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 283
b)Bezugspunkt beim Vertretenmüssen
VIII.Aufwendungsersatz aus §§ 437 Nr. 3, 284
IX.Verhältnis der Gewährleistungsrechte zu anderen Rechten
1.Rechtslage vor Anwendbarkeit des § 437
2.Rechtslage bei Anwendbarkeit des § 437
a)Verhältnis zur Anfechtung
b)Verhältnis zu §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, Abs. 3
c)Verhältnis zu §§ 823 ff.
E.Der Rückgriff des Verkäufers beim Lieferanten
I.Allgemeines
1.Sinn der §§ 478, 479
2.Allgemeine Voraussetzungen
II.Entbehrlichkeit der Fristsetzung, §§ 478 Abs. 1, 445a Abs. 2
III.Aufwendungsersatzanspruch aus §§ 478 Abs. 1, 445a Abs. 1
IV.Beweislastumkehr auch zugunsten des Unternehmers, §§ 478 Abs. 1, 477
V.Halbzwingender Charakter
F.Übungsfall Nr. 3
2. TeilDer Werkvertrag
A.Wirksamer Werkvertrag
I.Vertragsschluss mit Inhalt der §§ 631, 633 Abs. 1
1.Einigung auf Leistungspflichten gem. §§ 631, 633 Abs. 1
2.Abgrenzungen zu anderen Vertragstypen
a)Dienstvertrag und Behandlungsvertrag
b)Kaufvertrag und Werklieferungsvertrag
c)Fazit
II.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
B.Der Primäranspruch des Bestellers (§§ 631 Abs. 1, 633 Abs. 1)
I.Anspruchsentstehung
1.Wirksamer Werkvertrag
2.Sonstige Voraussetzungen
3.(Keine) Anfängliche Unmöglichkeit
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
1.Erfüllung und Erfüllungssurrogate
2.Nachträgliche Leistungsbefreiung (§ 275)
3.Zufälliger Untergang oder Verschlechterung nach Gefahrübergang
4.Kündigung
a)Wirkung der Kündigung
b)Voraussetzungen
5.Sonstige Einwendungen
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
C.Der Vergütungsanspruch des Werkunternehmers (§§ 631 Abs. 1, 632)
I.Anspruchsentstehung
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
1.Allgemeine Regeln
2.Wegfall nach § 326 Abs. 1 S. 1 wegen nachträglicher Unmöglichkeit
a)Grundregel des § 326 Abs. 1 S. 1
b)Allgemeine Sonderregel des § 326 Abs. 1 S. 2
c)Werkvertragliche Sonderregel des § 644
d)Allgemeine Sonderregel des § 326 Abs. 2 S. 1 Var. 1
e)Sondertatbestand des § 645 Abs. 1
3.Kündigung
a)Kündigungsrecht des Unternehmers aus § 643
b)Kündigungsrecht des Bestellers aus § 648 S. 1
c)Kündigungsrecht des Bestellers aus § 649 Abs. 1
d)Beiderseitiges Kündigungsrecht aus wichtigem Grund, § 648a
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
IV.Sicherung des Vergütungsanspruchs
D.Rechte des Bestellers bei mangelhaftem Werk
I.Mangel
1.Sachmangel
2.Rechtsmangel
II.Maßgeblicher Zeitpunkt
III.Ausschluss der Gewährleistung
1.Gesetzlicher Ausschluss in § 640 Abs. 2
2.Vertraglicher Ausschluss
IV.Rechte des Bestellers im Einzelnen
1.Anspruch auf Nacherfüllung aus §§ 634 Nr. 1, 635 Abs. 1
a)Inhalt und Wahlrecht
b)Kosten
c)Ausschlusstatbestände
2.Selbstvornahmerecht nach §§ 634 Nr. 2, 637
3.Rücktrittsrecht (§ 634 Nr. 3)
a)Rücktrittsrecht aus §§ 634 Nr. 3, 323
b)Rücktrittsrecht aus §§ 634 Nr. 3, 326 Abs. 5
4.Minderungsrecht aus §§ 634 Nr. 3, 638
5.Schadensersatz
V.Verjährung der Gewährleistungsansprüche
1.Frist
2.Beginn
E.Übungsfall Nr. 4
3. TeilBesondere Arten des Werkvertrages
A.Der Bauvertrag, §§ 650a–h
I.Vertragsänderungen, § 650b
1.Einvernehmliche Vertragsänderung, § 650b Abs. 1
2.Anordnungsrecht des Bestellers, § 650b Abs. 2
3.Gerichtliche Durchsetzung, § 650d
4.Sicherung des Vergütungsanspruchs des Unternehmers, §§ 650e, f
5.Abnahmeverweigerung, § 650g Abs. 1–3
6.Fälligkeit der Vergütung, § 650g Abs. 4
B.Der Verbraucherbauvertrag, §§ 650i–n
I.Anwendungsbereich, § 650i Abs. 1
II.Besonderheiten des Vertragsschlusses, § 650i Abs. 2
III.Widerrufsrecht, § 650l
IV.Abschlagszahlungen, § 650m
C.Architekten- und Ingenieurvertrag, §§ 650p–t
I.Vertragsinhalt, § 650p
II.Haftung, § 650t
D.Der Bauträgervertrag, §§ 650u, v
I.Vertragsinhalt, § 650u
II.Haftung
4. TeilDer Pauschalreisevertrag
A.Wirksamer Pauschalreisevertrag
I.Vertragsschluss mit dem Inhalt des § 651a Abs. 1
II.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
B.Die Primäransprüche
I.Anspruch des Reisenden (§ 651a Abs. 1 S. 1)
1.Anspruchsentstehung
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
II.Der Zahlungsanspruch des Reiseveranstalters (§ 651a Abs. 1 S. 2)
1.Anspruchsentstehung
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
C.Besondere Gestaltungsrechte beim Pauschalreisevertrag
I.Rücktritt des Reiseveranstalters, § 651h Abs. 4
II.Rücktritt des Reisenden
1.„Freies“ Rücktrittsrecht vor Reisebeginn aus § 651h Abs. 1
2.Rücktrittsrecht wegen Preiserhöhung und sonstigen erheblichen Vertragsänderungen § 651g Abs. 1 S. 2 Nr. 2
III.Kündigung wegen eines Reisemangels nach § 651i Abs. 3 Nr. 5
D.Gewährleistungsrechte des Reisenden
I.Reisemangel
1. Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit
2. Nichteignung zu dem vertraglich vorausgesetzten Nutzen
3.Fehlende Eignung für den gewöhnlichen Nutzen/Abweichung von der gewöhnlichen Beschaffenheit
4.Nichterbringung oder unangemessen verspätete Erbringung der Reiseleistung
a)Auswirkung auf Wert oder Tauglichkeit der Reise?
II.Abhilfeanspruch des Reisenden aus §§ 651i Abs. 3 Nr. 1, 651k
1.Anspruchsentstehung
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
III.Aufwendungsersatzanspruch aus § 651i Abs. 3 Nr. 2, 651k Abs. 2
1.Anspruchsentstehung
2.Rechtsvernichtende Einwendungen
3.Durchsetzbarkeit
IV.Minderung und Rückzahlungsanspruch
V.Kündigungsrecht des Reisenden nach § 651l
VI.Schadensersatzanspruch aus § 651n
1.Schadensersatz aus § 651n Abs. 1
2.Modifikation: Entschädigung nach § 651n Abs. 2
a)Vereitelung oder erhebliche Beeinträchtigung der Reise
b)Nutzlos aufgewendete Urlaubszeit
c)Umfang
3.Schmerzensgeldanspruch (§ 253 Abs. 2)
VII.Verjährung, § 651j
E.Schadensersatz aus §§ 280 ff
I.Pflichtverletzungen des Reiseveranstalters
II.Pflichtverletzungen des Reisenden
F.Übungsfall Nr. 5
5. TeilDie Schenkung
A.Schenkungsarten
I.Typisierung
II.Handschenkung und Schenkungsversprechen
1.Handschenkung i.S.d. § 516
2.Schenkungsvertrag i.S.d. § 518
B.Der Primäranspruch des Beschenkten (§ 518 Abs. 1)
I.Anspruchsentstehung
1.Wirksamer Schenkungsvertrag
a)Einigung über eine unentgeltliche Leistung
b)Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
2.Weitere Voraussetzungen
II.Rechtsvernichtende Einwendungen
1.Allgemeine Einwendungstatbestände
2.Widerruf wegen groben Undanks (§§ 530 ff.)
a)Verhältnis zu § 313
b)Voraussetzungen
c)Besonderheiten bei der gemischten Schenkung
III.Durchsetzbarkeit
1.Fälligkeit
2.Einreden
C.Gewährleistungsansprüche des Beschenkten
I.Schadensersatzansprüche aus §§ 523 Abs. 1, 524 Abs. 1
II.Nachlieferungsanspruch aus § 524 Abs. 2 S. 1
III.Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus § 523 Abs. 2 bzw. § 524 Abs. 2 S. 2
D.Allgemeiner Haftungsmaßstab
I.Beschränkung in § 521
II.Befreiung von Verzugszinsen in § 522
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bamberger, Heinz Georg/Roth, Herbert
Bürgerliches Gesetzbuch, Band 1, 3. Aufl. 2012
Bönninghaus, Achim
BGB Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2018
Bönninghaus, Achim
BGB Allgemeiner Teil II, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Allgemeiner Teil I, 3. Aufl. 2014
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Allgemeiner Teil II, 3. Aufl. 2014
Bönninghaus, Achim
Schuldrecht Besonderer Teil II, 3. Aufl. 2015
Looschelders, Dirk
Schuldrecht Besonderer Teil, 13. Aufl. 2018
Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan
Schuldrecht II Besonderer Teil, 18. Aufl. 2018
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 26. Aufl. 2017
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Band 1 (§§ 1–240), 7. Aufl. 2015Band 2 (§§ 241–432), 7. Aufl. 2015Band 3 (§§ 433–610), 7. Aufl. 2015Band 4 (§§ 611–704), 7. Aufl. 2015(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Palandt, Otto
Bürgerliches Gesetzbuch, 78. Aufl. 2019 (zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Westerhoff, Ralph
Schuldrecht Besonderer Teil III, 3. Aufl. 2015
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 5Mentale Techniken und Entspannung
Im Folgenden finden Sie konkrete Anwendungs- und Übungsvorschläge, um Ihre Aufmerksamkeit so zu lenken, dass es Ihnen leichter fällt, sich zu entspannen oder sich nach Arbeitsphasen zu regenerieren. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, das natürliche Phänomen der Alltagshypnose oder Trance gezielt zu nutzen. Sie haben es selbst schon erlebt, z.B. bei Tagträumen mit offenen Augen, wenn Ihre Aufmerksamkeit „wegdriftet“! Sie können auch absichtlich Ihre Gedanken und Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen lenken, so dass Sie sich entspannter, leichter, motivierter oder auch kompetenter fühlen. Ihre Aufmerksamkeitslenkung bestimmt also auch Ihr Erleben und die damit verbundenen Gefühle. Diese Trancefähigkeit von Menschen macht man sich bei Hypnoseverfahren in der Psychotherapie und Medizin zu Nutze (Ängste, Schlafstörungen, Depressionen oder starke Schmerzen). Im Führungskräftecoaching nutzt man mentale Techniken, die den Umgang mit Stress und Konflikten erleichtern. Warum sollten wir diese nicht auch zur Entspannung beim Prüfungslernen nutzen?!
Lerntipps
Nutzen Sie Ihre mentalen Möglichkeiten stärker als bisher aus!
Damit Sie sich in Trance „hypnotisieren“, müssen Sie aktiv mitarbeiten und üben. Nur wenn Sie wollen, können Sie sich aktiv auf bestimmte für Sie vielleicht neue Vorgehensweisen, Gedanken und Innenbilder einlassen. Mit mentalen Techniken kann man durch relativ einfache Übungen schnell eine tiefe Entspannung erreichen. Entspannung dient der Erholung, dem Stressabbau und der Wiederherstellung körperlicher und seelischer Ausgeglichenheit. Mit viel Übung z.B. auch in einem „Selbsthypnosetraining“ bei einem Coach können Sie innerhalb weniger Minuten, häufig manchmal sogar Sekunden sich tiefenentspannen oder akute Blockaden lösen. Weil wir in Trance für Anweisungen (Suggestionen) empfänglicher sind, können Sie geeignete Autosuggestionen sogar nutzen, um Ihr Lernverhalten positiv zu beeinflussen.
Es geht los mit einem Bild – wählen Sie Ihr Ruhebild aus!
In allen „Hypnosesitzungen“ ist das „Ruhebild“ zum Einstieg zentral. Es dient dazu, die Entspannung zu verbessern und so das innere Gleichgewicht leichter herzustellen. Das Bild sollte angenehm und mit Ruhe verbunden sein. Häufig werden als angenehm erlebte Szenen aus dem Urlaub gewählt, wie z.B. der Blick von einer Alpenwiese auf die Berge, oder man betrachtet die Hügel der Toskana, man liegt auf einer Wiese oder am Strand, schaut auf das Meer oder geht im Wald spazieren. In diesen Bildern sollten Sie ausreichend Zeit haben und länger dort verweilen können. Das Interessante ist, dass unser Gehirn in der Wirkung plastische Innenbilder nicht von äußeren Gegebenheiten unterscheidet. Eine kleine Anmerkung: Das ist bei Problemen und Ängsten übrigens genauso. Wir sind es letztendlich selbst, die diese erzeugen und das können wir auch in förderlicher Weise nutzen.
Lassen Sie die Sinneseindrücke auf sich wirken!
Wenn Sie Ihre Augen schließen, können Sie die Sinneseindrücke noch besser auf sich wirken lassen. Die Eindrücke werden mit der Zeit plastischer und reichhaltiger. Auch wenn jeder von Ihnen ein anderes Bild und Erleben haben wird, lassen Sie sich von dieser Beschreibung animieren.
Sie sitzen am Meer und sehen die Wellen, den Horizont . . . Sie spüren dabei die angenehme Wärme, die über Ihre Stirn und die Wangen streicht. Sie merken mitunter, dass ein angenehm frischer Luftzug Ihre Stirn kühlt. Sie hören dann die typischen Geräusche der Szenerie, das Kommen und Gehen der Wellen, vielleicht auch den Ruf der Möwen . . . Sie fühlen die unterschiedlichen Berührungen an den Händen, den feinen Sand, den Sie vielleicht in die Hand nehmen und durch die Finger rieseln lassen. Sie nehmen auch die typischen Gerüche wahr, die würzig-salzige Meeresluft und spüren sogar etwas Salz auf den Lippen . . . Vielleicht legen Sie sich jetzt hin und schließen die Augen . . .
Lesen Sie die Zeilen noch einmal und achten darauf, in Richtung welcher Wahrnehmungsqualitäten Sie Ihre Aufmerksamkeit gerichtet haben (Sehen, Fühlen, Hören, Riechen, Schmecken).
Positive Innenbilder fördern!
Begünstigen Sie Ihre Innenbilder, indem Sie stets mehreren Sinneskanälen Beachtung schenken. Je komplexer und plastischer das Bild, umso stärker werden die an die Wahrnehmung gekoppelten Erlebenskomponenten aktiviert, also die Gefühle. Die Innenrealität wirkt am besten, wenn Sie sich von der Außenrealität und Außenreizen abschirmen. Halten Sie die Augen geschlossen – Sie können auch eine Augenbinde oder Augenmaske zu Hilfe nehmen (siehe auch unten den Lerntipp zur Augenfixierung).
Da unsere Innenbilder vielfältige innere Verarbeitungsprozesse hervorrufen und damit verbunden sind, können auch unangenehme Gefühle auftreten, die uns nicht erklärbar sind. Damit sollten Sie ganz gelassen umgehen, weil das normal ist und die Gelassenheit schon ein Abklingen bewirken kann.
Falls Bilder erscheinen, die unangenehm sind und sich „verfestigen“, so brechen Sie abrupt ab und schalten bewusst auf ein schönes Bild, eine schöne Erinnerung um. Sie brauchen lernförderliche Bilder.
Finden Sie einen geeigneten Rahmen!
Schalten Sie vor der Entspannung mögliche Störgeräusche aus (Telefon, geöffnetes Fenster). Achten Sie darauf, dass Sie nicht gestört werden (Schild an die Tür . . .). Benutzen Sie einen bequemen Sessel, Stuhl oder ein Sofa, auf dem Sie abschalten können. Achten Sie darauf, dass die Übungen räumlich in Ihrem Freizeitbereich, also nicht im Arbeitsbereich durchgeführt werden, wenn es Ihnen möglich ist. Legen Sie zu Beginn jeder Übung fest, wie lange sie dauern soll (Ruhebild in der Trainingsphase z.B. nach 15 Minuten die Augen öffnen). Verlassen Sie sich darauf, dass Sie nach Ihrer Zeitvorgabe, die Augen wieder öffnen, stellen sie sich eventuell einen leise summenden Wecker, den Sie bald aber entbehren können. Entspannung erreichen Sie natürlich nach viel Kaffee- oder Colakonsum nur schlecht. Bei Übermüdung oder nach Alkoholgenuss wird man wahrscheinlich nur durch eine Portion Schlaf frischer.
Leiten Sie Ihre „Selbsthypnose“ durch eine Augenfixierung ein!
Die Einleitung verschiedener mentaler Techniken besteht darin, die Aufmerksamkeit von äußeren Geschehnissen weg immer mehr zu innerem Erleben zu lenken. Das können Sie folgendermaßen leichter erreichen:
•
Setzen Sie sich bequem hin und rücken Sie sich gemütlich zurecht.
•
Suchen Sie sich einen kleinen Punkt im Raum in Augenhöhe vor möglichst ruhigem Hintergrund, damit Sie sich gut konzentrieren können.
•
Sie können auch einen Papierschnipsel aus einem Aktenlocher nehmen und ihn an eine bestimmte Stelle kleben.
•
Verwenden Sie in der Übungsphase möglichst den gleichen Stuhl und den gleichen Fixationspunkt.
•
Sie beobachten den Punkt intensiv und werden feststellen, dass der Hintergrund und die Ränder verschwimmen, milchig werden, mal ist der Punkt scharf, dann wieder unscharf zu sehen.
•
Betrachten Sie den Punkt mit Geduld, die Augen werden automatisch müder. Sie können die Augen dann schließen, wieder leicht öffnen, schließen . . .
•
Beobachten Sie dann Ihre Atmung und bemerken, wie Sie ruhig ein- und ausatmen. Mit jedem Atemzug werden Sie und Ihr Körper lockerer und entspannter.
•
Wenn Sie Umweltgeräusche zu Beginn lauter hören, arbeiten Sie nicht dagegen an.
•
Richten Sie die Aufmerksamkeit dann verstärkt auf Ihren Körper, z.B. die Bauchdecke, die sich hebt und senkt, die Füße, Beine, das Gesäß . . . die Hände, die Arme . . . die Geräusche werden Ihnen gleichgültiger.
•
Stellen Sie sich nun Ihr Ruhebild vor – so lange Sie wollen.
•
Wenn Sie sich entspannt fühlen und die Augen öffnen möchten, zählen Sie rückwärts von 3 bis 0.
•
Stehen Sie dann auf und Sie werden sich frischer fühlen.
Jeden Tag das gleiche Ritual, nach einer Woche können Sie das!
Wahrscheinlich werden Sie feststellen, dass Sie die erlebten Prozesse auch aus dem Alltag kennen (Dösen, Tagträume, mit offenen Augen andere Inhalte sehen, während die Realität in den Hintergrund tritt . . .). Diese andere Welt des Alltags ist der menschliche Trancezustand und wird hier methodisch nutzbar gemacht. Folgende methodische Hinweise dazu:
•
Üben Sie das Vorgehen der Augenfixierung und des Ruhebildes täglich möglichst zweimal.
•
Planen Sie die Übungszeiten fest als Erholungszeit in größeren Zwischenpausen für ca. 15 Minuten ein, vielleicht nach einer Arbeitseinheit von 90 Minuten am späten Vormittag oder am Nachmittag (wenn das Lerntief naht).
•
Manche setzen die Übung auch direkt nach dem Wachwerden, also vor Lernbeginn ein, manche werden dann müder.
•
Auch wenn die Übung anfangs noch als unangenehme Pflicht erlebt wird, werden Sie schnellen Erfolg haben.
•
Nach ca. 1 Woche täglichen Übens werden Sie die Übung als hilfreich erleben und sich darauf freuen.
•
Nach ca. 2 Wochen und täglich zweimal üben können Sie schon die Kurzform der Autohypnose ausprobieren, es wird auf jeden Fall schneller gehen, sich zu entspannen
Falls Ruhebilder – selbst die schönsten – nicht mehr wirken, so ersetzen Sie diese durch andere.
Nutzen Sie die Entspannung auch für gezielte Autosuggestionen!
Nach ca. 1 bis 2 Wochen täglicher Übung werden Sie die Einleitung der Autohypnose zielgerichtet kombiniert mit „Selbstbeauftragungen“ und „Autosuggestionen“ einsetzen können, z.B. zu Beginn einer Lernphase. Nach einer Pause können Sie sich z.B. das wieder „Warmlaufen“ erleichtern.
Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über die gestellte Aufgabe, indem Sie sich orientieren, z.B.
•
Definition einmal durchlesen, in einem Kapitel eines Buches Überschriften, Stichworte ansehen, ohne sie sich merken zu wollen.
•
Aufbauschemata durchlesen.
•
Bei schriftlichen Ausarbeitungen die Gliederung ansehen, Stichworte lesen.
Das dauert nur wenige Minuten. Durch diese Übersicht ist Ihr Arbeitsspeicher auf die zukünftige Arbeit vorbereitet. Das Gehirn hat Grobinformationen für den kommenden Auftrag und stellt seine Mittel bereit.
Nun legen Sie eine Pause von einer knappen Minute mit einer Kurzentspannung mit geschlossenen Augen ohne Ruhebild ein und betrachten die anstehenden Aufgaben. Jetzt ist der Auftrag (Suggestion) erteilt und Sie können zügig mit der Weiterarbeit beginnen.
Überlegen Sie sich Ihre Autosuggestionen oder „Selbstbeauftragungen“ vor der Entspannung. Es kann z.B. auch motivationsförderliches Selbstlob sein („Ich habe schon etwas länger arbeiten können, Pausen besser eingehalten, folgende Dinge erledigt . . .“) oder andere lernförderliche Übungen und Selbstverbalisierungen.
Diese Lerntipps helfen und haben ihre Grenzen!
Autohypnose hilft nur, wenn sie regelmäßig und konsequent, also in der Übungsphase auch mehrmals täglich angewendet wird. Wenn Sie sehr viele Tagträume haben, die eher in Richtung Angstphantasien, Schwarzmalereien oder Realitätsflucht gehen, sollten Sie vorsichtiger mit der Anwendung sein. Sie können natürlich auch einen Experten wie einen Coach zu Rate ziehen. Bei sehr starken Lern- und Leistungsstörungen oder Depressionen, Ängsten, Lebenskrisen sollten Sie einen Psychotherapeuten oder eine Beratungsstelle konsultieren. Unsere Übungen können kein Ersatz dafür sein, sind aber eine hervorragende Grundlage zur direkten Entspannung, aber auch um seine mentalen Techniken an anderer Stelle weiterzuentwickeln (durch Bücher, in Übungsgruppen).
1. TeilDer Kaufvertrag
A.Wirksamer Kaufvertrag
B.Der Primäranspruch des Käufers (§ 433 Abs. 1)
C.Der Anspruch auf den Kaufpreis (§ 433 Abs. 2)
D.Die Rechte des Käufers bei Mängeln nach § 437
E.Der Rückgriff des Verkäufers beim Lieferanten
F.Übungsfall Nr. 3
1
Die §§ 433–479 widmen sich dem Kaufvertrag und dienen der näheren Ausgestaltung der Rechte und Pflichten der Kaufvertragspartner. Diese Regeln sind teilweise dispositiv, sie treten also hinter abweichenden vertraglichen Vereinbarungen der Vertragspartner zurück. Manche Vorschriften sind hingegen zwingend und bestimmen deshalb in ihrem Anwendungsbereich ohne Rücksicht auf die im Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen Rechte und Pflichten der Vertragspartner.
Nach § 476 Abs. 1 kann sich der Verkäufer (= „Unternehmer“) im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufvertrages (vgl. § 474 i.V.m. §§ 13, 14) auf eine vor Mitteilung des Mangels getroffene Vereinbarung nicht berufen, die zum Nachteil des Käufers (= „Verbraucher“) von den dort genannten Vorschriften abweicht. Insoweit sind die in § 476 Abs. 1 aufgeführten §§ 433–435, 437, 439–443 und 475, 477ff. also zwingendes Recht. Die in § 437 Nr. 3 genannten Regelungen über den Schadensersatz sind nach § 476 Abs. 3 hingegen nicht zwingend, sondern dispositives Recht. Die Schadensersatzpflicht des Verkäufers kann also auch im Verbrauchsgüterkauf – vorbehaltlich der §§ 307–309, 444 – grundsätzlich durch vertragliche Regelungen abweichend ausgestaltet werden.
2
Das Kaufrecht ist in den §§ 433 ff. nicht in allen Aspekten abschließend geregelt. Das kann nach der Regelungstechnik des BGB auch nicht sein, da die besonderen Vorschriften stets um die allgemeineren Regeln ergänzt werden. Erst die Gesamtschau aller Normen bildet das Regelwerk vollständig ab. So finden beispielsweise die allgemeinen Regeln des 1. Buches über das Zustandekommen und die Wirksamkeit von Verträgen sowie die Regeln des Allgemeinen Schuldrechts auch auf den Kaufvertrag Anwendung, soweit sich aus den §§ 433 ff. nicht ein anderes ergibt. Das Erbrecht stellt in den §§ 2371 ff. ganz spezielle Regeln über den Erbschaftskauf bereit, im HGB sind besondere Vorschriften über den Handelskauf in §§ 373 ff. HGB enthalten. Diese speziellen Vorschriften gehen ihrerseits den §§ 433 ff. und den noch allgemeineren Regeln des BGB im Allgemeinen Teil und im Allgemeinen Schuldrecht vor.
3
Wir wollen uns in diesem Skript auf die (examensrelevanten) Regeln der §§ 433 ff. konzentrieren. Die besonderen Vorschriften über den Teilzahlungskauf (§ 506 Abs. 3) und den Ratenlieferungskauf i.S.d. § 510 Abs. 1 gehören systematisch zu den Regeln über den Verbraucherkreditvertrag und werden zusammen im Skript „Schuldrecht Besonderer Teil II“ vorgestellt. Die Besonderheiten des Handelskaufes gehören in die Darstellung des Handelsrechts. Wegen der umfassenden Verweisung auf das Kaufrecht in § 480 können wir auf eine gesonderte Darstellung des Tauschs verzichten. Auf ihn gehen wir nur dann ausdrücklich ein, wenn Besonderheiten zu beachten sind, die nicht aus dem (knappen) Verweis in § 480 verständlich sind.
Die Darstellung orientiert sich an den Primär- und Sekundäransprüchen und folgt dem allgemeinen Anspruchsgrundlagenschema.[1] Jeder Anspruch wird nach dem bekannten „Dreiklang“ – Entstehen, Erlöschen, Durchsetzbarkeit – abgehandelt. „Vor die Klammer gezogen“ habe ich den Prüfungspunkt „Wirksamer Kaufvertrag“. Diese Einheit taucht bei allen kaufvertraglichen Primär- und Sekundäransprüchen auf. Um Wiederholungen zu vermeiden, beschäftigen wir uns also ganz am Anfang mit den einzelnen Schritten bei der Prüfung dieses Punktes und können später immer wieder darauf Bezug nehmen.
Anmerkungen
Siehe dazu im Skript „BGB AT I“ Rn. 10 ff.
1. Teil Der Kaufvertrag › A. Wirksamer Kaufvertrag
A.Wirksamer Kaufvertrag
I.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 433 (ggf. i.V.m. § 453)
Abgrenzung von Stück- und GattungsschuldRn. 12 ff.
Verkauf noch nicht existierender GegenständeRn. 19 ff., 40.
Abgrenzung zum Werk(lieferungs)vertragRn. 23, 366 ff.
II.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen (z. B. §§ 108, 125, 138, 142, 177)
hier dargestellte Probleme:
Formmangel beim GrundstückskaufvertragRn. 49 ff., 93 f.
Formmangel bei Finanzierungshilfe oder RatenlieferungRn. 53
Anfechtung wegen MängelnRn. 345 f.
1. Teil Der Kaufvertrag › A. Wirksamer Kaufvertrag › I. Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 433 oder § 453
I.Vertragsschluss mit Inhalt gem. § 433 oder § 453
1.Die Grundtypen des Kaufvertrages
4
Notwendige Voraussetzung für die Entstehung der kaufvertraglichen Primär- und Sekundäransprüche ist das Zustandekommen eines wirksamen Kaufvertrages. Für den Vertragsschluss gelten die allgemeinen Regeln – der Kaufvertrag kommt durch Angebot und Annahme zustande.[1]
Typische Klausurprobleme[2] sind hier die Abgrenzung der „invitatio ad offerendum“ vom verbindlichen Angebot, die Bestimmung des richtigen Vertragspartners beim „Bargeschäft des täglichen Lebens“ , beim „unternehmensbezogenen Geschäft“ und beim Handeln unter fremden Namen sowie die „falsa demonstratio“ und das Scheingeschäft vor dem Notar beim „Schwarzkauf“ eines Grundstücks.
Ein Kaufvertrag ist dann geschlossen, wenn die zwischen den Vertragspartnern vereinbarten primären Hauptleistungspflichten (die sog. „Essentialia“) dem Typus des § 433 (ggf. i.V.m. § 453 beim Rechtskauf) entsprechen. Es handelt sich um einen gegenseitigen Vertrag i.S.d. §§ 320 ff.: Zahlung des Kaufpreises gegen Verschaffung des Kaufobjekts.
5
Je nach dem vereinbarten Kaufgegenstand können wir zwei Grundtypen des Kaufvertrages unterscheiden: den „Sachkauf“ (§ 433) einerseits und den „Rechtskauf“ (§ 453) andererseits.
[Bild vergrößern]
Innerhalb dieser beiden Grundtypen des Kaufes kennen wir noch weitere Differenzierungen, die wir uns nachfolgend ebenfalls ansehen.
2.Sachkauf gem. § 433
a)Hauptleistungspflichten
6
Beim sog. „Sachkauf“ verpflichtet sich der Verkäufer, gegen Zahlung des Kaufpreises Besitz und Eigentum (oder nur Miteigentum) an einer Sache (§ 90) frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen (§ 433 Abs. 1). Die Primärleistungspflicht des Verkäufers umfasst also zwei Komponenten: die Verschaffung von Besitz und Eigentum (§ 433 Abs. 1 S. 1) einerseits und die Gewährleistung der Mangelfreiheit der Sache (§ 433 Abs. 1 S. 2) andererseits. Dabei soll die Gewährleistungspflicht des Verkäufers nicht ewig andauern. Der Verkäufer will sich typischerweise nicht zu einer dauernden Instandhaltung verpflichten, sondern die Mängelfreiheit nur zu einem bestimmten Zeitpunkt gewährleisten. Der Kaufvertrag begründet kein Dauerschuldverhältnis wie etwa die Miete (vgl. § 535 Abs. 1 S. 2). Der maßgebliche Zeitpunkt ist nach der Formulierung des § 433 Abs. 1 S. 2spätestens der Moment, in dem der Verkäufer dem Käufer Eigentum und Besitz „verschafft“ hat. Wir werden uns noch damit beschäftigen, dass in der Regel noch frühere Zeitpunkte als „Gewährleistungsstichtage“ in Betracht kommen.
7
Zur Herstellung der verkauften Sache ist der Verkäufer nicht verpflichtet. Soll er nach der Vereinbarung auch die Herstellung der Sache schulden, liegt kein Kauf-, sondern ein Werklieferungsvertrag i.S.d. § 650 vor (s.u. Rn. 366 ff.).
Daraus folgt, dass der Hersteller nicht Erfüllungsgehilfe des Verkäufers ist. Ein Herstellerverschulden kann dem Verkäufer nicht über § 278 zugerechnet werden![3]
8
Werden Tiere verkauft, finden die Vorschriften über den Sachkauf Anwendung. Denn nach § 90a S. 3 werden Tiere grundsätzlich wie Sachen behandelt. Für Tiere sehen die §§ 433 ff. keine Sondervorschriften (mehr) vor.
Wer einen Hund verkauft, verpflichtet sich gem. § 433 Abs. 1 dem Käufer Besitz und Eigentum am Hund frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
b)Besondere Auslegungsfragen
aa)Bestimmung der verkauften Sache(n)/Stück- und Gattungsschuld
9
Bei Vereinbarung eines Sachkaufes i.S.d. § 433 muss sich die verkaufte und damit vom Verkäufer geschuldete Sache als eines der „essentialia negotii“ des Kaufvertrages anhand der Vereinbarung eindeutig bestimmen lassen.[4]
10
Die Parteien können als „verkaufte Sache“ ein ganz bestimmtes, individuelles Stück als Kaufobjekt festlegen. Man spricht dann von einer „Stückschuld“ oder einem „Stückkauf“.
V verkauft dem K ein bestimmtes, mit der grundbuchmäßigen Flurbezeichnung bezeichnetes Grundstück.
11
Die Kaufvertragspartner können aber alternativ auch abstraktere Merkmale festlegen, die als solche noch keine Individualisierung einer ganz bestimmten Sache erlauben. Dann soll dem Verkäufer die Auswahl überlassen bleiben, mit welchen Exemplaren er seine Pflicht aus dem Kaufvertrag erfüllen möchte. Entscheidend ist dann nur, dass die ausgewählte Sache den vereinbarten Merkmalen gerecht wird und auch im Übrigen mangelfrei (vgl. § 243 Abs. 1) ist. Wegen der Festlegung der Auswahlmerkmale liegt eine hinreichende Bestimmbarkeit des Kaufobjekts vor. Es handelt sich dann um eine „Gattungsschuld“ bzw. um einen „Gattungskauf“. Wenn die Parteien in die Gattungsbeschreibung das Merkmal aufnehmen, die Sache solle aus dem Vorrat des Verkäufers stammen, vereinbaren sie eine sog. „beschränkte Gattungsschuld“ in Form einer „Vorratsschuld“.
K kauft beim Versandhändler V eine DVD über dessen Online-Shop durch Angabe der von V festgelegten Artikelnummer und Artikelbezeichnung.
12
Die Vereinbarung der Parteien ist nicht immer eindeutig. Häufig lassen sich die Äußerungen sowohl als Vereinbarung einer Stück- wie einer Gattungsschuld auffassen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Auswahl eines konkreten Stücks bei Vertragsschluss auch als exemplarische Beschreibung einer Gattung verstanden werden könnte und dem konkreten Stück lediglich die Funktion eines Musters zur Beschreibung der geschuldeten Gattung zukommen soll.
Entscheidend ist – wie immer – das redliche Verständnis der Äußerungen der am Vertragsschluss beteiligten Personen, §§ 133, 157. Fraglich ist alleine, welche Auslegung im Zweifel den Vorzug verdient und mit welchen Kriterien sich eine Vermutung für eine Stück- bzw. Gattungsschuld begründen lässt.
13
Geht es dem Verkäufer ersichtlich nur um die Abgabe des konkret ausgewählten Stücks, etwa weil er erkennbar kein sonstiges Stück besitzt oder die restlichen Stücke ausdrücklich zurückbehalten möchte, liegt eine Stückschuld vor.[5] Der Verkäufer macht hier deutlich, nur das bei Vertragsschluss ausgewählte und kein anderes Stück beschaffen zu wollen.
Der Verbraucher V verkauft dem K seinen einzigen, gebrauchten PKW.
Weinhändler V verkauft dem K wegen Räumung seines Ladenlokals seine gesamten Lagerbestände der Weinsorte X.
Verbraucher V bietet dem K eine neue DVD mit einem bestimmten Filmtitel zum Kauf an, die er selber versehentlich doppelt erworben hatte.
14
Entsprechendes gilt für den Fall, dass der Käufer deutlich macht, sich aus bestimmten Gründen bewusst für das konkrete Exemplar entschieden zu haben. Dann sind die „Zweifel“, welchem Auslegungsergebnis der Vorzug zu geben ist, zugunsten der Stückschuld ausgeräumt.
Computerhändler V präsentiert von jedem seiner vorrätigen Laptops jeweils ein Modell im Laden. Kunde K möchte ein präsentes Exemplar kaufen und sofort mitnehmen. Er teilt mit, er habe keine Zeit und wolle nicht warten, bis V ein anderes Exemplar desselben Typs aus dem Lager beschafft habe.
15
Eine bewusste Auswahlentscheidung des Käufers wird man redlicherweise auch bei unvertretbaren Sachen annehmen müssen. Das sind neben Grundstücken solche beweglichen Sachen, die vom Verkehr im Gegensatz zu den vertretbaren Sachen i.S.d. § 91 auch durch individuelle Merkmale unterschieden werden. Hier liegt wegen der Individualität des Stücks die Annahme fern, das Stück diene bloß als Muster für die Beschreibung einer Gattung.
K entscheidet sich beim Gebrauchtwagenhändler V nach Beratung und Probefahrt für einen von mehreren gebrauchten Jahreswagen desselben Modells mit vergleichbarer Laufleistung und Ausstattung. Hier unterscheidet sich jeder Wagen durch seinen individuellen Abnutzungsgrad, der von der Nutzungs- und Pflegeintensität der früheren Nutzer abhängt.[6]
K entscheidet sich beim Galeristen V nach eingehender Besichtigung für das Gemälde mit dem Titel „ICH“ aus der Trilogie „ICH – DU – WIR“ des Malers M. K will hier erkennbar das Bild „ICH“ und nicht „eines der drei Bilder“ aus dieser Trilogie erwerben.
16
Beim Kauf einer „vertretbaren Sache“ wird schließlich vertreten, es sei im Zweifel eine (ggf. auf den Vorrat des Verkäufers beschränkte) Gattungsschuld vereinbart.[7] „Vertretbar“ ist eine bewegliche[8] Sache nach § 91, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht und nicht durch individuelle Merkmale bestimmt wird.
K geht zum Lebensmitteldiscounter V und entnimmt einem Karton mit 40 Mehlpackungen eine Packung. Diese Mehlpackung legt er an der Kasse vor. Die Kassiererin zieht die Packung über den Scanner und verlangt den Kaufpreis. Haben die Parteien jetzt einen Kaufvertrag nur über diese, an der Kasse vorgelegte Mehlpackung geschlossen (Stückschuld) oder sollte die vorgelegte Packung lediglich exemplarisch die geschuldete Gattung beschreiben (Gattungskauf)?
[Bild vergrößern]
Der Schluss auf die Vereinbarung eines Gattungskaufes – meist in der Form einer Vorratsschuld – rechtfertigt sich daraus, dass vertretbare Sachen ohne weiteres untereinander austauschbar sind und der Verkäufer deshalb redlicherweise nicht davon ausgehen kann, es komme dem Käufer ausgerechnet auf das zufällig ausgesonderte Stück an. Im Beispiel ist aufgrund Vertretbarkeit der vorgelegten Mehlpackung und der Gesamtumstände davon auszugehen, dass die Auswahlentscheidung des K letztlich vom Zufall geprägt war und er dem Vorrat des Verkäufers ebenso gut eine andere Verpackung hätte entnehmen können. Allerdings musste K davon ausgehen, dass dem V nur an einer Leistung aus seinem Vorrat gelegen ist, um keine zusätzlichen Beschaffungskosten zu haben. Damit haben die Parteien eine auf den Vorrat des V beschränkte Gattungsschuld vereinbart.
Diese Ansicht bedeutet keineswegs, dass es keine Stückschuld über vertretbare Sachen geben kann. Kann etwa der Käufer erkennen, dass der Verkäufer nur dieses eine (vertretbare) Stück vorrätig hat und ihm deshalb bei Vertragsschluss nur dieses Stück verschaffen kann und will, liegt – nach allen Ansichten – eine Stückschuld vor (s.o. Rn. 13, Beispiele 2 und 3.). Eine Stückschuld liegt außerdem trotz Vertretbarkeit der Sache vor, wenn der Käufer – wie im Laptopfall oben – seine Auswahl erkennbar bewusst aus besonderen Gründen getroffen hat.
Fazit:
Die hier vorgestellte Ansicht unternimmt methodisch nichts anderes, als den Parteiwillen vom Standpunkt eines redlichen Empfängers unter Berücksichtigung der Verkehrssitte und Treu und Glauben nach §§ 133, 157 zu ermitteln. Verborgen gebliebene Auswahlkriterien einer Partei können – wie immer – bei der Auslegung vom jeweiligen normativen Empfängerhorizont mangels Erkennbarkeit keine Berücksichtigung finden.
bb)Erstreckung auf wesentliche Bestandteile/Zubehör
17
Lesen Sie im Gesetz die §§ 93 ff., 311c, 926 parallel mit!
Da an einem wesentlichen Bestandteil gem. § 93 keine besonderen dinglichen Rechte bestehen können, wäre der Kaufvertrag auf eine unmögliche Leistung gerichtet, wenn er gem. § 433 Abs. 1 S. 1 nur zur Übereignung der verkauften Sache ohne ihre wesentlichen Bestandteile verpflichtete.[9] Da die Vereinbarung einer unmöglichen Leistung dem Parteiwillen im Zweifel nicht entspricht, ist regelmäßig von einer Verpflichtung zur Übereignung auch der wesentlichen Bestandteile auszugehen.
Wird ein Grundstück verkauft, auf dem sich ein Haus befindet, sind auch das Haus und die zu seiner Herstellung eingefügten Sachen Gegenstand des Kaufvertrages (vgl. § 94).
Schließen die Parteien ausdrücklich einen Kaufvertrag, wonach bestimmte wesentliche Bestandteile beim Verkäufer verbleiben sollen, kann die Abrede im Wege der Auslegung als Einräumung von Wegnahme- und Aneignungsrechten an den wesentlichen Bestandteilen verstanden werden.[10]
18
Eine Auslegungshilfe bietet die – nicht nur auf Kaufverträge anwendbare! – Vermutungsregel des § 311c, wonach sich die Verpflichtung zur Veräußerung einer Sache „im Zweifel“ auch auf dessen Zubehör (vgl. §§ 97, 98) erstrecken soll.
Wer ein Grundstück mit einem Gartenlokal verkauft, ist im Zweifel auch verpflichtet, das dem dauernden Betrieb des Gartenlokals dienende Inventar (Küche, Schankanlage, Einrichtung etc.) zu übereignen.[11]
cc)Verkauf noch nicht existierender Sachen
19
Es ist denkbar, dass der verkaufte Gegenstand bei Abschluss des Kaufvertrages noch gar nicht existiert.
Züchter V „verkauft“ dem K sämtliche Welpen des nächsten Wurfes seiner Hündin Zora.
Händler V „verkauft“ dem K einen PKW, der erst noch vom Hersteller H hergestellt und von V beschafft werden muss.
20
Im Beispiel 1 und 2 schließen die Parteien einen Kaufvertrag über eine künftige Sache (bzw. Tier, vgl. § 90a S. 3). Hier kommen mehrere Varianten in Betracht:
Soll der Vertragspartner eine Sache selber erzeugen oder durch Erfüllungsgehilfen erzeugen lassen, liegt ein Werklieferungsvertrag i.S.d. § 650 (s.o. Rn. 7) vor. Im Beispiel 1 ist daher ein Werklieferungsvertrag i.S.d. § 650 anzunehmen.[12]
21
Verspricht der Vertragspartner keine persönliche Herstellung, schuldet er nur die Übereignung und Übergabe der zukünftig hergestellten Sache. Im Beispiel 2 liegt daher ein Kaufvertrag vor. Dem Umstand, dass der Verkäufer bei Vertragsschluss noch nicht liefern kann, tragen die Vertragspartner (ausdrücklich oder konkludent) durch Vereinbarung einer aufschiebenden (mögliche und erfolgreiche Herstellung) oder auflösenden(gescheiterte Herstellung) Bedingung bzw. einem Rücktrittsvorbehalt Rechnung.[13] Welche Variante einschlägig ist, ist eine Sache der Auslegung im Einzelfall (§§ 133, 157).
Deswegen müssen Sie gedanklich erst die aufschiebende Bedingung prüfen und dürfen erst dann die anfängliche Unmöglichkeit nach § 275 Abs. 1 bearbeiten – siehe Rn. 56 ff.
c)Wichtige Varianten des Sachkaufes
22
Die folgenden Varianten des Sachkaufes spielen in der Praxis eine herausragende Rolle. Diese Typen sind meistens miteinander kombiniert. Der Kauf mit Montageverpflichtung (aa) ist gerade beim Verbrauchsgüterkauf (cc) häufig anzutreffen, wie sich auch aus § 474 Abs. 1 S. 2 ergibt. Weiter ist der Verbrauchsgüterkauf regelmäßig auch mit einem Eigentumsvorbehalt (bb) verbunden.
aa)Kauf mit Montageverpflichtung
23
Der Verkäufer verpflichtet sich häufig zur Montage der verkauften Sache. Hier werden die Verkäuferpflichten um eine Werkleistung i.S.d. § 631 Abs. 2 erweitert. Dies bedeutet aber nicht zwangsläufig, nun einen Werkvertrag, Werklieferungsvertrag oder typengemischten Vertrag annehmen zu müssen. Wie sich aus § 434 Abs. 2 und § 474 Abs. 1 S. 2 ergibt, führt eine Montageverpflichtung nicht automatisch dazu, dass der Vertrag deswegen nun ganz oder teilweise dem Werkvertragsrecht zu unterstellen ist. Solange es sich bei der Montage um eine untergeordnete Nebenleistungspflicht handelt, unterliegt der Vertrag einheitlich den kaufrechtlichen Regelungen. Entscheidend für die rechtliche Einordnung als Kaufvertrag, Werk(lieferungs)vertrag oder typengemischter Vertrag ist, auf welcher der beiden Leistungsteile (Lieferung, Montage) der Schwerpunkt liegt.[14] Dabei ist vor allem auf die Art des zu liefernden Gegenstandes, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage sowie auf die Besonderheiten des geschuldeten Ergebnisses abzustellen.[15] Je mehr die Übertragung von Eigentum und Besitz auf den Kunden im Vordergrund steht und je weniger die individuellen Anforderungen des Kunden und die geschuldete Montageleistung das Gesamtbild des Vertragsverhältnisses prägen, desto eher ist die Annahme eines Kaufvertrages (mit Montageverpflichtung) geboten.[16]
A verpflichtet sich gegenüber B zur Lieferung und Montage einer Solaranlage zur Warmwasserversorgung des Wohnhauses von B. Der Gesamtpreis betrug 3500 €. B zahlt nur 3000 € und verweigert wegen behaupteter Mängel die Abnahme der Montage und die Restzahlung. A klagt auf Zahlung des von B noch nicht gezahlten Restbetrages. B meint, die Klage scheitere an fehlender Abnahme und Abnahmereife (§§ 640, 641).
Auf die Abnahme kommt es nur an, wenn auf den Vertrag Werkvertragsrecht Anwendung findet. Der BGH bejahte einen Kaufvertrag (und lehnte damit Werkvertragsrecht ab), indem er auf folgende Falldetails abstellte: Die Solaranlage bestand aus serienmäßig hergestellten und typmäßig bezeichneten Teilen nebst Zubehör, welche A seinerseits von einem Zulieferer einkauft. Die Einzelteile konnten ohne weiteres wieder demontiert und anderweitig verwendet werden. Laut Angebot des A entfielen nur ca. 25 % des Gesamtpreises auf die Montage einschl. Inbetriebnahme und Nachkontrolle.
Einen Werkvertrag bejahte der BGH hingegen bei der Verpflichtung zur Verlegung eines Parkettfußbodens.[18] Im Vordergrund steht hier nach Ansicht des BGH nicht die Übertragung von Eigentum und Besitz an dem zu verlegenden Holz, sondern die mangelfreie Handwerkerleistung zur Herstellung des Parkettbodens insgesamt, insbesondere die fachgerechte Vorbereitung des Untergrundes, Zuschnitt der Holzbauteile und deren Befestigung.[19]
bb)Kauf unter Eigentumsvorbehalt (§ 449)
24
Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache[20] das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, ist nach der Auslegungsregel des § 449 Abs. 1 im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Kaufpreiszahlung übertragen wird. Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist im Zweifel also nicht so zu verstehen, dass der Kaufvertrag als schuldrechtliches Verpflichtungsgeschäft, sondern nur das Verfügungsgeschäft nach §§ 929 ff. unter einer aufschiebenden Bedingung erfolgt. Der – unbedingte – Kaufvertrag verpflichtet den Verkäufer zunächst zur Verschaffung eines (mangelfreien) Anwartschaftsrechts durch aufschiebend bedingte Einigung und Übergabe bzw. Übergabesurrogat nach §§ 929 ff. mit § 158 Abs. 1.[21] Nach herrschender Meinung bleibt es aber auch beim Verkauf unter Eigentumsvorbehalt dabei, dass vollständige Erfüllung erst eintritt, wenn der Käufer durch Bedingungseintritt mangelfreies Eigentum erlangt hat.[22] Die Leistungspflicht des Verkäufers ist also durch die Verschaffung eines mangelfreien Anwartschaftsrechts noch nicht vollständig erfüllt, sondern dauert bis zum Vollrechtserwerb fort. Die Verschaffungspflicht des Verkäufers reduziert sich nach Übertragung eines Anwartschaftsrechts jedoch auf ein Unterlassen solcher Maßnahmen, die den Erwerb mangelfreien Eigentums gefährden können.[23] Hinsichtlich der zu gewährenden Mängelfreiheit kann noch aktives Tun erforderlich sein: Bei Gefahrübergang bestehende Sachmängel (s. dazu Rn. 146 ff.) und bis zum Bedingungseintritt auftretende Rechtsmängel (s. dazu Rn. 172 ff.) sind noch zu beseitigen.
cc)Verbrauchsgüterkauf (§ 474 Abs. 1)
25
Für den Verbrauchsgüterkauf werden die allgemeinen Regeln des Kaufrechts gem. § 474 Abs. 2 S. 1 durch die besonderen Vorschriften des § 475 ergänzt und modifiziert. Auf die sich daraus ergebenden Besonderheiten und Abweichungen gehen wir im jeweiligen Sachzusammenhang ein. An dieser Stelle sollen erst einmal nur die Merkmale des Verbrauchsgüterkaufes und damit der Anwendungsbereich der §§ 474 ff. vorgestellt werden.
(1)Sachlicher Anwendungsbereich
26
Lesen Sie hierzu die §§ 13, 14, 474 einmal genau durch.
Nach der Legaldefinition des § 474 Abs. 1 liegt ein Verbrauchsgüterkauf vor, wenn ein Verbraucher (§ 13) von einem Unternehmer (§ 14) eine bewegliche Sache kauft. Der Kauf von Tieren ist gem. § 90a ebenfalls erfasst.[24]
Der Begriff „Verbrauchsgüterkauf“ ist also missglückt, da der Anwendungsbereich gar nicht auf „Verbrauchsgüter“ beschränkt ist, sondern auch solche beweglichen Sachen erfasst, die nicht zum „Verbrauch“ bestimmt sind (z.B. Schmuck, Möbel oder Kunstwerke).
Wegen der Beschränkung auf bewegliche Sachen und Tiere fällt der Kauf von Grundstücken, Rechten und sonstigen unkörperlichen Gegenständen wie Strom und Wärme[25] nicht in den Anwendungsbereich des Verbrauchsgüterkaufes. Die Elemente Gas und Wasser fallen als solche auch nicht darunter, sondern nur als abgefüllte, handelbare Einheiten (Wasserflasche, Gaspatrone für „Sodasprudler“, etc.).[26]
27
Es spielt keine Rolle, ob es sich um neue oder gebrauchte Sachen handelt.
Allerdings gelten die Sonderregeln der §§ 474 ff. nach § 474 Abs. 2 S. 2 nicht, wenn der Verbraucher eine gebrauchte (bewegliche) Sache in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung gekauft hat, an der er persönlich teilnehmen konnte. Wie sich aus der Legaldefinition in § 312g Abs. 2 Nr. 10[27] ergibt, genügt die Möglichkeit zur Teilnahme. Auf die tatsächliche Teilnahme kommt es nicht an. Der Kaufvertrag kommt bei einer Versteigerung nicht durch Angebot und Annahme, sondern gem. § 156 durch Gebot und Zuschlag zustande.[28] Eine „eBay®-Auktion“ wird daher von § 474 Abs. 2 S. 2 aus zwei Gründen nicht erfasst: Zum einen besteht bei einer reinen Internettransaktion keine Möglichkeit zur persönlichen Teilnahme. Zum anderen wird der der Vertrag nicht gem. § 156, sondern dort durch vorweg erklärte Annahme des „Höchst(an)gebotes“ geschlossen.[29]
Ob eine Sache „neu oder gebraucht“ ist, ist nach einem objektiven Maßstab zu bestimmen und einer Parteivereinbarung entzogen.[30] „Gebraucht“ ist eine Sache, wenn sie bereits bestimmungsgemäß benutzt worden ist.[31] Tiere werden dann als „gebraucht“ angesehen, wenn sie – nach der Verkehrsanschauung – nicht mehr „jung“ sind, spätestens bei bestimmungsgemäßer Verwendung (z.B. als Nutz- oder Zuchttier).[32]
Der Anwendung der kaufrechtlichen Bestimmungen und der Vorschriften über den Verbrauchsgüterkauf steht es nach § 474 Abs 1 S. 2 nicht entgegen, wenn der Verkäufer neben dem Pflichtenprogramm des § 433 zusätzliche Nebenleistungspflichten übernimmt. Mit dem Begriff der „Dienstleistung“ in § 474 Abs. 1 S. 2 sind nicht nur die Dienstleistungen i.S.d. § 611 gemeint. Der Ausdruck ist etwas missglückt. Vielmehr soll der Begriff untechnisch in einem weiten Sinne verstanden werden, so dass auch erfolgsbezogene Leistungen i.S.d. Werkvertragsrechts darunter fallen.[33]
Montage oder Installation des Kaufgegenstandes, Schulung des Käufers in Bezug auf die Handhabung des Kaufgegenstandes.
Entscheidend ist, dass der Schwerpunkt des Vertrages auf den kaufrechtlichen Leistungspflichten liegt.[34] Damit haben wir uns bereits oben unter Rn. 23 beschäftigt. Die Montageverpflichtung des Verkäufers ist ein Hauptanwendungsfall des § 474 Abs. 1 S. 2.
(2)Persönlicher Anwendungsbereich
28
In persönlicher Hinsicht setzt § 474 voraus, dass bei Vertragsschluss der Käufer als Verbraucher i.S.d. § 13 und der Verkäufer als Unternehmer i.S.d. § 14 handelte.
Da auf den Vertragsschluss abgestellt wird, sind spätere Änderungen in der Zweckrichtung, die Einfluss auf die Eigenschaft als Verbraucher oder Unternehmer haben könnten, bedeutungslos. Bei Stellvertretung kommt es auf die Person des Vertretenen an – dessen Zweckrichtung entscheidet über die Einordnung als Verbraucher oder Unternehmer.[35]
(a)Verbraucher als Käufer
29
Nach § 13 ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
Aus der Formulierung folgt, dass Verbraucher immer Menschen sind und keine juristischen Personen oder Personengesellschaften.[36]
30
Ob ein Mensch bei Abschluss des Kaufvertrages als Verbraucher oder Unternehmer handelte, ist grundsätzlich anhand der – objektiv zu bestimmenden – Zweckrichtung seines Verhaltens bei Vertragsschluss zu entscheiden.[37] Das Gesetz stellt – aus Gründen der Rechtssicherheit - nicht generell auf das Vorhandensein geschäftlicher Erfahrung ab, etwa aufgrund einer bereits ausgeübten gewerblichen oder selbstständigen freiberuflichen Tätigkeit. Eine natürliche Person kann gem. §§ 13, 14 also bei einem Geschäft als Verbraucher und beim nächsten Geschäft als Unternehmer handeln. Der Verbraucher- und Unternehmerbegriff sind situationsbezogen und keine „Statussymbole“.
31
Bei Mischlagen, bei denen sowohl private als auch berufliche Zwecke verfolgt werden (sog. „dual use“), kommt es nach der Formulierung des § 13 darauf an, welche Zwecke die Partei bei Vertragsschluss objektiv überwiegend verfolgte.
32
Aus der „weder-noch“-Formulierung in § 13 folgt zugleich: Ist der Käufer ein Mensch („natürliche Person“) ist gem. § 13im Zweifel von seinem Verbraucherhandeln auszugehen.[38]
Bei (Einzel-)Kaufleuten wäre zwar die Vermutungsregel des § 344 HGB anwendbar und würde bei der Entscheidung der Zuordnungsfrage in umgekehrter Richtung helfen. Für die Frage der Anwendbarkeit der Verbraucherschutzvorschriften gilt aber auch bei gewerbetreibenden Menschen vorrangig die Vermutungsregel aus § 13, wonach im Zweifel von einer Verbrauchereigenschaft auszugehen ist![39]
Diese Vermutung ist widerlegt, wenn die dem Vertragspartner erkennbaren Umstände eindeutig und zweifelsfrei auf ein Handeln als Unternehmer hinweisen.[40]
Mit anderen Worten: Bei der Zurechnung gelten nicht die allgemeinen Auslegungsregeln der §§ 133, 157, sondern noch schärfere, objektivierte Maßstäbe.
Rechtsanwalt K kauft bei der Händlerin V GmbH eine Lampe. V schließt den Vertrag als juristische Person[41] in Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit und handelt damit als Unternehmerin. Bei K ist hingegen im Zweifel von einer privaten Nutzung und damit von seiner Verbrauchereigenschaft gem. § 13 auszugehen.
Rechtsanwalt K bestellt bei der Händlerin V GmbH über das Internet eine Lampe, die er privat nutzen möchte. Um den Einkaufspreis steuerlich absetzen zu können, gibt K bei der Bestellung jedoch als Käufer „Rechtsanwaltskanzlei K“ und als Rechnungs- und Lieferadresse seine Büroadresse an. Hier verfolgte K zwar einen privaten Zweck, muss sich anhand seiner eindeutigen Äußerungen aber als Unternehmer behandeln lassen.[42] Es liegt kein Verbrauchsgüterkaufvertrag vor.
(b)Unternehmer als Verkäufer
33
Auf der anderen Seite verlangt § 474 Abs. 1 die Unternehmereigenschaft des Verkäufers. Anders als beim Verbraucher kommen als Unternehmer gem. § 14 nicht nur natürliche Personen, sondern auch juristische Personen (z.B. GmbH/UG, AG, SE, eingetragener Verein) und rechtsfähige Personengesellschaften i.S.d. § 14 Abs. 2 (z.B. Außen-GbR, oHG, KG)[43] in Betracht.
Der Begriff des „Unternehmers“ i.S.d. § 14 und des „Kaufmanns“ i.S.d. §§ 1 ff. HGB sind strikt zu trennen. Freiberufler (z.B. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Ärzte) betreiben kein Gewerbe[44] und können daher bei selbständiger Berufsausübung zwar Unternehmer i.S.d. § 14, aber nicht Kaufmann sein.
34
Unternehmer ist nach § 14 Abs. 1, wer bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
Eine gewerbliche Tätigkeit ist eine planmäßig und auf Dauer angelegte wirtschaftlich selbständige Tätigkeit unter Teilnahme am Wettbewerb.[45]
Eine selbständige berufliche Tätigkeit ist die planmäßige und auf Dauer angelegte wirtschaftlich selbständige Tätigkeit am Markt, die kein Gewerbe ist (z.B. Tätigkeit der selbständigen Freiberufler).[46]
Auf den Umfang der Tätigkeit kommt es nicht an und auch nicht darauf, ob die Tätigkeit nebenbei oder schwerpunktmäßig erfolgen soll und ob Gewinne erzielt werden sollen oder nicht.[47]
Auch wenn die Gewinnerzielungsabsicht keine Rolle spielt, erfordert eine wirtschaftliche Betätigung immerhin ein planmäßiges Anbieten von entgeltlichen Leistungen.[48] Dieses Merkmal ist beim Kaufvertrag ohnehin gegeben, dessen Zustandekommen die Vereinbarung eines Kaufpreises als Entgelt voraussetzt.
Die Verwaltung und Anlage eigenen Vermögens dient nur dem Vermögensträger selbst und stellt daher grundsätzlich kein Leistungsangebot am Markt für Dritte dar. Sie ist daher bei natürlichen Personen eine Tätigkeit als Verbraucher.[49]
35
Bei der Beteiligung einer Handelsgesellschaft (z.B. oHG[50], KG[51], GmbH[52] oder AG[53]) arbeitet man wieder mit einer Vermutungsregel, diesmal in umgekehrter Richtung als beim Vebraucher: Im Zweifel ist nach §§ 6 Abs. 1, 344 Abs. 1 HGB von einer unternehmerischen Tätigkeit auszugehen, auch wenn es sich um ein branchenfremdes Geschäft handelt.[54] Es genügt „irgendein“ Zusammenhang“, auch wenn es das erste und einzige Mal war.[55] Selbst wenn die Gesellschaft nur die „Verwaltung eigenen Vermögens“ bezweckt (vgl. §§ 105 Abs. 2, 123 Abs. 2 HGB) ist sie als Unternehmer anzusehen, da zumindest eine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit außerhalb des Privatbereiches gegeben ist.[56] Das genügt.
Die V-GmbH handelt mit Lampen. Kauft Student K bei V deren ausrangierten Lieferwagen, gehört auch dieses Geschäft gem. § 13 Abs. 3 GmbHG i.V.m. §§ 6 Abs. 1, 343, 344 Abs. 1 HGB