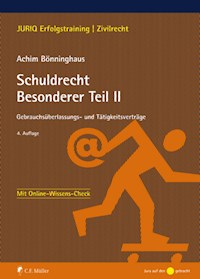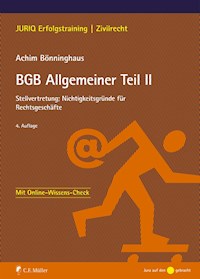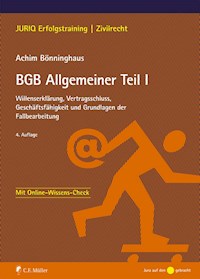19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Inhalt: Das Skript behandelt aus dem Allgemeinen Schuldrecht: Rücktrittsfolgen, Verantwortlichkeit des Schuldners und Schadensrecht. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Schuldrecht Allgemeiner Teil II
Pflichtverletzung
von
Achim Bönninghaus
4., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-7652-3
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre zivilrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Dieses Skript behandelt das Thema Pflichtverletzung in Schuldverhältnissen nach den Regeln des Allgemeinen Schuldrechts. Die Pflichtverletzung in Form der Schlechtleistung bleibt hingegen dem Besonderen Schuldrecht vorbehalten, wo sie bei den verschiedenen Vertragstypen eingehend behandelt wird.
Das Anliegen dieser Skriptenreihe besteht darin, den Stoff möglichst so aufzubereiten, wie er in einer Klausur, deren Lösung sich an der Begutachtung von Anspruchsbeziehungen orientiert, gedanklich abzuarbeiten ist. Die Darstellung gehorcht daher den gedanklichen Schritten im Rahmen einer Anspruchsprüfung und nicht der Gliederung des Gesetzgebers. Das Skript will kein Lehrbuch sein: Die einzelnen Rechtsinstitute werden nicht einzeln und in sich geschlossen behandelt, sondern stets von den Tatbeständen aus, die in der Klausur den Einstieg bilden. Erläuternde Einführungen erleichtern naturgemäß das Verständnis, doch sind sie auf das notwendige Mindestmaß beschränkt.
Dieses Skript richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Examenskandidaten. Dies liegt in der Natur des Themas, das vom ersten Semester an Bestandteil des zivilrechtlichen Lehrstoffs ist. Das Allgemeine Schuldrecht gehört zu den Kernbereichen des Prüfungsstoffes.
Zu den Fußnoten: Sie werden feststellen, dass Literaturverzeichnis und Fußnotenapparat „übersichtlich“ gehalten sind, um es noch milde zu formulieren. Das Skript will gar nicht den Anspruch erheben, das Schrifttum auch nur annähernd vollständig zu belegen. Das kann es gar nicht leisten. Betrachten Sie die Literaturangaben eher als persönliche Leseempfehlungen. Das gilt übrigens auch für die zitierte Rechtsprechung.[1] Ich würde mich freuen, wenn Sie die eine oder andere Entscheidung nachlesen. Urteile gehören in vielen Bereichen faktisch zu den Primärquellen unserer Rechtsordnung, so dass Sie sich möglichst frühzeitig an Stil und Aufbereitung des Stoffes im Urteil gewöhnen sollten. Gerade das noch relativ „junge“ Schuldrecht erfährt seit Inkrafttreten der Schuldrechtsreform eine laufende Ausgestaltung und Prägung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Nicht selten werden Examensklausuren neuen Entscheidungen nachgebildet, so dass ich auch unter diesem Aspekt nur dringend raten kann, die Rechtsprechungsentwicklung genau zu verfolgen. Zur Erleichterung haben wir uns bemüht, die „Hausnummer“ der Fundstelle innerhalb der Entscheidung anzugeben.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Frankfurt, im Januar 2020 Achim Bönninghaus
Anmerkungen
Die in den Fußnoten mit Aktenzeichen zitierten Entscheidungen des BGH können Sie kostenlos auf der Homepage des BGH unter www.bundesgerichtshof.de (Rubrik: „Entscheidungen“) abrufen.
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 82, 462
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinführung
A.Pflichten im Schuldverhältnis
B.Arten der Pflichtverletzung
I.Verletzung von Leistungspflichten
1.Leistungsverzögerung
2.Schlechtleistung
3.Nichtleistung wegen Leistungsbefreiung nach § 275
II.Verletzung von Rücksichtspflichten
C.Aufgaben der Regelungen über Leistungsstörungen
2. TeilVertretenmüssen
A.Unterscheidung zwischen Vertretenmüssen und Verschulden
B.Vertretenmüssen ohne Verschulden
I.Gesetzliche Bestimmung
1.Gesetzliche Ersatzpflichten ohne Vertretenmüssen im Tatbestand
2.Zufallshaftung nach § 287 S. 2
II.Geldmangel
III.Vertragliche Übernahme
IV.„Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
1.Garantieübernahme
2.Übernahme eines Beschaffungsrisikos
C.Vertretenmüssen wegen Verschuldens des Schuldners
I.Vorsatz
II.Fahrlässigkeit
1.Maßstab
2.Korrektur bei bestimmten Personengruppen
III.Eigenes Verschulden bei „unnatürlichen“ Schuldnern
1.Verschulden eines Repräsentanten
2.Bezug zur Stellung als Repräsentant
D.Vertretenmüssen wegen Verschuldens Dritter (§ 278)
I.Bestehendes Schuldverhältnis
II.Verschulden
III.Erfüllungsgehilfe
1.Tätigwerden mit Willen des Schuldners
2.Tätigwerden bei Erfüllung einer Verbindlichkeit des Schuldners
a)Verbindlichkeit des Schuldners
b)Handeln bei Erfüllung
IV.Gesetzliche Vertreter
E.Erleichterungen im Haftungsmaßstab
I.Gesetzliche Beschränkungen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
II.Haftungsbeschränkung auf die eigenübliche Sorgfalt
III.Vertragliche Haftungsmilderungen
1.Wirksamkeitsvoraussetzungen
a)Allgemeine Wirksamkeitserfordernisse
b)Wirksamkeitshindernisse
2.Besonderheiten bei Haftungsbeschränkung in AGB
3.Auswirkungen unzulässiger Haftungsklauseln
3. TeilLeistungsverzögerung
A.Tatbestand der Leistungsverzögerung
I.Unterscheidung zwischen Leistungsverzögerung und Verzug
II.Nichtleistung trotz Fälligkeit
1.Fälligkeit der Leistung
a)Vertraglich vereinbarte Fälligkeit
b)Gesetzlich besonders bestimmte Fälligkeit
c)Allgemeine Grundregel
2.Durchsetzbarkeit
a)Bestand des Anspruchs zum Fälligkeitstermin
b)Einredefreiheit
3.Kein Annahmeverzug des Gläubigers
a)Anbieten der Leistung
b)Entbehrlichkeit des Angebots nach § 296
c)Leistungsfähigkeit des Schuldners (§ 297)
d)Ausnahme des § 299
e)Sonderfall, § 298
4.Sonderfall: Schickschulden
a)Grundregeln
b)Besonderheiten bei Geldschulden
B.Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286
I.Die Unterscheidung zwischen Schadensersatz „neben“ und „statt“ der Leistung
II.Schuldverhältnis
III.Pflichtverletzung in Form des Schuldnerverzuges gem. §§ 280 Abs. 2, 286
1.Mahnung
a)Charakter und Inhalt der Mahnung
b)Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
2.Mahnungssurrogat, § 286 Abs. 1 S. 2
3.Entbehrlichkeit der Mahnung
a)Fall des § 286 Abs. 2 Nr. 1
b)Fall des § 286 Abs. 2 Nr. 2
c)Fall des § 286 Abs. 2 Nr. 3
d)Fall des § 286 Abs. 2 Nr. 4
e)Sonderfall des § 286 Abs. 3 für Entgeltforderungen
4.Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Forderung
a)Fall des Verzugseintritts durch Mahnung
b)Sonstige Fälle
5.Nichtleisten des Schuldners
IV.Vertretenmüssen
V.Ersatzfähiger Schaden
1.Rechtsverfolgungskosten
2.Entgangener Gewinn
3.Nutzungsausfall
4.Zinsschaden
5.Schadensberechnung bei Abtretung
VI.Art und Umfang des Schadensersatzes
C.Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281
I.Schuldverhältnis
II.Pflichtverletzung
1.Leistungsverzögerung
2.Erfolgloser Ablauf einer angemessenen Frist
a) Fristsetzung
b) Angemessenheit der Frist
c) Fortbestehende Leistungsverzögerung bei Fristablauf
3. Abmahnung, § 281 Abs. 3
4. Entbehrlichkeit der Fristsetzung/Abmahnung
a)Fall des § 281 Abs. 2 Var. 1
b) Fall des § 281 Abs. 2 Var. 2
III.Vertretenmüssen des Schuldners, § 280 Abs. 1 S. 2
IV. Ersatzfähiger Schaden
V. Art und Umfang des Schadensersatzes
1.Beschränkung auf Wertersatz
2.Surrogations- und Differenzmethode
a)Ansatz der Surrogationsmethode
b)Ansatz der Differenzmethode
c)Methodenauswahl
3.„Großer“ und „kleiner“ Schadensersatz statt der Leistung
a)Bewirken einer Teilleistung
b)Grundsatz: „Kleiner Schadensersatz“
c)Alternative: „Großer Schadensersatz“ bei Interessefortfall
D.Aufwendungsersatzanspruch nach § 284
I.Voraussetzungen des Anspruches auf Schadensersatz statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281
II.Ersatzfähige Aufwendungen
1.Vergebliche Aufwendungen
2.Vertrauenstatbestand
III.Billigkeit
IV.Keine Vergeblichkeit aus anderen Gründen
V.Vorteilsausgleichung
E.Zinsanspruch aus § 288
I.Geldschuld
II.Verzug
III.Beginn der Zinspflicht
IV.Zinshöhe
1.Grundsatz
2.Entgeltforderungen aus unternehmerischen Geschäftsverkehr
3.Besonders bestimmter Zinssatz, § 288 Abs. 3
F.Rücktritt vom gegenseitigen Vertrag gem. § 323
I.Wirkungen des Rücktritts
1.Erlöschen der Primärleistungspflichten
2.Anspruch auf Rückgewähr gemäß § 346 Abs. 1
a)Rückgewähr empfangener Leistungen
b)Herausgabe von Nutzungen
3.Wertersatzpflicht, § 346 Abs. 2
a)Wertersatz nach § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 1
b)Wertersatzpflicht nach § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 2
c)Wertersatzpflicht nach § 346 Abs. 2 S. 1 Nr. 3
d)Wertersatz nach § 347 Abs. 1
4.Aufwendungsersatz nach § 347 Abs. 2
II.Rücktritt nach § 323
1.Wirksamer Vertrag
2.Rücktrittserklärung
3.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen für einseitige Rechtsgeschäfte
4.Rücktrittsrecht aus § 323
a)Leistungsverzögerung im gegenseitigen Vertrag
b)Ablauf einer angemessenen Nachfrist
c)Entbehrlichkeit der Fristsetzung
d)Abmahnung, § 323 Abs. 3
e)Ausnahme nach § 323 Abs. 4
f)Ausschluss des Rücktrittsrechts gem. § 323 Abs. 5 S. 1
g)Ausschluss des Rücktrittsrechts gem. § 323 Abs. 6
h)Ausschluss aus sonstigen Gründen
III.Übungsfall Nr. 1
4. TeilLeistungsbefreiung
A.Ausschluss der Primärleistungspflicht gem. § 275
I.Wirkung und Anwendbarkeit des § 275
II.Ausschluss nach § 275 Abs. 1
1.Unmöglichkeit
2.Unterscheidung nach Zeitpunkt der Entstehung
3.Teilunmöglichkeit
4.Vorübergehende Unmöglichkeit
5.Besonderheiten bei der Gattungsschuld
6.Sondertatbestand des § 300 Abs. 2
III.Leistungsbefreiung gem. § 275 Abs. 2 und 3
1.§ 275 Abs. 2
2.Unzumutbarkeit (§ 275 Abs. 3)
B.Herausgabe eines stellvertretenden commodums (§ 285)
I.Schuldverhältnis
II.Leistungsbefreiung des Schuldners
III.Erlangung eines Ersatzes
IV.Adäquater Kausalzusammenhang zwischen Unmöglichkeit und erlangtem Ersatz/Anspruch
V. Kongruenz zwischen stellvertretendem Commodum und ursprünglich geschuldeter Leistung
C.Schadensersatz wegen Leistungsbefreiung nach § 275
I.Anspruchsgrundlagen
II.Schadensersatz aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283, 275 Abs. 4
III.Schadensersatz aus §§ 311a Abs. 2, 275 Abs. 4
IV.Schadensersatz neben der Leistung bei Unmöglichkeit?
D.Entfallen der Gegenleistungspflicht nach § 326 Abs. 1 S. 1
I.Gegenseitiger Vertrag
II.Wirkung des § 326 Abs. 1 S. 1
III.Ausnahme nach § 326 Abs. 1 S. 2
IV.Vertraglicher Ausschluss
1.Ausschluss durch Individualvereinbarung
2.Ausschluss durch gesetzliche Sondertatbestände
V.Ausnahmen des § 326 Abs. 2
1.Ausnahme nach § 326 Abs. 2 S. 1 Fall 1
2.Ausnahme nach § 326 Abs. 2 S. 1 Fall 2
3.Vorteilsausgleich nach § 326 Abs. 2 S. 2
VI.Ausnahme nach § 326 Abs. 3
E.Rückzahlungsanspruch aus §§ 346 Abs. 1, 326 Abs. 4
F.Sonderfall: Beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit
G.Rücktritt nach § 326 Abs. 5
I.Bedeutung des Rücktrittsrechts aus § 326 Abs. 5
1.Befreiung von einer Teilleistung nach § 275
2.Befreiung von der Nacherfüllung nach § 275
II.Voraussetzungen des Rücktrittsrechts
1.Gegenseitiger Vertrag
2.Leistungsbefreiung nach § 275
3.Kein Ausschluss nach § 323 Abs. 5
4.Kein Ausschluss nach § 323 Abs. 6
H.Übungsfall Nr. 2
5. TeilDie Rücksichtspflichtverletzung
A.Konkurrenz zu den Leistungsstörungsregeln
B.Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung aus § 280 Abs. 1
I.Schuldverhältnis
1.Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
a)Leistungsnähe des Dritten
b)Einbeziehungsinteresse des Gläubigers
c)Erkennbarkeit
d)Schutzbedürftigkeit des Dritten
2.Vorvertragliche Rücksichtspflichten (sog. „culpa in contrahendo“)
a)Voraussetzungen des § 311 Abs. 2
b)Parteien des vorvertraglichen Schuldverhältnisses nach § 311 Abs. 2
c)Verpflichtung Dritter nach § 311 Abs. 3
d)Begünstigung Dritter
e)Beendigung des vorvertraglichen Schuldverhältnisses
II.Rücksichtspflichtverletzung
1.Schutzpflichten
2.Aufklärungspflichten
a)Informationsgefälle
b)Besondere Umstände
c)Konkurrenz der vorvertraglichen Aufklärungspflichtverletzung zur Anfechtung
3.Leistungstreuepflichten
4.Sonderfall: Grundloser Abbruch von Vertragsverhandlungen
III.Vertretenmüssen
1.Grundregel
2.Besonderheiten beim Vertrag oder c.i.c. mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
3.Besonderheiten bei der Vertreterhaftung gem. § 311 Abs. 3
IV.Ersatzfähiger Schaden
V.Art und Umfang des Schadensersatzes (§§ 249 ff.)
1.Allgemeine Grundregeln
2.Besonderheiten beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
VI.Verhältnis der vorvertraglichen Pflichtverletzung zu §§ 122, 179
1.Verhältnis zu § 122
2.Verhältnis zu § 179
C.Schmerzensgeldanspruch aus § 253 Abs. 2 i.V.m. §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2
D.Schadensersatz „statt der Leistung“, §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 282
E.Rücktritt, § 324
F.Übungsfall Nr. 3
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Looschelders, Dirk
Schuldrecht Allgemeiner Teil, 17. Aufl. 2019
Medicus, Dieter
Allgemeiner Teil des BGB, 11. Aufl. 2016
Medicus, Dieter/Petersen, Jens
Bürgerliches Recht, 27. Aufl. 2019
Medicus, Dieter/Lorenz, Stephan
Schuldrecht I, 22. Aufl. 2020
Münchener Kommentarzum Bürgerlichen Gesetzbuch
Band 2 (Schuldrecht Allgemeiner Teil),8. Aufl. 2019
Palandt, Otto
Bürgerliches Gesetzbuch, 79. Aufl. 2020(zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Petersen, Jens
Allgemeines Schuldrecht, 9. Aufl. 2019
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 4Grundlagen: Lernen, Behalten und Erinnern
Die Lern- und Gedächtnispsychologie hat einige praktische Ideen, die Ihr Lernen erleichtern werden. Sie können damit effektiver lernen, mehr behalten und später den Lernstoff wieder gut abrufen. Sie können diese Methoden und Techniken sofort in die Praxis umsetzen und deren Erfolg unmittelbar feststellen. Lerntipps gibt es zu den Themen Arbeitsplanung, Techniken zum Warmlaufen, Einteilung des Lernpensums, Pausenmanagement und positive Abschlussgestaltung. Übrigens: Sie brauchen nicht alle Tipps auf einmal anzuwenden. Testen Sie ruhig einen nach dem anderen!
Lerntipps
Fangen Sie nicht einfach an!
Viele wollen das große Arbeitspaket möglichst schnell hinter sich bringen und fangen einfach an. Verschaffen Sie sich besser zu Beginn eine Übersicht über folgende Punkte:
•
Inhalte, die erarbeitet werden müssen
•
Tätigkeiten, die erbracht werden müssen (Lesen, Schreiben, Sammeln, Gliedern, Auswendiglernen)
•
Benötigte Arbeitszeiten
•
Dringlichkeit und Priorisierung einzelner Inhalte und Tätigkeiten
Schreiben Sie auf Arbeitskarten (Karteikartengröße), welche Arbeiten im folgenden Zeitabschnitt von ca. 2 bis 4 Stunden zu erledigen sind. Sie können das Ganze in eine optimale Reihenfolge bringen und an eine Pin-Wand heften. Damit bekommen Sie eine sinnvolle Ordnung, die Ihr Lernleben erleichtert. Und immer, wenn eine Tätigkeit beendet ist, vernichten Sie die Zettel als positiven Abschluss. Die Planungstechnik eignet sich auch für langwierige schriftliche Ausarbeitungen sehr gut.
Machen Sie Ihren Denkapparat warm!
Ein Sportler macht sich vor Beginn des Wettkampfes warm, um körperlich, aber auch mental auf „Betriebstemperatur“ zu kommen. Ein Musiker spielt sich vor seinem Konzert ein. Auch der Denkapparat braucht eine Warmlaufphase, da zu Beginn einer Lerneinheit die Aufnahmefähigkeit noch relativ gering ist. Starten Sie also mit möglichst einfachen Tätigkeiten, Dingen, die Ihnen persönlich eher leicht von der Hand gehen.
Startarbeiten können sein:
•
Definitionen erst einmal nur durchlesen
•
Begriffe aus einem Buch zu einem Thema heraussuchen, kennzeichnen, mit Seitenzahlen versehen
•
Einfache Texte lesen
•
Karteikarten schreiben und ordnen
•
Material abheften
Bei umfassenderen Arbeiten das wiederholte Warmlaufen nicht vergessen!
Wenn Sie an einer Hausarbeit oder an einem umfangreicheren Lernstoff sitzen, starten Sie nach Pausen immer wieder neu. Sie können sich das Denken für einen Neustart erleichtern, wenn Sie sich am Ende einer Arbeitsphase kurze Merksätze notieren, was Sie nach der Pause konkret lesen, erarbeiten, vergleichen oder welche Fragen Sie beantworten wollen. Mit diesen Notizen können Sie sehr schnell wieder Gedankengänge aktivieren und in Ihr Gesamtkonzept einsteigen. Sie können aber auch die Feingliederung für den geplanten Teil noch einmal durchgehen oder zwei Seiten zurückzublättern, um sich wieder einzulesen.
Den Lernstoff in 5 bis 7 Lernportionen einteilen!
Es gibt auch beim Lernen eine optimale Menge der „akuten Lernbelastbarkeit“. Ein Lernumfang von 5 bis 7 Elementen („Chunks“) kann leicht auf einmal gespeichert werden. Wird diese Menge überschritten, ist Ihr Arbeitsspeicher (Speicherdauer 15 bis 30 Sekunden) überfordert, und es wird weniger ins Langzeitgedächtnis („Festplatte“) befördert, also behalten. „Chunks“ sind sinnvolle Gruppierungen von Informationen, – z. B. 7 Aufbauschemata, 7 Definitionen etc. Der mögliche Umfang Ihrer „Chunks“ hängt von Ihrem Vorwissen zu einem Lerngebiet ab.
Fazit für die Praxis:
•
Bereiten Sie Ihr Lernmaterial so auf, dass die Zahl von 5 bis 7 Fachbegriffen, Definitionen, Merksätzen, Kategorien nicht überschritten wird.
•
Teilen Sie umfangreicheres Material in Einheiten mit Untereinheiten (ebenfalls max. 7), die sinnvoll miteinander in Beziehung stehen.
•
Denn: Sinnvoll gruppiertes Material wird besser behalten als beziehungslos nebeneinanderstehendes.
•
Stabilisieren Sie das Wissen durch regelmäßiges Wiederholen in kleineren Portionen.
Testen Sie den Positionseffekt beim Lernen!
Es gibt nicht nur bevorzugte Plätze im Stadion oder Konzertsaal, sondern auch in einer Reihe von Lernelementen. Der Anfang und das Ende werden besser behalten und erinnert (Erfahrung des Autors als Coach: auch die ersten und letzten Stellenbewerber werden besser erinnert als die in der Mitte eines Bewerbungsprozesses). Stellen Sie sich vor, Sie müssen 20 Aufbauschemata oder Definitionen lernen. Die erste und die letzte Definition machen 10% des Lernmaterials aus, das Sie sich ohne besonderes Zutun besser einprägen können. Bei 2 Lernpaketen wären das 20%, bei 4 Paketen à 5 Definitionen schon 40% erleichterte Aufnahme.
Fazit für die Praxis:
•
Nutzen Sie den Vorteil, dass Anfang und Ende einer Reihe leichter behalten werden!
•
Teilen Sie Ihre Gesamtmenge in Portionen von 5 bis 7 Elementen auf, dann haben Sie entsprechend mehr Randelemente!
•
Lernen Sie die Einheiten stets mehrfach in einer jeweils anderen Reihenfolge, dadurch wird der Positionseffekt mehrfach genutzt und sie werden damit flexibler bereitgestellt!
Beseitigen Sie die „Ähnlichkeitshemmung“!
Sind Lernelemente einander sehr ähnlich, so hemmen sie sich gegenseitig beim Lernen (= Ähnlichkeitshemmung). Man kann z. B. 5 unterschiedliche Begriffe besser abspeichern als 5 ähnliche. Lernen Sie ähnliche Inhalte stets zeitlich voneinander getrennt. Sie können diese dann „verwechslungssicherer“ abrufen. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn Sie inhaltlich unterschiedliche Dinge lernen. Das ist sogar eher förderlich.
Mit verteiltem Lernen behalten Sie auf die Dauer mehr!
Unsere Aufnahmefähigkeit ist begrenzt. Das haben Sie und ich schon mehrfach festgestellt. Selbst nach einem Warmstart dürfen wir nicht mit einer gleichmäßig ansteigenden Zunahme unseres Wissens rechnen. Es mag Sie zwar enttäuschen, aber wir behalten nach längerer Lernzeit immer weniger. Wir erreichen dann ein Lernplateau, wenn wir zu lange oder zu häufig denselben Stoff wiederholen. Es wird dann oft ohne Gewinn unnötiger Energieaufwand betrieben. Es kann sogar zu einer Abnahme schon erworbenen Wissens führen. Mehrarbeit kann also auch schaden. Das Gehirn braucht zum effektiven Lernen Zeit, um neue neuronale Verknüpfungen zu bilden, damit das Lernen auch „Spuren“ hinterlässt.
Die Konsequenz heißt „verteiltes statt massiertes Lernen“, den Lernstoff also mit Zwischenpausen bearbeiten.
•
Zuerst langsam und aufmerksam lesen und nicht direkt einprägen wollen.
•
Pause: Etwas ganz anderes tun.
•
Wesentliche einzelne Begriffe und Zusammenhänge aufschreiben.
•
Pause: Wieder ganz andere Dinge tun, auch Geistiges, jedoch möglichst unähnlich zu dem bisherigen Lernstoff.
•
Wieder Begriffe und Zusammenhänge einprägen.
•
usw.
Für Definitionen und Aufbauschemata zu einem Thema sind Abstände von 20 bis 40 Minuten zu empfehlen, bei größeren Textabschnitten wie Buchkapiteln können das auch mehrere Stunden sein.
Den Lernmotor und Ihre Motivation vor Überbelastung schützen!
Die maximale Leistungsfähigkeit kann nur in einem begrenzten Zeitraum erreicht werden. Bei Überschreitung passieren Fehler, die Leistung wird gemindert und die Motivation möglicherweise dauerhafter geschädigt. Vor Eintritt in eine solche Negativphase sollten Sie ein für Sie passendes Pausenmanagement einrichten.
Generell gilt:
•
Häufige Pausen von weniger als 20 Minuten sind besonders effektiv und besser als wenige lange Pausen.
•
Pausen sollten nicht mit lernnahen Tätigkeiten oder speicherbelastenden Aktivitäten (PC-Spiele) ausgefüllt werden.
Beispiele für unterschiedliche Pausenarten, die in den Tages- und Lernablauf integriert werden sollten:
•
Abspeicherpausen (Augen zu): 10 bis 20 Sekunden nach Definitionen, Begriffen und komplexen Lerninhalten zum sicheren Abspeichern und zur Konzentration.
•
Umschaltpausen: 3 bis 5 Minuten nach ca. 20 bis 40 Minuten Arbeit, um Abstand zum vorher Gelernten zu bekommen und dadurch besser Neues aufzunehmen.
•
Zwischenpausen: 15 bis 20 Minuten nach 90 Minuten intensiver Arbeit, also nach zwei Arbeitsphasen, dient dem Erholen und Abschalten.
Und nicht vergessen:
•
Die lange Erholungspause von 1 bis 3 Stunden, z. B. mittags oder zum Feierabend nach 3 Stunden Arbeit sollten Sie ebenfalls zum richtigen Abschalten, Regenerieren, Sich-Belohnen nutzen!
Die Lernarbeit positiv abschließen!
Unsere Erinnerung behält vor allem die letzten Erlebnisse. Endet ein an und für sich schöner Abend mit einem Streit, so wird der Abend rückwirkend als unangenehm empfunden. Ein Kellner bietet uns nach dem Essen auf Rechnung des Hauses einen Espresso oder Schnaps an. Wenn wir uns erinnern, werden wir geneigt sein, das gute Essen noch besser zu erinnern. D. h. wenn eine Tätigkeit positiv beendet wird, wird sie insgesamt als positiver erlebt.
Nach einer längeren Arbeitsphase von 1 bis 3 Stunden können Sie Folgendes tun:
•
Bewusst feststellen, was Sie alles geschafft haben, beachten Sie dabei weniger die unbearbeitete Menge.
•
Vergleichen Sie, was Sie zu Beginn einer Lernphase konnten oder wussten – und was Sie nun beherrschen.
•
Legen Sie eventuell ein Karteikartensystem an, mit dem Sie sehr leicht feststellen können, was Sie können (z. B. eine Kartei mit Aufbauschemata, Definitionskartei; siehe dazu auch die Arbeitskarten aus dem ersten Lerntipp)
Jeden Tag das gleiche Ritual!
Der Abschluss eines Lerntages sollte auch symbolisch eine Zäsur setzen, analog dem Wechsel von Arbeit zu Freizeit mit der Schulklingel oder dem Kleidungswechsel nach der Arbeit.
Abschlussrituale am Ende eines Tages können sein:
•
Denken Sie bereits 10 Minuten vor dem Arbeitsende eines Tages an das Ende der Arbeit.
•
Denken Sie kurz aber bewusst darüber nach, an welcher Stelle Sie die Arbeit für heute beenden.
•
Sagen Sie sich bewusst: Für heute ist die Arbeit für mich beendet.
•
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Geleistete.
•
Machen Sie sich kurze Notizen, welche Aspekte in der nächsten Arbeitsphase zu berücksichtigen sind. Das erleichtert den Einstieg am Folgetag.
•
Klappen Sie den Ordner bewusst zu, fahren Sie den PC bewusst herunter und sagen Sie sich „Ich habe jetzt Freizeit!“
•
Verlassen Sie den Arbeitsplatz und den Arbeitsbereich. Wenn möglich, ziehen Sie sich um.
•
Gestalten Sie dieses Abschlussritual jeden Tag!
1. TeilEinführung
A.Pflichten im Schuldverhältnis
B.Arten der Pflichtverletzung
C.Aufgaben der Regelungen über Leistungsstörungen
1. Teil Einführung › A. Pflichten im Schuldverhältnis
A.Pflichten im Schuldverhältnis
1
[Bild vergrößern]
2
Nach § 241 BGB[1] begründet ein Schuldverhältnis Leistungspflichten (Abs. 1) und Rücksichtspflichten (Abs. 2). Und sogleich stellt sich die Frage, worin sich diese beiden Pflichtenarten eigentlich unterscheiden.
Ein wichtiger Anhaltspunkt findet sich in den Formulierungen der beiden Absätze des § 241. Nach § 241 Abs. 1 ist der „Gläubiger“ „kraft des Schuldverhältnisses“ berechtigt „eine Leistung zu fordern“. Hingegen heißt es in Abs. 2, dass das Schuldverhältnis „seinem Inhalt nach“ zur Rücksicht verpflichten „kann“.
Leistungspflichten sind also solche Pflichten, auf die der Gläubiger kraft des Schuldverhältnisses einen klagbaren Anspruch hat. Das Schuldverhältnis ist dazu da, dem Gläubiger die Leistung zu verschaffen.[2]
Diejenigen Pflichten, die das Schuldverhältnis primär begründet und deren Inhalt für seine gesetzliche Typisierung ausschlaggebend ist, nennen wir „Hauptleistungspflichten“.[3] Die anderen Leistungspflichten bestehen von Anfang an oder später mit untergeordneter Bedeutung daneben. Man nennt diese Pflichten „Nebenleistungspflichten“.
Der Kaufvertrag verpflichtet den Käufer zur Zahlung des Kaufpreises und den Verkäufer zur Verschaffung des verkauften Gegenstandes in mangelfreiem Zustand (vgl. §§ 433, 453). Beide Leistungspflichten sind Hauptleistungspflichten, da sie primär mit Abschluss des Kaufvertrages entstehen und den Vertragstypus prägen. Die nach § 433 Abs. 2 vom Käufer auch geschuldete Abnahme der Kaufsache ist hingegen Nebenleistungspflicht, da sie zwar ebenfalls primär entsteht, aber für die Zuordnung zum Vertragstyp „Kauf“ nicht bedeutsam ist.[4]
Weitere Nebenleistungspflichten sind auch die Pflicht des Verkäufers zur Rechnungsstellung über den Kaufpreis[5] oder Erteilung einer Quittung (§ 368).
3
Bei den Leistungspflichten ist in der Regel ein bestimmter Erfolg durch Verhalten geschuldet. Das reine Verhalten ist nur ausnahmsweise Leistungsinhalt. Erfüllung der Leistungspflicht gem. § 362 Abs. 1 kann nur eintreten, wenn der Leistungserfolg herbeigeführt und die Leistung damit bewirkt worden ist.[6]
Der Verkäufer schuldet nicht sein Bemühen um Verschaffung des Eigentums an der Kaufsache, sondern die tatsächlich vollendete Übereignung der Sache im mangelfreien Zustand. Erfüllung tritt erst ein, wenn der Käufer Besitz und mangelfreies Eigentum erhalten hat.
Wer sich zur Unterlassung einer wiederholten Störung (etwa unlauteren Wettbewerbs) verpflichtet hat, schuldet den im Ausbleiben einer weiteren Störung zu sehenden Erfolg.
Der zur Dienstleistung Verpflichtete schuldet zwar kein besonderes Leistungsergebnis, aber immerhin das vereinbarungsgemäße Leistungsverhalten. So kann der Arzt keine Heilung versprechen, sondern immer nur sein fachmännisches Bemühen nach den anerkannten Regeln seines Fachgebietes.[7] Dieses Bemühen ist aber als Erfolg geschuldet. Unternimmt der Dienstverpflichtete gar nichts oder mangelhaft, erfüllt er seine Verpflichtung nicht.
4
Die Begründung der in § 241 Abs. 2 erwähnten Rücksichtspflichten ist hingegen nicht das Ziel des Schuldverhältnisses, sondern eine Begleiterscheinung („Schuldverhältnis kann verpflichten“). Rücksichtspflichten sind außerdem nie erfolgsbezogen, sondern immer verhaltensorientiert. Geschuldet ist also niemals ein bestimmter Erfolg, sondern immer nur ein bestimmtes Verhalten.[8]
A bestellt bei Gastwirt B einen „Cevapcici“-Grillteller. Beim Verzehr bricht ihm ein Zahn ab. Unter dem Aspekt einer Rücksichtspflichtverletzung im Rahmen des Bewirtungsvertrages genügt der Abbruch des Zahnes als solcher nicht, um eine Rücksichtspflichtverletzung zu begründen.[9] Nach der Verhaltenspflicht i.S.d. § 241 Abs. 2 ist eben kein bestimmter Erfolg – hier etwa Unversehrtheit von Gesundheit und Körper des Gastes – geschuldet. Eine solche umfassende Rücksichtspflicht gibt es nicht.[10] Vielmehr kommt es darauf an, ob der Gastwirt sich anders hätte verhalten müssen, weil sich in dem Fleisch ein harter Fremdkörper befand, den er hätte erkennen können. Das muss A darlegen und beweisen, weil die Beweislastumkehr des § 280 Abs. 1 S. 2 sich nur auf das Vertretenmüssen bezieht.
Ob eine Leistungs- oder Rücksichtspflicht vorliegt, ist im Zweifel durch Auslegung zu entscheiden. Maßgeblich ist, ob eine Partei von der anderen Partei nach dem Inhalt des Schuldverhältnisses von vornherein ein konkretes Verhalten erzwingen kann oder ob es grundsätzlich ins Belieben der anderen Partei gestellt ist, wie sie sich bei der Durchführung des Schuldverhältnisses verhält. Im letzteren Fall sind dann nur die sich aus der Verletzung ergebenden Sekundäransprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche einklagbar.
Als Leitlinie können Sie sich an Folgendem orientieren: Immer dann, wenn eine Pflichtverletzung keine Auswirkung auf die Rechtzeitigkeit und Mängelfreiheit der geschuldeten Hauptleistung hat, ist von einer Rücksichtspflicht auszugehen.[11]
V räumt in seinem Ladenlokal eine auf dem Gang liegende Verpackung nicht weg. Deshalb kommt seine Kundin K zu Fall und verletzt sich. Auf die Qualität seiner Ware und die Erfüllung des Kaufvertrages hat dieser Vorfall keinen Einfluss. Im Übrigen: Wie V seinen Schutz- bzw. Verkehrssicherungspflichten nachkommt, ist seinem Ermessen überlassen. Auf das Wegräumen der Verpackung hat K keinen klagbaren Anspruch. V hätte ebenso den Gang sperren können, wenn ihm das Aufheben der Verpackung zu lästig gewesen wäre.
5
Im vorvertraglichen Schuldverhältnis gem. § 311 Abs. 2, 3 stellen sich keine Abgrenzungsschwierigkeiten, da hier noch keine Leistungspflichten, sondern lediglich Rücksichtspflichten geschuldet sind (vgl. § 311 Abs. 2).
Anmerkungen
Paragraphen ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB.
Looschelders Schuldrecht-AT 1 Rn. 11.
Palandt-Grüneberg § 241 Rn. 5.
Eine andere Frage ist, ob die Abnahme im Gegenseitigkeitsverhältnis i.S.d. §§ 320 f. steht, vgl. Palandt-Weidenkaff § 433 Rn. 43, 44.
Palandt-Weidenkaff § 433 Rn. 32.
Siehe im Skript „Schuldrecht AT I“ Rn. 150 ff.
Siehe im Skript „Schuldrecht BT III“ Rn. 3.
Lorenz NJW 2007, 1, 2 unter Ziff. II 1.
So die einprägsame Empfehlung von Madaus JURA 2004, 289 ff. unter Ziff. III 3 und IV (sehr lesenswert! – mit krit. Würdigung aller „auf dem Markt gehandelten“ sonstigen Ansätze).
1. Teil Einführung › B. Arten der Pflichtverletzung
B.Arten der Pflichtverletzung
6
[Bild vergrößern]
Der Begriff der „Pflichtverletzung“ wird in § 280 Abs. 1 genannt und löst im Rahmen eines Schuldverhältnisses nach dieser Vorschrift eine Schadensersatzhaftung aus, es sei denn, dass der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Nach dem zuvor Gesagten kommen dabei einerseits Verletzungen der Leistungspflichten und andererseits Verletzungen der Rücksichtspflichten in Betracht.
1. Teil Einführung › B. Arten der Pflichtverletzung › I. Verletzung von Leistungspflichten
I.Verletzung von Leistungspflichten
7
Im Hinblick auf die Verletzung von Leistungspflichten hat sich eine objektive und erfolgsbezogene Betrachtung durchgesetzt. Das bedeutet, dass unter einer Leistungspflichtverletzung jedes objektive Abweichen der realen Lage vom ursprünglich festgelegten Pflichtenprogramm eines Schuldverhältnisses zu verstehen ist. Das Pflichten- oder „Sollprogramm“ ergibt sich beim vertraglichen Schuldverhältnis aus den Vereinbarungen, dispositiven Normen und ggfs. erläuternder oder ergänzender Vertragsauslegung, sowie aus § 242. Beim gesetzlichen Schuldverhältnis folgt das Pflichtenprogramm aus den jeweiligen Tatbeständen.[1] „Objektiv“ und „erfolgsbezogen“ ist diese Betrachtung deshalb, weil es auf Hindernisse in der Sphäre des Schuldners und Fragen des Verschuldens in diesem Zusammenhang nicht ankommt. Auch wenn der Begriff der Pflichtverletzung sprachlich eine gedankliche Nähe zu schuldhaftem Verhalten herstellt, ist dies damit nicht gemeint. Das „Wieso“ und „Warum“ einer Pflichtverletzung ist für die Frage einer Pflichtverletzung ohne jede Bedeutung, sondern eine Frage des Vertretenmüssens.[2]
K erwirbt vom Händler V ein Fernsehgerät. Das Gerät funktioniert nicht. Ohne V zunächst aufzufordern, die Reparatur durchzuführen, lässt K das Gerät vom Nachbarn N, einem Fernsehtechniker, reparieren, der K dafür 50 € in Rechnung stellt. K möchte von V das Geld erstattet haben.
Hier könnte dem K ein Ersatzanspruch aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283, 437 Nr. 3 (bitte lesen) zustehen. V war dem K nach §§ 437 Nr. 1, 439 zur Reparatur verpflichtet. Dadurch, dass das Gerät auf Verlangen des K bereits von N repariert wurde, ist dem V die Erfüllung seiner Pflicht unmöglich geworden, so dass er nach § 275 Abs. 1 von seiner Leistungspflicht befreit wurde.[3] Die Unmöglichkeit wurde zwar nicht von V verursacht, sondern durch K selbst; dennoch liegt nach der objektiven Betrachtungsweise eine „Pflichtverletzung“ des V vor. Der Grund für die bei V eingetretene Unmöglichkeit ist für die Frage der Pflichtverletzung unerheblich. Allerdings scheitert der Anspruch des K auf Schadensersatz daran, dass V die Unmöglichkeit nicht i.S.v. § 276 zu vertreten hat.
Die Frage des Vertretenmüssens stellt sich also bei der Prüfung des Tatbestandsmerkmals „Pflichtverletzung“ nicht. Das Vertretenmüssen ist allerdings bei verschiedenen Anspruchsgrundlagen, insbesondere beim Schadensersatzanspruch aus § 280, als weitere Tatbestandsvoraussetzung zu prüfen (§ 280 Abs. 1 S. 2).
8
Bei der näheren Bestimmung der einzelnen Pflichtverletzungskategorien helfen uns die Vorschriften über Leistungsstörungen. Sie können daher zur näheren Konkretisierung der verschiedenen Pflichtverletzungsarten herangezogen werden.[4]
1.Leistungsverzögerung
9
Eine erste Kategorie der Leistungspflichtverletzung können wir § 281 Abs. 1 S. 1 Var. 1 entnehmen. Dort beschreibt das Gesetz die Situation, dass der Schuldner „die fällige Leistung nicht erbringt“. Eine entsprechende Formulierung findet sich in § 323 Abs. 1. § 280 Abs. 2 und gibt dieser Pflichtverletzungskategorie einen besonderen Namen: „Verzögerung“ der (fälligen) Leistung. Das Auseinanderfallen des realen Leistungsstandes vom Sollprogramm liegt hier auf der Hand: Der Schuldner leistet nicht, obwohl er leisten muss.
[Bild vergrößern]
2.Schlechtleistung
10
In § 281 Abs. 1 S. 1 Var. 2 beschreibt das Gesetz die Situation, dass der Schuldner die fällige Leistung „nicht wie geschuldet“ erbringt. Eine ähnliche Formulierung findet sich in § 323 Abs. 1, wo es heißt, dass der Schuldner die fällige Leistung „nicht vertragsgemäß“ erbringt.
[Bild vergrößern]
Die Tatsache, dass § 323 von einer „nicht vertragsgemäßen“ statt „nicht wie geschuldet erbrachten“ Leistung spricht, erklärt sich daraus, dass die §§ 280 ff. grundsätzlich auf jedes Schuldverhältnis anzuwenden sind, § 323 aber nur auf gegenseitige Verträge Anwendung findet (vgl. die Titelüberschrift vor § 320). Dies soll im Tatbestand zum Ausdruck kommen, weshalb der Gesetzgeber eine entsprechend abweichende Formulierung gewählt hat. Die „nicht vertragsgemäß“ erbrachte Leistung ist also eine „nicht wie geschuldet“ erbrachte Leistung.
3.Nichtleistung wegen Leistungsbefreiung nach § 275
11
Aus § 275 Abs. 4 folgt zwingend, dass die Nichtleistung wegen Ausschlusses der Leistungspflicht nach § 275 Abs. 1 bis 3 eine Pflichtverletzung darstellt. Denn § 275 Abs. 4 verweist wegen der Rechtsfolgen auf die Vorschriften der §§ 280 ff. Dann muss also die Leistungsbefreiung ihrerseits eine Pflichtverletzung i.S.d. § 280 darstellen.[5]
Es kommt Ihnen möglicherweise eigenartig vor, dass der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht und dass das Gesetz die damit logischerweise verbundene Nichtleistung trotzdem als Pflichtverletzung ansieht. Wie kann man eine Pflicht verletzen, die es wegen des Ausschlusses nach § 275 Abs. 1–3 nicht mehr gibt? Jedoch ist diese Merkwürdigkeit die klare Rechtsfolge des § 275 Abs. 4. Bei näherem Hinsehen löst sich die vermeintliche Ungereimtheit auch auf: Das Ergebnis entspricht dem objektiven und erfolgsbezogenen Begriff der Pflichtverletzung. Denn im Falle der Leistungsbefreiung nach § 275 entspricht der reale Leistungsstand nicht mehr dem ursprünglichen Sollprogramm.
V verkauft dem K einen gebrauchten, von K ausgesuchten Pkw. Vor Übergabe wird der Pkw zerstört. Da V von Anfang lediglich den von K ausgesuchten Pkw zu übereignen und zu übergeben hatte, ist mit der Zerstörung des Pkw diese Leistung gem. § 275 Abs. 1 unmöglich geworden. V ist daher nicht mehr zur Leistung verpflichtet. Die bei Vertragsschluss zunächst vereinbarte Leistungspflicht des V gem. § 433 Abs. 1 besteht nun real wegen § 275 Abs. 1 nicht mehr. Vertragliches Sollprogramm und realer Leistungsstand fallen daher auseinander. Deshalb ist es gerechtfertigt, bei der Leistungsbefreiung von einer Pflichtverletzung zu sprechen.
[Bild vergrößern]
12
Im Ergebnis kennen wir damit drei verschiedene Leistungspflichtverletzungen, nämlich die nicht rechtzeitige Leistung („Leistungsverzögerung“), die nicht wie geschuldet erbrachte Leistung („Schlechtleistung“) und die Nichtleistung wegen Leistungsbefreiung nach § 275.[6]
1. Teil Einführung › B. Arten der Pflichtverletzung › II. Verletzung von Rücksichtspflichten
II.Verletzung von Rücksichtspflichten
13
Auch die Verletzung einer Rücksichtspflicht nach § 241 Abs. 2 stellt eine Pflichtverletzung i.S.d. § 280 dar. Dies folgt zwingend aus den §§ 282, 324, die für diesen Fall ergänzende Voraussetzungen für die Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung bzw. die Ausübung eines Rücktritts vom gegenseitigen Vertrag vorsehen. Da bei den Rücksichtspflichten nur ein Verhalten und kein darüber hinausgehender Erfolg geschuldet ist, liegt eine Pflichtverletzung dann vor, wenn der Schuldner sich nicht in der den Umständen nach erforderlichen Art und Weise verhalten hat.[7]
Maler M hat sich verpflichtet, die Wohnung des A zu streichen. Da er es nicht lassen kann, raucht er bei der Arbeit eine Zigarette nach der anderen. Durch herabfallende Asche wird der Teppichboden des A beschädigt, da M keinen Aschenbecher benutzt (= Rücksichtspflichtverletzung).
Wäre der Anstrich objektiv mangelhaft, läge insoweit eine Leistungspflichtverletzung in Form der Schlechtleistung vor, ohne dass es auf den Grund ankäme. Die Ursache ist dann eine Frage des Vertretenmüssens.
[Bild vergrößern]
[Bild vergrößern]
Anmerkungen
Palandt-Grüneberg § 280 Rn. 12; Lorenz „Schuldrechtsreform 2002: Problemschwerpunkte drei Jahre danach“; NJW 2005, 1889, 1890 unter Ziffer IV 1 (sehr lesenswert!).
Looschelders Schuldrecht AT § 24 Rn. 484; Lorenz NJW 2005, 1889, 1890 unter Ziff. IV 1.
Man spricht in diesem Fall von „Unmöglichkeit durch Zweckerreichung“, Looschelders Schuldrecht-AT § 23 Rn. 458.
Looschelders Schuldrecht AT § 24 Rn. 485.
Lorenz NJW 2005, 1889, 1890 unter Ziff. IV 1.
Lorenz NJW 2005, 1889, 1890 unter Ziff. IV 1.
Lorenz NJW 2007, 1 unter Ziff. II 1 und ders. in NJW 2005, 1889, 1890 unter Ziff. IV 1 (beide Aufsätze sehr lesenswert!).
1. Teil Einführung › C. Aufgaben der Regelungen über Leistungsstörungen
C.Aufgaben der Regelungen über Leistungsstörungen
14
In allen Fällen der Pflichtverletzung muss das Gesetz entscheiden, wie es die verschiedenen Interessen der betroffenen Personen ausgleicht.
Durch die Pflichtverletzung können dem Gläubiger Schäden entstanden oder Aufwendungen sinnlos geworden sein.
15
Es muss also geklärt werden, unter welchen Voraussetzungen der Gläubiger Schadensersatz und Ersatz für vergebliche Aufwendungen verlangen kann.
16
Bei gegenseitigen Verträgen stellt sich die zusätzliche Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der Gläubiger verpflichtet ist, die seinerseits geschuldete Gegenleistung zu erbringen. Wenn die Leistung des Schuldners nicht ordnungsgemäß erbracht wurde, hat der Gläubiger regelmäßig ein Interesse, seine Gegenleistung zurückzuhalten. Hat er bereits vorgeleistet, möchte er möglicherweise seine Gegenleistung wieder zurückbekommen.
Weiter kann es sein, dass der Gläubiger beim gegenseitigen Vertrag gar kein Interesse mehr hat, es weiter mit seinem Vertragspartner „zu tun zu haben“. Es muss daher auch geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen der Gläubiger sich vom Vertrag wieder lösen kann, um das Geschäft mit einem anderen Vertragspartner durchzuführen.
17
Wir werden diese Fragen nun der Reihe nach anhand der verschiedenen Pflichtverletzungen durchgehen. Wir beginnen mit der Leistungsverzögerung und besprechen anschließend die Besonderheiten bei der Nichtleistung wegen Leistungsbefreiung nach § 275. Den Abschluss bildet die Rücksichtspflichtverletzung nach § 241 Abs. 2 im Schuldverhältnis sowie in der besonderen Situation des vorvertraglichen Schuldverhältnisses.
Die Schlechtleistung ist hingegen kein gesonderter Gegenstand dieses Skripts. Sie soll im Zusammenhang mit dem Gewährleistungssystem der besonderen Schuldverhältnisse erörtert werden. Die Struktur und Probleme der Schlechtleistungsregeln des Allgemeinen Schuldrechts erschließt sich allerdings bereits durch die Beschäftigung mit den anderen Pflichtverletzungen, insbesondere den Verzögerungstatbeständen. Darauf können wir dann im Besonderen Schuldrecht aufbauen.
18
Wie wir gesehen haben, müssen wir streng zwischen dem Tatbestand der Pflichtverletzung und der Frage des Vertretenmüssens unterscheiden. Da das Vertretenmüssen als Tatbestandsmerkmal bei sämtlichen Schadensersatzansprüchen der §§ 280 ff. zu berücksichtigen ist, sollen die Grundzüge des Vertretenmüssens vorweg, sozusagen „vor die Klammer gezogen“ erörtert werden. Wir können uns dann bei den einzelnen Tatbeständen diesbezüglich kürzer fassen und ergänzend auf diesen Abschnitt verweisen.
2. TeilVertretenmüssen
A.Unterscheidung zwischen Vertretenmüssen und Verschulden
B.Vertretenmüssen ohne Verschulden
C.Vertretenmüssen wegen Verschuldens des Schuldners
D.Vertretenmüssen wegen Verschuldens Dritter (§ 278)
E.Erleichterungen im Haftungsmaßstab
19
I.Vertretenmüssen ohne Verschuldenserfordernis, weil:
1.Gesetzliche Anordnung, insbesondere § 287 S. 2
2.Pflichtverletzung wegen Geldmangels
3.Vertragliche Vereinbarung
Vereinbarung durch AGBRn. 30 f.
4.Verletzung einer übernommenen Garantie
Abgrenzung zur reinen BeschaffenheitsvereinbarungRn. 33 f.
5.Verwirklichung eines übernommenen Beschaffungsrisikos
Reichweite der übernommenen RisikenRn. 35 f.
II.Vertretenmüssen wegen Verschuldens des Schuldners/seiner Repräsentanten i.S.d. § 31
1.Vorsatz
2.Fahrlässigkeit
RechtsirrtumRn. 43
Korrekturen bei bestimmten PersonengruppenRn. 44 f.
3.Verschuldensfähigkeit
III.Vertretenmüssen wegen Verschuldens Dritter nach § 278
1.Bestehendes Schuldverhältnis
2.Verschulden des Dritten
Bestimmung des VerschuldensmaßstabesRn. 52 ff.
3.Verschulden bei Tätigkeit als Erfüllungsgehilfe
Reichweite der SchuldnerpflichtenRn. 59 ff.
Handeln bei Gelegenheit der ErfüllungRn. 62 ff.
4.Verschulden bei Tätigkeit als gesetzlicher Vertreter
IV.Haftungsbeschränkungen
1.Gesetzliche Haftungsbeschränkungen
2.Vertragliche Haftungsbeschränkungen
Haftungsbeschränkung durch AGBRn. 79
Rechtsfolgen bei unzulässiger VereinbarungRn. 80 ff.
2. Teil Vertretenmüssen › A. Unterscheidung zwischen Vertretenmüssen und Verschulden
A.Unterscheidung zwischen Vertretenmüssen und Verschulden
20
[Bild vergrößern]
21
Wenn der Schuldner eine Pflichtverletzung zu verantworten hat, spricht das Gesetz vom „Vertretenmüssen“ (vgl. §§ 276 Abs. 1, 280 Abs. 1 S. 2).
Was der Schuldner zu verantworten bzw. zu vertreten hat, bestimmen allgemein die §§ 276–278. Diese Vorschriften sind als Hilfsnormen[1] immer dann heranzuziehen, wenn das Gesetz in verschiedenen Tatbeständen vom Vertretenmüssen des Schuldners spricht.
§§ 275 Abs. 2 S. 2, 280 Abs. 1 S. 2, 286 Abs. 4, 536a Abs. 1 Var. 2, 538
22
„Vertretenmüssen“ und „Verschulden“ sind inhaltlich voneinander zu unterscheiden.
Das Verschulden ist nach § 276 Abs. 1 der Oberbegriff für die Schuldformen „Vorsatz“ und „Fahrlässigkeit“, die ihrerseits Verschuldensfähigkeit voraussetzen, wie sich aus § 276 Abs. 1 S. 2 i.V.m. §§ 827, 828 ergibt.[2]
23
Aus § 276 Abs. 1 folgt, dass der Schuldner grundsätzlich nur (sein eigenes) Verschulden zu vertreten hat. Er ist grundsätzlich also nur für die Folgen eines schuldhaften Verhaltens verantwortlich und nur dann verpflichtet, für die Folgen in besonderer Weise einzustehen (sog. „Verschuldensprinzip“). Die besondere Einstandspflicht kann entweder darin bestehen, dass der Schuldner auch unter erschwerten Bedingungen leisten muss (vgl. § 275 Abs. 2 S. 2), zum Ersatz allen sich aus seinem Verhalten ergebenden Schadens verpflichtet ist (etwa aus § 280 Abs. 1 S. 2) oder sonstige Ersatzleistungen zu erbringen hat, z.B. Zinsen nach §§ 288, 286 (§ 286 Abs. 4!).
24
Wie sich aus § 276 Abs. 1 S. 1 ergibt, kann aber auch eine „strengere“ oder „mildere“ Haftung bestimmt sein. Es gibt also einerseits Fälle, in denen der Schuldner etwas „zu vertreten hat“, obwohl ihn kein eigenes Verschulden trifft. Andererseits kann es vorkommen, dass ein Vertretenmüssen trotz Verschuldens ausgeschlossen ist. Die Begriffe „Vertretenmüssen“ und „Verschulden“ decken sich inhaltlich also nicht vollständig, sondern bilden (lediglich) eine Schnittmenge (siehe im Schaubild oben).
25
Das „Vertretenmüssen“ bezieht sich stets auf die objektive Pflichtwidrigkeit, die nach einer bestimmten Norm eine besondere Einstandspflicht auslöst.[3]Auf den Schaden muss sich das Vertretenmüssen hingegen nicht beziehen.[4]
Das Vertretenmüssen bezieht sich
–
bei § 280 Abs. 1 auf die Pflichtverletzung im Rahmen eines bestehenden Schuldverhältnisses;
–
bei § 286 Abs. 4 auf den eingetretenen Verzug mit der Erfüllung einer Leistungspflicht (bedeutsam für eine Haftung z.B. nach §§ 280 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2, 288 Abs. 1, 536a Abs. 1 Var. 3, 536a Abs. 2 Nr. 1);
–
bei § 536a Abs. 1 Var. 2 auf einen nachträglich entstandenen Mangel des Mietobjekts.
Betrachten wir nun die verschiedenen Formen des Vertretenmüssens.
Anmerkungen
Zur Funktion der „Hilfsnormen“ vgl. Skript „BGB AT I“ unter Rn. 35.
Palandt-Grüneberg § 276 Rn. 5 f.
Palandt-Grüneberg § 276 Rn. 8.
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden
B.Vertretenmüssen ohne Verschulden
26
In bestimmten Fällen hat der Schuldner eine Pflichtwidrigkeit auch dann zu vertreten, wenn kein Verschulden vorliegt. Dies folgt bereits aus § 276 Abs. 1 S. 1, wonach eine „strengere“ (= verschuldensunabhängige) Haftung „bestimmt“ ist oder sich aus dem „sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses“ ergeben kann. Die „Bestimmung“ einer strengeren Haftung kann sich entweder aus dem Gesetz oder aus einer vertraglichen Vereinbarung ergeben. Es kommen folglich drei Gründe für eine verschuldensunabhängige Einstandspflicht des Schuldners in Betracht: eine gesetzliche Bestimmung, eine vertragliche Bestimmung oder der sonstige Inhalt des Schuldverhältnisses. Wir gehen die einzelnen Gründe in dieser Reihenfolge durch.
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › I. Gesetzliche Bestimmung
I.Gesetzliche Bestimmung
1.Gesetzliche Ersatzpflichten ohne Vertretenmüssen im Tatbestand
27
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Tatbestände parallel im Gesetz mit.
Verschiedene Tatbestände begründen eine Ersatzpflicht, ohne dass es tatbestandlich auf ein „Vertretenmüssen“ der zum Ersatz verpflichteten Person ankommt. In diesen Fällen spielt die Frage des Verschuldens keine Rolle.
Schadensersatzhaftung wegen Nichtigkeit einer Willenserklärung nach § 122;
Schadensersatzhaftung des Vertreters ohne Vertretungsmacht nach § 179;
Schadensersatzhaftung des Vermieters wegen anfänglicher Mängel des Mietobjekts aus § 536a Abs. 1 Var. 1;
Deliktische Gefährdungshaftung wegen Gefährlichkeit eines Gegenstandes aus § 833 S. 1 BGB, § 7 Abs. 1 StVG, §§ 1, 2 HaftpflG sowie aus § 1 ProdHaftG;
Entschädigungspflichten aus §§ 904 S. 2, 906 Abs. 2 S. 2.
2.Zufallshaftung nach § 287 S. 2
28
Für das Thema dieses Skripts, nämlich die Pflichtverletzung im Rahmen von Schuldverhältnissen, spielt ein anderer Tatbestand eine ganz wichtige Rolle: § 287.
Gem. § 287 S. 2 hat der Schuldner während des Verzuges „wegen der Leistung“ auch „Zufall“ zu vertreten, sofern der Verzug für den Schadenseintritt kausal gewesen ist. Unter dem Begriff „Zufall“ ist ein ohne Verschulden des Schuldners eingetretenes Leistungshindernis i.S.d. § 275 zu verstehen, insbesondere Unmöglichkeit durch höhere Gewalt.[1]
Für die Schadensersatzhaftung wegen Verletzung einer Rücksichtspflicht i.S.v. § 241 Abs. 2 gilt die Haftungsverschärfung des § 287 S. 2 nicht!
Antiquitätenhändler V verkauft dem K eine antike Standuhr, die V dem K am nächsten Tag liefern soll. V organisiert den Transport aber nicht rechtzeitig, so dass die Lieferung am nächsten Tag ausbleibt. In der darauffolgenden Nacht brechen Diebe in die – ordnungsgemäß gesicherten – Geschäftsräume des V ein und nehmen unter anderem die Uhr mit. Die Diebe verschwinden spurlos. Schadensersatzansprüche statt der Leistung aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 scheitern hier an der fehlenden Fristsetzung. Sie ergeben sich jedoch aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283, da der V sein mit dem Diebstahl verbundenes Unvermögen i.S.d. § 275 Abs. 1 zur Leistung nach § 287 S. 2 auch ohne Verschulden zu vertreten hat. Er befand sich nach §§ 286 Abs. 2 Nr. 1, 286 Abs. 4 mit seiner Leistung in Schuldnerverzug und kann sich auch nicht auf die Ausnahme des 287 S. 2 Hs. 2 berufen. Hätte er zum vereinbarten Fälligkeitstermin geliefert, hätte die Uhr nicht mehr Teil der Diebesbeute sein können.
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › II. Geldmangel
II.Geldmangel
29
Auch ohne ausdrückliche Regelung ist allgemein anerkannt, dass für die Erfüllung von Geldsummenschulden stets verschuldensunabhängig gehaftet wird und auch bei sonstigen Schulden der Einwand fehlender Finanzkraft unbeachtlich ist.[2]
M schuldet seinem Vermieter V die monatlich im Voraus zu zahlende Miete für drei Monate. Hier tritt Verzug nach § 286 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 4 auch dann ein, wenn M aufgrund Insolvenz seines Arbeitgebers unverschuldet arbeitslos geworden ist und deshalb über keine ausreichenden Finanzmittel mehr verfügt.
A verpflichtet sich gegenüber dem B, auf dessen Grundstück ein Haus zu errichten. A gehen jedoch die finanziellen Mittel aus, so dass er nicht in der Lage ist, sich die nötigen Baustoffe zu beschaffen. Hier tritt Verzug mit der Werkherstellung auch dann ein, wenn A seine Liquiditätsprobleme nicht verschuldet hat (etwa weil seine sonstigen Kunden ihre fälligen Rechnungen alle nicht bezahlen).
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › III. Vertragliche Übernahme
III.Vertragliche Übernahme
30
Aus dem Prinzip der Privatautonomie folgt, dass jeder Schuldner sich vertraglich zur Übernahme einer verschuldensunabhängigen Haftung verpflichten kann, so dass dann aufgrund der vertraglichen Regelung eine „strengere“ Haftung bestimmt ist. Dazu wird sich ein Schuldner allerdings selten freiwillig hinreißen lassen.
31
Viel häufiger kommt es vor, dass eine solche Haftungsverschärfung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Vertragspartners enthalten ist.
Die Klausel „Der Mieter haftet für alle Schäden am Mietobjekt, die durch ihn verursacht wurden.“ stellt allein auf die Verursachung im Sinne einer Kausalität ab – zumindest ist ein solches Verständnis nach § 305c Abs. 2 zugrunde zu legen. Der Mieter eines Pkw würde nach dieser Klausel auch dann auf Schadensersatz haften, wenn er beim Fahren des Pkw schuldlos in einen Auffahrunfall verwickelt wird.
Da eine solche Bestimmung vom wesentlichen Grundgedanken des § 276 Abs. 1 abweicht, nach dem der Schuldner grundsätzlich nur Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat, stellt eine solche Klausel regelmäßig eine unangemessene Benachteiligung gem. § 307 Abs. 2 Nr. 1 dar.[3] Für die Verwendung der Klausel gegenüber einem Verbraucher gilt dies ausnahmslos. Bei Verwendung gegenüber einem Unternehmer gilt dies im Prinzip ebenfalls, wobei hier Ausnahmen aufgrund besonders günstiger, die strenge Haftung ausgleichender Gesamtkonditionen in Betracht kommen.[4]
2. Teil Vertretenmüssen › B. Vertretenmüssen ohne Verschulden › IV. „Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
IV.„Sonstiger Inhalt des Schuldverhältnisses“
32
Schließlich kann sich nach § 276 Abs. 1 S. 1 eine verschuldensunabhängige Haftung auch aus dem „sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses“ ergeben. Beispielhaft nennt die Vorschrift die Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.
1.Garantieübernahme
33
Bei der Garantie macht der Schuldner deutlich, in besonderer Weise für einen bestimmten Erfolg „mit seinem Namen“ einstehen zu wollen. In diesem Zusammenhang kommen insbesondere Eigenschaftszusicherungen in Betracht, bei denen ein Vertragspartner, z.B. der Verkäufer, für bestimmte Vorzüge des Leistungsgegenstandes wirbt.[5]
Eine Zusicherung im Sinn einer Garantie liegt vor, wenn der Verkäufer vertraglich die Gewähr für das Vorhandensein einer Beschaffenheit übernimmt und dabei seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen des Fehlens dieser Beschaffenheit uneingeschränkt einstehen zu wollen.[6]
34
Eine besondere Form sieht das Gesetz für die Garantieübernahme als solche nicht vor.
V verkauft dem K einen gebrauchten Pkw und teilt dem K mit, der Wagen habe „keine Unfallschäden“.
Die Frage, ob die Angabe „keine Unfallschäden“ lediglich als Beschaffenheitsangabe (§ 434 Abs. 1 S. 1) oder aber als Beschaffenheitsgarantie i.S.d. § 443 Abs. 1 zu werten ist, ist durch Auslegung nach §§ 133, 157 zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass an eine Garantie einschneidende Rechtsfolgen geknüpft sind, wie sich aus der Haftungsverschärfung nach den Regeln der §§ 276 Abs. 1, 442 Abs. 1 S. 2 Var. 2, 444 Hs. 2 Var. 2 ergibt.
Handelt es sich bei dem Verkäufer um einen Gebrauchtwagenhändler, so ist die Interessenlage typischerweise dadurch gekennzeichnet, dass der Käufer sich auf die besondere, ihm in aller Regel fehlende, Erfahrung und Sachkunde des Händlers verlässt. Er wird daher zumindest bei Angaben auf seine ausdrückliche Nachfrage erkennbar darauf vertrauen, dass der Händler sich für seine Angaben zur Beschaffenheit des Fahrzeuges „stark macht", diese mithin „garantiert“.[7] Anders liegt es dann, wenn der Händler für die von ihm angegebenen Beschaffenheiten eine hinreichend deutliche Einschränkung zum Ausdruck bringt, indem er etwa darauf hinweist, dass er die Angaben nicht überprüft hat[8] (z.B. „laut Vorbesitzer keine Unfällschäden“[9]).
Auf den Kauf direkt vom Privatmann trifft die für den gewerblichen Verkauf maßgebliche Erwägung, dass der Käufer sich in der Regel auf die besondere Erfahrung und Sachkunde des Händlers verlässt und in dessen Erklärungen daher die konkludente Übernahme einer Garantie sieht, nicht zu.[10] Insbesondere bei Angaben über technische Beschaffenheiten kann der Käufer beim Privatverkauf eines Gebrauchtfahrzeugs nicht davon ausgehen, der Verkäufer wolle für die Richtigkeit dieser Angabe unter allen Umständen einstehen und gegebenenfalls auch ohne Verschulden auf Schadensersatz haften. Will der Käufer beim Gebrauchtwagenkauf unter Privatpersonen eine Garantie für Beschaffenheiten (z.B. Laufleistung, Unfallfreiheit) des Fahrzeugs haben, muss er sich diese regelmäßig ausdrücklich von dem Verkäufer geben lassen.[11] Von einer stillschweigenden Garantieübernahme kann beim Privatverkauf eines Gebrauchtfahrzeugs daher nur ausnahmsweise bei besonderen Umständen ausgegangen werden.
2.Übernahme eines Beschaffungsrisikos
35
Ferner kann es sein, dass ein Vertragspartner im Vertrag ein besonderes Beschaffungsrisiko übernommen hat.
36
Regelmäßig ist mit der Vereinbarung einer Gattungsschuld, die nicht auf einen bestimmten Vorrat beschränkt wird, aus Sicht des Käufers zugleich die Übernahme des Risikos für die typischen Beschaffungshindernisse verbunden.[12] Schließlich erklärt der Lieferant mit dem Versprechen einer solchen Leistung konkludent, er könne die Ware beschaffen. Dies gilt umso mehr, wenn der Lieferant zugleich Hersteller der Ware ist. Wenn der Verkäufer das Beschaffungsrisiko nicht übernehmen will, muss er dies zum Ausdruck bringen. Dem dient die häufig verwendete Klausel „Selbstbelieferung vorbehalten“.