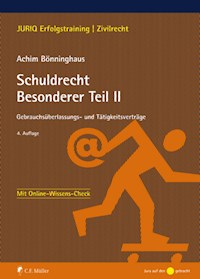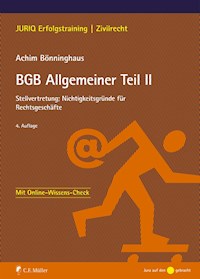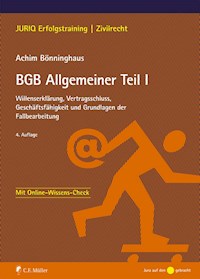19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: JURIQ Erfolgstraining
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Inhalt: Das Skript stellt den Erwerb von Besitz und Eigentum dar. An die Darstellung des Besitzerwerbs schließt sich ein ausführlicher Teil zum Eigentumserwerb an beweglichen Sachen (insbes. Übergabe, Einigung, gutgläubiger Erwerb, Besitzkonstitut, Abtretung des Herausgabeanspruchs etc.) an. Weitere Teile widmen sich dem Eigentumserwerb an Grundstücken und der Vormerkung sowiie dem gesetzlichen Eigentumserwerb. Die Konzeption: Die Skripten "JURIQ-Erfolgstraining" sind speziell auf die Bedürfnisse der Studierenden zugeschnitten und bieten ein umfassendes "Trainingspaket" zur Prüfungsvorbereitung: Die Lerninhalte sind absolut klausurorientiert aufbereitet; begleitende Hinweise von erfahrenen Repetitoren erleichtern das Verständnis und bieten wertvolle Klausurtipps; im Text integrierte Wiederholungs- und Übungselemente (Online-Wissens-Check und Übungsfälle mit Lösung im Gutachtenstil) gewährleisten den Lernerfolg; Illustrationen schwieriger Sachverhalte dienen als "Lernanker" und erleichtern den Lernprozess; Tipps vom Lerncoach helfen beim Optimieren des eigenen Lernstils; ein modernes Farb-Layout schafft eine positive Lernatmosphäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Sachenrecht II
Erwerb von Besitz und Eigentum
von
Achim Bönninghaus
3., neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-9275-2
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Liebe Leserinnen und Leser,
die Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ zur Klausur- und Prüfungsvorbereitung verbindet sowohl für Studienanfänger als auch für höhere Semester die Vorzüge des klassischen Lehrbuchs mit meiner Unterrichtserfahrung zu einem umfassenden Lernkonzept aus Skript und Online-Training.
In einem ersten Schritt geht es um das Erlernen der nach Prüfungsrelevanz ausgewählten und gewichteten Inhalte und Themenstellungen. Einleitende Prüfungsschemata sorgen für eine klare Struktur und weisen auf die typischen Problemkreise hin, die Sie in einer Klausur kennen und beherrschen müssen. Neu ist die visuelle Lernunterstützung durch
Illustrationen als „Lernanker“ für schwierige Beispiele und Fallkonstellationen steigern die Merk- und Erinnerungsleistung Ihres Langzeitgedächtnisses.
Auf die Phase des Lernens folgt das Wiederholen und Überprüfen des Erlernten im Online-Wissens-Check: Wenn Sie im Internet unter www.juracademy.de/skripte/login das speziell auf das Skript abgestimmte Wissens-, Definitions- und Aufbautraining absolvieren, erhalten Sie ein direktes Feedback zum eigenen Wissensstand und kontrollieren Ihren individuellen Lernfortschritt. Durch dieses aktive Lernen vertiefen Sie zudem nachhaltig und damit erfolgreich Ihre sachenrechtlichen Kenntnisse!
[Bild vergrößern]
Schließlich geht es um das Anwenden und Einüben des Lernstoffes anhand von Übungsfällen verschiedener Schwierigkeitsstufen, die im Gutachtenstil gelöst werden. Die JURIQ Klausurtipps zu gängigen Fallkonstellationen und häufigen Fehlerquellen weisen Ihnen dabei den Weg durch den Problemdschungel in der Prüfungssituation.
Das Lerncoaching jenseits der rein juristischen Inhalte ist als zusätzlicher Service zum Informieren und Sammeln gedacht: Ein erfahrener Psychologe stellt u.a. Themen wie Motivation, Leistungsfähigkeit und Zeitmanagement anschaulich dar, zeigt Wege zur Analyse und Verbesserung des eigenen Lernstils auf und gibt Tipps für eine optimale Nutzung der Lernzeit und zur Überwindung evtl. Lernblockaden.
Das vorliegende Skript trägt den Untertitel „Erwerb von Besitz und Eigentum“ und stellt die notwendige Ergänzung des ersten Bandes zum Sachenrecht dar. Während es dort zunächst einmal darum ging, Ihnen die die Systematik der Anspruchsgrundlagen zum Schutz von Besitz und Eigentum zu erläutern, geht es nun um die einzelnen Erwerbstatbestände, die im Rahmen der Ansprüche zu prüfen sind. So taucht z.B. in Klausuren bei der Prüfung des Eigentumsherausgabeanspruchs aus § 985 regelmäßig die Frage auf, ob der Anspruchsteller das Eigentum erworben, und möglicherweise später wieder an einen Dritten verloren hat. Hierzu muss man wissen, nach welchen Vorschriften das Eigentum erworben werden, und ggf. auch wieder verloren gehen kann. Dieses Skript vermittelt Ihnen hierzu die einschlägigen Klausurschemata und das erforderliche Detailwissen. Hierbei habe ich mich an der Häufigkeit orientiert, in der diese Probleme im Examen geprüft werden. So werden etwa Themen, wie z.B. der verlängerte Eigentumsvorbehalt, die antizipierte Sicherungsübereignung und die berühmte „juristisch-logische Sekunde“ ausführlich erklärt. Zu dem fast immer geprüften Thema des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten nach §§ 932 ff. habe ich für Sie das dahinter stehende Grundprinzip in leicht merkbarer Form zusammengefasst. Damit haben Sie stets eine Leitlinie an der Hand, an der Sie sich in Problemfällen orientieren können, auch wenn Sie vergessen haben, was der BGH oder die Literatur dazu sagen. Sie werden damit immer eine vertretbare Lösung finden. Hier zeigt sich, dass Jura in erster Linie eine Verständniswissenschaft und Anwendungskunst ist.
Aber auch bei den scheinbar exotischeren Themen, wie z.B. Ersitzung, Aneignung, Fund, gesetzlicher Fruchterwerb und gutgläubig lastenfreier Erwerb nach § 936 lässt Sie dieses Skript nicht im Stich. Bei der Besprechung des § 936 werden Sie sehen, dass diese Vorschrift kein „Buch mit sieben Siegeln“ ist, sondern dass dahinter das gleiche Grundprinzip wie hinter den §§ 932–935 steht.
Im Immobliarsachenrecht habe ich beim gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten die klausurtypische Verzahnung des § 892 mit der Vormerkung dargestellt. Erwerb, Verlust und Übertragung der Vormerkung und die Ansprüche des Vormerkungsberechtigten bei vormerkungswidrigen Verfügungen werden ausführlich behandelt. Wenn Sie das Skript durchgearbeitet haben, werden Sie sehen, dass das Sachenrecht nicht das befürchtete „Horrorgebiet“, sondern eigentlich sehr interessant und logisch ist.
Damit Ihnen keine grundsätzlichen Fehler unterlaufen, habe ich zunächst einen Abschnitt „sachenrechtliche Grundbegriffe“ vorangestellt. So ist z.B. die Unkenntnis oder die fehlerhafte Anwendung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips in Klausuren ein typischer „Killerfehler“. Wenn Sie diese Grundbegriffe durchgearbeitet und verstanden haben, werden Ihnen solche Fehler nicht mehr unterlaufen.
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Moritz Wahlster-Bode, der bei der Erstellung dieses Skripts mit seinen fachlichen Beiträgen eine große Hilfe gewesen ist.
Auf gehtʼs – ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg beim Erarbeiten des Stoffs!
Und noch etwas: Das Examen kann jeder schaffen, der sein juristisches Handwerkszeug beherrscht und kontinuierlich anwendet. Jura ist kein „Hexenwerk“. Setzen Sie nie ausschließlich auf auswendig gelerntes Wissen, sondern auf Ihr Systemverständnis und ein solides methodisches Handwerk. Wenn Sie Hilfe brauchen, Anregungen haben oder sonst etwas loswerden möchten, sind wir für Sie da. Wenden Sie sich gerne an C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg, E-Mail: [email protected]. Dort werden auch Hinweise auf Druckfehler sehr dankbar entgegen genommen, die sich leider nie ganz ausschließen lassen.
Frankfurt, im Januar 2020 Achim Bönninghaus
JURIQ Erfolgstraining – die Skriptenreihe von C.F. Müllermit Online-Wissens-Check
Mit dem Kauf dieses Skripts aus der Reihe „JURIQ Erfolgstraining“ haben Sie gleichzeitig eine Zugangsberechtigung für den Online-Wissens-Check erworben – ohne weiteres Entgelt. Die Nutzung ist freiwillig und unverbindlich.
Was bieten wir Ihnen im Online-Wissens-Check an?
•
Sie erhalten einen individuellen Zugriff auf Testfragen zur Wiederholung und Überprüfung des vermittelten Stoffs, passend zu jedem Kapitel Ihres Skripts.
•
Eine individuelle Lernfortschrittskontrolle zeigt Ihren eigenen Wissensstand durch Auswertung Ihrer persönlichen Testergebnisse.
Wie nutzen Sie diese Möglichkeit?
Registrieren Sie sich einfach für Ihren kostenfreien Zugang auf www.juracademy.de/skripte/login und schalten sich dann mit Hilfe des Codes für Ihren persönlichen Online-Wissens-Check frei.
Der Online-Wissens-Check und die Lernfortschrittskontrolle stehen Ihnen für die Dauer von 24 Monaten zur Verfügung. Die Frist beginnt erst, wenn Sie sich mit Hilfe des Zugangscodes in den Online-Wissens-Check zu diesem Skript eingeloggt haben. Den Starttermin haben Sie also selbst in der Hand.
Für den technischen Betrieb des Online-Wissens-Checks ist die JURIQ GmbH, Unter den Ulmen 31, 50968 Köln zuständig. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an das JURIQ-Team wenden, und zwar per E-Mail an: [email protected].
zurück zu Rn. 47, 132, 170, 194, 240, 296
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Codeseite
Literaturverzeichnis
1. TeilEinleitung
A.Sachenrechtliche Grundbegriffe
I.Begriff der Sache
II.Grundstücke und bewegliche Sachen
1.Grundstücke
a)Wesentliche und einfache Bestandteile eines Grundstücks
b)Scheinbestandteile eines Grundstücks
c)Grundstückszubehör
2.Bewegliche Sachen
a)Wesentliche und einfache Bestandteile
b)Scheinbestandteile
c)Zubehör
III.Weitere rechtsrelevante Einteilungen
1.Sachgesamtheit
2.Sacheinheit
3.Vertretbare Sachen
4.Nutzungen
IV.Verfügungsgeschäft
B.Trennungs- und Abstraktionsprinzip
C.Sachenrechtsgrundsätze
I.Numerus clausus der Sachenrechte und Typenzwang
II.Grundsatz der Absolutheit
III.Der Publizitätsgrundsatz
IV.Der Bestimmtheitsgrundsatz
V.Die Abstraktheit der dinglichen Rechtsgeschäfte
2. TeilErwerb des Besitzes
A.Erwerb des unmittelbaren Besitzes
I.Originärer Erwerb des unmittelbaren Besitzes
II.Abgeleiteter Erwerb des unmittelbaren Besitzes
III.Abgeleiteter Besitzerwerb durch bloße Einigung, § 854 Abs. 2
IV.Besitz bei Einschaltung eines Besitzdieners, § 855
V.Fingierter Erbenbesitz, § 857
B.Verlust des unmittelbaren Besitzes
C.Erwerb mittelbaren Besitzes
D.Übertragung des mittelbaren Besitzes
E.Verlust des mittelbaren Besitzes
3. TeilErwerb des Eigentums an beweglichen Sachen durch Rechtsgeschäft
A.Erwerb nach § 929 S. 1
I.Einigung über Eigentumsübertragung
1.Zustandekommen und Inhalt
2.Allgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen
II.Übergabe
1.Besitzerwerb auf Erwerberseite
a)Nach §§ 854 ff
b)Einschaltung von Geheißpersonen
2.Kein Besitz (mehr) auf Veräußererseite
3.Übertragung auf Veranlassung des Veräußerers
4.Zum Zweck der Übereignung
5.Wechsel des unmittelbaren Besitzers?
III.Einigsein
IV.Berechtigung
1.Verfügungsbefugter Eigentümer
a)Grundsatz
b)Verfügungsbeschränkungen, insbesondere §§ 1365, 1369
2.Verfügungsbefugter Nichteigentümer
a)Verfügungsbefugnis durch Rechtsgeschäft, die Ermächtigung nach § 185 Abs. 1
b)Verfügungsbefugnis kraft Gesetzes
V.Gutgläubiger Erwerb des Eigentums, §§ 932 Abs. 1 S. 1
1.Rechtsgeschäft i.S. eines Verkehrsgeschäfts
2.Verfügender Nichtberechtigter
3.Verfügender kraft Rechtsscheins legitimiert
a)Anknüpfungspunkt des Rechtsscheins
b)Problemfall: Geheißperson kraft Rechtsscheins
4.Kein Abhandenkommen, § 935
5.Keine Bösgläubigkeit des Erwerbers
a)Eigentum des Veräußerers als Bezugspunkt
b)Ausnahme: Schutz des guten Glaubens an die Verfügungsbefugnis, § 366 Abs. 1 HGB
VI.Erwerb nach § 185 Abs. 2
1.Genehmigung des Berechtigten
2.Nachträglicher Erwerb durch den Verfügenden
3.Beerbung des Nichtberechtigten durch den Berechtigten
B.Übereignung „kurzer Hand“ nach § 929 S. 2
I.Einigung über Eigentumsübertragung
II.Erwerber bereits im Besitz der Sache
III.Berechtigung
IV.Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten, § 932 Abs. 1 S. 2
1.Rechtsgeschäft i.S. eines Verkehrsgeschäfts
2.Verfügender nicht Berechtigter
3.Besitz vor Übereignung vom Veräußerer erlangt (Rechtsschein)
4.Kein Abhandenkommen, § 935
5.Keine Bösgläubigkeit des Erwerbers
V.Erwerb nach § 185 Abs. 2
VI.Übungsfall Nr. 1
C.Die Übereignung durch Besitzkonstitut, §§ 929, 930
I.Einigung über Eigentumsübertragung
1.Inhalt
a)Allgemeine Anforderungen
b)Besondere Probleme bei der Sicherungsübereignung
2.Wirksamkeit
II.Besitzkonstitut, § 868
1.Allgemeine Anforderungen
a)Vereinbartes Besitzmittlungsverhältnis
b)Gesetzliches Besitzmittlungsverhältnis
c)Rechtslage bei Unwirksamkeit des Besitzkonstituts
2.Problemfall Sittenwidrigkeit einer Sicherungsübereignung, § 138 Abs. 1
a)Die anfängliche Übersicherung
b)Die nachträgliche Übersicherung
III.Einigsein und Berechtigung
IV.Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten, § 933
V.Erwerb nach § 185 Abs. 2
D.Übereignung durch Abtretung des Herausgabeanspruchs (Vindikationszession), §§ 929, 931
I.Einigung über Eigentumsübertragung
II.Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen Drittbesitzer
III.Einigsein und Berechtigung
IV.Gutgläubiger Erwerb nach § 934
1.§ 934 Alt. 1
2.§ 934 Alt. 2
a)Voraussetzungen
b)Sonderproblem: Gleichstufiger mittelbarer „Nebenbesitz“
V.Erwerb nach § 185 Abs. 2
E.Erwerb des Anwartschaftsrechts an beweglichen Sachen
I.Ersterwerb, §§ 929 ff., 158
1.Einigung über die aufschiebend bedingte Übertragung des Eigentums
a)Der einfache Eigentumsvorbehalt
b)Der erweiterte Eigentumsvorbehalt
c)Der nachgeschaltete Eigentumsvorbehalt
d)Der weitergeleitete Eigentumsvorbehalt
e)Weitere Formen des EV
f)Rechtsstellung des Käufers bis zum Bedingungseintritt
2.Übergabe (oder Übergabesurrogat)
3.Einigsein
4.Berechtigung
5.Gutgläubiger Ersterwerb des Anwartschaftsrechts, §§ 932 ff
6.§ 185 Abs. 2
II.Zweiterwerb (Übertragung), §§ 929 ff. analog
1.Einigung über die Übertragung des Anwartschaftsrechts
2.Übergabe oder Übergabesurrogat
3.Einigsein
4.Berechtigung
5.Gutgläubiger Erwerb, §§ 932 ff. analog
6.§ 185 Abs. 2
III.Schutz des Anwartschaftsrechts
1.Schutz vor Zwischenverfügungen
2.Schutz vor Störung
3.Schutz vor Entziehung des Besitzes
4.Deliktsrechtlicher Schutz
IV.Übungsfall Nr. 2
F.Gutgläubig lastenfreier Erwerb, § 936
I.Lastenfreier Erwerb gem. §§ 929 S. 1, 936 Abs. 1 S. 1
1.Eigentumserwerb des Erwerbers nach § 929 S. 1
2.Belastung der Sache mit dem Recht eines Dritten
3.Kein Abhandenkommen beim Rechtsinhaber, § 935
4.Keine Bösgläubigkeit des Erwerbers im Hinblick auf das Recht des Dritten, § 936 Abs. 2
a)Grundsatz: Guter Glaube an das unbelastete Eigentum des Verfügenden
b)Ausnahme: § 366 Abs. 2 HGB
II.Der lastenfreie Erwerb gem. §§ 929 S. 2, 936 Abs. 1 S. 2
1.Eigentumserwerb des Erwerbers nach § 929 S. 2
2.Vorherige Besitzerlangung vom Veräußerer
3.Übrige Voraussetzungen
III.Der lastenfreie Erwerb gem. §§ 930, 936 Abs. 1 S. 3
1.Eigentumserwerb des Erwerbers nach § 930 oder nach § 931 und Veräußerer nicht mittelbarer Besitzer
2.Belastung der Sache mit dem Recht eines Dritten
3.Nachträgliche Besitzerlangung auf Grund der Veräußerung
4.Kein Abhandenkommen beim Rechtsinhaber, § 935
5.Keine Bösgläubigkeit des Erwerbers im Hinblick auf das Recht des Dritten, § 936 Abs. 2
IV.Lastenfreier Eigentumserwerb des Erwerbers nach §§ 931, 936 Abs. 1 S. 1 bei mittelbarem Besitz des Veräußerers
1.Besondere Voraussetzungen
2.Einschränkung durch § 936 Abs. 3
a)Direkte Anwendung des § 936 Abs. 3
b)Analoge Anwendung auf das Anwartschaftsrecht
V.Übungsfall Nr. 3
4. TeilRechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb an Grundstücken, §§ 873, 925, 891–893
A.Erwerb vom Berechtigten
I.Auflassung
1.Einigung
2.Form des § 925
II.Eintragung in das Grundbuch
III.Einigsein oder Bindung gem. § 873 Abs. 2
IV.Berechtigung des Veräußerers
1.Grundsatz: Berechtigung bei Eintragung des Erwerbers
2.Vorverlagerung des Zeitpunkts nach § 878
B.Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten, §§ 891–893
I.Rechtsgeschäft i.S. eines Verkehrsgeschäfts
II.Grundbuch unrichtig
III.Verfügender aus dem Grundbuch legitimiert, § 891
IV.Kein Widerspruch im Grundbuch eingetragen, § 899
V.Keine positive Kenntnis des Erwerbers von der Unrichtigkeit des Grundbuchs
1.Grundsätzlich maßgeblicher Zeitpunkt
2.Vorverlagerung des maßgeblichen Zeitpunkts
a)Nach § 892 Abs. 2 Hs. 1
b)Vorverlegung durch Eintragung einer Vormerkung
C.§ 185 Abs. 2
5. TeilErwerb einer Vormerkung, §§ 883 ff.
A.Ersterwerb, §§ 883 Abs. 1, 885
I.Schuldrechtlicher Anspruch auf dingliche Rechtsänderung an einem Grundstück
II.Bewilligung/einstweilige Verfügung
III.Eintragung in das Grundbuch
IV.Fortbestehen der Bewilligung im Zeitpunkt der Eintragung
V.Berechtigung
VI.Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten, §§ 893 Alt. 2, 892
VII.§ 185 Abs. 2
B.Zweiterwerb (Übertragung), § 398 i.V.m. § 401 Abs. 1 analog
I.Einigung über Abtretung der gesicherten Forderung
II.Doppelte Berechtigung des Zedenten
III.Gutgläubiger Zweiterwerb?
C.Rechtswirkungen der Vormerkung
I.Sicherungswirkung, § 883 Abs. 2
II.Rangwirkung
III.Insolvenzsicherungswirkung
IV.Vorwirkung
D.Ansprüche bei vormerkungswidrigen Verfügungen
I.Zustimmungsanspruch, § 888
II.Analoge Anwendung der §§ 987 ff.
E.Erlöschen der Vormerkung
6. TeilErwerb des Eigentums durch Gesetz und Hoheitsakt
A.Der Eigentumserwerb kraft Gesetzes
I.Die Mobiliarersitzung, §§ 937 ff.
1.Voraussetzungen
2.Rechtsfolgen der Ersitzung
a)Originärer Eigentumserwerb
b)Schuldrechtlicher Ausgleich für Rechtsverlust
II.Die Buchersitzung von Grundstücken nach § 900
III.Verbindung beweglicher Sachen mit einem Grundstück
1.Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück
2.Wesentlicher Bestandteil
3.Kein Scheinbestandteil, § 95
4.Rechtsfolgen
IV.Verbindung, Vermischung, Verarbeitung, §§ 947–950
1.Verbindung, § 947
2.Vermischung/Vermengung, § 948
3.Verarbeitung, § 950/Probleme des verlängerten Eigentumsvorbehalts
a)Voraussetzungen des § 950
b)Klausurproblem: Verlängerter Eigentumsvorbehalt
4.Schuldrechtlicher Ausgleich bei Rechtsverlust, § 951
a)Funktion des § 951
b)Konkurrenzen mit anderen Anspruchsgrundlagen
V.Eigentum an Schuldurkunden, § 952
VI.Der Fruchterwerb, §§ 953–957
1.Aneignungsgestattung durch den Gestattungsberechtigten, § 956
2.Aneignungsgestattung durch einen Nichtberechtigten, §§ 957, 956
3.Redlicher Eigen- oder Nutzungsbesitzer, § 955
4.An der fremden Sache dinglich Berechtigter, § 954
5.Fruchterwerb durch den Eigentümer, § 953
VII.Die Aneignung, §§ 958–964
VIII.Der Fund, §§ 965–984
IX.Die Universalsukzession nach § 1922 BGB
B.Der Erwerb durch Hoheitsakt
I.Zwangsversteigerung beweglicher Sachen, §§ 814 ff. ZPO
II.Eigentumserwerb in der Grundstückszwangsversteigerung
C.Übungsfall Nr. 4
Sachverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bamberger/Roth
Bürgerliches Gesetzbuch, Band 2, 3. Aufl. 2012(zitiert: Bamberger/Roth-Bearbeiter)
Baur/Stürner
Sachenrecht, 18. Aufl. 2009
Bönninghaus
BGB Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2018
Bönninghaus
BGB Allgemeiner Teil II, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus
Schuldrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus
Schuldrecht Allgemeiner Teil II, 4. Aufl. 2020
Bönninghaus
Schuldrecht Besonderer Teil I, 4. Aufl. 2019
Bönninghaus
Schuldrecht Besonderer Teil II, 3. Aufl. 2015
Bönninghaus
Sachenrecht I, 3. Aufl. 2018
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Band 8 (Sachenrecht), 8. Aufl. 2020(zitiert: MüKo-Bearbeiter)
Palandt
Bürgerliches Gesetzbuch, 79 Aufl. 2020(zitiert: Palandt-Bearbeiter)
Tipps vom Lerncoach
Warum Lerntipps in einem Jura-Skript?
Es gibt in Deutschland ca. 1,6 Millionen Studierende, deren tägliche Beschäftigung das Lernen ist. Lernende, die stets ohne Anstrengung erfolgreich sind, die nie kleinere oder größere Lernprobleme hatten, sind eher selten. Besonders juristische Lerninhalte sind komplex und anspruchsvoll. Unsere Skripte sind deshalb fachlich und didaktisch sinnvoll aufgebaut, um das Lernen zu erleichtern.
Über fundierte Lerntipps wollen wir darüber hinaus all diejenigen ansprechen, die ihr Lern- und Arbeitsverhalten verbessern und unangenehme Lernphasen schneller überwinden wollen.
Diese Tipps stammen von Frank Wenderoth, der als Diplom-Psychologe seit vielen Jahren in der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater und Personal Coach tätig ist und außerdem Jurastudierende in der Prüfungsvorbereitung und bei beruflichen Weichenstellungen berät.
Wie lernen Menschen?
Die Wunschvorstellung ist häufig, ohne Anstrengung oder ohne eigene Aktivität „à la Nürnberger Trichter“ lernen zu können. Die modernen Neurowissenschaften und auch die Psychologie zeigen jedoch, dass Lernen ein aktiver Aufnahme- und Verarbeitungsprozess ist, der auch nur durch aktive Methoden verbessert werden kann. Sie müssen sich also für sich selbst einsetzen, um Ihre Lernprozesse zu fördern. Sie verbuchen die Erfolge dann auch stets für sich.
Gibt es wichtigere und weniger wichtige Lerntipps?
Auch das bestimmen Sie selbst. Die Lerntipps sind als Anregungen zu verstehen, die Sie aktiv einsetzen, erproben und ganz individuell auf Ihre Lernsituation anpassen können. Die Tipps sind pro Rechtsgebiet thematisch aufeinander abgestimmt und ergänzen sich von Skript zu Skript, können aber auch unabhängig voneinander genutzt werden.
Verstehen Sie die Lerntipps „à la carte“! Sie wählen das aus, was Ihnen nützlich erscheint, um Ihre Lernprozesse noch effektiver und ökonomischer gestalten zu können!
Lernthema 10Imaginationsmethoden
Imaginationsmethoden haben – ähnlich wie beim Mentaltraining im Sport – zum einen die Funktion, dem Körper klare Handlungsanweisungen zu geben. Wenn Sie erforderliche Tätigkeiten zunächst in der Vorstellung durchführen, entwickeln Ihr Körper und Ihr Gehirn bereits ein Handlungskonzept, das nur noch abgerufen und umgesetzt werden muss.
Sie können damit zum anderen auch negative Gedanken- oder Gefühlskreisläufe unterbrechen, die Ihre Aktivität hemmen und positive Innenbilder erzeugen, die sich förderlich auf die Zuversicht auswirken und Energien freisetzen. Mittels Imagination können Sie sich selbst aus einer Flaute „herausrudern“.
Lerntipps
Vermeiden Sie die Vermeidungsspirale!
Es ist ganz normal, dass wir nicht jeden Tag gleichermaßen motiviert sind. Wir beginnen mit Arbeiten – zum Beispiel auch nach einer längeren Ruhephase –, die uns noch relativ unbekannt sind oder wie ein unüberwindbarer Berg erscheinen. Oder wir haben einen Durchhänger und das Gefühl, die Ideen gehen uns aus. Wir fühlen uns inkompetent und unwohl, haben Zweifel und werden unzufrieden. Negative Fantasien und die damit verbundenen Gefühle hindern uns an der Arbeit. In solchen Phasen erscheinen uns alle anderen Aktivitäten attraktiver als die bevorstehenden. Wir gehen die Aufgaben nicht an und fühlen uns danach noch unwohler, weil wir eigentlich produktiv sein wollten. Gefühle wie Unlust, Selbstzweifel und Unzufriedenheit addieren sich. Wenn wir uns nicht möglichst bald aktivieren, laufen wir Gefahr, in eine Vermeidungsspirale zu geraten.
Setzen Sie anstelle von Negativfantasien Innenbilder ein, die Sie aktivieren!
Die folgende Imaginationsmethode soll es Ihnen erleichtern, einen Anfang zu finden. Wenn Sie einmal begonnen haben, werden Sie von sich aus weiter arbeiten und die gesamte Arbeitsphase wird Ihnen leichter fallen. Weil viele Lernende die Erfahrung machen, dass die Methode sie unterstützt, können sie zukünftig gelassener mit anfänglichen Motivations- und Aktivitätsproblemen umgehen.
Methode: Innenbilder zur Aktivierung
•
Welche Inhalte sind gefordert (Teilthema XY zum Zivilrecht)?
•
Welche Arbeitsmittel sind zu benutzen (Bücher, Skripte, PC)?
•
Welche Lerntätigkeiten sind gefordert (Einführung, Karteikarten schreiben, mündlich Wiederholung, schriftliche Zusammenfassung)?
•
Welche Themen sollen abgehandelt werden (Aufbauschemata zum Thema X)?
•
Räumen Sie Ihren Schreibtisch leer.
•
Suchen Sie die Materialien zusammen, die Sie aus der gegenwärtigen Sicht benötigen können (Bücher, Ordner, Skripte).
•
Suchen Sie einen Ort der Entspannung wie Stuhl, Sofa.
•
Machen Sie es sich wie gewohnt bequem und entspannen Sie mit geschlossenen Augen für ca. 2 Minuten.
•
Stellen Sie sich vor, wie Sie sich dem Schreibtisch nähern und lassen sich dabei immer 30 bis 60 Sekunden Freiraum für weitere Imaginationen.
•
Sie sehen die Arbeitsmaterialien vor sich auf dem Schreibtisch liegen.
•
Stellen Sie sich vor, wie Sie in dem Buch X blättern, wie Sie den Ordner zum Thema Y aufschlagen und die Seiten durch Ihre Finger gleiten lassen!
•
Nun stellen Sie sich kurz das anstehende Thema vor, es heißt: XYZ.
•
Vorhin haben Sie sich einen groben Überblick zu dem Thema verschafft. Lassen Sie nun einige Begriffe zu diesem Thema in Ihrer Vorstellung emporkommen.
•
Sie werden merken, dass Ihnen sofort einige Begriffe dazu einfallen.
•
Sie stellen sich vor, wie Sie in dem vorhin schon vorgestellten Buch oder Ordner zu diesem Thema blättern und konzentriert verschiedene Stellen intensiver betrachten.
•
Dann stellen Sie sich vor, wie Sie sich an Ihren Arbeitsplatz setzen.
•
Ganz plastisch stellen Sie sich vor, wie Sie den Artikel X lesen und wie Sie Ihre Hände heben, um sich Notizen zu machen oder wie Sie den PC anschalten und anfangen, auf der Tastatur zu schreiben.
•
Spüren Sie bei Ihren Tätigkeiten deutlich, wie Sie sitzen, das Buch halten, Ihre Finger die Tastatur bedienen – so plastisch wie Ihnen möglich.
•
Sie merken, wie Sie aktiv sind, Ihr Kopf klarer wird, Sie sich entspannen und gleichzeitig handeln.
•
Stellen Sie sich vor, wie Sie gleich aufstehen werden, zum Arbeitsplatz gehen und zu arbeiten beginnen.
•
Öffnen Sie die Augen, stehen Sie auf und begeben Sie sich tatsächlich an Ihren Arbeitsplatz.
•
Beginnen Sie jetzt mit den imaginierten Tätigkeiten.
Sie werden verblüfft sein, wie gut diese Methode klappt, um eine Aktivität zu beginnen und dadurch eine Vermeidungsspirale zu unterbrechen!
Rufen Sie sich gelegentlich Ihre Gedanken vor Beginn einer Tätigkeit in Erinnerung!
Wir haben gerade bei größeren Ausarbeitungen Gedanken und Gefühle, die uns daran hindern, etwas zu beginnen. Wir blockieren uns damit auch, für die Zeit nach der Aufgabenerledigung positive Perspektiven zu entwickeln. Erinnern Sie sich doch einmal an Ihre Gedanken, die Sie vor Beginn einer solchen Tätigkeit hatten und vergleichen Sie diese mit den Gedanken und Gefühlen danach. Meist waren die Gedanken wesentlicher negativer und Sie merken danach häufig erleichtert, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Häufig ärgert man sich auch, dass man eine Tätigkeit so lange vor sich her geschoben hat.
•
Schreiben Sie sich häufiger die Gedanken und Gefühle vor und nacheiner Tätigkeit auf.
•
Ihre Bewertungen vor einer Handlung werden sich dadurch verbessern. Sie sehen weniger Hindernisse und sind zuversichtlicher, da Sie wissen, dass es danach fast immer besser ist als vor der Aufgabe.
•
Sie beginnen Ihre Tätigkeiten zügiger und sind bei der Arbeit motivierter.
•
Sie sparen sich damit viel psychischen Stress.
Weglaufende Gedanken können eskalieren!
Wenn wir negative Gedanken und Gefühle entwickeln, denken wir schnell und beharrlich in die gleiche Richtung. Wir denken uns dann lebhaft in eine Situation ein, sodass wir vergessen, diese an der Realität zu überprüfen. Dem Gehirn ist es gleich, ob wir uns Dinge lediglich vorstellen oder sie real vorhanden sind [in Lernthema 8 (Mentale Übungen und Autosuggestion) wurde schon erwähnt, dass man sich das auch positiv zunutze machen kann mit positiven Autosuggestionen und Imaginationen]. Dies führt zu einer Eskalation der Gedanken. Wir greifen auf frühere schlechte Erfahrungen zurück, übertragen sie auf die gegenwärtige Situation, wir übersteigern Vorurteile uns gegenüber. Man sieht sich schon im Vorhinein als Versager, bekommt Angst, Gefühle von Inkompetenz und schlimmstenfalls werden die Gedanken zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Unterbrechen Sie weglaufende Gedanken möglichst früh – mit dem Gedankenstopp!
Sobald ein Gedanke als Anfang negativer Gedankenkreisläufe einsetzt, schlagen Sie mit der flachen Hand auf den Tisch und sagen „Stopp!“. Auch wenn es albern klingt, es hilft vor allem, wenn Sie die Unterbrechung stets zu Gedankenbeginn durchführen und konsequent sind. Am besten gelingt die Unterbrechung mit körperlichen Aktivitäten wie Aufräumen, Bücher raussuchen. Überprüfen Sie den Realitätsgehalt Ihrer Gedanken auch, indem Sie Meinungen Außenstehender einholen und konkretes Feedback bekommen (z. B. über Ihre Ausarbeitung). Es geht aber vor allem darum, dass Sie allein bestimmen und Sie Macht über Ihre Gedanken haben.
Beseitigen Sie „Gedankenabfall“, wenn Sie die zugrunde liegenden Probleme jetzt nicht lösen können!
Mitunter verfolgen uns Gedanken, deren zugrunde liegenden Probleme wir (im Moment) nicht lösen können. Solche Gedanken können sein:
•
unangenehme und peinliche frühere Begebenheiten, die wir auch nach einer Entschuldigung nicht ungeschehen machen konnten,
•
immer wieder Ärger über Personen oder Sachverhalte, die nicht änderbar sind,
•
in der Zukunft liegende Probleme, die wir noch gar nicht lösen können.
Diese Gedanken können uns so absorbieren, dass sie unsere Lern- und Arbeitsfähigkeit und sogar unsere Lebensqualität beeinflussen.
Während Sie mit dem Gedankenstopp ständig auftretende Gedanken unterbrechen, sorgen Sie mit der Imaginationsübung „Der rote Ballon“ für mehr innere Ausgeglichenheit und Ruhe, da Sie diese Gedanken abschalten und „entsorgen“ können.
Übung „Der rote Ballon“
Bitte stellen Sie sich nun Ihr Problem oder die Person vor, mit der (jetzt) keine sinnvollen Lösungen möglich sind …
Nun steht neben Ihnen eine große Kiste … in diese stecken Sie nun das Problem.
Falls es groß ist, können Sie nachstopfen. Auch eine Person können Sie hinein geben und etwas nachhelfen …
Wenn das Problem oder die Person drin ist, nehmen Sie den Deckel, legen ihn fest drauf und nageln oder schrauben die Kiste zu … Sie merken deutlich, wie Sie immer zufriedener hämmern oder schrauben …
Nun sehen Sie neben sich. Da ist ein riesiger roter Ballon fest gebunden … sein Seil befestigen Sie ganz fest an der Kiste … und lassen es nun los …
Der Ballon erhebt sich, spannt das Seil straff und hebt die Kiste mit ihrem Inhalt hoch … steigt immer weiter auf, immer höher … und die Kiste mit ihrem Inhalt wird immer kleiner und kleiner …
Sie spüren das deutlich … Ihre Entlastung und Befreiung nimmt immer mehr und mehr zu … der Ballon wird immer kleiner und wird dann mit seiner Last weit fortgetragen … weit über den Horizont hinweg …
… und Sie können tief und entspannt durchatmen.
Diese Übung bereitet Freude und hat eine befreiende Wirkung. Entspannung und innere Ruhe können statt innerer gedanklicher Getriebenheit wieder einkehren.
1. TeilEinleitung
A.Sachenrechtliche Grundbegriffe
B.Trennungs- und Abstraktionsprinzip
C.Sachenrechtsgrundsätze
1
Um uns einen generellen Überblick über das Sachenrecht zu verschaffen, ist es hilfreich, vorab zu klären, was im Sachenrecht geregelt ist. Dazu soll die nachfolgende Übersicht dienen.
[Bild vergrößern]
Bevor wir zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Erwerb von Besitz und Eigentum kommen, sind zunächst einige sachenrechtliche Grundbegriffe und Grundprinzipien zu klären. Die genaue Kenntnis dieser Grundprinzipien und Grundbegriffe ist der Schlüssel für die gute Sachenrechtsklausur und vermeidet die Erörterung von Scheinproblemen.
Betrachten Sie also dieses Kapitel nicht als langweiliges „Begriffekloppen“, sondern machen Sie sich klar, dass hierdurch erst die Grundvoraussetzungen für Ihren Klausurerfolg gelegt werden. Sie werden anschließend auch die nachfolgenden Ausführungen viel leichter verstehen und in der Klausur die Probleme bereits bei der Lektüre des Sachverhalts erkennen.
1. Teil Einleitung › A. Sachenrechtliche Grundbegriffe
A.Sachenrechtliche Grundbegriffe
2
Das BGB enthält an vielen Stellen Definitionsnormen, sog. „Legaldefinitionen“. In der Regel verwendet das Gesetz dabei die Methode der „Essentialdefinition“. Dadurch soll das Wesen des zu definierenden Begriffs abstrakt umschrieben werden. Dies dient der Rechtssicherheit bei der Rechtsanwendung und eignet sich hierfür besser, als eine „Nominaldefinition“, die sich darin erschöpft, einen Begriff anhand von Beispielen zu erklären. Die Bestandteile einer Essentialdefinition setzen sich aus der nächst höheren Gattung und dem unterscheidenden Merkmal zusammen.
Ein Schimmel (zu definierender Begriff) ist ein Pferd (nächst höhere Gattung), welches weiß ist (unterscheidendes Merkmal), oder kurz: Ein Schimmel ist ein weißes Pferd.
1. Teil Einleitung › A. Sachenrechtliche Grundbegriffe › II. Grundstücke und bewegliche Sachen
II.Grundstücke und bewegliche Sachen
6
Die Sachen werden in bewegliche Sachen und Grundstücke eingeteilt. Da hierfür jeweils unterschiedliche Regeln gelten, ist es wichtig, diese Begriffe genau zu unterscheiden. Der Begriff des Grundstücks wird im BGB nicht näher definiert. Diese Aufgabe haben Rechtsprechung und Literatur übernommen.
1.Grundstücke
7
Grundstück ist ein Teil der Erdoberfläche, der im Grundbuch als „Grundstück“ geführt wird, einschließlich seiner Bestandteile.[8]
„Grundstück“ im Rechtssinne ist also nicht nur der blanke Grund und Boden, sondern auch die darauf wachsenden Pflanzen (vgl. § 94 Abs. 1 S. 2) so lange sie nicht vom Grundstück getrennt worden sind und i.d.R. auch die darauf stehenden Gebäude (vgl. § 94 Abs. 1 S. 1).
Man sieht einem Grundstück äußerlich nicht immer an, welche Ausdehnung es hat, vor allem, wenn eine sichtbare Begrenzung fehlt. Diese Aufgabe erfüllt das Grundbuch in Verbindung mit der katasteramtlichen Vermessung.
Das rechtliche Schicksal des Grundstücks teilen auch seine Bestandteile, und zwar die wesentlichen Bestandteile (§§ 93–96) immer, sowie die einfachen Bestandteile, soweit an ihnen keine Sonderrechte bestehen.
a)Wesentliche und einfache Bestandteile eines Grundstücks
8
„Wesentliche“ Bestandteile eines Grundstücks sind in den §§ 94–96 definiert. Die in § 93 angeordnete Rechtsfolge gilt aber auch für sie. Diese besteht darin, dass an wesentlichen Bestandteilen vor der Trennung von der Gesamtsache weder durch Rechtsgeschäft, noch kraft Gesetzes, noch durch Hoheitsakt irgendwelche Sonderrechte begründet werden können (beachte aber ErbbauRG[9] und WEG[10]).
Hierzu sagt § 93:
Wesentliche Bestandteile . . . können nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.“
Ein auf einem Grundstück errichtetes Gebäude ist nach § 94 Abs. 1 S. 1 i.d.R. wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Im juristischen Sinne ist es also „Grundstück“, und nicht nur der Boden, auf dem es steht. Als wesentlicher Bestandteil des Grundstücks kann es somit nicht Gegenstand besonderer Rechte sein.
Was aber sind die konkreten Rechtsfolgen, die sich aus dieser begrifflichen Einordnung ergeben? Ein Gebäude kann nicht, wie eine bewegliche Sache nach § 929 S. 1 durch Einigung und Übergabe übereignet werden, da dies bedeuten würde, dass hieran, entgegen § 93 gesondertes Eigentum entstehen könnte. Das Gebäude kann also, da es juristisch „Grundstück“ ist, nur nach §§ 873, 925 zusammen mit dem Grundstück als juristische Einheit übereignet werden.
9
Nach § 96 gelten auch Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, als Bestandteile des Grundstücks. Sinn der Regelung ist, dass Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, nur zusammen mit dem Eigentum an dem Grundstück übergehen sollen.
Zu den Rechten i.S.v. § 96 gehören z.B. die Grunddienstbarkeiten (§§ 1018 ff.), das Recht auf Duldung eines Überbaus (§ 912), eines Notweges (§ 917), aber auch umgekehrt das Rentenrecht des Nachbarn, der den Überbau oder den Notweg zu dulden hat (§§ 912 Abs. 2, 917 Abs. 2).[11]
Ob ein Recht, das unter § 96 fällt, als einfacher oder als wesentlicher Bestandteil einzuordnen ist, hängt davon ab, ob es seiner Natur nach von dem Eigentum getrennt werden kann. Wesentlicher Bestandteil ist daher z.B. die Grunddienstbarkeit, da diese nach § 1018 untrennbar mit dem Eigentum an einem anderen Grundstück, nämlich dem „herrschenden“ Grundstück verbunden ist.
A und B sind Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke. Das Grundstück des A ist im Grundbuch unter der Nr. 230, das Grundstück des B unter der Nr. 231 eingetragen. Das Grundstück des A ist mit einem Wohnhaus bebaut. Das Grundstück des B ist noch unbebaut. A, dem sehr an einer unverbauten Aussicht gelegen ist, vereinbart mit B, dass B gegen Zahlung eines Entgelts verspricht, sein Grundstück nicht zu bebauen. Damit A auch gegenüber einem eventuellen Rechtsnachfolger des B abgesichert ist, wird zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers des Grundstücks Nr. 230 (herrschendes Grundstück, Eigentümer derzeit A) eine Grunddienstbarkeit (§§ 1018 ff., bitte lesen!) in das Grundbuch eingetragen, wonach es dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Nr. 231 (dienendes Grundstück, Eigentümer derzeit B) untersagt ist, das Grundstück zu bebauen.[12] Die Grunddienstbarkeit ist nach § 96 Bestandteil des Grundstücks Nr. 230, und zwar wesentlicher Bestandteil.
b)Scheinbestandteile eines Grundstücks
10
Ist ein Gebäude nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grundstück verbunden, so gilt es nach § 95 als Scheinbestandteil.
Ein Scheinbestandteil gilt als selbständige bewegliche Sache, mag sie auch mit dem Grundstück fest verbunden und tatsächlich noch so unbeweglich sein.
A hat auf einem von der Stadt Köln gepachteten Grundstück einen Schrebergarten gepachtet und darauf, auf einem festen Fundament ein Gartenhaus gebaut. Im Pachtvertrag ist geregelt, dass ein vom Pächter errichtetes Gebäude nach Ablauf des Pachtvertrages wieder zu entfernen ist. Da A Geld benötigt, übereignet er das Gartenhaus an B, indem er dem B die Schlüssel des Gartenhauses übergibt. Da das Gartenhaus nach dem Pachtvertrag nur zu einem vorübergehenden Zweck errichtet worden ist, handelt es sich um einen Scheinbestandteil i.S.v. § 95, also um eine selbständige bewegliche Sache. Somit kann es auch nach §§ 929 ff. selbständig übereignet werden. B ist daher nach § 929 S. 1 Eigentümer des Gartenhauses geworden.
[Bild vergrößern]
c)Grundstückszubehör
11
Zubehör sind nach § 97 bewegliche Sachen, die, ohne Bestandteile der Hauptsache zu sein, dem Zweck der Hauptsache auf Dauer (sonst § 97 Abs. 2) zu dienen bestimmt sind und sich zu ihr in einem dem entsprechenden räumlichen Verhältnis befinden.
Der Traktor ist Zubehör eines Bauerhofs. Das Gleiche gilt z.B. auch für die Kühe, Schweine etc. oder die Maschinen auf einem Fabrikgrundstück.
Der Begriff des „wirtschaftlichen“ Zwecks ist weit auszulegen. Es ist nicht erforderlich, dass die Hauptsache gewerblich genutzt wird. Voraussetzung ist nur, dass sie in irgendeiner Weise nutzbar ist.[13]
Eine Orgel ist Zubehör der Kirche.[14]
12
Bitte lesen Sie die nachfolgenden Vorschriften im Gesetz mit.
Bei Zubehör gelten folgende rechtliche Besonderheiten:
Im Schuldrecht: Nach § 311c ist z.B. bei Abschluss eines Kaufvertrags das Zubehör, auch ohne besondere Absprache, im Zweifel mit verkauft.[15]
Im Sachenrecht: §§ 926; 1031; 1062; 1093; 1096; 1120–1122; 1135. Danach erwirbt z.B. nach § 926 der Erwerber eines Grundstücks mit seiner Eintragung als Eigentümer des Grundstücks automatisch auch das Eigentum am Zubehör, wenn sich die Parteien darüber einig sind, dass sich die Veräußerung auch auf das Zubehör erstreckt. Das Zubehör braucht in diesem Fall also nicht gesondert nach §§ 929 ff. übereignet zu werden.
In der Zwangsvollstreckung: §§ 865 Abs. 2 ZPO; 55 Abs. 1; 90 Abs. 2 ZVG (alle §§ bitte lesen!). So erwirbt z.B. der Ersteigerer eines zwangsversteigerten Grundstücks mit dem Zuschlag gem. §§ 55 Abs. 1; 90 Abs. 2 ZVG automatisch auch das Eigentum am Zubehör.
2.Bewegliche Sachen
13
Bewegliche Sachen sind alle selbständigen Sachen, welche nicht Grundstück (bzw. Grundstücksbestandteil) sind.[16] Auch hieran können wesentliche (genauer: sonderrechtsunfähige) und einfache (genauer: sonderrechtsfähige) Bestandteile bestehen.
Auch hierfür ordnet § 93 an, dass wesentliche Bestandteile vor der Trennung von der Gesamtsache nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können.
a)Wesentliche und einfache Bestandteile
14
Auch zusammengesetzte bewegliche Sachen können aus einfachen und wesentlichen Bestandteilen bestehen.
Fernsehgerät, ein Computer, ein Stuhl etc.
Für die Einordnung als wesentliche Bestandteile verlangt § 93, dass die Bestandteile:
„… voneinander nicht getrennt werden können, ohne dass dadurch der eine oder der andere Teil zerstört, oder in seinem Wesen verändert würde ...“
Der Sinn der Regelung besteht im Folgenden: Es soll die Zerschlagung wirtschaftlicher Werte vermieden werden. Sonderrechte sollen vor einer Trennung von der Hauptsache nur dort bestehen, wo dies einen Sinn macht. Dies ist nur dann der Fall, wenn diese Sonderrechte auch wirtschaftlich realisierbar sind.[17]
15
Für die Einordnung als wesentlicher Bestandteil muss man sich also vorstellen, was im Falle der Trennung des Bestandteils von der Hauptsache passieren würde. Diese Prüfung erfolgt zweimal, und zwar jeweils gesondert in Bezug auf den getrennten Bestandteil und die Restsache. Es muss also durch die Trennung entweder der eine Teil (der ehemalige Bestandteil) oder die Restsache zerstört oder in seinem Wesen verändert werden. Eine Wesensveränderung liegt vor, wenn die Trennung zu einer erheblichen Beschädigung führen würde, oder der eine oder der andere Teil nach der Trennung nicht mehr so genutzt werden könnte, wie vor dem Einbau.[18]
Der serienmäßige Motor eines Pkw ist „einfacher“, d.h. „sonderrechtsfähiger“ Bestandteil des Fahrzeugs. Im Falle des Ausbaus würde weder der Wagen, noch der Motor zerstört. Auch würde hierdurch der Wagen nicht in seinem Wesen verändert, da er danach noch genauso nutzbar ist, wie vor dem Einbau des Motors. Durch den Ausbau des Motors wird ja nicht verhindert, dass man jederzeit einen anderen Motor einbauen, und den Wagen dadurch wieder fahrbereit machen könnte. Auch der Motor wird durch den Ausbau nicht in seinem Wesen verändert, da er hierdurch nicht seine Eignung als Antriebsquelle in einem Auto verliert. Die eventuelle Begründung von Sonderrechten (z.B. Eigentumsvorbehalt des Lieferanten) macht hier also einen Sinn.[19]
Der Lack des Fahrzeugs ist „wesentlicher“, also „sonderrechtsunfähiger“ Bestandteil, da er bei der Trennung zerstört würde. Die Begründung von Sonderrechten macht hier also keinen Sinn.
Bestandteile, die nach allgemeinem Sprachgebrauch „wesentliche“ Bestandteile sind, wie z.B. der Motor (da der Wagen ohne Motor schließlich nicht mehr fährt), sind nach juristischem Sprachgebrauch häufig „unwesentliche“, d.h. sonderrechtsfähige Bestandteile. Entscheidend ist, ob die Begründung von Sonderrechten einen Sinn machen würde.
16
Eine zusammengesetzte Sache ist eine einzige Sache im Rechtssinne. Konsequenz ist, dass nicht jeder Bestandteil im Falle einer Veräußerung einzeln übereignet werden muss (bei wesentlichen Bestandteilen wäre dies wegen § 93 auch gar nicht möglich), sondern dass die aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzte Sache durch ein einheitliches Übereignungsrechtsgeschäft übereignet wird.
Alle nicht wesentlichen Bestandteile, welche nicht Scheinbestandteile i.S.v. § 95 sind, sind einfache Bestandteile. Diese sind auch schon vor der Trennung sonderrechtsfähig.
So kann z.B. an dem serienmäßigen Motor eines Pkw (s.o.) ein Eigentumsvorbehalt bestehen. Bestehen keine Sonderrechte, so teilen auch die einfachen Bestandteile das Schicksal der Gesamtsache. Zu beachten ist aber, dass im Falle des Einbaus des Motors bei der Herstellung des KFZ der Hersteller gem. § 950 das Eigentum an der neu hergestellten Sache erwirbt.
b)Scheinbestandteile
17
Der Begriff des Scheinbestandteils nach § 95 setzt stets die Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück voraus. Eine bewegliche Sache kann danach zwar Scheinbestandteil eines Grundstücks sein, nicht aber Scheinbestandteil einer anderen beweglichen Sache. Ist also eine bewegliche Sache mit einer anderen beweglichen Sache nur vorübergehend verbunden, so ergibt sich schon aus der Verkehrsanschauung, dass sie damit nicht Bestandteil der anderen Sache wird.[20]
A ist Jura-Student. Seine Eltern schenken ihm zu Weihnachten ein in Geschenkpapier gut verpacktes JURIQ-Skript „Sachenrecht II“, worüber A sich sehr freut. Das Geschenkpapier ist schon nach der Verkehrsauffassung nicht Bestandteil des JURIQ-Skripts.
c)Zubehör
18
Auch bewegliche Sachen können Zubehör i.S.v. § 97 haben.
Die zu einem Auto gehörende Betriebsanleitung.
Nach der Auslegungsregel des § 311c ist auch das Zubehör einer beweglichen Sache im Zweifel mit verkauft. Im obigen Beispiel kann der Käufer des Autos im Zweifel auch ohne besondere Erwähnung im Kaufvertrag vom Verkäufer die Übereignung der Betriebsanleitung verlangen.
Was allerdings die sachenrechtliche Seite betrifft, so existiert bei den §§ 929 ff. eine dem nur für Grundstücke geltenden § 926 entsprechende Vorschrift nicht. Das Eigentum an der Betriebsanleitung muss daher nach §§ 929 ff. durch gesondertes Rechtsgeschäft übertragen werden. Dies kann aber auch konkludent dadurch geschehen, dass sich z.B. bei der Übergabe des Autos an den Käufer, die Betriebsanleitung im Handschuhfach befindet.
Anders als bei den Grundpfandrechten (Hypothek, Grundschuld, Rentenschuld) erstreckt sich das Pfandrecht an beweglichen Sachen (§§ 1204 ff.) nicht automatisch auf das Zubehör. Vielmehr ist hierfür eine gesonderte Verpfändung erforderlich, die aber bei gemeinsamer Übergabe vermutet wird.[21]
Nach § 1212 erstreckt sich das Pfandrecht automatisch nur auf die Erzeugnisse einer verpfändeten beweglichen Sache.
A verpfändet an B seine Hündin. Die Hündin wirft vier Welpen. Gem. § 1212 erstreckt sich das Pfandrecht an der Hündin auch auf die vier Welpen.
1. Teil Einleitung › A. Sachenrechtliche Grundbegriffe › III. Weitere rechtsrelevante Einteilungen
III.Weitere rechtsrelevante Einteilungen
19
Neben der wichtigen Einteilung der Sachen in Grundstücke und bewegliche Sachen, gibt es noch weitere rechtlich relevante Einteilungen.
1.Sachgesamtheit
20
Unter einer Sachgesamtheit versteht man eine Mehrzahl sachenrechtlich selbständiger Sachen, welche aufgrund ihres wirtschaftlichen Gesamtzwecks schuldrechtlich als Einheit behandelt werden können.[22]
Einrichtung einer Wohnung.
Sachgesamtheiten können Gegenstand eines einheitlichen schuldrechtlichen Rechtsgeschäfts sein. Auch ist eine Herausgabeklage unter einer einheitlichen Bezeichnung möglich. Sachenrechtlich, sowie in der Zwangsvollstreckung handelt es sich um gesondert zu behandelnde Sachen.[23]
2.Sacheinheit
21
Der Begriff der Sacheinheit darf nicht mit dem Begriff der Sachgesamtheit verwechselt werden.
Bei einer Sacheinheit handelt es sich nur um eine theoretische Mehrzahl von Einzelsachen, welche aber nach der Verkehrsanschauung als einheitliche Sache behandelt werden.
Ein Pfund Zucker in der Verpackung. Sache im Rechtssinne sind hier nicht die einzelnen Zuckerkörner, sondern die Packung Zucker.
3.Vertretbare Sachen
22
Vertretbare Sachen i.S.v. § 91 sind Sachen, welche im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen.
Bitte lesen Sie dazu §§ 607; 650 S. 3; 700!
Bargeld, Wertpapiere, Serienmöbel[24]
Eine Sache ist vertretbar, wenn sie sich von anderen Sachen der gleichen Art nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale abhebt und daher ohne weiteres austauschbar ist.[25] Nicht vertretbar sind solche Sachen, die auf die Wünsche des Erwerbers ausgerichtet sind und deshalb für den Unternehmer anderweitig schwer oder gar nicht abzusetzen sind.[26]
Grundstück, Eigentumswohnung, Einbauküche
Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen vertretbaren und nicht vertretbaren Sachen zeigt sich z.B. im Schadensrecht: Bei Beschädigung einer vertretbaren Sache kann nach § 249 Abs. 1 Naturalrestitution in Form der Übereignung einer anderen Sache dieser Art geleistet werden, bei nicht vertretbaren Sachen dagegen grundsätzlich nicht.[27]
4.Nutzungen
23
Nutzungen i.S.v. § 100 sind die Früchte (§ 99) und die Gebrauchsvorteile einer Sache.
Rechtliche Relevanz hat der Begriff der Nutzungen z.B. für das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, da der unrechtmäßige Besitzer i.d.R. gem. §§ 987, 990 verpflichtet ist, dem Eigentümer die Nutzungen herauszugeben.
Bei den Früchten unterscheidet § 99 zwischen unmittelbaren Sachfrüchten (§ 99 Abs. 1)
Der Bauer erntet – als Grundstückseigentümer – die Kartoffeln.
und mittelbaren Sachfrüchten (§ 99 Abs. 3 Alt. 1),
Mittelbare Sachfrüchte sind die Erträge, die eine Sache aufgrund eines Rechtsverhältnisses (z.B. aufgrund eines Pachtvertrags) gewährt.
Bauer B hat das Grundstück an P verpachtet und erhält von P die Pacht. Für B ist die Pacht Ertrag seines Grundstücks aufgrund eines Rechtsverhältnisses (hier Pachtvertrag mit P); daher für ihn mittelbare Sachfrucht.
Wenn Sie Ihrem Vermieter die Miete überweisen, sind die Zahlungseingänge auf dem Konto Ihres Vermieters für Ihn also „mittelbare Sachfrüchte“ und damit „Nutzungen“.[28]
sowie unmittelbaren Rechtsfrüchten (§ 99 Abs. 2)
Die vom Pächter geernteten Kartoffeln. Diese sind für den Pächter nicht Ertrag seines Grundstücks (das gehört dem Verpächter), sondern Ertrag seines Pachtrechts; daher für P unmittelbare Rechtsfrüchte.
und mittelbaren Rechtsfrüchten (§ 99 Abs. 3 Alt. 2).
Der Pächter unterverpachtet das Grundstück.
1. Teil Einleitung › A. Sachenrechtliche Grundbegriffe › IV. Verfügungsgeschäft
IV.Verfügungsgeschäft
24
Eine Verfügung ist ein Rechtsgeschäft, welches unmittelbar darauf gerichtet ist, ein bestehendes Recht zu übertragen, zu belasten, aufzuheben oder inhaltlich zu verändern.[29]
Die in dieser Definition enthaltenen Stichworte finden Sie – dort im Zusammenhang mit Grundstücken – in den §§ 873, 875, 877.
Kennzeichnend für das Verfügungsgeschäft ist die unmittelbare Einwirkung auf ein bestehendes Recht. Im Gegensatz dazu werden durch schuldrechtliche Verträge lediglich Verpflichtungen erzeugt, die, sofern sie auf eine Veränderung der Rechtslage an einer Sache (oder einem sonstigen Recht) abzielen, erst noch durch ein Verfügungsgeschäft vollzogen (d.h. erfüllt) werden müssen.
Verfügungsgeschäfte sind z.B. die Übereignung (§§ 873, 929 ff.) oder die Verpfändung einer Sache, die Belastung eines Grundstücks mit einer Hypothek (§§ 873, 1113 ff.) etc.
Verfügungen gibt es übrigens nicht nur im Sachenrecht. Auch die Abtretung einer Forderung durch Abtretungsvertrag nach § 398 ist eine Verfügung, nämlich die rechtsgeschäftliche Übertragung eines bestehenden Rechts.
Der Unterschied zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft führt uns zum nächsten Rechtsgrundsatz, nämlich dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip.