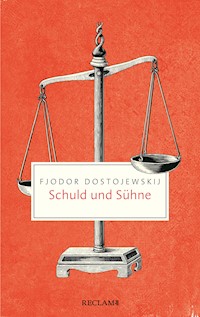14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fjodor M. Dostojewskij, Werkausgabe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Eine Stadt in Rußland wird von ›Bösen Geistern‹ heimgesucht, die ein Labyrinth aus Angst, Qual und Obsession errichten. Wie kein zweites Buch Dostojewskijs ist ›Böse Geister‹ ein Roman der Stimmen: Eine ganze Stadt spricht und entfaltet ihre Tragödie in Monologen und Dialogen, die wie Kraftfelder die Handlung vorantreiben. Und ganz nebenbei entsteht ein Handbuch von Mißbrauch und Perversion der Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1374
Ähnliche
Fjodor Dostojewskij
Böse Geister
Roman
Aus dem Russischen von Swetlana Geier
FISCHER E-Books
Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.
Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur.
Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.
Inhalt
Keine Wegspur, nichts zu sehen,
wissen wir noch, wo wir sind?
Böse Geister, scheint es, drehen
uns im Kreis, im Wirbelwind.
.............................
Und sie fliehen, und sie jagen,
hört ihr, wie sie kläglich schrein?
Wird ein Geist zu Grabe getragen?
Soll heut Hexenhochzeit sein?
A. S. Puschkin
Es war aber dort auf dem Berg eine große Herde Säue auf der Weide. Und sie baten ihn, daß er ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister von dem Menschen aus und fuhren in die Säue; und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und ersoff.
Als aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und den Dörfern. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig, und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war.
Lukas 8, 32–36
Erster Teil
Erstes Kapitel
Statt einer Einleitung: Einige Einzelheiten aus der Biographie des vielverehrten Stepan Trofimowitsch Werchowenskij
I
INDEM ich mich zu der Schilderung der so denkwürdigen Ereignisse anschicke, die sich kürzlich in unserer bisher durch nichts ausgezeichneten Stadt zugetragen haben, sehe ich mich in meiner Unerfahrenheit genötigt, ein wenig auszuholen und mit etlichen Einzelheiten aus der Biographie des talentvollen und vielverehrten Stepan Trofimowitsch Werchowenskij zu beginnen. Mögen diese Einzelheiten lediglich als Einleitung zu der vorliegenden Chronik dienen, die eigentliche Begebenheit nämlich, die ich zu schildern beabsichtige, steht noch bevor.
Ich sage es ohne Umschweife: Stepan Trofimowitsch hat bei uns stets eine ganz besondere, sozusagen öffentliche Rolle gespielt und diese Rolle nahezu leidenschaftlich geliebt – sogar so, daß er, wie mir scheint, ohne sie gar nicht hätte leben können. Nicht, daß ich ihn einem Schauspieler auf dem Theater gleichstellen möchte: Gott bewahre, um so weniger, da ich persönlich große Achtung für ihn hege. Dies alles mochte bei ihm eine Sache der Gewohnheit sein oder, besser gesagt, einer seit frühester Jugend bestehenden edlen Neigung zu angenehmen Träumen von einer schönen öffentlichen Pose. So liebte er zum Beispiel seine Lage eines »Verfolgten« und sozusagen »Verbannten«. Diese beiden Wörter umgibt eine Art klassischer Glorienschein, der ihn einmal für immer verführt hatte, der ihn allmählich in der Einschätzung seiner selbst erhöhte, viele Jahre hindurch, und ihn schließlich auf ein gewisses, ziemlich erhabenes und der Eigenliebe schmeichelndes Piedestal stellte. In einem satirischen englischen Roman aus dem vorigen Jahrhundert kehrte ein gewisser Gulliver aus dem Land der Liliputaner zurück, dessen Einwohner nur etwa zwei Werschok groß waren, und hatte sich so sehr daran gewöhnt, sich als Riese zu fühlen, daß er auch in den Straßen Londons unwillkürlich Fußgängern und Kutschen zurief, sie möchten ihm aus dem Wege gehen und sich in acht nehmen, damit er sie nicht unversehens zerquetsche, denn er hielt sich immer noch für einen Riesen und sie für winzig klein. Dafür wurde er ausgelacht, beschimpft, und grobe Kutscher schlugen sogar mit ihrer Peitsche nach dem Riesen; war das aber gerechtfertigt? Was tut nicht alles die Gewohnheit? Es war die Gewohnheit, die Stepan Trofimowitsch dazu gebracht hatte, sich fast ebenso zu benehmen, aber in einer noch unschuldigeren und argloseren Weise, weil er ein ganz wunderbarer Mensch war.
Ich glaube sogar, daß er zu guter Letzt und von allen vergessen worden ist; aber man kann nun keineswegs behaupten, daß er auch früher gänzlich unbekannt gewesen wäre. Unbestreitbar gehörte auch er eine Zeitlang zu der berühmten Plejade der gefeierten Männer unserer letzten Generation, und eine Zeitlang – freilich nur eine einzige allerkürzeste Minute lang – wurde sein Name von manchen voreiligen Zeitgenossen fast in einem Atemzug mit dem Tschaadajews, Belinskijs, Granowskijs und des damals gerade im Ausland aufsteigenden Herzen genannt. Aber das Wirken Stepan Trofimowitschs fand beinahe schon in demselben Augenblick ein Ende, in dem es begann – sozusagen in einem »Wirbelsturm zusammentreffender Umstände«.
Und was stellte sich heraus? Im nachhinein waren kein »Wirbelsturm«, sogar nicht einmal irgendwelche »Umstände« zu entdecken, wenigstens nicht in seinem Fall. Erst jetzt, in den letzten Tagen, habe ich zu meinem größten Erstaunen, jedoch absolut glaubwürdig erfahren, daß Stepan Trofimowitsch hier, in unserer Mitte, in unserm Gouvernement, nicht nur, wie allgemein angenommen, nicht in Verbannung, sondern sogar zu keinem Zeitpunkt unter polizeilicher Aufsicht gestanden hatte. Welche Macht der Einbildung! Er glaubte aufrichtig sein Leben lang, daß er in bestimmten Kreisen beständig für gefährlich gehalten, daß jeder seiner Schritte unablässig beobachtet und registriert werde und daß jeder der drei Gouverneure, die im Laufe der letzten zwei Dezennien bei uns einander ablösten, schon vor seiner Ankunft in unserem Gouvernement sich besorgt Gedanken über ihn gemacht hätte, auf höhere, bei der Amtsübergabe erteilte Weisung. Hätte damals jemand mit unumstößlichen Beweisen den trefflichen Stepan Trofimowitsch davon überzeugen wollen, daß er nicht das mindeste zu befürchten habe, so wäre er unbedingt gekränkt gewesen. Dabei war er wirklich ein außerordentlich kluger und begabter Mann, sogar ein Mann der Wissenschaft sozusagen, obwohl er übrigens in der Wissenschaft … Nun, in der Wissenschaft hatte er, kurz gesagt, nicht besonders viel oder, wie es scheint, gar nichts geleistet. Aber bei uns in Rußland ist das bei den Männern der Wissenschaft oft der Fall.
Er war aus dem Ausland zurückgekehrt und hatte als Lektor auf einem Universitätskatheder Ende der vierziger Jahre geglänzt. Es gelang ihm noch, einige Vorlesungen zu halten, ich glaube, über die Araber; es gelang ihm auch noch, eine brillante Dissertation zu verteidigen über die in der Zeit zwischen 1413 und 1428 sich gerade entwickelnde politische und hanseatische Bedeutung des deutschen Städtchens Hanau und zugleich über die speziellen und unklaren Gründe, weshalb diese Bedeutung ausblieb. Diese Dissertation versetzte den damaligen Slawophilen einige geschickte und schmerzhafte Seitenhiebe und verschaffte dem Verfasser in ihrem Lager zahlreiche grimmige Feinde. Dann – übrigens schon nach dem Verlust des Katheders – gelang es ihm, in einer progressiven Monatszeitschrift, die Dickens-Übersetzungen brachte und George Sand propagierte, den Anfang einer tiefschürfenden Studie zu veröffentlichen (sozusagen aus Rache und um zu zeigen, wen man verloren hatte), ich glaube, über die Ursachen des außerordentlichen Edelmutes und der Sittlichkeit irgendwelcher Ritter in irgendeiner Epoche oder etwas Ähnliches dieser Art. Jedenfalls wurde darin eine erhabene und ungewöhnlich edle Idee entwickelt. Später hieß es, die Fortsetzung dieser Studie wäre umgehend verboten und die progressive Zeitschrift sogar wegen der Veröffentlichung des ersten Teils zur Verantwortung gezogen worden. Das wäre durchaus möglich gewesen, denn was war damals nicht möglich? Aber in diesem Falle ist wahrscheinlich gar nichts geschehen, und der Verfasser selbst war zu bequem gewesen, seine Studie zu Ende zu führen. Und seine Vorlesung über die Araber hätte er nicht deshalb abgebrochen, weil irgend jemand (offenbar einer seiner reaktionären Gegner) irgendwann einen Brief von ihm an irgend jemand mit der Schilderung irgendwelcher »Umstände« abgefangen hätte, was dazu geführt haben soll, daß irgend jemand irgendwelche Richtigstellungen von ihm verlangte. Ich weiß nicht, ob es zutrifft, aber es wurde behauptet, daß zur selben Zeit in Petersburg eine riesige widernatürliche und staatsfeindliche Gesellschaft, aus etwa dreizehn Mitgliedern bestehend, aufgedeckt wurde, die das Gebäude beinahe zum Einsturz gebracht hätte. Man erzählt, sie hätten sogar beabsichtigt, Fourier zu übersetzen. Ausgerechnet zu dieser Zeit wurde in Moskau ein Poem von Stepan Trofimowitsch aufgegriffen, das er schon sechs Jahre zuvor in Berlin, in seiner frühen Jugend, verfaßt hatte und das nun als Abschrift zwischen zwei Liebhabern der Dichtkunst und einem Studenten kursierte. Dieses Poem liegt heute auch in meinem Schreibtisch; ich bekam es vor höchstens einem Jahr in einer eigenhändigen Abschrift neuesten Datums von Stepan Trofimowitsch überreicht, mit Widmung und in prachtvollem rotem Saffian-Einband. Es ist übrigens nicht unpoetisch und nicht unbegabt; es ist absonderlich, aber damals (das heißt in den dreißiger Jahren) wurde recht häufig in dieser Art gedichtet. Ich sehe mich kaum imstande, den Inhalt wiederzugeben, denn, um die Wahrheit zu sagen, ich verstehe es überhaupt nicht. Es ist eine Allegorie in lyrisch-dramatischer Form, die an den zweiten Teil des »Faust« erinnert. Die Handlung wird von einem Chor von Frauen eröffnet, ihm folgt ein Chor von Männern, darauf ein Chor irgendwelcher Kräfte und zum Schluß ein Chor von Seelen, die noch nicht gelebt haben, aber gar zu gern leben möchten. Alle diese Chöre singen etwas Unbestimmtes, meistens von einem Fluch, aber mit einer Nuance höheren Humors. Doch plötzlich verwandelt sich die Szene, es beginnt ein »Fest des Lebens«, auf dem sogar Insekten singen, eine Schildkröte mit irgendwelchen lateinischen sakramentalen Formeln auftritt und sogar, wenn ich mich recht erinnere, ein singendes Mineral, das heißt ein schon ganz und gar unbelebter Gegenstand. Überhaupt wird ununterbrochen gesungen, und wenn man sich unterhält, so streitet man irgendwie unbestimmt, jedoch wiederum mit einer Nuance höherer Bedeutung. Schließlich verwandelt sich die Bühne abermals und zeigt eine wilde Gegend, wo zwischen Felsen ein einsamer zivilisierter Jüngling wandelt, der irgendwelche Gräser pflückt, um an ihnen zu saugen; auf die Frage einer Fee, warum er an diesen Gräsern sauge, gibt er die Antwort, er suche, an des Lebens Überfülle leidend, Vergessen und finde es im Safte dieser Gräser; aber sein Hauptbegehren sei, so bald wie möglich sich des Verstandes zu entledigen (ein Begehren, das möglicherweise schon überholt ist). Plötzlich kommt ein Jüngling von unbeschreiblicher Schönheit auf einem Rappen hereingeritten. Ihm folgt die fürchterliche Menge sämtlicher Völker. Der Jüngling stellt den Tod vor, und alle Völker lechzen nach ihm. Schließlich, in der allerletzten Szene, erscheint der Babylonische Turm, irgendwelche Athleten führen ihn mit dem Lied einer neuen Hoffnung seiner Vollendung entgegen, und sobald die Spitze vollendet ist, ergreift der Herrscher, sagen wir, des Olymps als lächerliche Figur die Flucht, und die aufgeklärte Menschheit beginnt, nachdem sie sich seines Platzes bemächtigt hat, augenblicklich ein neues Leben mit einem neuen Wissen um die Dinge. Nun, und eben dieses Poem wurde damals als gefährlich befunden. Ich habe im vorigen Jahr Stepan Trofimowitsch vorgeschlagen, es zu veröffentlichen, da heutzutage niemand seine Harmlosigkeit in Frage stellen würde, aber er lehnte den Vorschlag sichtlich verstimmt ab. Meine Ansicht, die Harmlosigkeit seines Werkes sei unbezweifelbar, hatte ihm offenbar mißfallen, und diesem Umstand schreibe ich sogar jene Kühle zu, mit der er mich volle zwei Monate lang behandelte. Aber siehe da – plötzlich und fast zur selben Zeit, da ich ihm vorschlug, es hier zu drucken, wurde unser Poem dort gedruckt, das heißt im Ausland, in einer der revolutionären Anthologien, und zwar ohne Wissen und Zutun Stepan Trofimowitschs. Zuerst war er erschrocken, eilte zum Gouverneur und schrieb einen äußerst noblen Rechtfertigungsbrief nach Petersburg, den er mir zweimal laut vorlas, aber nicht abschickte, da er nicht wußte, an wen er ihn adressieren sollte. Kurz, er verbrachte einen ganzen Monat in hellster Aufregung; ich bin jedoch überzeugt, daß er in den geheimsten Winkeln seines Herzens sich außerordentlich geschmeichelt fühlte. Auch nachts konnte er sich von dem ihm zugestellten Exemplar der Anthologie nicht trennen, und am Tage versteckte er es unter der Matratze, weshalb er der Aufwartefrau verbot, sein Bett zu machen, und obwohl er täglich von irgendwoher irgendein Telegramm erwartete, blieb seine Miene hochmütig. Ein Telegramm traf nie ein. Damals söhnte er sich auch mit mir wieder aus, was von der außerordentlichen Güte seines sanften und nicht nachtragenden Herzens zeugte.
II
ICH will ja nicht sagen, daß er überhaupt gar nicht zu leiden gehabt hätte, ich bin jetzt nur endgültig davon überzeugt, daß er über seine Araber nach Belieben hätte weiterlesen können, wenn er nur die erforderlichen Richtigstellungen abgegeben hätte. Aber er war damals ambitioniert und beschloß allzu überstürzt, sich selber ein für allemal einzureden, daß seine Karriere durch den »Wirbelsturm der Umstände« endgültig zerstört sei. Wenn man jedoch die ganze Wahrheit sagen soll, so war der wirkliche Grund, der seine Karriere in eine andere Richtung lenkte, der frühere und nun wiederholte, ausnehmend zartfühlende Antrag Warwara Petrowna Stawroginas, der sehr vermögenden Gattin eines Generalleutnants, die Erziehung und die gesamte geistige Entwicklung ihres einzigen Sohnes in die Hand zu nehmen, als hoher Mentor und Freund, ganz zu schweigen von dem glänzenden Honorar. Dieser Antrag wurde ihm zum ersten Mal in Berlin gemacht, und zwar gerade zu der Zeit, als er zum ersten Mal Witwer geworden war. Seine erste Gattin war eine leichtsinnige junge Dame aus unserem Gouvernement gewesen, die er in seiner frühen gedankenlosen Jugend geheiratet hatte, worauf er mit dieser übrigens anziehenden Person viel Kummer ausstehen mußte, da seine Mittel zu ihrem Unterhalt nicht ausreichten, und auch noch aus anderen, zum Teil sehr delikaten Gründen. Sie verstarb in Paris, nachdem sie die letzten drei Jahre getrennt von ihm gelebt hatte, und hinterließ ihm einen fünfjährigen Sohn, »die Frucht der ersten frohen, noch ungetrübten Liebe«, wie Stepan Trofimowitsch einmal in meiner Gegenwart sagte, als er besonders melancholisch gestimmt war. Der Sprößling wurde sofort nach Rußland geschickt, wo er für die ganze Zeit der Obhut irgendwelcher entfernten Tanten tief in der Provinz anvertraut wurde. Stepan Trofimowitsch schlug damals Warwara Petrownas Antrag aus und heiratete sehr bald zum zweiten Mal, sogar vor Ablauf eines Jahres, eine Deutsche, eine sehr schweigsame kleine Berlinerin, und zwar, was die Hauptsache war, eigentlich ohne jede besondere Notwendigkeit. Aber außer diesem Grund gab es noch anderes, das ihn veranlaßt hatte, die Stellung eines Erziehers abzulehnen: Er ließ sich von dem weithin schallenden Ruhm eines unvergeßlichen Professors verlocken und schwang sich ebenfalls zum Katheder empor, für das er sich gerüstet hatte, um auch die eigenen Adlerfittiche zu erproben. Und nun, schon mit versengten Schwingen, erinnerte er sich natürlicherweise an den Antrag, der ihn auch schon früher in seinen Entschlüssen schwankend gemacht hatte. Der plötzliche Tod seiner zweiten Gattin, die kaum ein Jahr an seiner Seite gelebt hatte, gab den Ausschlag. Ich sage es ohne Umschweife: Das alles Entscheidende war die glühende Anteilnahme und die unschätzbare, sozusagen klassische Freundschaft Warwara Petrownas, wenn man für eine Freundschaft diesen Ausdruck gebrauchen darf. Er warf sich in die Arme dieser Freundschaft, und sie sollte mehr als zwanzig Jahre Bestand haben. Ich habe den Ausdruck »er warf sich in die Arme« gebraucht, aber Gott bewahre jedermann davor, etwas Ungehöriges oder Müßiges dabei zu denken; diese Arme sind lediglich im höchst moralischen Sinne zu verstehen. Das feinste und zarteste Band vereinte diese beiden so ausgezeichneten Wesen – für ewig.
Die Stelle des Erziehers wurde auch noch deshalb angenommen, weil das kleine Gut, das Stepan Trofimowitschs erste Frau hinterließ – ein sehr kleines Gut –, unmittelbar an Skworeschniki angrenzte, die prächtige Besitzung in Stadtnähe, die den Stawrogins in unserm Gouvernement gehörte. Außerdem eröffnete sich ihm nun die Möglichkeit, in der Stille einer Studierstube, nicht abgelenkt von den mannigfaltigen Aufgaben des Universitätslebens, sich ausschließlich der Wissenschaft zu widmen und die vaterländische Literatur durch profundeste Studien zu bereichern. Irgendwelche Studien kamen nicht zustande, dafür kam die Gelegenheit zustande, sein ganzes übriges Leben, das heißt mehr als zwanzig Jahre lang, als »Fleisch gewordener Vorwurf« vor dem Vaterlande dazustehen, entsprechend den Versen eines Dichters des Volkes:
Als Fleisch gewordener Vorwurf
…
Standest du vorm Vaterlande,
Ein Liberaler und Idealist.
Aber die Persönlichkeit, die von dem Dichter des Volkes geschildert wird, hat möglicherweise das Recht, zeitlebens in dieser Pose zu verharren, wenn sie nur Wert darauf legt, trotz der damit verbundenen Monotonie. Unser Stepan Trofimowitsch dagegen war, um bei der Wahrheit zu bleiben, nur ein Imitator solcher Persönlichkeiten, überdies ermüdete ihn das Stehen, und er legte sich so manchesmal auf die Bärenhaut. Gleichviel, auch auf der Bärenhaut blieb die Verkörperung des Vorwurfs unverändert – das muß gerechterweise gesagt werden, zumal es für die Provinz vollkommen genügte. Man hätte ihn bei uns im Club sehen sollen, wenn er sich an den Spieltisch setzte. Seine ganze Erscheinung sprach dann förmlich: »Karten! Ich setze mich mit euch zum Jeralasch! Ist denn das passend? Wer ist denn schuld daran? Wer hat mein Wirken jäh unterbrochen und es in einen Jeralasch verwandelt? Nun denn, mag also Rußland zugrunde gehen!« Und mit großartiger Geste spielte er Cœur aus.
In Wirklichkeit spielte er für sein Leben gern Karten, weswegen er besonders in der letzten Zeit immer häufiger unangenehme Scharmützel mit Warwara Petrowna zu bestehen hatte, zumal er ständig verlor. Aber davon später. Ich möchte nur noch hinzufügen, daß er sogar Gewissen hatte (das heißt manchmal) und deshalb oft trauriger Stimmung war. Im Verlauf der zwanzigjährigen Freundschaft mit Warwara Petrowna brach er regelmäßig drei- bis viermal jährlich unter, wie wir es nannten, »bürgerlichem Schmerz« zusammen, das heißt einfach, ihn befiel eine Hypochondrie, aber unser Ausdruck gefiel der hochgeschätzten Warwara Petrowna besser. Im Lauf der Zeit befiel ihn außer dem »bürgerlichen Schmerz« auch der Durst nach Champagner, aber die wachsame Warwara Petrowna behütete ihn sein ganzes Leben lang vor allen trivialen Neigungen. Und er war ja auch auf eine Kinderfrau angewiesen, da er sich mitunter sehr sonderbar benahm: Mitten im erhebendsten Weltschmerz brach er plötzlich in das profanste Gelächter aus, und es gab Augenblicke, in denen er sich sogar über sich selbst im humoristischen Sinn äußerte. Nichts aber fürchtete Warwara Petrowna mehr als humoristischen Sinn. Sie war eine Frau der Klassik, eine Frau des Mäzenatentums, die immer und ausschließlich nach höheren Gesichtspunkten handelte. Der zwanzig Jahre währende Einfluß dieser hohen Dame auf ihren armen Freund war kapital. Von ihr sollte gesondert berichtet werden, was ich auch tun will.
III
ES gibt sonderbare Freundschaften: zwei Freunde zerfleischen sich beinahe, ihr ganzes Leben lang, und sind dennoch außerstande, sich zu trennen. Eine Trennung ist sogar gänzlich unmöglich: Der Freund, der, dieser Verbindung überdrüssig, sie zerreißt, wird als erster krank werden und vielleicht sterben, wenn es so weit kommt. Ich weiß definitiv, daß Stepan Trofimowitsch mehrfach und gelegentlich nach vertraulichen Ergießungen unter vier Augen plötzlich, nachdem Warwara Petrowna gegangen war, vom Diwan aufgesprungen ist und mit den Fäusten gegen die Wand getrommelt hat.
Das geschah keineswegs allegorisch, sondern er hat einmal sogar den Putz von der Wand geschlagen. Vielleicht wird man fragen: Wie konnte ich eine solch heikle Einzelheit in Erfahrung bringen? Und wenn ich gelegentlich Augenzeuge gewesen wäre? Und wenn Stepan Trofimowitsch persönlich mehrfach an meiner Schulter geschluchzt und dabei in grellen Farben sein ganzes Innerstes vor mir ausgebreitet hätte? (Und was kam da nicht alles zur Sprache!) Aber fast immer geschah nach solchem Schluchzen folgendes: Am nächsten Tag war er bereit, sich wegen Undankbarkeit eigenhändig ans Kreuz zu schlagen; er ließ mich eilig holen oder kam höchstselbst zu mir gelaufen, einzig und allein um zu verkünden, daß Warwara Petrowna ein »Engel an Ehr- und Taktgefühl, er aber das absolute Gegenteil« sei. Und er kam nicht nur zu mir gelaufen, sondern richtete an sie selbst die beredtesten, mit vollem Namen unterzeichneten Briefe, in denen er dies alles schilderte und gestand, daß er erst gestern einer dritten Person erzählt hätte, sie halte ihn in ihrem Haus aus purem Ehrgeiz und neide ihm seine Bildung und seine Talente; sie hasse ihn und vermeide es, ihren Haß offen zu zeigen, lediglich aus Furcht, er könne sie verlassen und dadurch ihren Ruf als Mäzenatin ruinieren; infolgedessen verachte er sich selbst und habe sich entschlossen, freiwillig aus dem Leben zu gehen, erwarte aber von ihr das letzte Wort, das alles entscheiden werde, und so fort und so fort, alles in dieser Art. Man kann sich vorstellen, in welcher Hysterie die nervösen Zustände dieses unschuldigsten aller fünfzigjährigen Säuglinge gipfelten! Ich habe einmal einen dieser Briefe nach einem Streit zwischen ihnen aus nichtigem Anlaß, aber mit giftigen Folgen, selbst gelesen. Ich war entsetzt und beschwor ihn, die Briefe nicht abzuschicken.
»Unmöglich … So ist es ehrlicher … Meine Pflicht … Ich sterbe, wenn ich ihr nicht alles, alles gestehe!« antwortete er fast wie im Fieber und schickte den Brief unbeirrt ab.
Gerade darin bestand der Unterschied zwischen den beiden, daß Warwara Petrowna niemals einen solchen Brief abgeschickt hätte. Freilich, er schrieb für sein Leben gern, er schrieb an sie sogar, als beide im selben Haus wohnten, und in hysterischen Zuständen zweimal täglich. Ich weiß ganz sicher, daß sie diese Briefe sehr aufmerksam las, sogar dann, wenn sie zwei an einem Tag erhielt, und sie nach der Lektüre numeriert und geordnet in einer besonderen Schatulle ablegte; außerdem bewahrte Warwara Petrowna sie in ihrem Herzen. Darauf, nachdem sie ihren Freund einen ganzen Tag auf Antwort hatte warten lassen, begegnete sie ihm, als wäre nichts geschehen, als wäre gestern nichts Besonderes vorgefallen. Nach und nach hatte sie ihn so abgerichtet, daß er nicht mehr an dieses Gestern zu erinnern wagte und eine Weile lang nur in ihren Augen zu lesen suchte. Aber sie vergaß nie etwas, wohingegen er manchmal gar zu schnell vergaß und, durch ihre Ruhe ermutigt, gelegentlich noch am selben Tag wieder lachen und sich beim Champagner wie ein Schuljunge amüsieren konnte, wenn seine Freunde ihn besuchten. Wie giftig muß sie ihn in solchen Augenblicken angesehen haben, während ihm überhaupt nichts auffiel! Wenn er allerdings eine Woche, einen Monat oder sogar ein halbes Jahr später in einem besonderen Augenblick sich zufällig an eine bestimmte Wendung aus einem solchen Brief und dann an den ganzen Brief und sämtliche Begleitumstände erinnerte, verging er plötzlich vor Scham und quälte sich so sehr, daß er einen seiner Anfälle bekam. Diese eigentümlichen, der Cholerine ähnlichen Anfälle waren dann und wann die übliche Folge der Erschütterung seiner Nerven und stellten eine Art besonderes Curiosum seiner Konstitution dar.
In der Tat, Warwara Petrowna hat ihn ganz gewiß, und zwar sehr oft, gehaßt, aber er hat bis zum Schluß eines an ihr nicht erkannt, nämlich daß er schließlich für sie ihr Sohn, ihr Geschöpf, ja man kann sogar sagen ihre Erfindung, Fleisch von ihrem Fleisch geworden war und daß sie ihn keineswegs bloß »aus Neid auf seine Talente« in ihrem Hause hielt. Wie sehr müssen derlei Verdächtigungen sie verletzt haben! In ihr lebte eine geheime, unbezwingliche Liebe zu ihm, inmitten von anhaltendem Haß, Eifersucht und Verachtung. Sie schützte ihn vor dem kleinsten Stäubchen, hegte und pflegte ihn zweiundzwanzig Jahre lang und hätte nächtelang kein Auge zugetan, wenn es um seinen Ruf als Dichter, Gelehrter und Mann des öffentlichen Lebens gegangen wäre. Sie hatte ihn sich ausgedacht und war die erste, die an ihr eigenes Phantasiegebilde glaubte. Er war für sie so etwas wie ihr eigener Traum … Aber sie forderte dafür von ihm wirklich sehr viel, manchmal sogar sklavischen Gehorsam. Nachtragend war sie über alle Maßen! Dazu erzähle ich am besten zwei Geschichten.
IV
EINES Tages, noch zu jener Zeit, als die ersten Gerüchte von der Aufhebung der Leibeigenschaft aufkamen, als ganz Rußland plötzlich jubelte und sich zu einer vollständigen Wiedergeburt bereitete, stattete ein Petersburger Baron, ein Mann mit höchsten Verbindungen und bedeutendem Einfluß auf die zu erwartenden Geschehnisse, Warwara Petrowna auf der Durchreise einen Besuch ab. Warwara Petrowna legte größten Wert auf solche Besuche, denn ihre Verbindungen zu der höchsten Gesellschaft lockerten sich nach dem Tod ihres Gatten immer mehr, bis sie schließlich völlig abrissen. Der Baron blieb eine Stunde und nahm den Tee bei ihr ein. Sonst war niemand zugegen, aber Stepan Trofimowitsch wurde von Warwara Petrowna ausdrücklich eingeladen und präsentiert. Der Baron hatte sogar von ihm gehört oder tat wenigstens, als hätte er von ihm gehört, sprach ihn allerdings beim Tee nur selten an. Selbstverständlich machte Stepan Trofimowitsch überall eine gute Figur, und seine Manieren waren vorzüglich. Obwohl er, wie ich glaube, aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammte, war er von frühester Kindheit an in einem vornehmen Moskauer Hause aufgewachsen, also anständig erzogen worden; Französisch sprach er wie ein Pariser. Auf diese Weise sollte der Baron auf den ersten Blick erkennen, welche Menschen zu Warwara Petrownas Umgebung gehörten, auch in der Abgeschiedenheit der Provinz. Aber es sollte anders kommen. Als der Baron die damals kursierenden ersten Gerüchte von der großen Reform ausdrücklich und uneingeschränkt bestätigte, hielt Stepan Trofimowitsch nicht länger an sich, rief »Hurra!« und machte sogar mit der Hand eine Geste, die Begeisterung ausdrücken sollte. Er rief es nicht laut, und es klang sogar elegant; seine Begeisterung mochte sogar vorsätzlich gewesen sein und seine Geste wohlüberlegt und eine halbe Stunde vor dem Tee vor dem Spiegel einstudiert, aber offenbar war ihm dabei irgend etwas mißglückt, so daß der Baron sich ein kaum, kaum merkliches Lächeln erlaubte, wenn er auch sofort überaus höflich eine Phrase über die erklärliche allgemeine Rührung sämtlicher russischer Herzen angesichts der großen Ereignisse einflocht. Bald darauf empfahl er sich und versäumte nicht, beim Abschied auch Stepan Trofimowitsch zwei Finger entgegenzustrecken. Als Warwara Petrowna in den Salon zurückkehrte, schwieg sie zunächst gute drei Minuten und tat so, als ob sie etwas auf dem Tisch suchte; aber plötzlich wandte sie sich, blaß, mit funkelnden Augen, Stepan Trofimowitsch zu und stieß flüsternd hervor: »Das werde ich Ihnen nie vergessen!«
Am nächsten Tag begegnete sie ihrem Freund, als wäre nichts geschehen; auf das Vorgefallene kam sie nie mehr zu sprechen. Aber dreizehn Jahre später, in einem tragischen Augenblick, sprach sie davon, warf es ihm vor und wurde ebenso bleich wie vor dreizehn Jahren, als sie es ihm zum ersten Mal vorgeworfen hatte. Nur zweimal in ihrem ganzen Leben hat sie zu ihm gesagt: »Das werde ich Ihnen nie vergessen!« Die Geschichte mit dem Baron war schon die zweite Geschichte. Aber auch die erste Geschichte war in ihrer Art so charakteristisch und, wie ich glaube, für das Schicksal Stepan Trofimowitschs so bedeutsam, daß ich mich entschließe, auch sie zu erwähnen.
Es war im Frühling 1855, im Monat Mai, unmittelbar nachdem in Skworeschniki die Nachricht vom Ableben des Generalleutnants Stawrogin eingetroffen war, eines lebenslustigen alten Herrn, der auf der Reise nach der Krim, wo er ein Kommando bei der aktiven Armee übernehmen sollte, an einem Magenleiden verschieden war. Warwara Petrowna war also nun Witwe und legte tiefe Trauer an. Freilich, ihr Schmerz dürfte nicht besonders groß gewesen sein, denn die letzten vier Jahre hatte sie von ihrem Gatten wegen unüberbrückbarer charakterlicher Verschiedenheit gänzlich getrennt gelebt und hatte ihm eine Apanage ausgesetzt. (Der Generalleutnant besaß ganze hundertfünfzig Seelen und sein Gehalt, außerdem einen angesehenen Namen und Verbindungen, das große Vermögen jedoch und Skworeschniki gehörten Warwara Petrowna, der einzigen Tochter eines reichen Branntweinpächters.) Nichtsdestotrotz erschütterte sie die plötzliche Nachricht, und sie zog sich in völlige Einsamkeit zurück. Selbstverständlich wich Stepan Trofimowitsch nicht von ihrer Seite.
Der Mai stand in vollster Blüte, die Abende waren wunderbar. Der Faulbaum blühte. Die beiden Freunde trafen sich allabendlich im Garten und saßen bis in die Nacht hinein in der Laube, wobei sie ihre Gedanken und Empfindungen voreinander ausbreiteten. Es gab poetische Minuten. Warwara Petrowna, noch ganz unter dem Eindruck der Veränderung in ihrem Schicksal, war gesprächiger als gewöhnlich. Sie schmiegte sich gleichsam an das Herz des Freundes, und dies setzte sich mehrere Abende fort. Plötzlich stieg Stepan Trofimowitsch ein seltsamer Gedanke auf: “Sollte nicht die untröstliche Witwe Absichten auf ihn haben und gar nach Ablauf des Trauerjahres einen Heiratsantrag von ihm erwarten?” Ein zynischer Einfall, aber eine hochgeistige Organisation begünstigt gelegentlich sogar die Neigung zu zynischen Einfällen, allein schon dank ihrer vielseitigen Entwicklung. Er begann zu überlegen und fand, daß es ganz danach aussah. Er wurde nachdenklich: “Das Vermögen ist riesig, das stimmt, aber …” In der Tat, Warwara Petrowna war alles andere als eine Schönheit. Sie war eine große, gelbe, knochige Frau mit einem unmäßig langen Gesicht, das etwas von einem Pferdekopf an sich hatte. Stepan Trofimowitsch geriet zunehmend ins Schwanken, quälte sich, zweifelte und brach in seiner Unentschlossenheit sogar ein paarmal in Tränen aus, er weinte ziemlich oft. Abends aber, daß heißt in der Laube, nahm sein Gesicht unwillkürlich einen kapriziösen und mokanten, einen koketten und gleichzeitig hochmütigen Ausdruck an. Dergleichen geschieht unabsichtlich, unwillkürlich und sogar um so eher, je edler der Mensch ist. Gott allein mag wissen, was man davon denken soll, aber wahrscheinlich hat sich in Warwara Petrownas Herzen überhaupt nichts geregt, was Stepan Trofimowitschs Vermutungen hätte rechtfertigen können. Jedenfalls hätte sie niemals den Namen Stawrogina mit dem seinigen, wenn auch noch so illustren, vertauschen wollen. Vielleicht war es nur ein weibliches Spiel, die Äußerung eines unbewußten weiblichen Bedürfnisses, das bei einem ausgefallenen weiblichen Charakter völlig natürlich ist. Übrigens möchte ich mich dafür nicht verbürgen: Die Tiefe des weiblichen Herzens ist unerforschlich, sogar noch heute. Aber ich fahre fort.
Es ist anzunehmen, daß sie im stillen das merkwürdige, eigentümliche Mienenspiel ihres Freundes alsbald durchschaute; sie war feinfühlig und hatte ein scharfes Auge, er hingegen war manchmal allzu naiv. Aber die Abende wurden fortgesetzt, und die Gespräche blieben poetisch und interessant. Einmal jedoch, bei Anbruch der Nacht, nach einem besonders angeregten und poetischen Gespräch, schieden sie freundschaftlich mit einem heißen Händedruck voneinander an der Treppe des kleinen Hauses, das Stepan Trofimowitsch bewohnte. Jeden Sommer siedelte er aus dem riesigen Herrenhaus von Skworeschniki in dieses kleine Nebengebäude über, das fast mitten im Garten stand. Kaum war er in seinem Zimmer, kaum war er dort gedankenverloren, eine Zigarre noch nicht angesteckt, an das offene Fenster getreten, um sich reglos, müde, wie er war, dem Anblick der flaumenleichten weißen Wölkchen hinzugeben, die an der klaren Mondsichel vorbeizogen, als ein leises Geräusch ihn plötzlich zusammenfahren und sich umdrehen ließ. Warwara Petrowna, die er erst vor vier Minuten verlassen hatte, stand wieder vor ihm. Ihr gelbes Gesicht war beinahe blau, die Lippen waren aufeinandergepreßt, die Mundwinkel zuckten. Gute zehn Sekunden lang sah sie ihm schweigend mit einem festen, unerbittlichen Blick in die Augen und flüsterte plötzlich atemlos:
»Nie werde ich Ihnen das vergessen!«
Als Stepan Trofimowitsch mir zehn Jahre später diese traurige Geschichte erzählte, flüsternd, nachdem er zuvor die Tür geschlossen hatte, versicherte er mir hoch und heilig, er sei damals so versteinert gewesen, daß er weder gehört noch gesehen habe, wie Warwara Petrowna wieder verschwunden sei. Und da sie auch später kein einziges Mal auf das Geschehene anspielte und alles seinen gewohnten Gang ging, neigte er zeit seines Lebens zu der Annahme, daß alles nur eine Halluzination vor seiner Krankheit gewesen sei, um so mehr, als er tatsächlich noch in derselben Nacht erkrankte und ganze zwei Wochen darniederlag, was übrigens den Rendezvous in der Laube ein Ende machte.
Aber ungeachtet seines Wunschtraums von einer Halluzination erwartete er gleichsam täglich, sein ganzes Leben lang, eine Fortsetzung und sozusagen Auflösung jenes Vorfalls. Er glaubte nicht, daß es damit sein Bewenden haben sollte! Aber wenn dem so war, welch seltsame Blicke muß er dann zuweilen seiner Freundin zugeworfen haben.
V
SIE hatte sich sogar ein Kostüm für ihn ausgedacht, das er von da an zeit seines Lebens trug. Das Kostüm war elegant und charakteristisch: Langschößiger schwarzer Überrock, fast bis oben zugeknöpft, aber von vorzüglichem Schnitt, weicher Hut (im Sommer aus Stroh) mit breiter Krempe; weiße Halsbinde aus Batist, zu einem großen Knoten mit wehenden Enden geschlungen; Spazierstock mit silbernem Knauf, dazu schulterlanges Haar. Er war dunkelblond, und erst in letzter Zeit begann sein Haar leicht zu ergrauen. Er trug weder Bart noch Schnurrbart. Man sagt, in seiner Jugend sei er ein außerordentlich schöner Mann gewesen. Meiner Meinung nach war er auch im Alter eine ungewöhnlich eindrucksvolle Erscheinung. Und wie konnte man bei dreiundfünfzig Jahren von Alter reden!? Aber aus einer gewissen öffentlichen Koketterie gab er sich nicht nur nicht jünger, sondern schien sich mit der Solidität seines Alters zu brüsten und erinnerte in seinem Kostüm, großgewachsen, schlank, mit fast bis auf die Schultern wallendem Haar, an einen Patriarchen oder an das Portrait des Dichters Kukolnik auf einer Lithographie in der Ausgabe aus den dreißiger Jahren, besonders, wenn er im Sommer auf einer Gartenbank saß, unter einem blühenden Fliederbusch, beide Hände auf den Stockknauf gestützt, ein aufgeschlagenes Buch neben sich und in poetischer Betrachtung des Sonnenuntergangs versunken. Was die Bücher angeht, so muß ich anmerken, daß er in der letzten Zeit sich immer weniger der Lektüre widmete. Freilich war das erst kurz vor seinem Ende. Zeitungen und Zeitschriften, die Warwara Petrowna in Mengen abonniert hatte, las er beständig. Ebenso beständig interessierte er sich für die Erfolge der russischen Literatur, allerdings ohne dabei seiner Würde auch nur das mindeste zu vergeben. Eine Zeitlang stürzte er sich in das Studium unserer inneren und äußeren höheren Tagespolitik, gab es jedoch alsbald achselzuckend wieder auf. Gelegentlich kam es vor, daß er Tocqueville mit in den Garten nahm und in der Tasche heimlich Paul de Kock stecken hatte. Aber das sind ja Bagatellen.
En parenthèse möchte ich auch zu dem Portrait von Kukolnik etwas bemerken: Dieses Bild war Warwara Petrowna zum ersten Mal in die Hände gefallen, als sie, noch ein Mädchen, sich in einem vornehmen Moskauer Pensionat befand. Sie verliebte sich auf der Stelle in dieses Portrait, ganz nach der Gewohnheit aller jüngeren Damen im Pensionat, die sich in alles auf der Welt verliebten, unter anderem auch in ihre Lehrer, besonders, wenn diese Kalligraphie und Zeichnen unterrichteten. Beachtenswert jedoch sind nicht die Gewohnheiten dieses jungen Mädchens, sondern der Umstand, daß Warwara Petrowna sogar noch mit fünfzig Jahren dieses Bildchen unter ihren intimsten Schätzen aufbewahrte und vielleicht nur aus diesem Grunde für Stepan Trofimowitsch sich ein Kostüm ausgedacht hatte, das mit dem auf dem Portrait abgebildeten eine gewisse Ähnlichkeit aufwies. Aber auch dies ist natürlich eine Bagatelle.
In den ersten Jahren, genauer gesagt, in der ersten Hälfte seines Aufenthaltes bei Warwara Petrowna, trug sich Stepan Trofimowitsch noch immer mit dem Gedanken an ein größeres Werk und nahm sich Tag für Tag ernstlich vor, mit der Niederschrift zu beginnen. In der zweiten Hälfte jedoch muß er wohl völlig aus der Übung gekommen sein. Immer häufiger sagte er uns: »Man sollte meinen, daß ich für die Arbeit gerüstet sei, das Material ist zusammengetragen, aber es geht nicht! Es kommt nichts zustande!« und ließ trübselig den Kopf hängen. Zweifellos mußte gerade dieser Umstand ihn in unseren Augen noch weit mehr als einen Märtyrer der Wissenschaft glorifizieren, er selbst aber lechzte nach anderem. »Sie haben mich vergessen, niemand braucht mich!« entschlüpfte es ihm wiederholt. Diese zunehmende Hypochondrie erreichte ihren Höhepunkt am Ende der fünfziger Jahre. Warwara Petrowna begriff schließlich, daß die Lage ernst war. Zumal der Gedanke, ihr Freund sei vergessen und werde von keinem gebraucht, ihr völlig unerträglich war. Zu seiner Zerstreuung und auch, um seinen Ruhm wieder aufzufrischen, brachte sie ihn nach Moskau, wo sie einige feinsinnige Bekanntschaften aus der Welt der Literatur und Wissenschaft unterhielt, aber es erwies sich, daß auch Moskau nicht zufriedenstellend war.
Es war damals eine ganz besondere Zeit; etwas Neues kündigte sich an, etwas, das der vorhergegangenen Stille gar zu unähnlich war, etwas gar zu Seltsames, jedoch überall, sogar in Skworeschniki Spürbares. Gerüchte kamen auf. Die Tatsachen waren im allgemeinen mehr oder minder bekannt, aber es war offenkundig, daß außer den Tatsachen gewisse sie begleitende Ideen aufgetaucht waren, und zwar, was das Wichtigste war, unzählbar viele: Es war schlechthin unmöglich, sich unter ihnen zurechtzufinden und sich darüber klar zu werden, was diese Ideen eigentlich zu bedeuten hatten. Warwara Petrowna wollte, dem Gesetz der weiblichen Natur folgend, dahinter unbedingt ein Geheimnis vermuten. Schon schickte sie sich an, Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, verbotene, im Ausland gedruckte Bücher und sogar die damals aufkommenden Proklamationen (das alles wurde ihr zugesandt), aber das machte sie nur schwindlig. Sie schickte sich an, Briefe zu schreiben: Diese wurden selten und je weiter die Zeit fortschritt, desto unverständlicher beantwortet. Stepan Trofimowitsch wurde aufgefordert, ihr »alle diese Ideen« einmal und für immer zu erklären. Aber mit seinen Erklärungen war sie entschieden unzufrieden. Stepan Trofimowitschs Ansicht über die allgemeine Bewegung war im höchsten Grade überheblich; bei ihm lief alles darauf hinaus, daß er vergessen sei und keiner ihn brauche. Da geschah es, daß man sich endlich auch seiner erinnerte, anfangs in ausländischen Publikationen als eines verbannten Märtyrers und dann, unmittelbar darauf, in Petersburg, als eines ehemaligen Sterns in einem bekannten Sternbild; man verglich ihn sogar aus irgendeinem Grunde mit Radischtschew. Anschließend schrieb jemand, er sei inzwischen gestorben, und kündigte einen Nekrolog an. Stepan Trofimowitsch erwachte augenblicklich wieder zum Leben und nahm eine außerordentlich würdevolle Haltung an. Seine überheblichen Ansichten über seine Zeitgenossen waren wie weggeblasen, und er hatte den einzigen glühenden Wunsch: der Bewegung sich anzuschließen und seine Kräfte zu beweisen. Warwara Petrowna glaubte von neuem und an alles und entwickelte eine ungeheure Geschäftigkeit. Es wurde beschlossen, unverzüglich nach Petersburg zu reisen, alles an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen, alles persönlich abzuwägen und nach Möglichkeit sich der neuen Aufgabe zu widmen, ausschließlich und ungeteilt. Unter anderem erklärte sie sich bereit, ein eigenes Journal zu gründen und ihm von Stund an ihr ganzes Leben zu weihen. Sobald Stepan Trofimowitsch hörte, daß es soweit war, verhielt er sich noch hochmütiger und begann, Warwara Petrowna auf der Reise beinahe herablassend zu behandeln – was sie sofort in ihrem Herzen verschloß und bewahrte. Im übrigen hatte sie noch einen weiteren, sehr wichtigen Grund zu dieser Reise, nämlich die Wiederbelebung ihrer höheren Verbindungen. Sie beabsichtigte, sich in der großen Welt nach Möglichkeit in Erinnerung zu bringen, wenigstens es zu versuchen. Als offizieller Anlaß dieser Reise wurde das Wiedersehen mit ihrem einzigen Sohn angegeben, dessen Studien am Lyzeum in Petersburg sich gerade damals dem Ende zuneigten.
VI
SIE reisten also nach Petersburg und verbrachten dort fast die ganze Wintersaison. Aber zu den Großen Fasten platzte alles wie eine regenbogenfarbene Seifenblase. Die Träume verflogen, und der Wirrwarr ließ sich nicht nur nicht durchschauen, sondern wurde noch widerwärtiger. Erstens: Höhere Verbindungen kamen nicht zustande, höchstens in mikroskopischem Ausmaß und unter demütigenden Anstrengungen. Tiefgekränkt stürzte sich Warwara Petrowna als nächstes in die »neuen Ideen« und öffnete ihnen ihr Haus. Sie rief Literaten, und solche wurden ihr umgehend und in großer Zahl zugeführt. Späterhin kamen sie von selbst, auch ungeladen; einer brachte den anderen mit. Noch nie hatte sie solche Literaten gesehen. Sie waren unglaublich eitel, und sie waren es so unverblümt, als genügten sie damit einer Pflicht. Manche (wenn auch längst nicht alle) kamen sogar in betrunkenem Zustand, schienen aber darin einen besonderen, erst gestern entdeckten Reiz zu finden. Alle waren bis zur Absonderlichkeit eingebildet. Auf allen Gesichtern stand geschrieben, daß sie soeben einem außerordentlich wichtigen Geheimnis auf den Grund gekommen seien. Sie beschimpften einander und rechneten sich dies zur Ehre an. Es war schwierig, in Erfahrung zu bringen, was sie eigentlich geschrieben hatten; aber es gab hier Literaturkritiker, Romanschriftsteller, Dramatiker, Satiriker, kritische Publizisten. Stepan Trofimowitsch drang sogar bis in ihren allerhöchsten Kreis vor, dorthin, von wo aus die Bewegung gelenkt wurde. Der Weg zu diesen Lenkern war unwahrscheinlich steil, aber sie nahmen ihn mit offenen Armen auf, obwohl natürlich keiner von ihnen je etwas von ihm gehört hatte und auch nichts von ihm wußte, außer, daß er »die Idee vertritt«. Er hat mit solchem Geschick manövriert, daß er selbst diese bewog, ein paarmal in Warwara Petrownas Salon zu erscheinen, ungeachtet ihrer olympischen Hoheit. Es waren sehr ernsthafte und höfliche Männer, ihr Benehmen war tadellos, die anderen hatten sichtlich Respekt vor ihnen. Aber es war nicht zu übersehen, daß sie keine Zeit hatten. Es tauchten auch zwei oder drei literarische Zelebritäten von früher auf, die gerade in Petersburg weilten und mit denen Warwara Petrowna schon seit langem die feinsinnigsten Beziehungen unterhielt. Aber zu ihrem Erstaunen blieben die wirklichen und unbezweifelten Zelebritäten mäuschenstill, und manche von ihnen liebäugelten mit diesem ganzen neuen Gesindel und buhlten schmählich um seine Gunst. Zunächst hatte Stepan Trofimowitsch Glück; man hieß ihn emphatisch willkommen und stellte ihn bei öffentlichen literarischen Veranstaltungen zur Schau. Als er zum ersten Mal auf die Bühne trat, als einer der Vortragenden, bei einem öffentlichen Leseabend, begrüßte ihn rasender Beifall, der ungefähr fünf Minuten anhielt. Mit Tränen in den Augen erinnerte er sich daran neun Jahre später – übrigens eher aus künstlerischer Empfänglichkeit als aus Dankbarkeit. »Ich schwöre und möchte wetten«, sagte er zu mir (aber nur zu mir und streng vertraulich), »daß in diesem ganzen Publikum kein einziger Mensch von mir auch nur das Geringste wußte!« Das ist ein bemerkenswertes Geständnis: Er war also doch ein kluger Kopf, wenn er sogleich, auf der Bühne, trotz des Freudenrausches seine Lage so klar erkannte. Und andererseits war er doch kein kluger Kopf, wenn er sogar ganze neun Jahre später sich nicht ohne ein Gefühl der Kränkung daran erinnerte. Man nötigte ihn, zwei oder drei Kollektivproteste zu unterzeichnen (wogegen, wußte er nicht); er unterzeichnete. Warwara Petrowna wurde ebenfalls genötigt, gegen irgendein »schändliches Verhalten« zu protestieren, und unterzeichnete ebenfalls. Übrigens hielten die meisten dieser neuen Menschen, auch wenn sie Warwara Petrowna regelmäßig besuchten, sich aus irgendeinem Grunde für verpflichtet, sie von oben herab, mit Geringschätzung und unverhohlenem Spott zu behandeln. Später ließ Stepan Trofimowitsch in mancher bitteren Minute durchblicken, daß sie damals angefangen habe, ihn zu beneiden. Sie sah natürlich ein, daß diese Menschen kein Umgang für sie waren, aber dennoch blieb sie unersättlich, empfing sie mit der ganzen weiblichen hysterischen Ungeduld und (das war die Hauptsache) wartete unablässig auf irgend etwas! An ihren Abenden sprach sie wenig, obwohl sie durchaus in der Lage war mitzureden; aber sie hörte lieber zu. Man unterhielt sich über die Abschaffung der Zensur und des Harten Zeichens, über das Ersetzen des russischen Alphabets durch das lateinische, über die tags zuvor erfolgte Verbannung von Sowieso, über den in der Passage vorgefallenen Skandal, über die Zweckmäßigkeit einer Aufteilung Rußlands in nationale Einheiten in freier föderativer Verbindung, über den Abbau von Armee und Flotte, über die Wiederherstellung Polens bis zum Dnjepr, über die Landreform und die Proklamationen, über die Abschaffung von Erbrecht, Familie, Kindern und Geistlichen, über die Rechte der Frau, über das Haus des Herrn Krajewskij, das niemand dem Herrn Krajewskij je verzeihen wollte, und so weiter und so weiter. Es war klar, daß in diesem Kunterbunt von neuen Menschen mancher Schwindler zu finden war, aber zweifellos auch viele ehrliche, sogar außerordentlich anziehende Persönlichkeiten, trotz mancher immerhin befremdlichen Züge. Die Ehrlichen waren wesentlich unverständlicher als die Unehrlichen und Plumpen; aber es war keineswegs zu erkennen, wer wen in der Hand hatte. Als Warwara Petrowna ihren Gedanken von der Gründung einer Zeitschrift bekanntgegeben hatte, strömte noch mehr Volk herbei, aber zugleich regnete es unverblümte Vorwürfe, sie sei eine Kapitalistin und beute fremde Arbeit aus. Diese Vorwürfe waren ebenso unverfroren wie unerwartet. Der bejahrte General Iwan Iwanowitsch Drosdow, ein alter Freund und Waffenbruder des verstorbenen Generals Stawrogin, eine höchst ehrwürdige Persönlichkeit (natürlich in ihrer Art) und bei uns allgemein bekannt als äußerst starrsinnig und reizbar, gewaltiger Esser und geschworener Feind des Atheismus, geriet an einem der Abende Warwara Petrownas mit einem berühmten jungen Mann aneinander. Der sagte gleich anfangs: »Wenn Sie so reden, dann sind Sie ein General«, was heißen sollte, daß er kein ärgeres Schimpfwort kannte als »General«. Iwan Iwanowitsch brauste fürchterlich auf: »Jawohl, mein Herr, ich bin General, Generalleutnant, und habe meinem Zaren gedient, und du, mein Herr, du bist ein grüner Junge und ein Atheist!« Es kam zu einem ganz und gar unmöglichen Skandal. Am nächsten Tag wurde dieser Vorfall in der Presse angeprangert, und man begann, Unterschriften für einen Kollektivprotest gegen das »schändliche Verhalten« Warwara Petrownas zu sammeln, die sich geweigert hatte, dem General auf der Stelle die Tür zu weisen. Ein illustriertes Journal brachte eine bissige Karikatur, die Warwara Petrowna, den General und Stepan Trofimowitsch als reaktionäres Freundestrio darstellte; der Zeichnung waren auch Verse beigefügt, die ein volksnaher Dichter aus diesem Anlaß verfaßt hatte. Meinerseits sei angemerkt, daß tatsächlich viele Personen im Generalsrang die komische Redensart im Munde führen: »Ich habe meinem Zaren gedient …«, als hätten sie nicht denselben Zaren wie auch wir, des Zaren gewöhnliche Untertanen, sondern einen ganz besonderen, ihren eigenen.
Natürlich war es nicht möglich, noch länger in Petersburg zu bleiben, um so weniger, da Stepan Trofimowitsch ein endgültiges Fiasko erlebt hatte. Er hatte es schließlich nicht mehr aushalten können und begonnen, die Rechte der Kunst zu proklamieren, worauf das Lachen über ihn noch lauter wurde. Bei seinem letzten Vortrag nahm er sich vor, durch politische Rhetorik die erwünschte Wirkung zu erzielen, wobei er hoffte, die Herzen zu rühren und als »Verbannter« auf allgemeine Hochachtung rechnen zu können. Er räumte als unbestritten ein, daß das Wort »Vaterland« wertlos und lächerlich sei; er räumte ein, daß die Religion schädlich sei, aber er erklärte laut und bestimmt, daß ein Paar Stiefel weniger sei als Puschkin, sogar erheblich weniger. Man pfiff ihn erbarmungslos aus, und er brach auf der Stelle, in aller Öffentlichkeit, ohne das Podium zu verlassen, in Tränen aus. Warwara Petrowna brachte ihn mehr tot als lebendig nach Hause. »On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!« stammelte er wie von Sinnen. Sie pflegte ihn die ganze Nacht, reichte ihm Kirschlorbeertropfen und redete ihm bis zum Morgengrauen zu: »Sie werden noch gebraucht; Ihre Stunde wird noch kommen; man wird Sie anerkennen … an einem anderen Ort!«
Gleich am folgenden Tag, am frühen Vormittag, erschienen bei Warwara Petrowna fünf Literaten, darunter drei ihr gänzlich unbekannte, sie hatte sie noch nie gesehen. Mit strenger Miene teilten sie ihr mit, daß sie sich mit dem Plan ihrer Zeitschrift befaßt und eine diesbezügliche Entscheidung getroffen hätten. Warwara Petrowna hatte entschieden niemals und niemand den Auftrag erteilt, sich mit ihrer Zeitschrift zu befassen und eine diesbezügliche Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung bestand darin, daß die Zeitschrift, unmittelbar nach Gründung, mitsamt dem Kapital in eine freie Assoziation umzuwandeln sei und Warwara Petrowna anschließend nach Skworeschniki zurückzukehren habe, nicht ohne Stepan Trofimowitsch, »der veraltet ist«. Sie erklärten sich taktvollerweise bereit, ihr Eigentumsrecht anzuerkennen und ihr alljährlich ein Sechstel des Reingewinns zu überweisen. Das Rührendste aber war, daß vier von diesen fünf Menschen höchstwahrscheinlich nicht die geringsten eigennützigen Ziele verfolgten und sich nur im Namen der »allgemeinen Sache« engagierten.
»Als wir abreisten, waren wir wie benommen«, erzählte Stepan Trofimowitsch, »ich konnte überhaupt nicht einen vernünftigen Gedanken fassen und murmelte zum Rattern der Räder nur vor mich hin:
Wek und Wek und Lew Kambek,
Lew Kambek und Wek und Wek …
und weiß der Teufel, was noch alles, bis Moskau. Erst in Moskau kam ich wieder zu mir – aber hätte ich dort tatsächlich etwas anderes vorgefunden? Oh, meine Freunde!« rief er vor uns manchmal in Begeisterung aus. »Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Trauer und welcher Zorn das Herz ergreifen, wenn die große Idee, die einem schon lange heilig ist, Banausen und Pfuschern in die Hände fällt, die sie in die Gosse, unter ebensolche Hohlköpfe zerren, und man sie plötzlich dann auf dem Trödelmarkt wiederfindet, unkenntlich, schmutzig, entstellt, absurd, unproportioniert, disharmonisch, ein Spielzeug unverständiger Kinder! Nein! Zu unserer Zeit ging es anders zu. Wir strebten nach etwas ganz anderem. Nein, nein, nach etwas ganz anderem. Ich erkenne nichts wieder … Aber unsere Zeit wird wiederkommen und alles Schwankende, Heutige wieder in sichere Bahnen lenken. Denn was soll sonst werden? …«
VII
GLEICH nach der Rückkehr aus Petersburg schickte Warwara Petrowna ihren Freund ins Ausland: zur »Erholung«; es war auch nötig, daß sie sich für einige Zeit trennten, das fühlte sie. Stepan Trofimowitsch ging mit Begeisterung darauf ein. »Dort werde ich auferstehen!« rief er aus. »Dort werde ich mich endlich der Wissenschaft widmen!« Aber schon in den ersten Briefen aus Berlin nahm er die alte Melodie wieder auf: »Mein Herz ist gebrochen«, schrieb er an Warwara Petrowna, »nichts kann ich vergessen! Hier in Berlin hat mich alles an vergangene Zeiten erinnert, an das erste Entzücken und die erste Qual. Wo ist sie, wo sind sie beide? Wo seid ihr, meine beiden Engel, deren ich niemals würdig war? Und wo ist mein Sohn, mein geliebter Sohn? Wo bin ich schließlich selbst, ich, wie ich früher war, mit stählernen Kräften und unerschütterlich wie ein Fels, wenn jetzt ein Andrejeff, un … rechtgläubiger Narr mit Bart, peut briser mon existence en deux!«, und so weiter und so weiter. Was Stepan Trofimowitschs Sohn betraf, so hatte er ihn in seinem ganzen Leben zweimal gesehen, das erste Mal bei seiner Geburt und das zweite Mal erst kürzlich in Petersburg, wo der junge Mann sich auf die Universität vorbereitete. Seine Kindheit hatte er, wie bereits erwähnt, bei seinen Tanten verbracht, im Gouvernement O., siebenhundert Werst von Skworeschniki entfernt, wo er (auf Kosten Warwara Petrownas) erzogen wurde. Und was nun »Andrejeff« betraf, das heißt Andrejew, so war das ganz einfach einer unserer hiesigen Kaufleute, Ladenbesitzer, ein großer Sonderling, Autodidakt, Archäologe, leidenschaftlicher Sammler russischer Altertümer, der manches Mal mit Stepan Trofimowitsch die Klingen kreuzte, wenn es um Kenntnisse ging und vor allem um politische Überzeugungen. Dieser ehrbare Kaufmann, mit grauem Bart und großer silberner Brille, schuldete Stepan Trofimowitsch vierhundert Rubel, nachdem er einige Desjatinen Wald auf dessen kleinem, an Skworeschniki angrenzenden Gut zum Abholzen gekauft hatte. Obwohl Warwara Petrowna ihren Freund für seine Reise nach Berlin mehr als großzügig mit Geldmitteln versehen hatte, hatte Stepan Trofimowitsch auf diese vierhundert Rubel ganz besonders gerechnet, vermutlich für seine heimlichen Ausgaben, und brach vor der Abreise beinahe in Tränen aus, als »Andrejeff« um einen Monat Aufschub bat, übrigens mit vollem Recht, da er die ersten Raten alle fast ein halbes Jahr im voraus entrichtet hatte, aus Rücksicht auf die damalige besondere Notlage Stepan Trofimowitschs. Warwara Petrowna las begierig diesen ersten Brief, unterstrich mit Bleistift den Ausruf »Wo sind sie beide?«, versah ihn mit dem Eingangsdatum und verschloß ihn in der Schatulle. Er hatte selbstverständlich an seine beiden verstorbenen Ehefrauen gedacht. Im zweiten Brief aus Berlin wurde die Melodie variiert: »Ich arbeite zwölf Stunden täglich« (»wenn es doch wenigstens elf wären«, murmelte Warwara Petrowna ärgerlich), »stöbere in den Bibliotheken, vergleiche, exzerpiere, bin dauernd unterwegs, war schon bei vielen Professoren. Habe die Bekanntschaft mit der großartigen Familie Dundassow erneuert. Wie reizend Nadeschda Nikolajewna heute noch ist! Sie läßt Sie grüßen. Ihr junger Gatte und alle drei Neffen weilen ebenfalls in Berlin. Abends Gespräche mit der Jugend bis zum Morgengrauen, beinahe Attische Nächte, aber nur des Feinsinns und des Geschmacks; alles Edle: viel Musik, spanische Motive, der Traum von der Erneuerung der ganzen Menschheit, die Idee der ewigen Schönheit, Sixtinische Madonna, Licht mit flüchtigen Schatten, aber auch die Sonne hat ja ihre Flecken! Oh, meine Freundin, meine edle, treue Freundin! Meine Seele ist immer bei Ihnen und gehört Ihnen, Ihnen allein, en tous pays, und wäre es sogar le pays de Makar et de ses veaux, von dem wir, Sie erinnern sich, in Petersburg vor der Abreise zitternd gesprochen haben. Ich denke mit einem Lächeln daran zurück. Nachdem ich die Grenze passiert hatte, fühlte ich mich in Sicherheit, ein seltsames Gefühl, ein neues, zum ersten Mal nach so langen Jahren …«, und so weiter und so weiter.
»Alles Unsinn«, entschied Warwara Petrowna, indem sie auch diesen Brief zu den anderen legte. »Wenn er bis zum Morgengrauen Attische Nächte feiert, dann wird er doch nicht zwölf Stunden täglich über seinen Büchern sitzen. War er vielleicht betrunken, als er das schrieb? Und wie wagt es diese Dundassowa, mich grüßen zu lassen! Übrigens, mag er sich doch ein wenig amüsieren …«
Der Ausdruck »dans le pays de Makar et de ses veaux« bedeutet, »wohin nicht einmal Makar seine Kälber treibt«. Stepan Trofimowitsch pflegte bei Gelegenheit russische Sprichwörter und volkstümliche Redensarten mit Bedacht auf die törichteste Weise ins Französische zu übersetzen, obwohl er sie zweifellos besser zu deuten und zu übersetzen imstande war, aber er fand das besonders chic und geistreich.
Er amüsierte sich nicht lange, hielt es keine vier Monate aus und eilte nach Skworeschniki zurück. Seine letzten Briefe enthielten einzig und allein die empfindsamsten Liebesergüsse an seine ferne Freundin und waren buchstäblich von Tränen der Sehnsucht benetzt. Es gibt Naturen, die sich außerordentlich an das Haus gewöhnen, wie die Schoßhündchen. Das Wiedersehen der Freunde war ein Freudenrausch, zwei Tage später jedoch war alles wie früher und sogar langweiliger als früher. »Mein Freund«, vertraute mir Stepan Trofimowitsch zwei Wochen später als tiefstes Geheimnis an, »mein Freund, ich habe eine für mich schreckliche … Entdeckung gemacht: Je suis un ganz gewöhnlicher Schmarotzer, et rien de plus! Mais r-r-r-ien de plus!«
VIII
DARAUF trat bei uns eine Windstille ein, die diese ganzen neun Jahre fast ununterbrochen anhielt. Die hysterischen Ausbrüche und das Schluchzen an meiner Schulter, die sich regelmäßig wiederholten, störten nicht im geringsten unser Behagen. Ich wundere mich, daß Stepan Trofimowitsch in dieser Zeit nicht dick geworden ist. Nur seine Nase hatte sich ein bißchen gerötet und seine Gutmütigkeit zugenommen. Nach und nach hatte sich ein Freundeskreis um ihn gebildet, der allerdings beschränkt blieb. Obwohl Warwara Petrowna mit diesem Kreis nur wenig in Berührung kam, erkannten wir sie alle als unsere Patronin an. Nach der Petersburger Lektion ließ sie sich endgültig in unserer Stadt nieder; den Winter verbrachte sie in ihrem Stadthaus, den Sommer auf dem in der Nähe gelegenen Gut. Zu keiner anderen Zeit fand sie größere Beachtung und übte einen stärkeren Einfluß in unserer Gesellschaft aus als in den letzten sieben Jahren, das heißt bis zur Ernennung unseres jetzigen Gouverneurs. Unser früherer Gouverneur, der unvergeßliche weichherzige Iwan Ossipowitsch, war ein naher Verwandter von ihr und hatte irgendwann eine Wohltat von ihr empfangen. Seine Gattin zitterte bei der bloßen Vorstellung, Warwara Petrownas Mißfallen zu erregen, und die Ehrerbietung der Gouvernementsgesellschaft nahm sogar irgendwie sündhafte Formen an. Infolgedessen hatte auch Stepan Trofimowitsch sich nicht zu beklagen. Er war Mitglied des Clubs, verlor im Spiel gravitätisch und wurde hochgeachtet, obwohl viele in ihm nur den »Studierten« sahen. Später, als Warwara Petrowna ihm gestattete, in einem anderen Haus zu wohnen, fühlten wir uns noch weniger geniert. Wir versammelten uns bei ihm etwa zweimal wöchentlich; manchmal ging es sehr lustig zu, besonders, wenn er mit Champagner nicht geizte. Den Wein bezog er aus dem Laden des besagten Andrejew. Die Rechnungen wurden halbjährlich von Warwara Petrowna beglichen, und der Tag der Bezahlung war fast immer ein Tag der Cholerine.
Das älteste Mitglied unseres Kreises war Liputin, Gouvernementsbeamter, nicht mehr ganz jung, ein großer Liberaler, der in der Stadt im Rufe eines Atheisten stand. Er war in zweiter Ehe mit einer jungen, hübschen Frau verheiratet, die eine ansehnliche Mitgift in die Ehe gebracht hatte, und außerdem Vater dreier heranwachsender Töchter. In seiner Familie, die er nicht aus dem Hause ließ, führte er ein strenges Regiment, war außerordentlich geizig und hatte sich von seinem Gehalt ein Häuschen und ein gewisses Kapital zusammengespart. Er war ein sehr unruhiger Mensch, dazu im niedrigsten Rang: in der Stadt genoß er kein besonders hohes Ansehen, und die bessere Gesellschaft verkehrte nicht mit ihm. Überdies erwiesenermaßen ein Klatschmaul, mehrfach bestraft, und zwar empfindlich, einmal von einem Offizier, ein anderes Mal von einem ehrbaren Familienvater, einem Gutsbesitzer. Wir liebten jedoch seinen Scharfsinn, seine Wißbegierde, seinen eigentümlich boshaften Witz. Warwara Petrowna mochte ihn nicht, aber er verstand es immer wieder, sich bei ihr einzuschmeicheln.
Ebensowenig mochte sie Schatow, der sich erst im letzten Jahre unserm Kreis angeschlossen hatte. Schatow hatte früher studiert, war aber wegen irgendeiner Studentengeschichte relegiert worden; als Kind war er Schüler von Stepan Trofimowitsch gewesen, war noch als Warwara Petrownas Leibeigener, Sohn ihres verstorbenen Kammerdieners Pawel Fjodorow, geboren worden und hatte manche Wohltat empfangen. Sie mochte ihn nicht, weil er sich stolz und undankbar betrug, und konnte ihm nie verzeihen, daß er sich nicht sofort nach seiner Relegation bei ihr gemeldet hatte; im Gegenteil, er ließ sogar den Brief, den sie ihm durch einen Eilboten zugeschickt hatte, einfach unbeantwortet und zog es vor, die Kinder eines zivilisierten Kaufmanns zu unterrichten. Mit der Familie dieses Kaufmanns war er ins Ausland gereist, eher als Wärter denn als Hauslehrer, aber zu jener Zeit wollte er gar zu gern ins Ausland. Die Kinder wurden auch noch von einer Gouvernante betreut, einem lebhaften jungen Mädchen, einer Russin, die ebenfalls unmittelbar vor der Abreise engagiert wurde, hauptsächlich, weil sie billig war. Etwa zwei Monate später setzte sie der Kaufmann »wegen Freidenkerei« auf die Straße, Schatow trottete hinter ihr her, und bald darauf wurden die beiden in Genf getraut. Sie lebten etwa drei Wochen zusammen und gingen dann als freie und völlig ungebundene Menschen jeder seiner Wege; natürlich auch aus Armut. Dann zog er allein durch Europa und lebte von der Hand in den Mund. Man sagt, er habe sich auf der Straße als Schuhputzer und im Hafen als Lastträger sein Brot verdient. Schließlich, etwa vor einem Jahr, kehrte er zu uns in sein heimatliches Nest zurück und zog zu seiner alten Tante, die er bereits nach einem Monat zu Grabe trug. Zu seiner Schwester Dascha, die ebenfalls von Warwara Petrowna erzogen worden war und als ihre Favoritin in den vornehmsten Verhältnissen lebte, unterhielt er nur äußerst spärliche und distanzierte Beziehungen. In unserm Kreis war er beständig finster und wortkarg, aber gelegentlich, wenn man an seine Überzeugungen rührte, krankhaft erregt und unbeherrscht in seinen Äußerungen. »Man sollte Schatow zuerst an Händen und Füßen fesseln und dann erst mit ihm diskutieren«, pflegte Stepan Trofimowitsch zu scherzen, aber er liebte ihn. Im Ausland hatte Schatow einige seiner früheren sozialistischen Überzeugungen radikal geändert und die entgegengesetzte Position bezogen. Er gehörte zu jenen idealistischen russischen Naturen, die, plötzlich von einer mächtigen Idee getroffen, gleichsam auf der Stelle von ihrer Wucht erdrückt werden, manchmal sogar für immer. Ihre Kräfte reichen nie aus, um sie je zu bewältigen, deshalb beginnen sie, leidenschaftlich an sie zu glauben, und so vergeht ihr ganzes späteres Leben in den letzten Zuckungen unter dem auf ihnen lastenden Felsbrocken, der sie bereits zur Hälfte zerquetscht hat. Schatows Äußeres entsprach vollkommen seinen Überzeugungen: Er war linkisch, blond, struppig, untersetzt, breitschultrig, mit dicken Lippen, sehr dichten, buschigen weißblonden Brauen, stets gerunzelter Stirn und einem unfreundlichen, hartnäckig, gleichsam irgendwie verlegen gesenkten Blick. Auf seinem Kopf war ein Wirbel, der sich trotz aller Mühe nicht ausbürsten ließ und immer in die Höhe stand. Er war ungefähr sieben- oder achtundzwanzig. »Ich wundere mich nicht