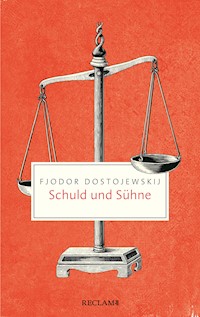8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Alexej Iwanowitsch kommt als Hauslehrer einer russischen Generalsfamilie in den noblen deutschen Kurort Roulettenburg. Man lebt weit über die eigenen Verhältnisse und wartet auf eine große Erbschaft. Alexej verfällt der Generalstochter Polina, am Roulettetisch soll er das dringend benötigte Geld auftreiben. Plötzlich taucht die überaus lebendige Erbtante auf … "Der Spieler" ist Dostojewskijs Aufarbeitung eigener Erlebnisse an Wiesbadener Roulettetischen und im Kasino von Baden-Baden. Durch seine Spielesucht 1866 an den Rand des Ruins gedrängt, diktierte der russische Autor diesen Roman innerhalb von vier Wochen, nachdem er sein gesamtes Vorschusshonorar bereits verspielt und die Rechte an all seinen Werken verpfändet hatte. – Mit einer kompakten Biographie des Autors.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Ähnliche
Fjodor Dostojewskij
Der Spieler
Aus den Aufzeichnungen eines jungen Mannes
Übersetzt und herausgegeben von Elisabeth Markstein
Reclam
Die Übersetzung folgt der Ausgabe: Fedor M. Dostoevskij: Igrok. In: F. M. D.: Sobranie sočinenij v 10 tomach. Bd. 4. Moskau: Gosudarstvennoe izdatel’stvo chudožestvennoj literatury, 1956. S. 283−432.
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: Bridgeman Images
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961898-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020644-7
www.reclam.de
Inhalt
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Zu dieser Ausgabe
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Erstes Kapitel
Endlich bin ich nach zwei Wochen Abwesenheit wieder zurück. Die Unsrigen waren schon drei Tage in Roulettenburg. Ich glaubte, sie hätten weiß Gott wie auf mich gewartet – weit gefehlt. Der General tat äußerst unbeteiligt, ließ sich zu einem kurzen Gespräch herab und verwies mich an seine Schwester. Es war offensichtlich, dass sie irgendwo Geld ergattert hatten. Mir kam es sogar vor, als schämte sich der General ein wenig, mich anzusehen. Marja Filippowna war überaus beschäftigt und beschränkte sich auf ein paar flüchtige Worte; das Geld nahm sie allerdings an, zählte nach und lauschte meinem Rapport. Zum Mittagessen wurde Mesenzow erwartet, dazu ein Französlein und noch irgendein Engländer; die übliche Moskauer Lebensart: kaum ist Geld im Haus, werden Gäste geladen. Polina Alexandrowna fragte, als sie mich erblickte, warum ich so lange fortgeblieben sei, und ging, ohne die Antwort abzuwarten, davon. ’s ist wirklich Zeit, dass wir uns aussprechen. Vielerlei hat sich angehäuft.
Man gab mir ein kleines Zimmer im vierten Stock des Hotels. Es ist hierorts bekannt, dass ich zur Gefolgschaft des Generals gehöre. Alles deutet darauf hin, dass es ihnen allemal gelungen ist, sich ins richtige Licht zu setzen. Man hält den General für einen steinreichen russischen Magnaten. Noch vor dem Mittagessen versäumte er nicht, mir neben anderen Aufträgen zwei Tausendfrancscheine zum Wechseln zu geben. Ich wechselte sie in der Hotelrezeption. Von nun an werden wir als Millionäre gelten, zumindest eine Woche lang. Ich war im Begriff, Mischa und Nadja zu einem Spaziergang auszuführen, da rief man mich von der Treppe zum General zurück; es beliebte ihm, sich zu erkundigen, wohin ich mit ihnen ginge. Dieser Mensch vermag mir ganz entschieden nicht in die Augen zu sehen; sosehr er es auch möchte – ich antworte ihm jedes Mal mit einem so durchdringenden, will heißen, aufsässigen Blick, dass er gleichsam in Verlegenheit gerät. In hochgestochener Rede, bei der er einen Satz auf den anderen stülpte und letztlich vollends den Faden verlor, gab er mir zu verstehen, ich möge mit den Kindern tunlichst den Kursaal meiden und in den Park gehen. Schließlich geriet er ganz außer sich und fügte barsch hinzu: »Ihnen ist ja zuzutrauen, dass Sie sie zum Roulette führen. Entschuldigen Sie«, fügte er hinzu, »aber ich weiß, dass Sie noch recht leichtsinnig sind und dem Spielen mitnichten abgeneigt. Wie immer, obgleich ich nicht Ihr Mentor bin und diese Rolle gar nicht beanspruche, habe ich doch immerhin das Recht zu wünschen, dass Sie mich sozusagen nicht kompromittieren …«
»Ich hab ja nicht mal Geld«, erwiderte ich gelassen. »Um welches zu verlieren, muss man es besitzen.«
»Sie sollen es sofort bekommen«, antwortete der General leicht errötend, kramte eine Weile in seinem Schreibschrank, blätterte in einem Kassenbuch, worauf sich herausstellte, dass er mir etwa hundertzwanzig Rubel schuldete.
»Wie wollen wir das begleichen?«, begann er. »Was macht das in Talern? Da, nehmen Sie hundert, eine runde Zahl. Der Rest geht Ihnen natürlich nicht verloren.«
Ich nahm schweigend das Geld an mich.
»Seien Sie bitte wegen meiner Worte nicht beleidigt. Sie sind ja so leicht gekränkt … Mein Hinweis möge bloß eine Warnung sein, und natürlich steht mir dies gewissermaßen zu …«
Als ich mit den Kindern vor dem Essen auf dem Heimweg war, begegnete uns ein ganzer Wagenaufzug. Die Unsrigen waren zur Besichtigung irgendwelcher Ruinen ausgefahren. Zwei elegante Kutschen, prachtvolle Pferde! Mademoiselle Blanche in der einen zusammen mit Marja Filippowna und Polina; das Französlein, der Engländer und unser General hoch zu Ross. Die Passanten blieben stehen und gafften: die Wirkung war erzielt; bloß dem General wird es nicht gut bekommen. Ich rechnete mir aus, dass sie mit den viertausend Franc, die ich mitgebracht habe, und dem, was sie offensichtlich inzwischen ergattert hatten, nunmehr sieben- oder achttausend besitzen müssten; zu wenig für Mademoiselle Blanche.
Mademoiselle Blanche logiert ebenfalls in unserem Hotel, sie hat ihre Mutter bei sich; das Französlein ist auch irgendwo in der Nähe. Die Dienerschaft spricht ihn mit »Monsieur le comte« an, Mademoiselle Blanches Mutter heißt »Madame la comtesse«; was soll’s, vielleicht sind sie wirklich Comte und Comtesse.
Ich wusste im vorhinein, dass Monsieur le comte mich beim Mittagstisch nicht erkennen würde. Der General wäre selbstredend nicht auf die Idee gekommen, uns bekannt zu machen oder zumindest mich ihm vorzustellen; und Monsieur le comte war in Russland gewesen und wusste, was für ein unbedeutender Vogel so ein Hauslehrer ist, den sie outchitel nennen. Im Übrigen kennt er mich sehr gut. Doch zugegebenermaßen war ich ja zum Mittagessen ungeladen erschienen; der General hat scheint’s vergessen, entsprechende Anweisungen zu geben, sonst hätte er mich an die Table d’hôte geschickt. Ich war mit einem Mal einfach da, so dass der General mich ungnädig ansah. Die gute Marja Filippowna wies mir sogleich einen Platz an; da kam mir aber die Bekanntschaft mit Mister Astley zupass, und ich wurde notgedrungen Teil ihrer Gesellschaft.
Diesem seltsamen Engländer war ich zum ersten Mal in Preußen begegnet, in einem Zugabteil, in dem wir einander gegenübersaßen, damals, als ich den Unsrigen nachfuhr; später traf ich ihn an der französischen Grenze und schließlich in der Schweiz; zweimal also im Verlaufe dieser zwei Wochen – und nun treffe ich ihn plötzlich schon in Roulettenburg. Nie habe ich in meinem Leben einen schüchterneren Menschen kennen gelernt; er ist schüchtern bis zum Dummsein und weiß das natürlich, weil er gar nicht dumm ist. Im Übrigen ist er sehr nett und still. Ich habe ihn bei unserer ersten Begegnung in Preußen zum Reden gebracht. Er eröffnete mir, dass er im Sommer am Nordkap war und überaus gerne den Jahrmarkt von Nischnij Nowgorod besuchen würde. Ich weiß nicht, wie er den General kennen gelernt hatte; es sieht so aus, als wäre er maßlos in Polina verliebt. Als sie eintrat, wurde er feuerrot. Er freute sich, dass ich mich am Tisch neben ihn setzte, und scheint mich bereits für einen alten Freund zu halten.
Bei Tische gab das Französlein bravourös den Ton an, er tut allen gegenüber herablassend und blasiert. Ich erinnere mich noch, wie er in Moskau leeres Stroh drosch, sich weitschweifig über die Finanzen und die russische Politik erging. Der General ermannte sich, hie und da zu widersprechen, bescheiden indes, einzig, um nicht vollends an Erhabenheit zu verlieren.
Ich war in einer seltsamen Gemütsverfassung und stellte mir, versteht sich, noch bevor die halbe Zeit am Tisch um war, meine gewohnte und stete Frage: »Warum vertrödle ich meine Zeit mit diesem General, warum hab’ ich mich nicht schon längst von ihnen abgesetzt?« Ab und zu warf ich einen Blick auf Polina Alexandrowna; sie schenkte mir überhaupt keine Beachtung. Am Ende wurde ich wütend und beschloss, mich als Grobian zu präsentieren.
Es begann damit, dass ich mich plötzlich, mir nichts, dir nichts, laut und ohne zu fragen in ein fremdes Gespräch einmischte. Vor allem wollte ich mich mit dem Französlein anlegen. Ich wandte mich plötzlich an den General, unterbrach ihn zudem, wie mir scheint, und bemerkte ganz laut und fest, dass es in diesem Sommer für Russen beinahe unmöglich sei, in Hotels am Gemeinschaftstisch zu speisen. Der General fixierte mich erstaunt.
»Wenn Sie ein Mensch mit Selbstachtung sind«, setzte ich fort, »ernten Sie gewiss Grobheiten und müssen unvermutete Seitenhiebe einstecken. In Paris und am Rhein, ja in der Schweiz sogar sitzen an den Table d’hôte so viele mickrige Polen und mit ihnen sympathisierende Franzmänner, dass Sie, wenn Sie bloß Russe sind, kein Wort vorbringen können.«
Ich hatte französisch gesprochen. Der General sah mich erstaunt an, im Zweifel, ob er böse werden oder sich lediglich wundern sollte, dass ich mich derart vergessen konnte.
»Das heißt, es hat Ihnen irgendwer und irgendwo die Leviten gelesen«, meinte das Französlein leichthin und verächtlich.
»In Paris habe ich mich zuerst mit einem Polen überworfen«, erwiderte ich, »darauf mit einem französischen Offizier, der den Polen unterstützte. Aber dann, nachdem ich ihnen erzählte, wie ich dem Monsignore in den Kaffee spucken wollte, ist ein Teil der Franzosen schon zu mir übergeschwenkt.«
»Spucken?«, erkundigte sich der General mit zur Schau getragener Verblüffung und sah sich sogar um. Das Französlein musterte mich ungläubig.
»Exakt, mit Verlaub«, antwortete ich. »Da ich zwei Tage lang überzeugt war, ich müsste in unsrer Angelegenheit einen Abstecher nach Rom machen, suchte ich wegen eines Vermerks im Pass die Nuntiatur Seiner Heiligkeit in Paris auf. Dort empfing mich ein Abate, um die fünfzig, ein trockenes Männlein, das Gesicht eisig starr, der mich anhörte, höflich, aber überaus trocken, und zu warten bat. Ich war zwar in Eile, setzte mich dennoch, versteht sich, zog die Opinion nationale hervor und begann die schrecklichsten Beschimpfungen gegen Russland zu lesen. Dabei hörte ich, wie jemand durch das Nebenzimmer zum Monsignore ging; ich sah meinen Abate Buckel machen. Ich wandte mich mit der früheren Bitte an ihn; er forderte mich abermals und noch trockener auf zu warten. Etwas später trat wiederum ein Fremder ein, aber in Geschäften – irgendein Österreicher, man hörte ihn an und geleitete ihn sofort nach oben. Nun wurde es mir entschieden zu dumm; ich stand auf, ging zum Abate und sagte mit Nachdruck, dass Monsignore offensichtlich empfange und somit auch meine Angelegenheit erledigen könne. Da trat der Abate plötzlich höchst erstaunt einen Schritt zurück. Es war ihm schlichtweg unverständlich, wie ein Nichts von Russe dazu kam, sich mit den Gästen des Monsignore zu messen. In unverschämtester Art, geradezu erfreut, mich beleidigen zu können, musterte er mich vom Scheitel bis zur Sohle und fragte mit erhobener Stimme: ›Glauben Sie wirklich, dass Monsignore Ihretwegen auf seinen Kaffee verzichtet?‹ Nun hob auch ich die Stimme, noch höher als er: ›Dann sag ich Ihnen, dass ich auf den Kaffee Ihres Monsignore spucke! Wenn Sie nicht auf der Stelle meinen Pass erledigen, gehe ich selbst zu ihm.‹
›Wie! Während der Kardinal bei ihm sitzt!?‹ Der Abate wich entsetzt vor mir zurück, stürzte zur Tür und breitete die Arme aus, als wollte er mir zeigen, dass er eher sterben als mich vorbeilassen würde.
Darauf antwortete ich, dass ich ein Ketzer und Barbar bin, que je suis hérétique et barbare, und mir sämtliche Erzbischöfe, Kardinäle, Monsignores etc. etc. völlig egal sind. Kurzum, ich gab ihm zu verstehen, dass ich nicht nachgeben würde. Der Abate sah mich mit unendlicher Gehässigkeit an, riss mir den Pass aus der Hand und trug ihn nach oben. Eine Minute, und der Vermerk stand drin. Da, beliebt es jemand, ihn zu sehen?« – Ich zog den Pass hervor und zeigte das römische Visum.
»Na, Sie sind mir doch …« setzte der General an.
»Ihr Glück, dass Sie sich als Barbar und Ketzer deklarierten«, bemerkte grinsend das Französlein. »Cela n’était pas si bête.«
»Soll ich mir an unsern Russen ein Beispiel nehmen? Da sitzen sie und traun sich nicht, den Mund aufzumachen, und sind vermutlich bereit, überhaupt zu leugnen, dass sie Russen sind. In meinem Hotel in Paris ging man, nachdem ich die Geschichte mit dem Abate herumerzählt hatte, jedenfalls wesentlich höflicher mit mir um. Ein dicker polnischer Pan, der bei der Table d’hôte besonders feindselig war, trat in den Hintergrund. Die Franzosen ertrugen es sogar, als ich erzählte, wie ich vor zwei Jahren einem Mann begegnet bin, auf den 1812 ein französischer Grenadier geschossen hat – einzig und allein, um das Gewehr zu entladen. Der Mann war damals erst ein zehnjähriges Kind, und seine Familie hatte es nicht geschafft, rechtzeitig aus Moskau fortzukommen.«
»Das kann nicht sein«, brauste das Französlein auf, »ein französischer Soldat schießt nicht auf Kinder!«
»Und doch ist es wahr«, gab ich zurück. »Wurde mir von einem ehrenwerten pensionierten Hauptmann berichtet, und ich habe selbst auf seiner Wange die Narbe von der Schusswunde gesehen.«
Der Franzose redete eifrig und schnell drauflos. Der General schickte sich an, ihn zu unterstützen, doch ich empfahl ihm, bloß mal in den Erinnerungen beispielsweise von General Perowskij nachzulesen, der 1812 in französischer Gefangenschaft war. Schließlich schnitt Marja Filippowna etwas anderes an, um die Auseinandersetzung zu unterbrechen. Der General war sehr ungehalten über mich, denn wir wären, der Franzose und ich, beinahe ins Schreien geraten. Hingegen glaube ich, dass Mister Astley meine Debatte mit dem Franzosen sehr gefallen hat; als er sich vom Tisch erhob, schlug er mir vor, ein Glas Wein mit ihm zu trinken. Abends gelang es mir, wie zu erwarten war, eine Viertelstunde lang mit Polina Alexandrowna zu sprechen. Es war beim Spaziergang. Alles machte sich auf den Weg zum Kursaal. Polina setzte sich auf eine Bank gegenüber dem Springbrunnen und ließ die kleine Nadja in der Nähe mit Kindern spielen. Mischa durfte ebenfalls zum Springbrunnen, wir blieben endlich allein.
Zuerst ging es, versteht sich, ums Geschäftliche. Polina war geradezu außer sich, als ich ihr nicht mehr als siebenhundert Gulden aushändigte. Sie war überzeugt gewesen, dass ich ihr für die versetzten Brillanten mindestens zweitausend oder sogar mehr aus Paris mitbringen würde.
»Ich brauche dringendst Geld«, sagte sie, »es muss beschafft werden, sonst bin ich einfach verloren.«
Ich wollte wissen, was während meiner Abwesenheit geschehen war.
»Nichts, als dass aus Petersburg zwei Nachrichten kamen. Zuerst, dass es Großmutter sehr schlecht geht, und zwei Tage danach, dass sie, scheint’s, schon gestorben ist. Das stammt von Timofej Petrowitsch«, fügte Polina hinzu, »und auf den ist Verlass. Wir warten auf die letzte, endgültige Bestätigung.«
»Mit anderen Worten: alle warten hier?«, fragte ich.
»Natürlich: alle und alles; ein ganzes halbes Jahr hat man allein darauf gehofft.«
»Und Sie, hoffen Sie auch?«, fragte ich.
»Ich bin ja bloß die Stieftochter vom General und mit ihr nicht verwandt. Aber ich weiß mit Bestimmtheit, dass sie mich im Testament bedenken wird.«
»Ich glaube, Sie werden sehr viel bekommen«, sagte ich bestätigend.
»Ja, sie liebte mich; doch warum glauben Sie das?«
»Sagen Sie mir«, stellte ich eine Gegenfrage, »unser Marquis, der scheint ja ebenfalls in alle familiären Geheimnisse eingeweiht?«
»Und Sie selbst, was kümmert es Sie?«, fragte Polina und sah mich streng und abweisend an.
»Wie denn nicht? Wenn ich nicht irre, hat sich der General bei ihm bereits Geld geborgt.«
»Sie sind sehr gut im Raten.«
»Na eben, als ob der mit Geld herausgerückt wäre, wenn er nicht über Großmütterchen Bescheid wüsste! Haben Sie’s bei Tisch bemerkt? Mehrmals hat er, sobald er über Großmutter sprach, sie Großmütterchen genannt: la baboulinka. Auf wie vertrautem und wie freundschaftlichem Fuß er doch mit ihr steht!«
»Sie haben Recht. Kaum wird er erfahren, dass auch mir etwas an Erbschaft zufällt, macht er mir auf der Stelle einen Antrag. Ist es das, was Sie wissen wollten?«
»Erst dann einen Antrag? Ich dachte, er hat es schon längst getan.«
»Sie wissen sehr wohl, dass das nicht so ist!«, sagte Polina gereizt. »Wo haben Sie diesen Engländer kennen gelernt?«, fügte sie nach kurzem Schweigen hinzu.
»Ich wusste schon, dass Sie gleich danach fragen würden.«
Ich berichtete ihr über meine früheren Begegnungen mit Mister Astley. »Er ist schüchtern und verliebt sich leicht und ist natürlich schon in Sie verliebt?«
»Ja, das ist er«, antwortete Polina.
»Und natürlich ist er zehnmal reicher als der Franzose. Wie ist’s mit dem, hat er wirklich Geld? Sicher und zweifelsfrei?«
»Zweifelsfrei. Er besitzt irgendein Schloss. Der General hat es mir noch gestern ganz dezidiert erklärt. Na, sind Sie nun zufrieden?«
»Ich an Ihrer Stelle würde unbedingt den Engländer nehmen.«
»Warum?«, fragte Polina.
»Der Franzose ist hübscher, aber skrupelloser; und der Engländer ist obendrein zu seiner Ehrlichkeit auch noch zehnmal so reich«, meinte ich kurz.
»Gewiss, aber der Franzose ist Marquis und klüger«, erwiderte sie mit größter Gelassenheit.
»Sind Sie sicher?«, ließ ich nicht locker.
»Ganz sicher.«
Polina waren meine Fragen ganz und gar lästig, ich sah, dass sie mich durch den Ton und die Absonderlichkeit ihrer Antwort ärgern wollte, und sagte es ihr sogleich.
»Nun ja, es belustigt mich tatsächlich zu sehen, wie Sie in Rage geraten. Schon allein darum, dass ich Ihnen solche Fragen und Vermutungen erlaube, verdienen Sie eine Strafe.«
»Ich glaube mich in der Tat berechtigt, Ihnen allerhand Fragen zu stellen«, gab ich ruhig zurück, »weil ich nämlich bereit bin, dafür geradezustehen, und mein Leben keinen Wert mehr für mich hat.«
Polina brach in Lachen aus.
»Zuletzt haben Sie mir auf dem Schlangenberg gesagt, Sie seien bereit, sich auf ein einziges Wort von mir kopfüber in die Tiefe zu stürzen, und das sind dort, glaube ich, fast tausend Fuß. Irgendwann werde ich das Wort aussprechen, einzig um zu sehen, wie Sie dafür geradestehen. Ich versichere Ihnen, ich werde nicht zaudern. Sie sind mir darum verhasst, dass ich Ihnen so viel erlaubt habe, und noch verhasster, weil ich Sie brauche. Doch so lange ich Sie brauche, muss ich Sie schonen.«
Sie machte Anstalten, sich zu erheben. Sie sprach gereizt. In letzter Zeit beendete sie jedes Gespräch, das wir führten, mit Gehässigkeit und Gereiztheit, einer wirklichen Gehässigkeit.
»Gestatten Sie die Frage: was ist sie, die Mademoiselle Blanche?«, sagte ich, weil ich sie ohne Erklärung nicht fortlassen wollte.
»Sie wissen selbst, was die Mademoiselle Blanche ist. Seither kam nichts Neues hinzu. Mademoiselle Blanche wird wahrscheinlich Generalin, vorausgesetzt freilich, dass sich die Gerüchte über Großmutters Tod bestätigen, denn sie alle, Mademoiselle Blanche und ihre Mutter und der entfernte Cousin von Marquis wissen sehr wohl, dass wir ruiniert sind.«
»Und der General ist endgültig verliebt?«
»Darum geht es jetzt nicht. Hören Sie zu und merken Sie sich’s: Nehmen Sie die siebenhundert Gulden und gehen Sie spielen, gewinnen Sie für mich beim Roulette, soviel Sie können; ich brauche jetzt partout Geld.«
Nach diesen Worten rief sie Nadja herbei und ging zur Promenade, wo sie sich unsrer ganzen Gesellschaft anschloss. Ich meinerseits bog auf dem erstbesten Weg nach links ein, grübelnd und staunend. Der Befehl, zum Roulette zu gehen, hatte mich wie ein Blitz getroffen. Seltsam: obwohl es genug Dinge gab, über die ich nachzudenken hatte, vertiefte ich mich vollkommen in die Analyse meines Gefühls für Polina. Es war mir in den zwei Wochen Abwesenheit wahrlich besser gegangen als jetzt, am Tag meiner Rückkehr, wenngleich ich mich doch während der Reise wie ein Wahnsinniger in Sehnsucht verzehrte, vor lauter Besessenheit keine Ruhe fand und sie sogar im Schlaf dauernd vor mir sah. Einmal (in der Schweiz) war ich im Zug eingeschlafen und begann scheint’s laut mit Polina zu sprechen, sehr zur Belustigung meiner Mitreisenden. Und wieder fragte ich mich jetzt: Liebe ich sie? Und wieder vermochte ich nicht, darauf zu antworten, besser gesagt, ich antwortete mir zum hundertsten Mal, dass ich sie hasse. Ja, sie war mir verhasst. Es hat Augenblicke gegeben (und zwar jedes Mal am Schluss unserer Gespräche), da ich die Hälfte meines Lebens geopfert hätte, um sie zu erdrosseln! Ich schwöre: Wenn es möglich wäre, langsam ein scharfes Messer in ihre Brust zu stoßen, ich hätte, glaube ich, mit Genuss danach gegriffen. Und zugleich schwöre ich bei allem, was mir heilig ist: Hätte sie tatsächlich am Schlangenberg bei der beliebten Aussicht »springen Sie« gesagt, ich wäre hinabgesprungen, und sogar mit Genuss. Ich wusste es. So oder so, es musste sich entscheiden. Sie versteht das alles wunderbar, und der Gedanke, dass ich mir zweifelsfrei und deutlich ihrer Unerreichbarkeit und der ganzen Aussichtslosigkeit meiner Phantasien bewusst bin, dieser Gedanke bereitet ihr, da bin ich sicher, einen außerordentlichen Genuss; wie hätte sie sonst, die Vorsichtige und Kluge, sich mir gegenüber so vertraut und offenherzig geben können? Mir scheint, ich war in ihren Augen bislang nichts anderes als der Sklave jener antiken Kaiserin, die sich vor ihm auszog, weil sie ihn nicht für einen Menschen erachtete. Ja, Polina hat mich viele Male nicht für einen Menschen erachtet …
Ich hatte indes einen Auftrag – für sie Roulette zu spielen und partout zu gewinnen. Die Zeit war zu knapp, um nachzudenken, wofür und wie schnell sie den Gewinn brauchte und was für neue Überlegungen ihr stets kalkulierender Kopf geboren hatte. Außerdem war in den zwei Wochen offensichtlich eine Vielfalt von neuen Konstellationen hinzugekommen, von denen ich noch keine Ahnung hatte. Ich musste dahinterkommen, mich zurechtfinden, und dies möglichst schnell. Zunächst aber war keine Zeit zu verlieren: Ich musste zum Roulette.
Zweites Kapitel
Offen gesagt, es kam mir nicht gelegen; freilich hatte ich daran gedacht, zu spielen, aber für andere damit zu beginnen war ich keineswegs gesonnen. Es verwirrte mich sogar ein wenig, und ich betrat die Spielsäle mit größter Verdrossenheit. Auf den ersten Blick wollte mir dort nichts gefallen. Ich kann die Liebedienerei in den Feuilletons der ganzen Welt nicht leiden und vornehmlich die in unseren russischen Zeitungen nicht, wo sich unsere Schreiberlinge in fast jedem Frühjahr über zwei Dinge ergehen: erstens über die ungeheure Pracht und Herrlichkeit in den Spielhäusern am Rhein, und zweitens über die Goldberge, die sich da angeblich auf den Tischen türmen. Werden dafür ja nicht bezahlt, schreiben es einfach so, aus selbstloser Unterwürfigkeit. Von Herrlichkeit ist in den schmuddeligen Sälen keine Rede, und es gibt an Gold nicht nur keine Berge, sondern nicht mal immer ein Häuflein auf den Tischen. Natürlich kommt es im Verlaufe der Saison auch schon mal vor, dass irgendein Kauz, ein Engländer oder ein Asiate, wie der Türke in diesem Sommer, Unsummen verliert oder gewinnt; die übrigen spielen alle um kleine Gulden, und im Schnitt genommen liegt allemal sehr wenig Geld auf dem Tisch. Als ich im Spielsaal war (zum ersten Mal in meinem Leben), konnte ich mich nicht gleich zum Spielen entschließen. Außerdem drängte die Menge. Doch mir scheint, auch wenn ich allein gewesen wäre, hätte ich mich eher zurückgezogen als mit dem Spielen begonnen. Offen gesagt, ich hatte Herzklopfen und Mühe, kaltes Blut zu bewahren; ich wusste, es war längst beschlossene Sache, dass ich aus Roulettenburg so einfach nicht wegfahren würde; irgend etwas Schicksalhaftes kündigte sich entschieden an, etwas Radikales und Endgültiges, ein Muss; so wird es sein. Wie lächerlich es auch erscheinen mag, dass ich mir soviel vom Roulette erwarte, doch noch lächerlicher ist nach meinem Dafürhalten die gängige und allseits anerkannte Meinung, dass es dumm und widersinnig sei, sich vom Spiel etwas zu erwarten. Warum soll das Spielen anrüchiger sein als eine beliebige andere Art des Gelderwerbs, etwa des Handels, wenn Sie wollen? Es stimmt, dass von je hundert einer gewinnt. Doch was geht’s mich an?
Wie immer, ich beschloss fürs Erste, mich umzusehen und an diesem Abend noch nicht ernst zu machen … Würde an diesem Abend doch etwas geschehen, dann nur zufällig und leichthin – das nahm ich mir fest vor. Außerdem wollte auch das Spiel selbst erst studiert werden; denn trotz der Tausende von Beschreibungen des Roulettes, die ich stets mit solcher Gier verschlang, hatte ich, ehe ich es nicht mit eigenen Augen sah, nicht die geringste Ahnung, wie es funktionierte.
Zunächst einmal kam mir alles so schmutzig vor, irgendwie moralisch anrüchig und schmutzig. Mitnichten meine ich die gierigen und unruhigen Gesichter, die sich zu Dutzenden, ja zu Hunderten um die Spieltische drängen. Ich sehe entschieden nichts Schmutziges daran, dass einer so viel und so schnell wie möglich gewinnen möchte; der Ausspruch eines wohlgenährten und betuchten Moralisten, der auf irgendwessen Rechtfertigung, man »spiele ja mit kleinen Einsätzen«, geantwortet hatte: »Um so schlimmer, wenn die Habsucht klein ist« – dieser Ausspruch kam mir immer sehr dumm vor. Kleine Habsucht, große Habsucht – als ob’s nicht egal wäre. Es ist eine Frage des Proporzes. Was für Rothschild klein ist, ist für mich mehr als reichlich, und was Profit und Gewinn anlangt, so sind die Menschen nicht nur beim Roulette, sondern überall mit nichts anderem beschäftigt, als dem Mitmenschen etwas abzuluchsen oder abzugewinnen. Ob Profit und Gewinn überhaupt etwas Widerwärtiges sind, gehört auf ein anderes Blatt. Darauf gehe ich hier nicht ein. Da ich ja selbst in höchstem Maße vom Wunsch zu gewinnen besessen war, erschien mir diese ganze Habsucht samt dem ganzen, sagen wir, habsüchtigen Schmutz beim Betreten des Saales irgendwie geläufiger, vertrauter. Nichts besser, als wenn man voreinander keine Umstände macht; man handle offen und ohne Gezier. Wozu sich selbst belügen? Welch überaus nichtige und unbesonnene Beschäftigung! Besonders unschön war an dem ganzen Roulettegesindel auf den ersten Blick jene Achtung vor dem eignen Tun, jene Ernsthaftigkeit, ja sogar Ehrfurcht, mit der sich alle um die Tische drängten. Eben darum weiß man hier exakt zu unterscheiden, welche Art Spiel »mauvais genre« zu heißen hat und welche einem honorigen Menschen zusteht. Es gibt zwei Arten zu spielen: der einen befleißigen sich Gentlemen, der anderen die Plebs, habsüchtiges Gesindel. Hier wird streng unterschieden – und wie niederträchtig doch im Grunde dieses Unterscheiden ist! Ein Gentleman darf beispielsweise fünf oder zehn Louisdor setzen, selten mehr, im Übrigen nach Belieben auch tausend Franc, so er sehr reich ist, dies jedoch allein als Spiel, einzig aus Spaß, eigentlich nur um sich den Vorgang des Gewinnens oder Verlierens zu besehen; der Gewinn selbst hat ihn nicht zu interessieren. Gewinnt er, darf er zum Beispiel laut lachen, eine Bemerkung zu einem der Umstehenden machen, darf sogar nochmals setzen und nochmals verdoppeln, jedoch einzig aus Neugier, zwecks Beachtung und Berechnung der Chancen, niemals aus dem plebejischen Wunsch heraus, zu gewinnen. Mit einem Worte, all diese Spieltische, Roulettes und Trente-et-quarante dürfen ihm nichts anderes als Unterhaltung sein, eigens zu seinem Wohlbehagen eingerichtet. Die Habsucht und die Fallen, auf denen die Bank gründet, soll er nicht mal ahnen. Gut und bestens wäre es sogar, wenn er glaubte, dass alle übrigen Spieler, der ganze Abschaum, der da um die Gulden zittert, genau solche Geldmänner und Gentlemen seien wie er selbst und nur des Vergnügens und der Unterhaltung wegen spielten. Derlei absolute Lebensfremdheit und kümmerliche Menschenkenntnis wären selbstredend etwas außerordentlich Aristokratisches. Ich sah, wie viele treusorgende Mütter ihre unschuldigen und graziösen fünfzehn- oder sechzehnjährigen Misses, ihre Töchter, an die Tische schoben und sie mit einigen ausgehändigten Goldmünzen im Spielen unterrichteten. Das Fräulein gewann oder verlor, lächelte unbeirrt und zog sich sehr zufrieden zurück. Unser General trat behäbig und ernst an den Tisch; ein Lakai wollte ihm eilends einen Stuhl heranrücken, doch er schenkte dem Lakaien keine Beachtung; er suchte sehr lange nach seiner Börse, kramte sehr lange dreihundert Goldfranc daraus hervor, setzte auf Schwarz und gewann. Nahm den Gewinn nicht und ließ ihn auf dem Tisch. Wieder Schwarz; auch diesmal ließ er den Gewinn liegen, und als beim dritten Mal Rot kam, hatte er zwölfhundert Franc verloren. Er stand auf und ging, ohne sich etwas anmerken zu lassen, mit einem Lächeln fort. Ich bin sicher, es war ihm nicht wohl zumute; wäre der Einsatz doppelt oder dreimal so hoch gewesen, es hätte ihm gewiss an Charakterstärke gemangelt, soviel Gelassenheit zur Schau zu tragen. Im Übrigen hat ein Franzose in meiner Gegenwart fast dreißigtausend Franc zuerst gewonnen und dann verloren, durchaus frohgemut und ohne die leiseste Erregung. Ein wahrer Gentleman muss kühl bleiben, mag er auch sein ganzes Vermögen verspielen. Das Geld muss so tief unter dem Status eines Gentleman rangieren, dass es kaum der Mühe wert ist, darum besorgt zu sein. Natürlich wäre es ein überaus aristokratischer Zug, den ganzen Schmutz dieses versammelten Gesindels samt dem ganzen Drumherum überhaupt nicht zu beachten. Allerdings ist auch das gegenteilige Verhalten mitunter nicht weniger aristokratisch: das Gesindel wohl zu bemerken, es sogar in Augenschein zu nehmen, etwa durchs Lorgnon, doch mitnichten anders als unter dem Gesichtspunkt, dass diese Menge und dieser Schmutz eine Art Zeitvertreib sind, eine Art Aufführung, eigens zur Belustigung der Gentlemen inszeniert. Man darf sich auch unter das Gesindel mengen, ohne indes in der festen Überzeugung zu wanken, eigentlich Beobachter zu sein und nicht zu ihm zu gehören. Im Übrigen ziemt es sich auch nicht, allzu großes Interesse zu zeigen: es wäre wiederum nicht gentlemanlike, denn das Dargebotene verdient kein großes und allzu neugieriges Betrachten. So wie es überhaupt weniges an Sehenswürdigkeiten gibt, das eine allzu neugierige Betrachtung durch den Gentleman verdiente. Ich persönlich aber meinte, dass dies alles sehr wohl einer überaus genauen Betrachtung wert sei, besonders für jemanden, der nicht allein der Betrachtung wegen gekommen war, sich vielmehr aufrichtig und gewissenhaft als Teil dieses ganzen Gesindels sieht. Was nun meine verborgensten sittlichen Anschauungen anlangt, so ist für sie in diesen meinen Überlegungen natürlich kein Platz. So sei’s eben; ich sage es zur Beruhigung meines Gewissens. Doch eins will ich vermerken: dass ich es in letzter Zeit irgendwie schrecklich leid war, meine Handlungen und Gedanken an irgendwelchen sittlichen Maßstäben zu messen. Von etwas anderem ließ ich mich leiten …
Das Gesindel spielt tatsächlich sehr eklig. Ich neige sogar dazu, zu glauben, dass hier am Tisch oft schlicht und einfach gestohlen wird. Für die Croupiers, die an den Tischenden sitzen, die Einsätze beachten und berechnen, schrecklich viel Arbeit. Na, das ist erst ein Gesindel! Die meisten sind Franzosen. Im Übrigen beobachte und vermerke ich es keineswegs, um das Roulette zu beschreiben; ich nehme nur Augenmaß, für mich, um zu wissen, wie ich mich künftig verhalten soll. Zum Beispiel habe ich bemerkt, dass es nichts Üblicheres gibt, als wenn plötzlich eine Hand über den Tisch greift und sich, was Sie gewonnen haben, holt. Es kommt zum Streit, mitunter lauthals, aber bitte sehr – wo ist der Beweis samt Zeugen, dass der Einsatz der Ihrige war!?
Zuerst war für mich alles wie chinesische Grammatik; einiges vermochte ich mit Mühe zu erraten, erkannte auch, dass man auf Zahl, auf Pair und Impair sowie auf Farbe setzte. Von Polina Alexandrownas Geld beschloss ich an jenem Abend hundert Gulden zu riskieren. Der Gedanke, dass ich nicht für mich spielte, brachte mich irgendwie in Verwirrung. Was ich empfand, war äußerst unangenehm, ich wollte möglichst schnell aus der Sache raus. Es war mir, als bringe ich das eigne Glück in Gefahr, sobald ich für Polina spielte. Ist es wirklich unmöglich, bei der ersten Bekanntschaft mit dem Spieltisch nicht gleich dem Aberglauben zu verfallen? Ich begann damit, dass ich fünf Friedrichsdor, fünfzig Gulden also, hervorholte und auf Pair setzte. Die Kugel rollte und hielt auf dreizehn – ich hatte verloren. Mit einer schmerzlichen Empfindung und einzig, um irgendwie aus der Sache rauszukommen und zu gehen, setzte ich abermals fünf Friedrichsdor auf Rot. Es kam Rot. Ich setzte alle zehn Friedrichsdor – wieder kam Rot. Ich setzte wieder alles ein, wieder kam Rot. Ich erhielt vierzig Friedrichsdor und setzte, ohne zu wissen, was daraus würde, zwanzig auf die zwölf mittleren Zahlen. Man zahlte mir das Dreifache aus. Somit waren aus den zehn Friedrichsdor plötzlich achtzig geworden. Ein ungewohntes und seltsames Gefühl überkam mich, so unerträglich, dass ich zu gehen beschloss. Es war mir, als hätte ich ganz anders gespielt, wenn’s für mich gewesen wäre. Dennoch setzte ich alle achtzig Friedrichsdor nochmals auf Pair. Es kam die Vier; man schob mir weitere achtzig Friedrichsdor zu, ich steckte den ganzen Haufen von hundertsechzig Friedrichsdor ein und machte mich auf die Suche nach Polina Alexandrowna.
Sie spazierten alle irgendwo im Park, also gelang es mir erst beim Abendessen, sie zu sehen. Das Französlein fehlte diesmal, und der General kam in Schwung; er hielt es übrigens für angebracht, mich abermals wissen zu lassen, dass er nicht wünsche, mich am Spieltisch anzutreffen. Seiner Meinung nach würde es ihn sehr kompromittieren, wenn ich gelegentlich zu viel verlöre. »Und auch wenn Sie sehr viel gewönnen, wäre ich nicht minder kompromittiert«, setzte er bedeutungsvoll hinzu. »Natürlich bin ich nicht befugt, über Ihr Tun zu bestimmen, doch gestehen Sie selbst …« Wie’s seine Gewohnheit war, ließ er den Satz unbeendet. Ich antwortete trocken, dass ich zu wenig Geld besäße und folglich nicht gerade aufsehenerregend verlieren könne, selbst wenn ich zu spielen begänne. Ehe ich in mein Zimmer ging, hatte ich Zeit, Polina ihren Gewinn zu geben und ihr deutlich zu machen, dass ich fortan nicht gewillt sei, für sie zu spielen.
»Warum denn nicht?«, fragte sie beunruhigt.
»Weil ich für mich spielen will«, gab ich zur Antwort und betrachtete sie verwundert. »Es würde mich stören.«
»Demnach halten Sie noch immer daran fest, im Roulette den einzigen Ausweg und alles Heil zu sehen?«, fragte sie spöttisch. Ich antwortete wiederum sehr ernst mit Ja; was nun meine Gewissheit anlangte, partout zu gewinnen, so sei dies vielleicht lächerlich – das nehme ich hin, aber: »man lasse mich tunlichst in Ruhe«.
Polina Alexandrowna wollte darauf beharren, dass ich den heutigen Gewinn mit ihr teilte, und mir die achtzig Friedrichsdor aufzwingen, sie schlug mir vor, das Spielen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Ich wies die Hälfte entschieden und endgültig zurück und erklärte dezidiert, dass ich nicht deswegen für niemand anderen spielen kann, weil ich’s nicht wollte, sondern weil ich sicherlich verlieren würde.
»Dabei ist das Roulette, dumm oder nicht, fast auch meine einzige Hoffnung«, sagte sie nachdenklich. »Und darum müssen Sie unbedingt mit mir weiter auf Hälfte-Hälfte spielen. Und natürlich werden Sie’s tun.« Damit ging sie, ohne meinen weiteren Einwänden Gehör zu schenken.