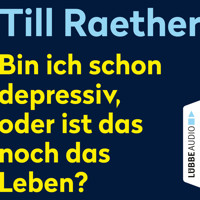9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Adam Danowski
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Es ist Abend, dunkel. Im Elbtunnel herrscht wie immer Stau. Plötzlich ein Schuss. Der Fahrer eines weißen Geländewagens sackt über dem Lenkrad zusammen. Der Täter entkommt unerkannt. Ein Amokläufer? Der Beginn eines Bandeskrieges? Alle Spuren führen ins Nichts. Und dann interessiert sich mit einem Mal ein amerikanischer Geheimdienst für den Fall. Hauptkommissar Adam Danowski gilt trotz seines jüngsten Ermittlungserfolges als unberechenbar. Auch diesmal geht er eigene Wege. Die führen in eine Neubausiedlung inmitten weiter Moorwiesen am Rande der Stadt, an verlassene Orte und düstere Geheimgänge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
Till Raether
Danowski: Blutapfel
Kriminalroman
Über dieses Buch
Es ist Abend, dunkel. Im Elbtunnel herrscht wie immer Stau. Plötzlich ein Schuss. Der Fahrer eines weißen Geländewagens sackt über dem Lenkrad zusammen. Der Täter entkommt unerkannt. Die Tat eines Amokläufers? Der Beginn eines Bandenkrieges? Alle Spuren führen ins Nichts. Und dann interessiert sich mit einem Mal ein amerikanischer Geheimdienst für den Fall.
Hauptkommissar Adam Danowski gilt trotz seines jüngsten Ermittlungserfolges als unberechenbar. Auch diesmal geht er eigene Wege. Die führen in eine Neubausiedlung inmitten weiter Moorwiesen am Rande der Stadt, an verlassene Orte und in düstere Geheimgänge.
«Raether schreibt überdurchschnittlich gut und gönnt nicht allein seinem Ermittler Kontur und Individualität.» Frankfurter Allgemeine Zeitung
«Ein komplizierter, atmosphärisch dichter Fall, den Raether mit der perfekten Mischung aus Spannung, Humor und Tiefgang erzählt. Der bisher beste deutsche Krimi des Jahres.» Brigitte
«Raether seziert das kleinbürgerliche Leben, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren. Die Sprache ist klar und reduziert, die Protagonisten sind erfrischend anders.» 3sat Kultur
Vita
Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u. a. für Brigitte, Brigitte Woman und das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, Regie führte Markus Imboden.
Inhaltsübersicht
Für meine Mutter, für meinen Vater
Blutapfel, der, des -s, plur. die -äpfel, eine Art kugelrunder, von außen rosenrother Äpfel, mit einem bluthrothen süßen Fleische.
Herders Conversation-Lexikon, 1854
Prolog
Am Ende war es doch immer das Gleiche: Schläge ins Gesicht, Schläge in den Magen, die Leber und die Nieren, Schläge in den Unterleib. Arbeitsteilung: Zwei Kollegen übernahmen die Fixierung, der dritte führte aus. Wenn es länger dauerte, wechselten sie sich ab. Diesmal dauerte es länger. Und Tracy Harris sah zu. Das war der vorgeschriebene Arbeitsablauf: Keine Befragung ohne Supervision, sie war als Analystin und nominell Vorgesetzte hier.
Sie runzelte die Stirn und spielte mit dem Gedanken, sich an die Wand zu lehnen. Ihre Füße taten weh in den falschen Schuhen, weil die Kollegen sie direkt aus dem Besprechungsraum geholt hatten. Der bei Lichte betrachtet nur ein Container war, aber wenn sie dort am Tisch mit den Jungs von der Armee, den privaten Dienstleistern und den konkurrierenden Behörden saß, trug sie amtliche Pumps und keine bequemen Sneakers. Und ein dunkelblaues Kostüm. Was dagegen sprach, sich hier während des Verhörs an die Wand zu lehnen: klassische Brache mit entkernter Werkshalle, die Wände vor Jahrzehnten geweißt, durch Ruß und Witterung grau schattiert, das würde Abdrücke hinterlassen auf dem dunklen Stoff.
«Harris», sagte der, der jetzt fürs Schlagen zuständig war, wahrscheinlich, weil er sich ausruhen wollte. «Haben Sie irgendwelche Fragen?»
Sie schüttelte den Kopf und winkte ab. Das hier war alles sinnlos. Der da auf dem Aluminiumstuhl saß und sich bearbeiten lassen musste, wusste nichts. Sein nackter Oberkörper hatte an vielen Stellen die Farbe von Auberginen der, wie sie in Deutschland sagten, Handelsklasse 1 angenommen, Blut lief ihm übers Gesicht, bis es in seinem Bart verschwand, und auf seiner hellen Jeans war ein großer Fleck mit vage geographischen Umrissen.
Waterboarding, dachte Tracy Harris, was für ein Witz. Das ganze jahrzehntelange Gerede, Hin und Her und Für und Wider, und am Ende prügelten sie halt einfach, weil es weniger Vorbereitung erforderte und, wie sie vermutete, weil es sich organischer, natürlicher anfühlte.
Normal, jemanden festzuhalten und zusammenzuschlagen.
Unnormal, jemanden sorgfältig festzuschnallen und mit Hilfsmitteln zu bearbeiten, und seien sie noch so primitiv. Und wenn sie eins gelernt hatte, dann, dass jeder ihrer Mitarbeiter und Kollegen vor allem den Wunsch hatte, normal zu sein.
Außerdem gab es vor Ort selten fließend Wasser. Hier, in den öden Landschaften am unübersichtlichen Rande Europas, wo sie und ihre Kollegen die leeren Räume, aus denen die sterbenden Industrien sich zurückgezogen hatten, mit neuem Leben füllten. Wenn man das hier Leben nennen wollte.
«Was weißt du? Was weißt du? Was weißt du?» Manchmal einfach nur so, drei- oder viermal hintereinander, ohne Pause, dann wieder voneinander abgegrenzt durch Schläge.
Sie schwitzte und schüttelte unmerklich den Kopf. Nach vier Tagen und Nächten in verdeckt aufgestellten Containern und leeren Hallen, mit keinem anderen Kontakt nach draußen als über Monitore und Satelliten, wusste selbst sie so viel weniger als zuvor. Die Frage hätte auch sie nicht mehr sinnvoll beantworten können: «Was weißt du?» Alles und nichts. Wo sind wir diese Woche? Hello Turkey, hello Northern Iraq, hello Azerbeijan, are you having a good time? Und sie wurde nicht mal geschlagen, trotzdem verlor sie langsam die Orientierung. Das hier war sinnlos, völlig sinnlos, und es war für sie und alle, die damit zu tun hatten, das Gegenteil dessen, worauf doch eigentlich alles hinauslaufen sollte: a good time. Ganz ehrlich, warum sonst machten sie das alles hier? Um die guten Zeiten zu schützen oder, falls es sie schon nicht mehr gab, zurückzuholen.
Und ihre Füße taten weh.
Immer wieder ließen sie ihm zwei oder drei Sekunden Pause, und währenddessen hörte Tracy Harris nichts als das gedämpfte Brummen der Generatoren, das Knarren ihrer Schuhe, den feuchten Atem des Verhörten. Aber das änderte sich jetzt. Er sprach.
«Birakin beni. Artik yapamiyorum. Birakin beni!»
Sprachen waren ihre Stärke und vielleicht ihre Flucht. In ihren Jahren als Offizierin und Analystin hatte sie viele gelernt. Die erste für die Karriere (Arabisch), die zweite aus Trotz (Deutsch), die dritte, weil sie sie brauchte (ein syrisch gefärbtes Kurdisch, wie es im Nordirak gesprochen wurde), die vierte nebenbei (Türkisch), weil sie davon umgeben war, und erst da war ihr aufgefallen, wie schwer es ihren Kollegen zu fallen schien, auch nur fünf gängige Redewendungen zu behalten, die dort verwendet wurden, wo sie sich monate- und manchmal jahrelang aufhielten. Die fünfte Sprache lernte sie, weil sie sich was beweisen wollte, und weil sie sich nach Osteuropa orientieren wollte, wenn das hier vorbei war: Ungarisch. Und eines Tages Mandarin, als letzte Herausforderung.
Jetzt aber Türkisch. Wenn ein Kurde aus dem Nordirak sich zu Wort meldete in der Sprache der verhassten Unterdrücker seines Volkes, dann bedeutete das, vermutete Tracy Harris, zwei Dinge. Zum einen, dass er auch sie für verhasste Unterdrücker hielt. Aus dieser Haltung konnte sie ihm auf Grundlage des augenblicklichen Sachverhalts keinen Vorwurf machen, wenn sie die Einschätzung auch nicht teilte. Zum Zweiten, dass er sie erreichen wollte, sein Englisch in diesem qualvollen Moment aber schon vergessen hatte, und dass er wirklich genug hatte, dass er wirklich nicht mehr konnte.
«Ondan haberim yok.»
Und dass er wirklich nichts wusste. Einer der drei Verhörer, den sie genauso wenig wie die anderen in diesem Zusammenhang als «Verhör-Experten» bezeichnet hätte, schlug ihm unvermittelt noch einmal ins Gesicht, mit der flachen Hand, und wies ihn, Hurensohn, an, Englisch zu sprechen. Sie sah, dass der Verhörte den Kopf sinken ließ, nicht aus Trotz, sondern weil er keine Kraft mehr hatte, ihn zu stützen. Und schon konnte sie vor ihrem inneren Auge nicht mehr rekonstruieren, wie unkenntlich sein Gesicht im Laufe der letzten zwanzig Minuten geworden war. An seinem blutüberströmten Oberkörper sah sie, dass er Anfang, Mitte zwanzig war. Er war dabei, sein Bewusstsein zu verlieren. Es war sinnlos, und es war eine Verschwendung, aber die drei Verhörer wechselten sich noch einmal ab.
Sie trat einen Schritt vor und merkte, dass ihre Waden sich verkrampft hatten vom viel zu starren Stehen im Raum. Auf einem Blechtisch außerhalb des Lichtkegels lagen die drei Dienstwaffen der Verhörer, vorschriftsmäßig abgelegt, bevor sie sich dem Gefangenen genähert hatten. Dreimal die gleiche SIG Sauer P226 im gleichen schwarzen Gürtelholster aus Funktionsfaser, für Tracy Harris durch nichts voneinander zu unterscheiden. Aber die Männer würden, wenn sie hier fertig waren, ihre Waffen auseinanderhalten können wie Kinder ihre iPods. Ihre Füße schmerzten, und ihre Beine gehorchten ihr nicht perfekt, als sie mit ein paar Schritten zum Blechtisch ging. Die drei beachteten sie nicht.
Tracy Harris nahm die mittlere der drei P226 vom Tisch, löste den Verschluss mit dem Daumen, ließ das Holster aufs Blech gleiten und lud die Waffe durch. Das metallische Schaltgeräusch bescherte ihr die volle Aufmerksamkeit zumindest von drei der vier Anwesenden. Bevor jemand sie daran hindern konnte, hob sie die Waffe und schoss dem Gefangenen aus etwa anderthalb Metern Entfernung mit sicherer Hand durch den Kopf.
Noch während der Knall sich entfaltete und sie ahnte, wie lange sie unter dem Pfeifen in ihren ungeschützten Ohren leiden würde, wusste sie, dass der Gefangene tot war. Blut, Knochensplitter und Hirnmasse hatten sich durch die Austrittswunde auf den Betonboden hinter ihm verteilt und auf die, die ihn festgehalten hatten, und die jetzt jeweils zwei, drei Schritte zurückgewichen waren, in ihre Richtung. Sie spürte, wie der Dritte ihr den Arm auf den Rücken drehte. Während ihr der Schmerz durch den Oberkörper bis in die Stirn fuhr, sah sie an seinen Lippen, dass er «Dämliche Fotze!» schrie, stupid cunt, das Erste, was ihnen allen immer zuverlässig einfiel.
Aber ihr habt doch gesehen: Er konnte nicht mehr, er wusste nichts, er bat nur noch darum, dass es aufhört. Zeigt ein bisschen Respekt, dachte sie, ein bisschen Respekt.
Als ihr Kollege sie losließ, streifte sie als Erstes die Schuhe ab. Ihr graute vor den Disziplinarausschüssen und den ernsten Gesprächen, den Berichten, die sie würde schreiben müssen, vor der Evaluation, vor den vielen, vielen Worten, bis das hier ausgestanden war, und am Ende wohl auch vor der Degradierung und der Versetzung.
Aber der kühle, sandige Betonfußboden unter ihren Füßen, spürbar, nur leicht gedämpft durch ihre dunklen Nylonstrümpfe, fühlte sich herrlich an.
1. Kapitel
Hauptkommissar Adam Danowski war enttäuscht von der Rosine. Ja, er fühlte sich von ihr im Stich gelassen. Er hatte sich das besser vorgestellt mit ihr, so, dass da was passieren würde zwischen ihm und der Rosine.
Jetzt saß er hier und sah, wie die anderen abgingen mit der Rosine, die waren richtig vertieft in die, die liebkosten die Rosine mit den Fingern, die drehten und drückten sie ganz nah an ihren Ohren und lauschten der Rosine, die schnüffelten mit geschlossenen Augen an der Rosine, als berge deren Aroma wortlose Antworten auf alle Fragen. Er kriegte irgendwie nichts mit von der Rosine. Er dachte stattdessen an seinen Kollegen Finzi, der nach einem Alkoholrückfall im Koma gelegen hatte und jetzt im Pflegeheim war. Und auf Ansprache nicht reagierte. Der saß nur da und starrte vor sich hin. Eigentlich die perfekte Meditation. Der brauchte keinen Kurs mehr.
Er müsste seinen alten Partner und, ja, Freund Finzi dringend besuchen. Wie lange war das jetzt her? Fünf Monate? Wie konnte es sein, dass jemand fast ein halbes Jahr lang keine Gelegenheit fand, einen kranken Freund im Pflegeheim zu besuchen? Wobei: krank. Was hieß schon krank. Sein Vorgesetzter Behling sagte: Der sieht eigentlich ganz gesund aus. Besser als vorher. Vielleicht, weil sie ihn bei Wind und Wetter nach draußen schieben, der hat ordentlich Sonne gezogen diesen Sommer. Aber der sitzt nur da und sagt nichts und starrt vor sich. Unheimlich. Und wenn Behling schon «unheimlich» sagte, dann wusste Danowski: Es musste die Hölle sein.
Aber die Freundschaft. Und die Pflicht. Nur, heute war es natürlich auch schon wieder zu spät. Bis er hier raus war, war es 21 Uhr durch, die hatten längst keine Besuchszeit mehr im Pflegeheim, und morgen musste er die Kinder nach der Arbeit zum Fußball und zum Tanzen fahren, das war knapp genug, vor allem, wenn Behling ihn vorher wieder in irgendein Psychogespräch verwickelte über …
Scheiße, dachte Danowski. Konzentrier dich auf die verdammte Rosine. Die Kursleiterin Franka hatte sie verteilt, damit sie sich «einließen» auf die Rosine, sie wirklich «erfuhren», ein erster Anfang, um achtsam im Moment zu leben. Warum war er der Einzige hier, der nichts anfangen konnte mit der Rosine? Ihm war klar, dass die Rosine ja nur eine Art Platzhalter war, hier ging es gar nicht um die Rosine an sich, die Rosine war nur ein Anlass, sich wirklich nur auf das zu konzentrieren, was man unmittelbar vor sich hatte, die Gegenwart, den Augenblick.
Leslie liebte Rosinen. Sie mochte Rezepte, in denen Rosinen vorkamen. Seine Frau war der einzige Mensch, den er kannte, der nicht aus dem Apfel- oder Kranzkuchen, den der Backshop hochgejagt hatte, die Rosinen rauspulte. Für ihre Kinder und ihn sahen die Rosinen im Kuchen aus wie Wasserleichen von Stubenfliegen. Leslie mochte auch Couscous mit Rosinen und so was. Salat. Er würde mal was für sie kochen mit Rosinen, wenn sie Schulleiterin war und er auf Teilzeit. Wenn. Wenn, wenn, wenn. Falls. Da mussten sie jetzt auch mal dringend drüber reden. War das die richtige Entscheidung? Die aktive Ermittlungsarbeit endgültig an den Nagel zu hängen, damit seine Frau Karriere machen konnte? Es gab so viel, worüber er mit allen möglichen Leuten dringend reden musste.
Die anderen waren alle schon viel weiter mit der Rosine, die rollten das Ding neben ihrem Ohr und horchten und lächelten, und er saß hier und dachte an seinen alten Kollegen und seinen verdammten Chef und seine erfolgreiche Frau.
«Na, Adam», sagte Franka, die Kursleiterin. «Bei dir dreht sich ja wieder das Gedankenkarussell, oder?»
Danowski lächelte schuldbewusst. Nachdem der Amtsarzt ihn evaluiert und nichts bei ihm festgestellt hatte, als das, was Danowski schon wusste, hatte er ihm einen Meditationskurs empfohlen. Achtsamkeits-Meditation, ein «gangbarer Weg», um mit dem Stress klarzukommen, den Danowskis Hypersensibilität ihm verursachte. Obwohl, empfohlen war vielleicht der falsche Ausdruck: Der Amtsarzt hatte vor Danowskis Augen bei der Kursleiterin angerufen und ihn angemeldet.
«Ich kenn doch meine Pappenheimer», hatte der Amtsarzt gesagt, «ihr büxt mir immer aus, wenn’s an die Achtsamkeits-Meditation geht. Ihr sitzt hier bei mir aufm Amt und lächelt und nickt, und dann meldet ihr euch nicht an. Darum mach ich das jetzt immer gleich selbst. Die Franka ist eine Gute, die kenn ich schon lange, bei der war ich auch mal. Ja, auch Amtsärzte geraten in Stress. Also, das ist eine gute Sache: Achtsamkeit, da lernen Sie, im Moment zu leben, sich nicht zu viele Sorgen zu machen, und vor allem, Sie lernen, sich selbst von Ihren Gefühlen und Eindrücken unabhängig zu machen. Sie sind nicht der Stress, Sie sind nicht Ihre Gefühle, Sie können sich im Alltag Freiräume zurückerobern, die …», und so weiter und so fort, der Amtsarzt redete viel, und Danowski nickte dazu.
Hypersensibilität bedeutete, dass zu viele Eindrücke ungefiltert auf ihn einstürmten und er Mühe hatte, sie zu ordnen und zu verarbeiten. Darum war er schneller überfordert und gestresst als andere. Und deshalb saß er jetzt hier. Und immer, das hatte Franka ihnen gleich erklärt, fing es damit an, eine Rosine zu erforschen. Sich einzulassen auf eine Rosine. Sie wirklich wahrzunehmen.
«Lass es laufen», sagte Franka. «Nimm die Gedanken zur Kenntnis, aber häng ihnen nicht nach.»
«Gar nicht so einfach», sagte Danowski konstruktiv, und die anderen, durch ihn aus ihrer Rosinenbetrachtung gerissen, nickten zustimmend.
«Darum üben wir das ja auch. Und wir haben ja gerade erst angefangen», sagte Franka. «Du kannst hier nichts falsch machen. Hier kann keiner gewinnen oder verlieren.»
Na gut, dachte Danowski. Franka war nicht viel jünger als er, vielleicht Ende dreißig, sah aber deutlich frischer aus und hatte eine phantastische Körperhaltung in ihrem dunkelgrünen ärmellosen Yoga-Dress. Er war ein bisschen verknallt in ihre Schultern, die gefielen ihm am besten am Meditationskurs. Besser jedenfalls bei weitem als die Rosine. Und so eine Haltung wie Franka wollte er auch. Unwillkürlich richtete er sich auf seinem Meditationskissen auf.
«Lasst euch einfach noch mal fünf Minuten ein auf die Rosine», sagte Franka. «Und schmeckt sie auch am Ende.»
Die anderen lächelten, als freuten sie sich darauf. Danowski betrachtete die Rosine und schob alles weg von sich, erst aktiv, dann schien es ihm, als könnte er in den kakerlakenbraunen Runzeln der Trockenfrucht wirklich nichts anderes mehr sehen als Rosinenfalten. Und der Geruch war einfach nur Wald, süßer Boden, ausblühende Lilien, was Dunkles, und nicht mehr zuerst die Erinnerung daran, dass Rosinen die einzige Süßigkeit waren, die sein Vater ihm und seinen Brüdern erlaubt hatte. Er spürte, dass er ganz tief drin war in der Rosine. Dann sah er aus den Augenwinkeln, dass die anderen dabei waren, die Rosine endlich zu essen. Er hob die Hand an den Mund und konnte es nicht. Er mochte Lebensmittel, die frisch aus der Packung kamen, nichts, was er zehn oder fünfzehn Minuten in der Hand und zwischen den Fingern gewendet hatte, am Ohr und unter der Nase. Er tat, als steckte er die Rosine in den Mund und als kaute er sie, in Wahrheit verbarg er sie jedoch in der Handfläche.
Franka schlug die Zimbel, um das Ende der Übung zu markieren. Danowski schämte sich ein bisschen fremd für das Geräusch, weil es so ungeschützt und freundlich war. Dann richtete er sich auf wie Franka und presste die Rosine in seiner rechten Hand. Wohin jetzt damit?
«Und, wie ist es euch ergangen?»
Tja, dachte Danowski ratlos und schwieg wie die anderen. Aber Franka hatte kein Problem damit, Stille auszuhalten. Die Frau auf der Wolldecke schräg gegenüber von Danowski machte ein unverbindliches Ich-glaub-ich-sag-gleich-was-Geräusch dicht unterhalb eines Räusperns, und im Raum breitete sich Erleichterung aus wie Plätzchenduft in der Vorweihnachtszeit.
Warum bin ich eigentlich der einzige Mann hier?, dachte Danowski. Sind außer mir nur Frauen gestresst, oder geben es nur Frauen zu? Verdammt, jetzt hatte die gegenüber schon zu Ende geredet, und er hatte nicht zugehört. Bei der Nächsten nahm er sich fest vor, besser aufzupassen, das war die Studentin, aber warum war die eigentlich gestresst? In dem Alter hatten Leslie und er sich abends schön einen Joint geteilt, den die Kollegen von der Streife mitgebracht hatten, das war deutlich weniger zeitintensiv gewesen, als sich hier einmal die Woche ins Nachbarschaftsheim Bahrenfeld zu schleppen. Nach der Schicht.
«Und bei dir, Adam?» So eine Runde war doch ganz schön schnell rum. Das war ihm schon am Anfang beim Vorstellen so gegangen: Kein bisschen zugehört, weil zu beschäftigt, sich zurechtzulegen, was er gleich sagen würde, und, zack!, war er auch schon dran gewesen. Seine Arbeit bei der Mordbereitschaft hatte er verschwiegen, für die Frauen im Meditationskurs hier war er in der Personalplanung bei der Kripo, er hatte das ganz vage gelassen, und irgendwie stimmte es ja auch: Danowski plante, wie es mit der Personalie Danowski weitergehen sollte, kam nur zu keinem rechten Ergebnis dabei.
Alle Augen ruhten auf ihm. Er merkte, wie seine Knie heiß wurden unter der Decke, die er sich in einem Anflug von Rentnertum über die Beine gelegt hatte wie Opa vorm «Blauen Bock». In seiner Handfläche machte die Rosine ungerührt ihr Ding und klebte vor sich hin.
«Also, ganz ehrlich», sagte er und war selbst gespannt, was jetzt seine große Ehrlichkeitsoffensive sein würde, «nachdem ich mich drauf eingelassen hatte, fand ich’s ganz toll.»
Franka sah ein bisschen enttäuscht aus, aber vielleicht bildete er sich das nur ein: Wo, wenn nicht hier, sollte es erlaubt sein, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und einfach irgendeinen Blödsinn zu erzählen?
«Du kommst mir wahnsinnig bekannt vor», sagte eine freundliche Frau vom Bezirksamt, Anfang sechzig, im Job auf dem Abstellgleis, die links zwei Kissen neben ihm saß, sodass er sich im Schneidersitz vorbeugen musste, um einen Dialog mit ihr zu ermöglichen. Warum hatte er angeberisch diesen Schneidersitz probiert, sie sollten doch bequem sitzen, nur, weil Franka den so gut konnte, jetzt befürchtete er jeden Augenblick Auskugelungen der Hüftgelenke.
«Echt? Vielleicht von meinem Passfoto, ich verlier den öfter», sagte er, und ein paar kicherten über seinen Scherzversuch, am ersten Abend wurde ja alles gern genommen.
«Nee, Pässe mache ich schon lange nicht mehr», sagte die Frau vom Bezirksamt. «Ich bin ja da weggemobbt worden. Ich kenne dich aus dem Fernsehen, meine ich.»
«Du verwechselst mich mit dem jungen Rudi Cerne.»
«Oder mit Kurt Krömer ohne Brille», sagte die Studentin halblaut, worüber jetzt schon lauter gekichert wurde, man musste aufpassen, dass das hier nicht ausartete. Franka ließ schon die Hand über der Zimbel schweben.
«Geschützter Raum», sagte sie freundlich. «Bitte bedrängt Adam nicht, wenn er nicht über sich sprechen möchte.»
«Ach, du Armer», sagte die Frau vom Bezirksamt, «jetzt weiß ich wieder. Du bist der Polizist, der auf diesem Kreuzfahrtschiff hier im Hafen gefangen war. Als dieses Killervirus ausgebrochen ist. Im Frühjahr.»
Danowski nutzte das allgemeine «Stimmt ja!» und laute Durchatmen, um die Rosine kurz und humorlos im Schutze der fliederfarbenen Wolldecke in den Tretford-Teppich des Meditationsraums zu schmieren. Wenigstens die war er los.
2. Kapitel
Auf den blaugrauen Teppichfliesen im Flur lag Glas, das andere aus den Sichtfenstern der Klassenraumtüren geschlagen hatten. Verstreut in Tausenden eckigen Teilchen, die Überreste von Sicherheitsscheiben. Vermischt mit den leicht gerundeten, milchig weißen Splittern der Neonröhren von der Flurdecke. Trickster atmete flach unter seiner Maske und ging mit sorgfältig hochgezogenen Knien auf Zehenspitzen. Er durfte kein Geräusch verursachen, wenn er sie finden wollte. Diesmal würde sie ihm nicht entkommen.
Er nannte sie Erdmännchen, weil sie gut im Verstecken war. Bis sie ihren Kopf mit den großen Augen aus einem Loch streckte, um zu sehen, wie nah er ihr schon war.
Durch die fensterlosen Türen fiel unterbrochenes, diffuses Herbstlicht in den Flur. Die Luft war fast so kalt wie draußen zwischen Waldrand und Autobahnzubringer, und Trickster stellte sich vor, wie ihr Körper dampfen würde, wenn er sie nach der Jagd zu Boden drückte. Er hielt inne und freute sich an seiner Erregung. Die Stadt gehörte ihm und damit die ganze Welt, er hatte die Macht, den Tag zur Nacht werden zu lassen.
Als er den Fuß wieder auf eine Teppichfliese setzte, trat er auf eine Neonröhrenscherbe. Ein Knacken und Knirschen, als wäre ein Insekt gestorben. Trickster hielt den Atem an. Huschte da was hinter den zugetaggten Flügeltüren zum Treppenhaus? Nein, er hörte nur den sturen Nachmittagsverkehr, der sich Richtung Wohnmeile Halstenbek-Krupunder wälzte.
Er hatte Erdmännchen zehn Minuten Vorsprung gelassen, um die Jagd interessanter zu machen. Er kannte ihr Temperament, sie würde sich nicht einfach in einem Putzmittelschrank oder einer Lehrertoilette verstecken, bis er das Gebäude bei Einbruch der Dunkelheit wieder verlassen würde: Sie war eine, die in Bewegung blieb und bei der es nicht undenkbar war, dass sie jeden Augenblick hinter ihm auftauchte und ihn ihrerseits zur Strecke brachte. Sein Herz schlug ein wenig schneller, und er ärgerte sich, dass er hinter der Maske nicht tiefer atmen konnte. Andererseits, wenn das Asbest nicht gewesen wäre, dann wäre das hier noch immer eine voll funktionstüchtige Berufsschule für kaufmännische Berufe, ein Ort, der ihm verwehrt geblieben wäre. Dass es so teuer war, ein mit Asbest verseuchtes Gebäude vorschriftsmäßig abzureißen, hatte ihm viele aufregende Tage und Nächte in den Ruinen von Hamburg beschert.
Er kam langsam voran, aber sein Instinkt sagte ihm, dass sie die Treppe nach oben genommen hatte: Sie floh nicht gern Richtung Keller, wo es so viel dunkler war als hier, und als er sie hergebracht hatte, hatte sie gesehen, dass das Erdgeschoss mit Brettern und Schutzfolie verrammelt war, das perfekte Gefängnis. Trickster erinnerte sich, wie er sie über die Schulter geworfen und seine Bauarbeiterleiter hinauf zu einem kaputten Fenster im ersten Stock getragen hatte. Ihr Hintern direkt neben seinem Gesicht, und wie sie versucht hatte, mit den Beinen zu strampeln. Er lächelte. Ihm ging es so viel besser inzwischen, manchmal konnte er es selbst kaum fassen. Vor zwei, drei Jahren war es ihm egal gewesen, ob er lebte oder starb. Jetzt zog er das Leben jenseits der Menschenwelt gierig in sich ein.
Die Tür zum Treppenhaus klemmte, er ahnte ihr metallisches Quietschen, egal, wie vorsichtig er beim Dagegendrücken war. Trickster nahm seinen Rucksack ab und lehnte sich an die Tür. Er schob die Atemmaske unters Kinn, für einen Moment war das okay, und nachher, wenn er sie gefunden hatte, würden sie schließlich auch keine Masken tragen, bis alles vorbei war. Taschenlampe in den Mund, dann leuchtete er in den Rucksack, bis er das Silikonöl gefunden hatte. Er sprühte es in die Scharniere, verstaute es, setzte den Rucksack wieder auf und öffnete die Tür lautlos. Am Geländer hatte er eine Eingebung: Er nahm eine leere Bierdose vom Boden und ließ sie zwei Stockwerke tief ins Treppenauge fallen, sodass es sich anhörte, als hätte er sie aus Versehen im Erdgeschoss umgetreten.
Im nächsten Stockwerk waren die meisten Klassenzimmer verschlossen, und die Toiletten stanken nach all den Jahren immer noch so, dass er sich nicht vorstellen konnte, sie hier zu finden: Ihre Nase war empfindlicher als seine. In einem Klassenzimmer lag eine zusammengerollte Matratze hinter einem Fort aus drei umgestürzten Tischen, daneben eine halbvolle Aldi-Tüte und eine erloschene weiße Adventskerze. Trickster berührte den Docht, hart und kalt, aber jemand würde heute Nacht herkommen. Bis dahin wäre er fertig mit ihr.
Er ging ein paar Schritte rückwärts und scannte dabei gewohnheitsmäßig die Fensterbretter nach einem Zeichen vom bleichen Diener ab. Immer noch keins, das ganze Gebäude war bisher clean. Trickster spürte, wie ein wenig Anspannung von ihm wich. Der bleiche Diener war der Einzige, der sein Nachtglück störte. Wo der bleiche Diener sein Zeichen hinterließ, war Trickster nur Zweiter, und das war schlimm, denn: Das Gelände, das Gebäude, diese eine ganz spezielle Welt gehörte dem, der als Erster dort sein Zeichen machte. Und das war viel zu oft der bleiche Diener.
Trickster öffnete noch einmal seinen Rucksack und nahm, als er die Wand erreicht hatte, die schwarze Sprühdose heraus. Nicht ideal, sein Zeichen genau hier zu hinterlassen, wo ein Schläfer sein Nachtquartier aufgeschlagen hatte. Aber manchmal hatte er für Sekunden das Gefühl, dass der bleiche Diener vielleicht sogar in der Nähe war und dass es darum keine Zeit zu verlieren galt.
Er verzog das Gesicht, weil die Sprühdose jedes Mal lauter zischte, als er in Erinnerung hatte. Der berauschende Duft drang durch die Atemmaske, als Trickster an der Wand sein Zeichen hinterließ.
Dann folgte er den Schildern Richtung Mensa, die letzte Treppe weiter nach oben. Links und rechts die Lehrerzimmer und Sekretariate, am Ende des kurzen Ganges sah er schon am veränderten Licht, dass das Stockwerk sich in einen großen Raum öffnete, den Esssaal. Er nahm aus den Augenwinkeln wahr, dass die Büros davor leer waren, und er gab sich jetzt keine Mühe mehr, nicht auf Glas zu treten. Das Knirschen und Splittern unter seinen Füßen war triumphal, er stellte sich vor, wie sie ihn näher kommen hörte und wusste, dass sie ihm jetzt nicht mehr entkommen konnte.
Trickster sah an ihrer Körpersprache, dass sie Angst hatte. Im großen Speisesaal waren nur ein paar Esstische stehen geblieben, und ein paar vereinzelte Stühle waren lustlos aufgereiht an den Wänden, als habe ein Entrümpelungsunternehmen den Enthusiasmus verloren oder vor Ende des Auftrags neue Informationen über Asbest erhalten. Keiner der verlassenen Orte, an denen Trickster sein Glück fand, war je vollständig und makellos ausgeräumt, jeder dieser Orte verharrte am Ende in einem halbleeren Zustand aus Plünderung, Vandalismus und Kapitulation.
Er ging zu ihr, sachte, um sie nicht zu erschrecken. Ihr schwarzes Haar endete weit über dem Anorak. Daran, wie sie im Stehen die Beine kreuzte, sah er, dass sie alles andere als bereit für ihn war. Er nahm sie an der Schulter und drehte sie in seine Richtung. Sie hatte den Blick gesenkt, und im fahlen Licht des Herbstnachmittags verstand Trickster zuerst nicht, ob sie ihm auswich oder etwas in ihrer Hand, zwischen ihren Fingern studierte.
Er atmete scharf aus, denn er ahnte, was sie in ihrer schmalen Faust vor ihm verbarg. Er öffnete ihre Finger, als wäre es ein Spiel, sie wehrte sich, aber er war stärker.
Ein Projektil, wie er es schon fast zwei Dutzend Male gefunden hatte: Eine frische Kugel, die wie immer ihm galt. Mit einer winzigen Gravur, die man bei diesem Licht mit bloßem Auge nicht lesen konnte, aber die Trickster unter dem Daumen spürte, geschwungene Schrift in einem Oval. «Your pale servant», dein bleicher Diener.
Er wusste nicht, was der Name bedeuten sollte und warum er in Englisch war, aber das Zeichen sagte ihm: Der bleiche Diener war ihm wieder zuvorgekommen. Im Grunde wie fast immer. Er schloss ihre Hand wieder zur Faust und stellte die Patrone vorsichtig zurück auf das Fensterbrett, dort, wo sie einen kleinen runden Abdruck im giftigen Staub hinterlassen hatte. Er wollte dem bleichen Diener nicht die Genugtuung geben, sich einbilden zu können, Trickster sammele seine Erkennungszeichen oder nehme sie auch nur zur Kenntnis. Obwohl er sie natürlich sammelte, aber eben nicht sofort: Trickster kam immer irgendwann zurück, wenn ihr Wettstreit längst woanders stattfand, und entfernte die Zeichen seines Gegners, damit auf Dauer keine Spur von ihm blieb.
Sie legte ihm die Hand auf den Arm, als wollte sie ihn trösten. Sie wusste genau, wie er sich fühlte. Trickster zog sie an sich und küsste sie auf ihren Scheitel. Einen Moment versuchte sie, sich ihm zu entziehen, aber dann ergab sie sich in seine Umarmung. Sie roch nach Keller, aber nicht einmal das konnte ihn jetzt noch erregen. Auch das hatte der bleiche Diener ihm verdorben.
3. Kapitel
«Wissen Sie, was mich wundert, Adam», sagte die Chefin und sah an ihm vorbei aus dem Fenster. «Sie gehören zu den wenigen Kollegen in der Mordbereitschaft, die kein Versetzungsgesuch eingereicht haben.»
Danowski betrachtete seine leeren Hände. Wenigstens eine Rosine wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Er mochte keine Termine bei der Chefin, und seit sein Kollege Behling ihn wegen dieser Hypersensibilitätsgeschichte als labil hingestellt hatte, wollte die ihn ständig sprechen. Also, alle zwei Monate in etwa. Das wurde ihm langsam zu viel.
«Die Situation ist ziemlich absurd, das stimmt», fuhr die Chefin fort, als hätte er was gesagt, «und inzwischen habe ich fast dreißig Versetzungsgesuche hier. Stand ja sogar in der Zeitung. Die meisten davon werden wieder zurückgezogen werden, ist mir klar, dass das ein politisches Signal ist, weil die Mordbereitschaften in Zukunft bei freien Kapazitäten in anderen Abteilungen aushelfen sollen. Wie sehen Sie denn die Sache?»
«Werden halt nicht mehr genug Leute umgebracht in der schönsten Stadt der Welt», sagte Danowski müde. Er war Anfang des Jahrhunderts aus seiner Heimatstadt Berlin nach Hamburg gekommen und hatte sich nicht daran gewöhnen können. «Das ist doch ein schöner Erfolg der Sozialpolitik und der Polizeiführung. Ändert sich vielleicht, wenn Crystal Meth seinen vollen Zauber entfaltet. Aber das wird zwei, drei Jahre dauern. Dann wollen die Kollegen alle wieder zurück in die Mordbereitschaften. Warum soll ich also zweimal Formulare ausfüllen. Außerdem habe ich nichts dagegen, zwischendurch ein paar Eigentumsdelikte oder so was zu machen.»
Na gut, die Chefin wusste, dass das nicht alles war.
«Ist das der Grund, warum wir diesen Termin haben?», fragte Danowski.
«Es gibt ein Gerücht, dass Sie auf Teilzeit gehen wollen.»
«Es gibt auch das Gerücht, dass ich meinen Partner in den Suff getrieben habe», wandte Danowski ein, um das Ganze ein bisschen zu relativieren; Teilzeit war hier das ultimative Schimpfwort.
«Was ist mit dieser Teilzeitgeschichte?»
Man konnte nicht auf Teilzeit gehen und weiter Tötungsdelikte ermitteln. Er mochte seine Chefin. Er seufzte.
«Meine Frau hat eine gute Chance, befördert zu werden. Das wäre insgesamt schwierig, mit mir in Vollzeit, Bereitschaftsdienst und so weiter.»
«Und?»
Er musste lächeln. «Und» war das stärkste Wort bei jeder Befragung. «Ich denke drüber nach, mich auf die Tauschliste setzen zu lassen. Leichter, eine Vollzeitstelle hier im Dezernat zu tauschen, da wollen ja auch immer wieder gute Leute hin. Vielleicht Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, irgendwas auf dem Dorf. Und dann von da aus Teilzeit.» Stellen in anderen Bundesländern fand man nur, wenn man einen Tauschpartner hatte. Und wenn die Vorgesetzten zustimmten. Jetzt war es raus. Es fühlte sich an, als hätte er seinen Dienstausweis und die Waffe auf den Tisch gelegt.
«Sie wollen Dorfpolizist werden?»
Vielleicht, um meinen Vater zu ärgern, dachte Danowski. Der alte Westberliner Revoluzzer hatte nie verstanden, warum sein jüngster Sohn gegen die linksradikale Familientradition in den Polizeidienst gegangen war. Polente in Verbindung mit Provinz, das würde nach all den Jahren echt noch mal einen draufsetzen.
«Die neue Schule wäre südlich der Elbe. Meine Frau denkt drüber nach, aufs Land zu ziehen.»
«Sie sind doch Stadtmensch, Adam. Hauptstadt und so.»
Er zuckte die Achseln. Er wusste nicht, was er für ein Mensch war. Wie lange wollten die Büros hier eigentlich noch nach Auslegware riechen. Die Chefin zögerte ein bisschen, als wollte sie ihm jetzt Beziehungsratschläge geben: nicht immer nur die Bedürfnisse des anderen erfüllen, kommunizieren, was man selber will.
«Ich würde es ja gern sehen, dass Sie hierbleiben und sich durchbeißen», sagte die Chefin. «Ich hab gehört, dass Sie sich mit Entspannungstechniken beschäftigen, und Sie wissen ja, dass Sie immer … also, wenn Ihnen das zu viel wird, zwischendurch, wir haben ja auch Ruheräume, wissen Sie …» Sie war schlecht darin, zu persönlich zu werden. Umso besser.
«Ich weiß», sagte er. «Ist halt nur die Frage, ob ich nicht irgendwo anders besser aufgehoben bin, und jemand anders hier, also …» Er zuckte die Achseln.
«Sie wissen, ich halte was von Ihnen, so als Polizist, nur …» Die Chefin beugte sich vor, getrieben offenbar von dem dringenden Bedürfnis, das am Abroller festgeklebte Bandende eines Tesafilms freizupulen. Danowski hatte sie noch nie so verlegen gesehen. Jetzt staunte er aber langsam. «Ich werde Sie nicht mehr lange dabei, äh, begleiten können. Ich gehe in den Ruhestand.»
«Oh», sagte Danowski. Das war schlecht.
«Ende des Jahres.»
«Wie schade. Obwohl, Ihre, äh, Frau wird sich sicher freuen. Nehme ich an.» Dass er jedes Mal «äh» sagte, wenn er von der Frau seiner Chefin sprach, konnte auch im Ernst nicht wahr sein. Wie konnte man, wenn es einem doch völlig egal war, ob die Chefin Männer oder Frauen oder beide liebte, jedes Mal plötzlich so verklemmt sein? War es die Angst, verklemmt zu wirken, die ihn verklemmt machte? Und wie verklemmt war das eigentlich?
«Ach, Marion wird sich noch wundern, wenn ich …», fing die Chefin an, das gängige Repertoire an Ruhestands-Klischees anzukurbeln, als sie jäh unterbrochen wurden. Durchs Gesicht der Chefin lief was Gequältes. Knud Behling, Danowskis Teamleiter, hielt sich nicht lange damit auf, seinen grau geföhnten Schädel durch die Tür zu schieben. Jetzt stand er schon mitten im Raum.
«Seid ihr so weit? War ja abgemacht, dass ich dazukomme.» Behling setzte sich in den Besucherstuhl neben Danowski, der von dieser Abmachung gar nichts wusste, und hielt ihm die Hand zum Schütteln hin, obwohl sie sich heute schon mehrfach zugenickt hatten. Offizieller Anlass offenbar.
«Bisschen früh, Knud», sagte die Chefin.
«War gerade in der Nähe», sagte Behling und strich seine Bundfaltenhosenbeine glatt. «Und nach Gesprächsleitfaden müsstet ihr das meiste hinter euch haben. Hast du Adam von der Beförderung erzählt?»
«So weit waren wir noch nicht», sagte die Chefin steif.
«Ich werde befördert?», fragte Danowski, der jetzt doch langsam anfing, sich zu wundern. Andererseits: keine schlechte Idee, gut war er im Grunde ja doch, trotz Hypersensibilität und Überforderungsangst, also vielleicht Stellvertreter-Stelle, nur noch administrativer Kram. Das würde passen. Wer hätte gedacht, dass Leslie und er beide mal Chefs werden würden. Hey, wir kaufen uns eins von diesen Townhäusern, scheiß aufs Land, dachte Danowski.
Behling lachte von Herzen, was selten war, meistens kam das bei ihm aus der Nase. «Nee, Adam, nicht du. Ich werde befördert. Ich mach den Nachfolger hier ab Januar.»
«Ja, ja. Nee, nee, klar.»
«Stellvertreter macht Kienbaum, der ist jetzt so weit.»
«Herzlichen Glückwunsch.»
«Richte ich ihm aus.»
«Nee, für dich, Knud.» Zugegeben, das klang ziemlich düster, wie er das so rauspresste.
Die Chefin richtete sich auf. «Ich wollte Ihnen das eigentlich gerade sagen, Adam.»
«Vorwarnung geben», erklärte Behling.
«Wir machen hier einen, na, weichen Übergang», sagte die Chefin. «Das heißt, Knud Behling und ich werden …»
«Ich hab meine Finger schon im Teig», unterbrach Behling.
Die Chefin seufzte.
«Und das heißt was?», fragte Danowski.
«Du wirst dringend gebraucht», sagte Behling feierlich. «Du weißt, die Kollegen meckern, weil sie sonst wo aushelfen sollen. Mordbereitschaften sind überbesetzt. Kennst ja die ganzen Versetzungsgesuche. Und da kommst du ins Spiel.»
«Ich kann die gern weiterleiten, die Versetzungsgesuche», sagte Danowski konstruktiv.
«Nee, Adam. Du bist das Trostpflaster für die richtigen Mordbullen. Die haben alle Angst, dass sie in Zukunft bei Flaute Materialbeschaffe und Dienstpläne machen oder Diebstahlanzeigen aufnehmen sollen. Aber …» Kunstpause: «Das machst dann alles du. Ich kommunizier denen, dass wir dich und Jurkschat dafür abstellen, inoffiziell. Dann hast du deine Ruhe, und wir können uns auf die Arbeit konzentrieren. Win-win, sag ich mal.»
Eigentlich fast genau das Richtige für ihn. Aber wenn Behling das wollte, konnte es ihm nicht gefallen. «Warum Jurkschat?», fragte Danowski. «Die hat dir doch nichts getan. Die betet dich doch an.» Aufpassen, dass man jetzt nicht unsachlich wurde.
Behling wiegte sein prächtiges Haupt. «Die Deern ist noch nicht so weit.»
Die Chefin verzog das Gesicht, als hätte sie auf was Ekelhaftes gebissen, das sich andererseits schnell runterschlucken ließ.
Danowski nickte. «Materialbeschaffe.»
«So was halt. Werden wir ja sehen. Musst dich auf jeden Fall nicht mehr im Nahkampf stressen. Gut gelaufen für dich, würde ich sagen. Im Felde unbesiegt. Ihr bleibt pro forma im Bereitschaftsdienst, Jurkschat und du. Falls was richtig Großes ist. Was mit Schiffen oder so.»
In seinem Büro setzte Danowski sich an den Rechner und schrieb in wenigen Sätzen sein Teilzeitgesuch. Niemals würde er irgendwo arbeiten, wo Knud Behling der Endboss war. Er druckte das Dokument aus und legte es in einen leeren Aktendeckel. Das würde er bei nächster Gelegenheit der Chefin geben. Dann schloss er die Augen und wartete auf irgendwas. Oder genauer gesagt: auf seinen letzten Fall.
4. Kapitel
Am Morgen seines Todestages beschloss Oliver Wiebusch, ein paar Minuten länger liegen zu bleiben.
Eigentlich war er Frühaufsteher, aber hin und wieder erlaubte er sich, aus seiner Routine auszubrechen. Nur, wenn man das tat, wurde einem die eigene Disziplin erst wieder so richtig klar. Er nannte es den Luxus des Asketen. Außerdem war es gestern Nacht spät geworden, er war zu lange draußen geblieben, gefangen in seiner Leidenschaft. Und wenn er jetzt ein paar Minuten länger liegen blieb, hieß das, er würde immer noch bei weitem als Erster in der Siedlung aufstehen, Stunden vor den anderen. Er hatte keine Zeit zu verlieren. Nie.
Das mit dem Todestag war ihm vor ein paar Jahren bei einer Schulung der Firma eingefallen. Klar, es war eigentlich um Adress-Beschaffung, Datenauswertung und andere langweilige Tätigkeiten gegangen, aber die Trainerin hatte einen Spruch ans Whiteboard geschrieben, der Wiebusch sofort eingeleuchtet hatte: «Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens.» Damit er und die anderen Teilnehmer sich bewusst machten, dass sie keine Zeit zu vergeuden hatten. Wiebusch, der Dinge gern bis zum Anschlag festdrehte, hatte auf die leicht blumige Handschrift der Trainerin gestarrt und gedacht, dass das nicht schlecht war, aber dass man es noch steigern könnte. Würde man nicht noch bewusster, entschiedener und zielgerichteter leben, wenn man jeden Tag mit dem Gedanken begönne: Heute ist dein letzter Tag auf Erden? Heute ist der Tag, an dessen Ende du stirbst? Lebe jeden Tag, als ob es dein letzter wäre. Oder, wie er es für sich im Laufe der Jahre abgekürzt hatte: Heute ist dein Todestag.
Mach das Beste draus.
In seinem Fall hieß das: An seinem Todestag würde er seine alten Eltern besuchen, die ein paar Minuten entfernt im Stadtteil Hausbruch wohnten und dort aus Fenstern, die er geputzt hatte, aufs Moor starrten. In Gedanken und wenn er mit den Nachbarn oder Kollegen sprach, sagte er immer: besuchen. Was er meinte, war pflegen. Aber er mochte das Wort nicht. Man pflegte seine Haut oder den Garten, einen greisen Vater und eine demente Mutter besuchte man.
An seinem Todestag würde er versuchen, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. Und er würde an seinem Todestag eine gute Tat vollbringen, oder, weil er die Steigerung liebte, so viele gute Taten wie möglich. Da war er ganz Pfadfinder, wie in allem, was er tat: als Informatiker, beim Anlegen und Administrieren von Netzwerken, beim Auswerten von Daten, beim Durchstreifen der Stadt, in der er aufgewachsen war, und eben als Nachbar.
Vor seinem Fenster lag die Fischbeker Heide schwarz und ohne Konturen, dahinter im frühen Morgennebel vage die Lichter von der nördlichen Elbseite. Als er in die Küche kam, machte er dort wie immer kein Licht, weil er es gewohnt war, sich im Dunkeln zu bewegen. Durch sein Küchenfenster fiel das nicht besonders zuversichtliche Laternenlicht am Reihenendhaus der Bressins und am Reihenmittelhaus der Thomsens vorbei in einer vagen breiten Bahn auf seine Arbeitsfläche. Der Kaffee war schon automatisch durchgelaufen, das hatte er wie immer gestern Abend programmiert, Timer auf 5 Uhr 15, und als er ihn im Becher hatte und vors Gesicht hob, fiel ihm wie immer auf, dass er ihn eigentlich nur wegen des Geruchs aufsetzte. Wenn man alleine lebte, musste man darauf achten, woher die Gerüche kamen.
Jeder Gedanke übers Alleinleben führte auf geradem Pfad wieder zu seinen Eltern. Als wenn die Tatsache, dass er mit Mitte vierzig nicht die Frau gefunden und nie die Familie gegründet hatte, die ihm irgendwann einmal vage vorgeschwebt hatten, etwas mit ihnen zu tun hätte. Seine Mutter war Anfang siebzig, sein Vater über achtzig, und er wusste, dass die Zeit, in der er jeden Tag so leben konnte, als wäre es sein letzter, zu einem Ende kommen würde. Wenn für seine Eltern das Pflegeheim-Kapitel begann. Komplikationen, neue Logistik, mehrere Wege am Tag, sein Mitgefühl und seine Aufmerksamkeit verteilt auf zwei Orte, einer davon vielleicht ein Grab.
Nein, dass er allein war, hatte mit der vielen Arbeit zu tun und damit, dass einem so was passierte und dass man das, was einem in der Hinsicht dann eben passiert war, umso schwerer wieder hinbiegen konnte, je weiter man über vierzig war.
Manchmal besuchte er seine Eltern schon morgens, weil sein Weg zur Arbeit in die Innenstadt an ihnen vorbeiführte, und manchmal abends, wenn er zurückkam. Heute hatte er Sehnsucht nach ihnen: nach der weichen Haut seiner Mutter, wenn sie ihre Wange an seine drückte und von Mal zu Mal weniger scherzhaft «Wer ist der alte Mann auf meinem Sofa?» wisperte, und nach dem sanften Erstaunen in den Augen seines Vaters, der jedes Mal überrascht schien, dass sein Sohn sich über Nacht in einen hageren Mann mittleren Alters mit wenig Haaren und faltigem Hals verwandelt hatte, «zaddrig», wie seine Mutter uncharmant, aber zutreffend sagte. Vielleicht war die Sehnsucht heute ein wenig größer als sonst, weil ihm von den zwei, drei Minuten länger im Bett ein altes Gefühl geblieben war wie damals als Teenager, wenn seine Mutter irgendwann gerufen hatte: «Olli, komm runter, die Fähre wartet nicht.» Damals, als sie noch die Apfelbäume im Alten Land gehabt hatten.
Sein Impuls war, gleich zu ihnen zu fahren, denn ab sechs Uhr morgens war für seine Eltern zu jeder Jahreszeit mitten am Tag und sie saßen am Küchentisch mit Kaffeeringen auf dem Wachstuch, während die Scheinwerfer des Pendlerverkehrs Richtung Autobahn ihre Girlanden über die Raufasertapete zogen.
Aber er liebte es, seinen Impulsen zu widerstehen, und noch mehr liebte er es, sich den ganzen Tag über auf seine Eltern zu freuen. Es machte die Zeit im Büro erträglicher. Er kippte seinen Kaffee in den Ausguss, spülte den Becher ab und stellte ihn umgedreht zum Trocknen. Der ungepflegte silberne Golf IV der Bressins stand bei ihnen vorm Haus am Straßenrand, die Garage wohl belegt von ihrem Bully. Umso besser, denn das war die Gelegenheit, auf die er seit Tagen wartete.
Oliver Wiebusch wusste nur allzu gut, dass die Bressins sich ein wenig übernommen hatten mit dem Kredit für den Neubau, obwohl das hier schon die preiswerteste Gegend in ganz Hamburg war, wenn es um neue Reihenhäuser ging. Er hatte die Bankdaten und den Schriftverkehr über ihren Kredit mit eigenen Augen gesehen. Aber er neigte nicht dazu, andere zu beurteilen; er neigte dazu, ihnen zu helfen. Er mochte die Bressins, vor allem sie: eine seltsam störrische Frau, die eine Energie in sich hatte, die sie selbst wohl nur ahnte. Goldschmiedin mit einer kleinen Werkstatt in der Neustadt nördlich der Elbe, die an ein oder zwei Geschäfte in Hamburg lieferte. Manchmal nahm er sie mit in die Stadt, und ihm gefiel die gespannte Aufmerksamkeit, mit der sie seinen Geschichten lauschte. Ihr Mann wartete auf einen Lehrauftrag, den er niemals kriegen würde, und verdiente sich hin und wieder was als Party-DJ. Woher sollte da das Geld für Winterreifen oder eine anständige Hecke kommen?
Wiebusch war selbst mal Golf IV gefahren, lange, bevor er sich den Geländewagen gekauft hatte, und hinten bei ihm in der Garage lag noch ein Satz passender Winterreifen. Zuerst hatte er vorgehabt, die Reifen dem jungen Bressin anzubieten, aber der sah nicht so aus, als könnte er damit was anderes anfangen, als sie unsachgemäß zu lagern und nie zu montieren. Nicht der Typ, den man sich mit Wagenheber vorstellen konnte. Viel besser schien Wiebusch wie immer die Überraschung, vor allem, wenn sie vielleicht gar nicht bemerkt würde. Den Nachbarn im Schutze der herbstlichen Dunkelheit die Felgen mit den Winterreifen anzuschrauben, ohne dass sie damit rechneten und vielleicht sogar, ohne dass sie es merkten, und ihnen dadurch eine sicherere Fahrt, insgesamt also ein besseres Leben zu schenken: Das war eine wahre gute Tat. Im Grunde sogar die Steigerung davon, sozusagen eine optimale Tat, da sie für Wiebusch mit keinen Kosten und geringem Aufwand verbunden war.
Und jemand von den anderen Nachbarn würde ihn vielleicht dabei beobachten, wahrscheinlich die Nachbarin Susanne Thomsen im Reihenhaus zwischen ihnen, und dann würden die Bressins es doch noch erfahren und wären erst recht verblüfft und erfreut, weil Oliver Wiebusch selbst nichts sagte über seinen nachbarschaftlichen Hilfsdienst. Er wusste, dass er manchmal zu viel redete, er sah es kurz in den Augen der Nachbarinnen, wenn er von seinen Entdeckungen erzählte. Wiebusch musste lächeln über seine eigene Widersprüchlichkeit. Aber ein bisschen Eitelkeit war erlaubt, und Anerkennung brauchte jeder, auch er.
Die Novemberluft war scharf und klar nach der Heizungsluft wie ein Kümmel nach schwerem Essen, und er atmete sie mit Begeisterung, während er einen Reifen nach dem anderen aus seiner Garage zum Golf der Bressins rollte. Dann holte er seinen Wagenheber und den Schlüsselsatz und freute sich an dem Gedanken, dass die verschrammten Radkappen der Bressins, sobald sie auf den schwarzen Felgen seiner alten Winterreifen saßen, so gut wie jede Spur seiner guten Tat verbergen würden.
Während er die Muttern löste, wanderte sein Blick durch die Anfänge der früh verkümmerten Neubausiedlung. Die zwei Gebäudeteile mit jeweils drei Einheiten, dazwischen Brache für mindestens neun weitere, ungebaut, weil bisher dann doch nicht so viele hierher hatten kommen wollen an den Rand der Heide. Zu weit von der Innenstadt, zu umständlich, jeden Tag zwei Mal durch den Elbtunnel zu pendeln und zwei Mal im Stau zu stehen mit allen anderen, die das gleiche Problem hatten.
Unsere kleine Geisterstadt, nannte er die Siedlung manchmal scherzhaft.
Als die vierte Mutter des rechten Vorderrades sich löste, blieb sein Blick am Blutapfel im Vorgarten der Thomsen hängen. Vorgarten war geprahlt: Außer der nicht besonders sorgfältig ummulchten Pflanzstelle des Zierapfelbaums war da außer Rollrasen nicht viel passiert.
Er musste der Thomsen mal den Apfelbaum zurückschneiden, die hatte sich schon letztes Jahr nicht darum gekümmert. Nicht aus Faulheit oder Böswilligkeit, das war ihm klar. Es wusste heute nur einfach keiner um die dreißig und aus der Stadt mehr, wie und wann man einen Apfelbaum zurückschnitt, und sei es ein Zierapfel. Und seit der Thomsen der Mann weggelaufen war, kümmerte sie sich noch weniger darum, die Dinge am Laufen zu halten. Die ungeputzten Fenster ihrer Reihenhausscheibe waren matt und trübe wie die Augen einer drei Tage toten Katze am Straßenrand. An einem vagen Lichtreflex sah er, dass hinter ihrem Küchenfenster schon Leben war, und obwohl er sich über die Zeugenschaft freute, bedauerte er sie auch: Noch schöner wäre es gewesen, jetzt in der langsam über dem Hamburger Osten aufziehenden Morgendämmerung auch den Zierapfel noch zu versorgen. Die passende Teleskopschere hatte er im Schuppen.
Nachdem er wieder im Haus war, ging er in den Wohnraum und vergewisserte sich, dass bei den Fischen alles in Ordnung war. Als er Kind war, hatten seine Eltern ihm ein Sechzig-Liter-Aquarium mit Guppys, einem Kampffisch und Leopardenwelsen zum Geburtstag geschenkt. Das Aquarium war immer noch dasselbe, aber heute hielt er nur noch die Welse. Kleine Fische, zwei bis drei Zentimeter lang, die tagsüber in kleinen Gruppen über den Kiesboden des Aquariums streiften und nachts auch so schliefen, versteckt hinter Pflanzen und Steinen, aneinandergelehnt, eine Art Familie. Die Zeitschaltuhr und der Futterautomat waren so eingestellt, dass die Fische Wochen ohne ihn auskommen konnten, falls etwas Unvorhergesehenes passierte.
Er ging die Kellertreppe nach unten und machte in dem Raum, den er «stilles Zimmer» nannte, seine Übungen. Die Sache mit dem Mädchen konnte er bald abschließen, es war fast zu einfach gewesen, nächstes Mal brauchte er eine größere Herausforderung. Dann betrachtete er die starren Schwarz-Weiß-Bilder seiner Eltern und sah, dass alles unter Kontrolle war. Am Ende schaltete er seinen Kurzwellenempfänger ein, damit ihn abends, wenn er zurückkommen würde, Stimmen begrüßten.
Dann sah er, dass das Licht bei der Thomsen wieder aus war. Hatte sie heute überhaupt das Kind, oder war sie allein? Bei denen ging immer alles durcheinander, nicht mal er konnte sich das merken, obwohl er im Prinzip über alle nötigen Informationsquellen verfügte. Aber er merkte, dass er kaum noch nachsah bei ihr. Eine Zeitlang waren sie sich nahe gewesen, aber dann hatte sie sich zurückgezogen. Wahrscheinlich war sie einfach nur kurz auf die Toilette gegangen und hatte sich wieder hingelegt, Susanne Thomsen schlief immer lang, ohne Mann und Kind.
Wiebusch straffte sich, ging zum Schuppen und holte die Teleskopschere. Dann stieg er in ihren Garten und fing an, mit weiten, beherzten Schnitten den Blutapfel zu bearbeiten wie jemand, der angreift.
5. Kapitel
Bei der nächsten Sitzung im Meditationskurs passierte, was Danowski von Anfang an befürchtet hatte: Sein Diensthandy klingelte mit industrieller Melodik, unleugbar und brachial. Wenigstens nicht bei der Sitzmeditation, sondern während Franka ihnen erklärte, wie man es lernte, im Alltag ab und zu innezuhalten. Indem man eine raucht, hatte Danowski gerade gedacht, dann aber eben: das Telefon. Bereitschaftsdienst, das hatte er eigentlich auch noch mit Franka besprechen wollen, und dass er sich deshalb leider nicht an ihre dringende Empfehlung halten konnte, die mehr eine zutiefst von Herzen kommende Bitte war, Mobiltelefone auszuschalten oder wenigstens draußen im Vorraum an der Garderobe zu lassen. Er räusperte sich entschuldigend, was jetzt gar nicht mehr in den Raum passte. Meta Jurkschats Nummer.
«Adam?»
«Am Apparat.»
«Wo bist du?»
«Ganz im Augenblick.»
«Wie bitte?»
«Nachbarschaftsheim Bahrenfeld, kurz vor der Osdorfer Landstraße, wenn du …»
«Das such ich mir raus.» Jurkschat, seine neue Partnerin, zuverlässig und konstruktiv wie eine, an der bei der Gruppenarbeit früher immer das ganze Referat hängengeblieben war, weil allen immer was dazwischenkam, aber den Schein hatten die anderen am Ende natürlich auch bekommen und sich nicht einmal bedankt. «Bin in …» Er hörte, wie das Navi unter Jurkschats Fingern piepste. «… acht Minuten bei dir. Wir haben einen Einsatz.»
Danowski seufzte. Die anderen sahen ihm mit interessierter und gar nicht genervter Aufmerksamkeit zu, oder war das schon Achtsamkeit? Man könnte ja jetzt auch mal aufstehen, dachte er und faltete sich mühsam aus dem Schneidersitz, irgendwie war er nicht abzubringen davon, er versuchte es jede Woche aufs Neue.
«Worum geht’s denn?», fragte er und stand mühsam auf eingeschlafenen Unterschenkeln.
«Gewaltsamer Tod durch Schussverletzung», sagte Jurkschat. «Opfer männlich, etwa Mitte vierzig, Personalien folgen, Leichenfundort und vermutlich Tatort in seinem Pkw, und jetzt kommt’s.»
Danowski ging Richtung Tür und winkte den anderen vage zum Abschied. Jurkschat schuf normalerweise keine Cliffhanger, die war viel zu phantasielos, um sich oder andere von irgendwas überraschen zu lassen, aber in diesem Fall war das offenbar anders. Da horchte er auf.
«Na», sagte er, widerwillig einladend.
«In seinem Pkw im Elbtunnel. Mitten im Verkehr. Täter flüchtig. Was meinst du, was da los ist.»
«Alles klar», sagte Danowski, wie eigentlich immer, wenn ihm gar nichts klar war. Und er und die rechtschaffene Jurkschat mittendrin.
«Behling sagt, da ist die Hölle los», sagte Jurkschat, als könnte diese erklärende Information noch irgendeine Art von Zauber für ihn haben.
«So, so», sagte Danowski. «Na, ich warte dann mal draußen.» Er streifte seine Jacke über und nahm den Stoffbeutel, in dem er unvorschriftsmäßig seine Dienstwaffe und das Gürtelholster verstaut hatte, um im Meditationsraum nicht für Irritation zu sorgen. Tja, heute würde er schon mal keine Unterschrift von Franka kriegen, und er brauchte acht von zehn, um sich eine weitere Runde beim Amtsarzt zu ersparen. Durch die halb angelehnte Tür winkte er seinen Mitmeditierenden und Franka zum Abschied.
6. Kapitel
Zwei Schüsse im Elbtunnel. Laut, weil abgefeuert ohne Schalldämpfer (das würde wenig später die ballistische Analyse bestätigen). Laut, weil die Fahrertür des Wagens, in dem sie abgefeuert wurden, einen Spalt weit geöffnet war (offenbar der verzweifelte Anfang eines schnell vereitelten Fluchtversuchs).
Schwer, sich das vorzustellen, aber Danowski hatte eine lebhafte Phantasie, wenn es um den Elbtunnel ging. Er mied ihn, weil er es hasste, dort auf der Autobahn in einer der Röhren im Stau zu stehen. Und Stau war um diese Zeit fast immer. Vor allem, wenn, wie heute, in einer der verbleibenden Röhren ein Fahrstreifen gesperrt war: Fahrbahnschäden durch einen Lkw-Unfall am Tag davor.
Wenn man im Stau stand, unter der Erde, unter dem Fluss, dann reichten zehn, fünfzehn Minuten, und man wurde schläfrig. Das gedämpfte Licht, die Abertausenden Kacheln, die immer wieder aufblinkenden Bremslichter der Autos vor einem, wenn jemand die Position seiner Füße änderte. Der Gedanke, warum nicht alle ihre Motoren ausstellten, und werden wir jetzt alle ersticken hier?
Das Radio, die Frage, ob die Popmusik einfach viel schlechter geworden war in den letzten Jahren, oder ob einem das nur so vorkam, weil man selbst gealtert war und einen Job hatte, der einen zwang, zwischen einem preiswerten Zuhause südlich der Elbe und einem Job nördlich in der Innenstadt zu pendeln. Oder Kinder auf der Rückbank, mit der Familie in einen dieser wild in alle möglichen außersaisonalen Monate gelegten Urlaube, weil keins der Kinder schulpflichtig war, vielleicht auf der Rückfahrt aus Dänemark, wann sind wir da, warum stehen wir hier und dann eben: zwei Schüsse. Nur Augenblicke hintereinander, die Angaben schwankten zwischen direkt hintereinander, Bäng-Bäng, und getrennt durch Sekunden. Hunderte Zeugen, die alle etwas anderes gehört hatten. Die alle etwas anderes gesehen hatten. Vor allem aber: die alle in Panik oder zumindest stark in Richtung Fluchtwege orientierte Aufregung geraten waren. Zwei Schüsse und dann sofort Chaos: Leute, die aus ihren Autos ausstiegen und Richtung Tunnelausgang rannten, instinktiv, obwohl sie in beide Richtungen rund anderthalb Kilometer entfernt waren von den Tunnelenden. Eltern, die ihre Kinder in Richtung der Rettungstüren trugen oder zerrten, zu Gängen, die in die anderen Tunnelröhren in nördlicher Fahrtrichtung führten.
Je näher man als Stausteher dem weißen Geländewagen war, in dem die Schüsse abgegeben wurden, desto mehr klangen sie nach Explosion. Und eine Explosion im Tunnel, auch wenn man sie nur hörte und kein Feuer sah und nur wenig Rauch, bedeutete instinktiv nur eines: raus hier. So schnell wie möglich raus hier. Da vorne hat es in einem Auto geknallt. Da brennt ein Auto. Da ist ein Auto explodiert.
Hunderte von Zeugen, die am Ende eins gesehen hatten: Hunderte von anderen Zeugen, die sich so schnell sie konnten vom Tatort entfernten.
Deutlich hatte Danowski später im Grunde nur den Toten vor Augen, und das vielleicht auch nur, weil er am Tag danach genug Zeit hatte, um die Tatort-Fotos zu studieren, die sich später vermutlich überlagerten mit seiner Erinnerung. Daran, wie der Tote auf dem Fahrersitz des weißen Audi-Geländewagens leicht gegen die schmal geöffnete Fahrertür gedreht gesessen hatte. Den Kopf nach hinten gelehnt an die Außenseite der Nackenstütze und an die T-Säule, zwei Einschussverletzungen sofort erkennbar: auf der Stirn fast genau in der Mitte, vielleicht zwei Zentimeter oberhalb der Augenbrauen, und dann auf der rechten Schläfe. Offenbar ein absoluter Nahschuss. Die Schmauchhöhle mit den sternförmig davon wegführenden Hautrissen, in denen Kopfblut trocknete, lag klar wie eine Miniaturlandschaft im auf- und abschwellenden Licht der vorbeifahrenden Autos. Darin die Stanzmarke wie eine böse Sonne.
Dann wieder sein gegenwärtiger Teamleiter und künftiger Chef-Chef Behling, der ihn vom Beifahrersitz zog, obwohl Danowski den kaum mit dem Knie berührte, von hinten, wie ein Kind am Anorak: «Adam, raus hier, Spurensicherung machen wir, Tathergang braucht dich nicht so zu interessieren. Meta und du, ihr macht nur persönliches Umfeld.»
Meta Jurkschat hatte noch versucht, von der Autobahn-Auffahrt Bahrenfeld über die A7 südlich zum Elbtunnel zu fahren, hoffnungslos. Der Verkehr stand noch bedingungsloser und unerbittlicher als sonst um diese Tageszeit, donnerstags um kurz nach neunzehn Uhr, Pendlerstau in südlicher Richtung so weit das Auge, das Benzin und die Geduld reichten, ja, die Geduld musste immer als Erstes dran glauben. Danowski wusste, dass andere Polizisten als er für solche Momente lebten, und Jurkschat war eine davon, also: Automatik auf R, Blaulicht, und dann rückwärts mit Sirene über den Standstreifen, weil zum Wenden nicht genug Platz war. Er konnte schon das Getriebe riechen, Jurkschat mit dem Arm über seiner Rückenlehne und den Kopf so weit nach hinten gedreht, dass er ihren Pferdeschwanz im Gesicht hatte, bis er sich zum Beifahrerfenster drehte und den in falscher Richtung an ihm vorbeizischenden Grünstreifen im Dunkeln ahnte.
Zurück auf der Straße, kannte sie einen Schleichweg durch die Kleingärten zur Auffahrt Othmarschen, der letzten vorm Tunnel. Sie hatten den Wagen irgendwo stehen gelassen und waren durch den hupenden Umleitungsverkehr und die Absperrung der Kollegen gelaufen, Jurkschat schneller als er. Seltsame Dimensionen: wie breit und weit und absurd gebogen eine Autobahn-Auffahrt war, wenn man sie zu Fuß hinunterlief, und wie unmenschlich groß die Schilder mit ihrer vertrauten Schrift waren, wenn man nicht im Auto an ihnen vorbeiraste.
Ab da wurde es vage in seiner Erinnerung. Mittlere Tunnel-Röhre in südlicher Fahrtrichtung, und als Jurkschat und er Ausweise schwenkend den Weg in den Tunnel gefunden hatten, fing der Verkehr zumindest auf der rechten Spur wieder an zu rollen, fließen wäre zu viel gesagt gewesen. Die Sperrung der Fahrbahn hatte die Tunnelleitzentrale aufgehoben, Fahrbahnschäden waren heute Abend ein Luxusproblem, dessen Lösung Zeit bis morgen hatte. Und wie Behling sie begrüßt hatte, als wäre es eine apokalyptische Erfolgsmeldung, andererseits aber irgendwie auch Danowskis Schuld: «Zwanzig Kilometer Stau! Wir müssen das weiter laufen lassen. Bricht ja sonst alles zusammen in der ganzen Stadt. Spuren sind sowieso alle im Wagen. Aber es dauert, bis die Halter alle wieder bei ihren Fahrzeugen sind.»
Fast anderthalb Kilometer mussten Jurkschat und er unter die Elbe laufen, der Wagen mit dem Toten stand bei Tunnelmarke 1650, ungefähr auf der Mitte, genau unter dem Fluss. Verkehrspolizei, die dunkelblauen Uniformen der Schutzpolizisten hier unten im düsteren Orangelicht schwarz. Danowski zählte fast ein Dutzend Kollegen von den Mordbereitschaften, je näher sie dem Tatort kamen. Er nickte durch die Gegend. Jurkschat blieb stehen, um sich mit Markus Kienbaum in seiner weichen Lederjacke zu unterhalten, mit dem sie früher im Team gewesen war. Er blieb stehen, vielleicht, um auf sie zu warten, in Wahrheit, weil ihn der Gedanke an seinen alten Kollegen Finzi mitten im Schritt gestoppt hatte: Finzi hätte aus der Formulierung, mit Kommissar Kienbaum sei Meta Jurkschat früher im Team gewesen, mindestens zwei Kalauer mehr gezogen als unbedingt notwendig.
Dann Behling, und natürlich stand er breitschultrig im hellgrauen Schutzanzug der Spurensicherung am Opfer-Audi, als regele er hier alles persönlich, vom Zugang zum Tatort bis zum Verkehr.
«Wo ist denn deine bessere Hälfte?», rief Behling durch den Zweiter-Gang-Lärm der Vorbeifahrenden. «Habt euch ganz schön Zeit gelassen.»