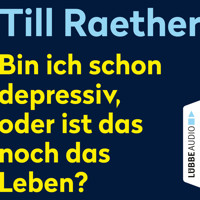9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Adam Danowski
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Hamburg wird von einer Serie spektakulärer Leichenfunde erschüttert: In Schulkellern werden mumifizierte Tote entdeckt. Die örtliche Polizei ist überfordert und setzt auf Unterstützung von Deutschlands populärstem Fallanalytiker: Martin Gaitner. Der lässt keine Gelegenheit aus, sich wichtigzutun. Kommissar Danowski kann ihn nicht ausstehen und zweifelt an der Theorie des Kollegen: ein zu Schulzeiten traumatisierter Einzeltäter? Sein Gefühl sagt ihm etwas anderes. Die Recherche gestaltet sich nicht gerade einfacher dadurch, dass seine alte Kollegin Meta Jurkschat früher mit einem der Toten liiert war und über die Verbindung eisernes Schweigen bewahrt. Mehr noch: Danowski soll dieses Wissen um der alten Zeiten willen nicht in seine Ermittlungen einbeziehen. Währenddessen gehen Hinweise bei der Polizei ein und lösen eine Lawine von Ereignissen aus: Panik erfasst die Stadt, Keller werden durchsucht, Schüler beurlaubt, die Senatsverwaltung erwägt Sonderferien, quasi «Leichenfrei». Am Ende steht eine Entdeckung, die die Ermittler in einen Abgrund blicken lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Ähnliche
Till Raether
Danowski: Neunauge
Kriminalroman
Über dieses Buch
Hamburg wird von einer Serie spektakulärer Leichenfunde erschüttert: In Schulkellern werden mumifizierte Tote entdeckt. Die örtliche Polizei ist überfordert und setzt auf Unterstützung von Deutschlands populärstem Fallanalytiker: Martin Gaitner. Der lässt keine Gelegenheit aus, sich wichtigzutun. Kommissar Danowski kann ihn nicht ausstehen und zweifelt an der Theorie des Kollegen: ein zu Schulzeiten traumatisierter Einzeltäter? Sein Gefühl sagt ihm etwas anderes.
Die Recherche gestaltet sich nicht gerade einfacher dadurch, dass seine alte Kollegin Meta Jurkschat früher mit einem der Toten liiert war und über die Verbindung eisernes Schweigen bewahrt. Mehr noch: Danowski soll dieses Wissen um der alten Zeiten willen nicht in seine Ermittlungen einbeziehen.
Währenddessen gehen Hinweise bei der Polizei ein und lösen eine Lawine von Ereignissen aus: Panik erfasst die Stadt, Keller werden durchsucht, Schüler beurlaubt, die Senatsverwaltung erwägt Sonderferien, quasi «Leichenfrei». Am Ende steht eine Entdeckung, die die Ermittler in einen Abgrund blicken lässt.
«Raether hat für komplizierte Charaktere so viel Sinn wie für die temporeiche Auflösung verwickelter Geschichten. Hoffentlich hat Danowski noch ein paar Dienstjahre vor sich.» Der Tagesspiegel
«Auch in Raethers neuem Roman fasziniert der labile Ermittler Danowski. Gleichgültig welchen Fall Raether mit seinem Kommissar erzählt, man bleibt an ihm dran, ist gut unterhalten.» Der Freitag
«Ein starker Hamburg-Krimi!» Hamburger Abendblatt
«Kaum jemand in diesem Genre schreibt so klug, so menschlich, so schön.» Brigitte
Vita
Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u. a. für Brigitte, Brigitte Woman und das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, Regie führte Markus Imboden.
Für Christine Hohwieler
Neunauge, das, –n. Aalartiger Fisch, der sich mit spiralförmig angeordneten Zähnen an sein Opfer heftet, um sich von dessen Blut zu ernähren. (…)Mikrone Fischerei-Lexikon, 1962
1. Kapitel
«Habibi! Jetzt renn doch nicht so.»
Er rannte gar nicht. Aber stehen bleiben wollte er auch nicht.
«Hey, Habibi! Digger! Wart doch mal!»
Echt? Konnten die sich nicht entscheiden? Habibi? Digger?
Wenn mittwochs nachmittags die Theater-AG vorbei war, wollte Niklas schnell nach Hause. Zu wenig los an der Schule: keine Lehrer, die dazwischengingen, wenn Linus und Brook ihren Scheiß machten. Aber dann hatte er doch wieder getrödelt, und das rächte sich jetzt.
Niklas straffte sich, vielleicht gewann er so einen Zentimeter oder zwei an Höhe. Und er ging langsamer. Denn merken, dass er Schiss hatte, sollten Linus und Brook nicht. Schiss, na ja. Das war so ein Erwachsenenwort für Kinderprobleme, die zu groß für Kinder waren. Niklas fand, er war in Sorge.
Zwischen ihm und Linus und Brook lag kaum die Hälfte des nicht besonders großen Schulhofs, Hochsommerhitze, die Ferien waren spät dieses Jahr, noch zehn Tage Schule und nächste Woche die Aufführung. Der Schulhof schimmerte, man dachte, wenn man raufspuckt, würde es zischen, Vollkornpausenbrote wurden hart, bevor sie den Boden der Mülleimer trafen.
Das alte Problem: Wenn er jetzt losrannte, hätten sie keine Chance, ihn zu kriegen, aber er wäre für immer der Lappen, der weggerannt war. Aber wenn er tat, als wär nichts, kriegten sie ihn. Er drehte sich ein bisschen um und winkte lässig über die Schulter.
«He, Habibi, bleib do’ ma’ stehen!» Die nannten alle in der Klasse Habibi, außer Walid, der war als Einziger Araber, mit dem redeten sie gar nicht. Niklas auch nicht, wenn er ehrlich war.
Er näherte sich dem Schatten, den die Wand des alten, rot geklinkerten Schulhauses warf, dahinter stand sein Fahrrad, er musste da hin. Andererseits sah ihn da gar keiner mehr, wenn Linus und Brook ihr Ding machten, und zwar an ihm. War das da vorn der Hausmeister, der Richtung Fahrradkeller im Haus verschwand, die kleine Treppe runter ins Kühle? Niklas speicherte das, für den Notfall. Er ging noch ein paar Schritte, bis er im Schatten stand, dann drehte er sich um. Er konnte nicht anders. Da war was Unwiderstehliches in Linus’ Stimme oder in Brooks, er konnte die kaum auseinanderhalten.
Denk an deinen Selbstverteidigungskurs, hatte seine Mutter gesagt. Das eine Mal, als Niklas den Fehler gemacht hatte, ihr doch was zu erzählen.
Ja. Genau. Danke, Mama.
Jetzt stand er. Als ob er sowieso hätte warten wollen auf die. Sie schlenderten auf ihn zu, beide waren mitten im Stimmbruch, darum klangen sie mal so und mal, also ähnlich. Linus hatte diese langen ungeschnittenen Haare, die sie alle in der Grundschule toll gefunden hatten, aber er trug sie immer noch, als wären sie das Einzige, was ging. Er sah mehr nach zehnter als nach achter Klasse aus. Skaterklamotten, die enger an ihm saßen, als sie sollten, dadurch wirkte er noch größer. Brook, blond, Undercut, Jack & Jones, superdünn, das dickste an ihm war die Zahnspange. Als sie vor Niklas standen, stellte Brook sich gleich so ein bisschen auf die Seite, das machten sie instinktiv, sie nahmen ihn in die Zange.
«Alla, gib ma’ Telefon», sagte Linus, jetzt in diesem superschlecht nachgemachten Türkenakzent. Leute, die so sprachen, kannten sie nur von YouTube.
«Hab ich nicht», sagte Niklas, schon in der Defensive. Jetzt auf keinen Fall da hinfassen, wo das Telefon saß.
«Diggi, ich lauf zwei Kilometer hinter dir her, ich seh doch deinen Arsch, ich seh doch, dass du Telefon in deiner Arschtasche hast. Diggi. Als ob.» Linus, leicht empört: Wir sind doch Freunde!
«Guckst du Nicki auf’n Arsch, ja, du Schwuchtel», sagte Brook zu Linus und lachte heiser. Brook durfte das.
«Ich fick den gleich in’n Arsch, wenn er sein Telefon nicht rausgibt», sagte Linus. Niklas atmete durch die Nase. Er wusste, dass es kein gutes Zeichen war, wenn sie anfingen, über ihn in der Er-Form zu reden. Dritte Person Singular: Eine passendere Bezeichnung hätte man sich nicht ausdenken können für ihn, fand Niklas.
«Dann bist du ja’n Arschficker», sagte Brook. «Quod erat demonstrandum.» Klar, dass die beiden Latein genommen hatten.
«Nee», sagte Linus, «das wär ja ein Straffick, ich würde den ja nicht in Arsch ficken, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil das für den die ultimative Strafe wäre. Endboss. Endboss Arschfick. Ne, Nicki?»
«Ich glaub, der fänd das geil», sagte Brook. «Nicki ist doch ’ne alte Schwuchtel.»
«Du meinst, dann ist das kein Straffick für den?»
«Nee. Der freut sich schon.»
«Scheiße, Alla, it’s complicated.»
Niklas spürte, seine Optionen gingen gegen null. Als wenn er mit der Maus über die Menüleiste fuhr, und alles war hellgrau, nichts konntest du anklicken. Jetzt doch noch rennen? Wohin. Und Brook hatte Beinstellen geübt seit der Vorschule, der machte das in der Studienstufe als Profil.
«Die Dicke sagt, du hast unsere Telefone gehackt», sagte Brook und täuschte einen Ausfallschritt in seine Richtung an, sodass Niklas zusammenzuckte und sich sofort darüber ärgerte.
«Ganz ruhig, du Keck», sagte Linus. «Gib Telefon und gut ist.»
Aus verschiedenen Gründen war es Niklas unmöglich, auch nur in Erwägung zu ziehen, den beiden sein Telefon zu geben. Erstens, weil er es dann nie wiedergesehen hätte. Zweitens, weil es einen Chat gab, den sie unter keinen Umständen sehen durften. Mit Jannis. Den er zwar als «Janina» gespeichert hatte, aber Jannis hatte Fotos geschickt. Oberkörper. Bisschen Pose. Beim Gedanken daran wurde Niklas rot und ahnte, dass es wie Angst aussah, aber eigentlich, das merkte er wie von außen, war er einen winzigen Augenblick glücklich gerade.
«Ich glaub, der will echt, dass du ihn in’n Arsch fickst», sagte Brook.
Niklas merkte, dass Brook für einen Augenblick abgelenkt war. Sich was überlegen, ehe Linus was erwidern konnte. Und Linus wartete drauf. Es war nur ein Wimpernschlag, aber Niklas ließ sich nach hinten fallen, drehte sich auf dem Fuß und war weg.
Sie riefen gar nichts, aber er hörte am Schotter, dass sie sofort hinter ihm waren. In der nächsten Phase, die begann, wenn sie ihn hatten, würde es kein Geplänkel mehr geben. Das mit dem Fahrrad konnte er vergessen, das war angeschlossen, und er sah, dass das Tor zu den Fahrradständern zu war, vielleicht nur angelehnt, vielleicht hatte der Hausmeister schon abgeschlossen, so spät am Nachmittag. Das Problem hatte er immer nach der Theater-AG. Niklas bog nach links und rutschte auf dem Schotter seitlich weg, in ihm dehnte sich was aus, das Gefühl, gleich packen sie dich, aber Linus und Brook hatten das gleiche Problem, und er hörte, dass einer von ihnen hinfiel und in zwei Stimmlagen kreischte und fluchte.
«Ey, jetzt mach ich dich tot. Guck dir die Scheiße an, ich bin voller Blut, Alter.»
Niklas setzte über das schmale Geländer der äußeren Kellertreppe, Hockwende, hatte er im Sportunterricht noch nie so makellos hingekriegt wie jetzt gerade eben. Im Keller waren ihre Requisiten, und Frau Schürs hatte zwar zu Lucie und Hannah gesagt, sie sollen abschließen, wenn sie fertig sind mit Aufräumen, und sie hofft, sie kann ihnen vertrauen mit dem Schlüssel, aber wer Kulissendienst hatte, vergaß fast immer das Abschließen, also, die Hälfte der Zeit, und Niklas wurde sozusagen eins mit dem Schloss und der Tür und konnte sie sich nicht anders denken als unverschlossen, aufdrückbar, sodass er abtauchen konnte in den feuchten, tröstlichen Kelleratem, magisches Denken hieß das, das hatten sie in der Siebten in Deutsch gehabt, Märchen, denn wenn die Tür zu war, dann saß er in der Falle.
Frau Schürs konnte sich nicht verlassen auf Lucie und Hannah, aber er schon. Er spürte sein Herz bis ins Kinn, als die Tür aufging und der Keller ihn verschluckte. Requisiten, aufgegebene Kunstprojekte, ausgemusterte Matrizendrucker, Baumaterial, falls doch mal unter Elternbeteiligung der Musikraum renoviert werden sollte, alter Lehrkram, diese Schaubilder auf Leinwand, die keiner mehr aufhängte, seit sie in allen Klassenzimmern Smartboards hatten. Landkarten, von der Kaulquappe zum Frosch, der Sternenhimmel im Sommer, Fischarten, dutzendfach zusammengerollt und bis unter die schräge Treppe geschoben, die hinauf Richtung Aula führte. Okay, Lucie und Hannah waren hinten aus dem Keller noch mal raus, um eine zu rauchen, und hatten dann die Tür offen gelassen. Aber die Tür ins Schulgebäude, durch die sie den ganzen Kram für «Unsere kleine Stadt» gezerrt hatten, der jetzt noch halb auf der Treppe lag, sodass Frau Schürs Zustände kriegen würde: Ja, gut, die Tür zur Aula hatten sie abgeschlossen.
Im Grunde hatte Niklas es geahnt. Eigentlich gab es ja nie einen Ausweg, das deckte sich mit seinen Erfahrungen. Und er wusste, dass Linus und Brook gesehen haben mussten, wie er hier im Keller verschwunden war. Sein einziger Vorteil war, dass er sich hier besser auskannte als sie.
Wahrscheinlich würden sie zuerst unter der Treppe suchen, bei den Rollen von alten Schaubildern, die sahen aus wie das perfekte Versteck. Er musste was in der Nähe der Tür finden. Und dann abhauen, sobald sie tiefer im Raum waren. Eine Abdeckplane, darunter Bottiche mit Kalk und angetrocknetem Zement, da hatte der Hausmeister seinen Enthusiasmus für irgendeine aufwendige Reparatur verloren. Tief im Dunkeln. Er kroch darunter und hatte Angst, dass die Plane im Rhythmus seines Herzschlags knistern könnte.
Dann waren die beiden drin.
«Diggi, mach mal Licht an.»
«Der Schalter geht nicht, was für ein Scheiß. Räudige Asi-Schule ist das.»
«Du schmierst alles voll mit deinem Blut.»
«Yo, Nicki-Ficki, ich mach dich tot, ich tret dir so den Kopf ab. Komm raus, dann hast du’s hinter dir!»
Er hörte, dass es sie tiefer in den Raum zog, die Plane und die Bottiche waren im Schatten der Tür, das bisschen Licht, das sie jetzt hatten, würde sie hoffentlich zur Aulatreppe führen.
«Alter, die ganze alte Scheiße hier, guck dir das an, dieser Dreck hier. Voll die Nazikarten und so.»
«Mach das mal weg, die Sau hat sich bestimmt da unten verkrochen, der geht bestimmt in die hinterste Ecke wie so ’ne Küchenschabe.»
Die Karten fielen durcheinander, Niklas hörte, wie die Holzstangen, um die sie gewickelt waren, auf den Betonboden rollten.
«So eine Müllschule. Dass die den ganzen Nazischeiß nicht mal wegschmeißen.»
«Das ist nur die Nazischrift, hier die Fische, das sind keine Nazifische.»
«Die sehen voll nazihaft aus, die Fische. Hier, zieh dir das Maul rein von dem.»
Dann wurde es still. Gleich hatten sie ihn. Das war genau diese Stille, die entstand, wenn zwei sich mit den Augen verständigten und auf die Plane zeigten und dann anfingen, sich anzuschleichen, und wenn Niklas überhaupt noch eine Chance haben wollte, dann musste er jetzt …
Niklas riss die Plane von sich und erschrak über ihr ungelenkes Knattern, dann schlug er sich das Knie und war trotzdem gleich draußen an der Treppe, fünf Stufen, es war wie ein Wunder, aber da kamen auch schon Linus und Brook, er fühlte sich, als könnte er fliegen, aber die beiden waren noch schneller, und jetzt hatten sie ihn.
Aber die Welt stimmte nicht mehr, denn sie sprangen über ihn weg, statt ihn zu packen und zu treten, sie rannten weiter, bis an den Rand des Schulhofes, während er ungläubig mit pochendem Knie auf der Kellertreppe hockte und die beiden über die oberste Stufe wie über einen backsteinernen Horizont auf dem flirrenden Schulhof sah, ihre Füße und Unterschenkel verschwommen bis zu den Knien.
«Niklas!», schrien sie beide durcheinander, und er erkannte kaum seinen Namen, «Niklas, Alter, komm her, echt, geh da nicht rein, geh da nicht wieder rein!» Er verstand jedes Wort, aber nicht, was sie von ihm wollten, sie klangen, als hätten sie Schiss oder eben: als wären sie in Sorge, und er sah, wie Brook ein paar Schritte über den Schulhof auf ihn zukam, die Arme ausgestreckt, ich tu dir nichts, ich mein’s ernst, und Brook rief dabei: «Geh da nicht mehr rein, Alter! Da drin ist eine Leiche oder so was, da ist einer totgegangen. Da ist voll die ranzige Leiche!»
Linus hinter ihm dabbte, und da wusste Niklas, dass irgendwas wirklich ganz und gar nicht in Ordnung war, denn der Dab war so was von 2016, den machte Linus aus Versehen nur, weil ihn etwas wirklich erschüttert haben musste.
2. Kapitel
Ich hab eine Übersicht über unsere Projekte des vorigen Quartals geschrieben und bin dafür von meinem Chef sehr gelobt worden.
Die Mädchen und ich waren im Kino. Es gab fast keinen Streit.
Leslie hat gesagt, ich soll es nicht «meine Wohnung» nennen, sondern «die kleine Wohnung», denn ich bin ja nicht ausgezogen, sondern schlafe nur während der Woche näher am Präsidium.
Was Besseres fiel ihm nicht ein? Was Schöneres hatte er nicht erlebt? Das war das Glück? Er hatte jetzt schon keine Lust mehr.
Hauptkommissar Adam Danowski saß in seinem Büro bei der Operativen Fallanalyse am Landeskriminalamt Hamburg und wartete auf das Arschloch aus München. Lindenblattfarbenes Sonnenlicht fiel durch die hohen Fenster. Die OFA war in einem der alten Gebäude der Bereitschaftspolizei untergebracht, hier war alles ein bisschen ab vom Schuss und grüner, fast beschaulich. Er war gerade zurückgekehrt an seinen Arbeitsplatz, denn die Kollegen hatten gesagt, die Sitzung im Haupthaus finge später an: Hauptkommissar Martin Gaitner verspätete sich, und sie würden dann Bescheid sagen. Wenn das Arschloch aus München endlich da war.
Wobei, wieso Arschloch, wo kam das jetzt schon wieder her? Er kannte den Kollegen nur flüchtig, der Kollege war ihm unsympathisch, der Kollege nannte sich «Deutschlands berühmtester Profiler» oder widersprach zumindest nicht, wenn andere ihn so nannten, er trat im Fernsehen auf und schrieb Bücher, aber: Was ging das Adam Danowski an? Sollte der Kollege doch machen, was er wollte. Inwiefern beeinträchtigte das Adam Danowskis Lebenszufriedenheit?
Nach seinem Zusammenbruch vor zwei Jahren hatte Danowski sich vorgenommen, sich vor allem darauf zu konzentrieren: Zufriedenheit. Und die Arschlöcher Arschlöcher sein zu lassen, so egal, wie sie waren. Danowski fummelte an ein paar Unterlagen rum, unfähig, etwas Neues anzufangen oder etwas Altes weiterzumachen, während er warten musste und nicht wusste, wie lange. Der Zufriedenheitswille kämpfte in ihm wie ein Außenbordmotor, der sich in tiefem Schlick festgefahren hatte. Aber noch war Gemisch im Tank.
Danowski hatte sich neu erfunden, er lernte gerade, sich auf das Positive zu besinnen, jeden Tag. Aber daran, dass er sich immer wieder sagen musste, dass er sich neu erfunden hatte, merkte er, dass es bisher nicht so ganz geklappt hatte. Die These der Therapeutin war, dass er möglicherweise weniger hypersensibel war, sondern eher leicht depressiv. Sie sagte «hypersensibel» so, als hätte er das Wort erfunden, dabei war es ihm mal angeheftet worden. Er störte sich am Attribut «leicht» vor «depressiv»: Konnte er nicht einfach mal ganz regulär bekloppt oder okay sein, ohne weitere Einschränkungen? Das «Glückstagebuch», das er alle zwei Wochen mit zur Therapie bringen sollte, machte ihn wahnsinnig. Es sollte ihn «aus negativen Gedankenspiralen befreien» und ihn «am Grübeln hindern». Allein bei dem Wort «Glückstagebuch» musste er die Zähne zusammenbeißen. Und damit wollte er ja eigentlich aufhören, mit dem Zähnezusammenbeißen. Stattdessen lächeln, auch wenn’s weh tat.
Drei Dinge, die ihn am Tag glücklich gemacht hatten.
Abends sollte er das aufschreiben, vorm Schlafengehen. Damit er nicht wach lag mit düsteren Gedanken oder die Geister heraufbeschwor, so wie vor zwei Jahren an der Nordsee seine tote Mutter, die er am Ende nicht mehr aus dem Kopf bekommen hatte. Bis sie ihn ein paar Monate weggebracht hatten, Kurklinik am Stadtrand, aber in der Akte stand vage was von «verdeckter Ermittlung», damit das Gerede nicht noch größer wurde. Der Arm seiner Chefin war lang gewesen, sie hatte ihn eine Weile noch aus dem Ruhestand beschützt. Dann hatte sie ihm gesagt: «Versuchen Sie, glücklich zu sein», seitdem war er wieder im Dienst. Es war das Letzte, was er von seiner alten Chefin gehört hatte.
Früher war er oft viel zu spät in einen unruhigen Schlaf gefallen, hatte nachts mit den Zähnen geknirscht und war am nächsten Morgen so gut wie gar nicht aufgewacht, zu schwer für diese Welt. Jetzt sollte alles viel leichter werden für ihn, aber er kam nicht nach mit dem Glücks-Geschreibe, heute war Mittwoch, er arbeitete noch am Glücks-Eintrag vom Montag, so war das überhaupt nicht gedacht gewesen, das war ihm schon klar. Es erinnerte ihn an die vierte oder fünfte Klasse, als sie in Sachkunde Wetterbeobachtung gemacht hatten, und am Ende der Osterferien war ihm eingefallen, dass er zwei Wochen lang die Windstärke, die Temperatur, die Bewölkung und den Niederschlag hätte aufschreiben müssen, mit speziell dafür vorgesehenen Symbolen, auf Millimeterpapier, und nichts davon hatte er gemacht. Rekonstruiere mal zwei Wochen Wetter oder finde es heraus, 1979 in Südberlin. Da gab’s noch nicht mal Computer, um ins Internet zu gehen. Danowski schlug das schwarze Buch mit den roten Ecken zu, das so aufdringlich nach Tagebuch aussah. 2,49 im Ein-Euro-Shop, das machte ihn irgendwie auch wahnsinnig.
Zum Glück – und an dieser Stelle dachte er sich ein Ausrufezeichen in Klammern, wie immer, wenn er an Glück dachte, seitdem seine Therapie die Richtung hin zum Positiven gewechselt hatte –, zum Glück gab es ja immer noch den Fall. Oder die Fälle. Er wusste inzwischen, dass er den Platz in der Operativen Fallanalyse nicht wegen seiner kriminalistischen Verdienste bekommen hatte, sondern weil man ihn aus den aktiven Ermittlungen heraushaben wollte, ohne ihn allzu auffällig kaltzustellen. Weggelobt. Er hatte sich damit abgefunden und was einigermaßen Brauchbares daraus gemacht: Er arbeitete fleißig und zielstrebig an den eher uninteressanten Fällen, viel Aktenstudium, nur noch wenig Reisen. Er zweifelte zwar nicht daran, dass die Kollegen seinen Beitrag irgendwie zu schätzen wussten. Aber er merkte schon, dass außer ihm keiner in einem Einzelbüro saß.
Danowski ahnte, warum er den Verbindungsmann machen sollte für den Kollegen aus München, der ein paar Wochen lang auf ihre Ressourcen zugreifen sollte, um der Mordbereitschaft beim Schulkellerleichen-Fall zu helfen. Keiner hier in der OFA spielte gern den Roadie für einen Profiler-Rockstar, und keiner arbeitete gern mit Hauptkommissar Behling zusammen, der die Ermittlungen leitete. Danowski erst recht nicht, aber: Wenn man einmal aufgehört hatte, sich gegen Routineaufgaben zu wehren, machte man irgendwann die Drecksarbeit. War so.
Zwei Leichen in zwei Schulkellern, er fand das erst mal nicht so bemerkenswert. Die erste hatten sie im März in Tonndorf gefunden im Nordosten der Stadt, die zweite vorige Woche in Othmarschen im Hamburger Westen, Elbvororte. Beide mumifiziert, die erste ein Hamburger, nicht besonders vermisst seit sieben Jahren, seine Frau hatte gedacht, ihr Mann wäre einfach abgehauen. Ehen gab’s. Die zweite Leiche ein Hamburger, der aus Kassel stammte und der seit zwei Jahren als verschollen galt, verschwunden bei einer Bergwanderung in Patagonien. Zumindest hatten das seine Eltern und seine Freunde gedacht, es gab E-Mails, die jemand in seinem Namen offenbar nach seinem Tod verschickt hatte, damit alle weiter in Patagonien suchten und nicht in einem schlecht aufgeräumten Schulkeller.
Die Unterlagen hatte Danowski auf dem Tisch, aber er fand, das war noch nichts für die Fallanalyse, und vor allem nicht für den großen Gaitner aus München. Aber die Polizeipräsidentin fürchtete eine PR-Katastrophe und wollte verhindern, dass Hundertschaften während der Sommerferien alle Hamburger Schulkeller nach weiteren Leichen durchsuchen mussten, «der Ruf», hatte sie gesagt, «ist ja schon laut geworden». Was für Danowski nur hieß, dass irgendjemand es im Abendblatt geschrieben hatte, womöglich als Leserbrief oder auf der Facebook-Seite. Jedenfalls war der Plan: Die Fallanalytiker kreisten einen Serientäter ein, während die Schulen den Sommer über geschlossen waren, und wenn die Schule wieder anfing, war der Täter gefasst.
Hoffma, dachte Danowski. So redeten seine Töchter. Zumindest die kleine, Martha, elf und vom Temperament her seit langem unberechenbar pubertär. Stella, fast vierzehn, keine Ahnung, was mit Stellas Pubertät war, die hielt sich abseits und lächelte überlegen. Als könnte man damit irgendwas kaschieren. Von wem sie das wohl hatte.
Danowski merkte, dass er seltsam unfähig war, die Mappe zu öffnen und sich noch einmal mit dem Fall zu beschäftigen, bevor das Arschloch aus München ihm und den anderen alles endlich ganz in Ruhe erklärte. Es war der zweite Tote, dessen Akte obenauf lag. Das Gesicht der mumifizierten Leiche war praktisch unkenntlich, die lederne Haut in dunklen Farbtönen über Erhebungen und Öffnungen gezogen wie das Gegenteil einer Frischhaltefolie, eher geeignet, menschliche Züge für immer zu verbergen, als sie hervorzurufen. Aber die Kollegen von der Mordbereitschaft hatten in der Wohnung dieses Toten ein anderes Foto gefunden, es zeigte ihn, als er noch ein Mann war und lebte und in sehr wenig Sportkleidung auf einem Felsen saß, der zu schartig aussah, als sich mit nur ein bisschen Lycra am Hintern daraufzuhocken. Drahtig, Muskeln, bisschen unscharf, obwohl er in Wirklichkeit vermutlich sehr kantig gewesen war. Danowski traute sich nicht, den Gedanken für sich klar zu formulieren, denn es konnte nichts Gutes bedeuten, aber: Der Mann kam ihm bekannt vor. Und nichts Gutes war, dass er entweder anfing, eine Scheinvertrautheit mit Mordopfern zu empfinden. Eine Art Empathie-Exzess, den er noch von früher kannte. Hypersensibel hatten sie ihn genannt. Definitiv nicht der neue Danowski, sondern eher der gleiche neurotische Scheiß wie früher. Oder es bedeutete, dass sein Gedächtnis hin war, und eins passte ihm so wenig wie das andere.
«Na, feilst du dir gerade einen oder kann ich reinkommen?»
Andreas Finzel, genannt Finzi, sein alter Freund und Expartner, nicht mehr ganz so schwer, aber immer noch groß, gleich war das kleine Zimmer voll, und der Himmel verdunkelte sich. Konnte aber auch an Finzis finsterem Gesichtsausdruck liegen.
«Wie siehst du denn aus», sagte Danowski und lächelte schief, ein bisschen angeödet von ihren männlichen Begrüßungsritualen. «Haben sie dir wieder das Fahrrad geklaut?» Tatsächlich hatte Finzi sich im Frühjahr zum Gespött der ganzen Fahrradstaffel gemacht, als sein Dienstrad vor einer Eisdiele in Winterhude geklaut worden war, während er sich drinnen zwei Kugeln im Becher mit halber Sahne geholt hatte, und dann musste er sich von zwei Kolleginnen abholen lassen und in diesen dämlichen Radlerhosen in den Streifenwagen steigen.
«Nee.» Finzi konnte sich irgendwie nicht hinsetzen, er lehnte sich ein bisschen an die Fensterbank, verschränkte die Arme und schaute auf den Parkplatz, als wartete da jemand auf ihn. «Ich darf gerade gar nicht für länger aufs Rad. Bandscheibe.»
Danowski runzelte die Stirn. Es war nicht so, dass er kein Mitgefühl hatte, wenn andere Probleme hatten, im Gegenteil. Das Gefühl war da. Eher zu viel als zu wenig. Er musste sich nur immer wieder aufs Neue vergewissern, dass er die Lagerfläche für das Gefühl hatte und Platz zum Rangieren.
«Echt?» Mehr ging gerade nicht.
«Jawohl», sagte Finzi. «Seit drei Monaten.»
Danowski nickte, als wäre ihm das klar gewesen. So lange hatten sie schon wieder kaum geredet oder gar nicht. Er ertappte sich dabei, dass er dachte: Heute Abend schreib ich ins Glückstagebuch, dass ich mit Finzi geplaudert habe.
«Und nun? Ich meine, was macht ein Fahrradpolizist, der nicht mehr aufs Polizeifahrrad kann?» Es klang nach einem von diesen pseudophilosophischen Problemen, bei denen man am Ende das Gefühl hatte, man hätte was fürs Leben gelernt, aber Pustekuchen.
Finzi guckte wieder aus dem Fenster und sagte: «Dienstpläne. Fahrradtraining an Grundschulen. So was halt.»
Finzi setzte sich direkt vor Danowski auf den Besucherstuhl, der so gut wie nie benutzt wurde. Die meisten Leute, die zu Adam Danowski kamen, standen nur kurz im Türrahmen und waren dann auch schon wieder weg.
«Ihr macht doch jetzt diese Kellerleichen, oder», sagte Finzi.
«Na ja, das ist Behlings Fall.» Knud Behling, sein alter Vorgesetzter, der große alte Knacker der Mordbereitschaften. Wahrscheinlich Behlings letzter wichtiger Fall, der ging am 30. September in Pension und sorgte dafür, dass keiner das vergaß. Danowski fiel es leicht, sich das Datum zu merken, denn er war froh, sobald er Behlings graues Haupt, seine Polohemden und seine über die Schulter gelegten Kaschmirpullis in Pastell nicht mehr sehen musste.
Finzi verzog das Gesicht. Knud Behling hatte ihm mal das Leben gerettet, als Finzi Alkoholiker auf dem Höhe- beziehungsweise Tiefpunkt war und sich aufhängen wollte, weil das Leben mit Alkohol so unerträglich geworden war wie ohne, und dann war Behling reingeplatzt und hatte ihm den Gürtel weggenommen, weil er sich als Einziger gefragt hatte, was Finzi eigentlich am Wochenende allein zu Hause in Hammerbrook so trieb. Aber selbst wenn einem Knud Behling das Leben gerettet hatte, konnte man ihn nicht unbedingt mögen.
«Ja, Behling», sagte Finzi. «Meta ist auch dabei.»
Danowski nickte. Meta Jurkschat hatte er auch lange nicht mehr gesehen. Seine zweite ehemalige Partnerin, die mit Finzi zusammen war, seit Danowski mit keinem von beiden mehr arbeitete. Ohne ihn kamen die Leute offenbar besser zurecht.
«Aber die haben die OFA dazugeholt», sagte Finzi, «damit ihr euch das anschaut, und wie man so hört, kommt sogar Gaitner aus München. Weil die Präsidentin …»
«Ahrens hat gesagt, dass er mich mit Gaitner an der Sache arbeiten lassen wird.» Danowski atmete tief durch. Nein, er würde jetzt nicht darauf herumreiten, wie wenig Lust er darauf hatte. Er würde sich aufs Positive konzentrieren. «Wobei Gaitner wohl nicht länger als ein bis zwei Wochen hier ist. Wird sicher interessant, mal die legendären Methoden aus München kennenzulernen.»
«Hm», machte Finzi. «Interessant. Gut. Adam, hör mal zu. Was weißt du über den zweiten Toten?»
«Den die Schüler gefunden haben? Ehrlich gesagt noch nicht so viel. Ahrens möchte, dass wir da mit frischem Blick rangehen, darum wird Gaitner uns nachher neue Details präsentieren.»
«Du weißt, dass die Leiche identifiziert ist?»
«Das schon, klar. Aber …»
«Hast du dir die Meldeadresse mal angeschaut?»
Danowski angelte nach dem Aktendeckel, aber Finzi kam ihm zuvor.
«Thorsten Stahmer», las Finzi vor. «Kommt dir bekannt vor?»
Danowski schüttelte den Kopf, aber jetzt wusste er, dass er recht gehabt hatte: Das Gesicht kannte er.
«Hier sind verschiedene Meldeadressen», sagte Finzi und fuhr mit seinem großen Zeigefinger über die nächste Seite, die, das wusste Danowski, danach leicht zerknittert sein würde.
«Barmbek-Nord, auch mal Wandsbek», sagte Danowski, um zu zeigen, dass er auch schon in die Akte geschaut hatte.
Finzi nickte, dann hielt er inne. «Hier, Meldeadresse von vor fünf, sechs Jahren. Rombergstraße 92. Kommt dir das irgendwie bekannt vor?»
«Eimsbüttel», sagte Danowski.
«Adam, klar. Das ist hier aber kein Heimatkunde-Quiz, kenne deine Stadtteile oder so was. Du hast da sogar mal geschlafen.»
«Hör auf.»
«Auf dem Fußboden oder auf dem Futon.»
«Auf dem Fußboden. Meta hat auf dem Futon geschlafen. Ach du …»
«Ja, Scheiße, genau.»
Danowski rieb sich die Stirn. Vor ein paar Jahren hatte er mit Hauptkommissarin Meta Jurkschat ein Tötungsdelikt im Elbtunnel bearbeitet. Zwischendurch hatte jemand angefangen, ihre Telefone abzuhören und sie zu überwachen, und für ein, zwei Nächte hatten sie sich in einer Wohnung versteckt, die Metas Freund gemietet hatte, in der er aber kaum noch war, weil er inzwischen bei Meta wohnte. Dieser Extremsportler, den Danowski nie kennengelernt hatte, aber er hatte Fotos von ihm rund um Metas Schreibtisch gesehen, die waren vom Licht und vom sportlichen Ausdruck her so ähnlich gewesen, immer Lycra auf Felsen.
Aus dem Augenwinkel sah Danowski, wie die Klinke seiner Bürotür langsam nach unten ging, und gleichzeitig klopfte jemand. Dann stand Meta Jurkschat im Raum. Typisch, dachte er, die klopft, aber kann’s nicht erwarten reinzukommen.
«Okay», sagte sie zu Finzi, mit dem sie zusammen war, seitdem sie sich von Thorsten Stahmer getrennt hatte. Der nun seinerseits tot, mumifiziert und Danowskis Problem war. «Das hätte ich mir denken können, aber das ist ein Fehler. Dass du mit Adam darüber redest. Hallo, Adam.»
«Meta», sagte er und stand halb auf, denn seit sie mit Finzi zusammen war, hatten sie eine Umarmungskultur entwickelt, deren Etikette ihm nach wie vor nicht ganz klar war, aber er wollte sich sicherheitshalber bereithalten, «schön, dich …»
«Dann weißt du ja, was das … also.» Sie brach ab und griff in ihren Pferdeschwanz. Zwischendurch, bei ihrem Fall an der Nordsee, waren die Haare ab gewesen. Er hatte sie lange nicht gesehen.
«Dein Exfreund ist ermordet worden», sagte er. «Das tut mir leid.»
«Meta», sagte Finzi von unten aus seinem Stuhl, «bei Adam ist das sicher, und du brauchst irgendjemanden, der auf deiner Seite ist, also, der dich da …»
Jurkschat, wie Danowski sie in Gedanken immer noch nannte, lehnte sich an die Wand. Sie war immer noch fünf, sechs Jahre jünger als Finzi und er, aber sie sah nicht mehr aus, als wären es zehn oder zwölf. Er fand ihr Gesicht spitzer, und weil er sich in Details verlor, fielen ihm die feinen vertikalen Falten zwischen ihren Ohren und ihren Wangen auf. Neu war auch der Ausdruck von Ratlosigkeit und mühsam wegverhandelter Panik um ihre blasse Stirn. Mit Erschrecken stellte er fest, dass er Jurkschat, seit er sie kannte, zu Unrecht für unerschütterlich gehalten hatte.
«Moment», sagte Danowski, «was sagen denn die Kollegen von der Mordbereitschaft dazu? Ist Behling irgendwie der Meinung, dass du was damit zu tun hast? Vielleicht magst du mir das mal von Anfang an …»
«Keiner weiß das», unterbrach ihn Jurkschat und sah ihn aus harten Kieselaugen an. «Woher auch.»
«Von dir?»
Sie schwieg und blickte hinunter zu Finzi: Siehst du, was für eine dumme Idee das war.
«Meta hat sich auf eine Leitungsstelle beworben», sagte Finzi. Danowski hatte davon gehört. Es war ihm so sinnvoll und folgerichtig erschienen, dass er es sich nicht gemerkt hatte. Jurkschat war in allem irgendwie gut und hatte keine Feinde im Präsidium, darum hatte sie Chancen. Sie machte ein gequältes Gesicht, aber Danowski wusste von früher: Es war nicht so, dass sie Versteckspielen nicht gut konnte. Geheimnistuerei passte nur nicht zu ihrem Selbstbild. Aber hier quälte sie noch was anderes.
«Und wenn du als Zeugin in eine Mordermittlung verwickelt bist, die sich womöglich bis weit in den Herbst hinzieht oder nie abgeschlossen wird, dann kannst du das vergessen», sagte er.
«Ist auch ein bisschen spät jetzt», sagte Finzi. «Wenn man einmal angefangen hat, Sachen zu verschweigen.» Wieder ein Blick. Bei den beiden war noch mehr los als eine alte Leiche, das sah er und hob es auf für später.
«Ich weiß nichts», sagte Jurkschat Richtung Danowski. «Nur, damit das gleich klar ist. Ich hab Thorsten seit drei Jahren nicht gesehen oder gesprochen.»
«Sein Leichnam hat seit etwa zwei Jahren da im Schulkeller gelegen», sagte Danowski.
«Ich weiß nichts über sein letztes Jahr», sagte Jurkschat. «Wir hatten keinen Kontakt mehr.»
«Komm, Meta», sagte Danowski. «Das glaube ich dir zwar, aber du weißt genau, dass du trotzdem unendlich viel mehr über ihn weißt als Behling und seine Leute. Alles, was du über dein Leben mit Thorsten erzählen kannst, ist ermittlungsrelevant.»
«Und da», sagte Finzi, «kommst du ins Spiel, Adam, mein Sohn. Meta erzählt dir das, und du lässt es über die Fallanalyse-Schiene in die Ermittlungen einfließen.»
«Ihr spinnt», sagte Danowski. «Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr euch das …»
«Wir sind Freunde», sagte Finzi. Es klang weniger wie ein Appell und mehr wie das Eingeständnis einer Niederlage. Danowski schluckte.
3. Kapitel
Scheffler, den sie Scheff nannten, war back on top, er hatte die Dinge wieder unter Kontrolle, die trüben Tage waren vorbei, jetzt ging die Party richtig los, und überhaupt war er bereit, der Welt ein zweites Arschloch zu reißen. Wenn die Welt verdammt noch mal nur wenigstens einen Augenblick stillhalten würde.
Scheffler hielt sich am Tresen fest, nicht, weil ihm schwindlig war, oh nein, Euer Ehren, sondern weil er sonst abgehoben wäre, schwerelos, bis direkt unter die Decke, deren Nikotin-Bernstein-Ton zu den Ecken hin immer dunkler wurde. Und Scheffler trank nur Cola, höchstens mal eine Spezi, Alkohol nie. Alkohol war für die Häschen, das war eine ganz klare Sache. Dann trank er vielleicht mal mit, aber das war dann was anderes als trinken, das war Strategie. Oder Taktik.
«Na, Scheff, gut drauf heute?» Leon machte im King Horse die Bar, seit die guten Jahre vorbei waren, Scheffs und die vom King Horse. Leon hatte diesen hart gönnerhaften Ton, an dem Scheff sich innerlich schubberte wie die Wildsau an der Baumrinde. Es tat ihm gut zu wissen, wer seine Feinde waren.
«Absolut, mein lieber Freund, absolut», sagte Scheff, ohne in Leons Richtung zu blicken. Er konnte nicht anders, als im King Horse Richtung Tür zu starren. Er war Ende dreißig, es war Jahre her, dass das hier ein Laden mit Hot Babes gewesen war, ein ertragreicher Jagdgrund. Inzwischen saßen hier nur noch Ehemalige und Vormittagstrinker und Poser aus den Werbeagenturen in Altona, aber Scheff kam immer noch, weil hier alles angefangen hatte, und angefangen hatte es immer damit, dass jemand reinkam. «Große Sache am Start», sagte er.
«Nee, is klar», sagte Leon. Wischten Barleute nicht überall sonst immer den Tresen mit dem Lappen, während sie mit einem sprachen? Oder Gläser? Er hatte Leon noch nie mit einem Lappen gesehen.
Scheff merkte, wie seine Euphorie anfing, sich zu verflüchtigen. Wie immer fing er an, große Worte zu machen, als könnte er das Gefühl der Begeisterung damit zurückholen.
«Die Stunde der Rache ist gekommen», sagte er. «Arsch-ab-Tag. Jetzt wird abgerechnet.»
«Ja, nee, is klar. Mit wem denn?»
Scheff drehte den Kopf in Leons Richtung, als wäre es eine noch größere Anstrengung als in Wirklichkeit. «Kannst du dich noch an Thorsten erinnern?»
Leon war unfassbar. Der stand echt einfach nur hinter der Bar, ohne irgendwas zu tun, der verschränkte nicht mal die Arme über der Brust, der ließ die Arme hängen wie eine Hintergrundfigur in einem alten Computerspiel, «GTA 3» auf Playstation 2 oder so.
«Vielleicht», sagte Leon.
Scheff, der wusste, dass er im Laufe der letzten zehn Jahre dicklich geworden war auf die unproportionale Art von Dünnen, die zu viel rumsaßen und zu falsch aßen, riss die alberne 0,2-Colaflasche hoch, die sie im King Horse servierten, als würde er Leon zuprosten, und sagte: «Oh, vielleicht! Vielleicht kann er sich noch an Thorsten erinnern. Der Herr Leon spricht in Rätseln! Möchten wir uns interessant machen, hm?»
Leon hob kaum die wundgepiercte Augenbraue und wandte sich ab.
«Sie haben Thorsten gefunden», sagte Scheff, «hast du vielleicht in der Zeitung gelesen.» Abends kam immer ein Libanese durch auf seiner Verkaufstour und legte vorm Rausgehen die Nachtausgabe der Mopo fürs Haus auf den Tresen. Wenn Scheff vormittags kam, war sie immer schon fleckig.
«Ich sag dir: erst Fränkie, dann Thorsten. Verstehst du, Leon? Nee, oder? Und Ecki ist auch seit Jahren nicht mehr da. Wer weiß, ob sie den nicht auch bald finden. Von wegen ertrunken.»
«Ich versteh schon. Dass du ganz schön viel Scheiß redest.»
«Herr Leon. Sie wissen doch gar nicht, was hier früher los war.»
«Mehr, jedenfalls.»
Scheff nickte. Da hatte Leon allerdings recht. Aber er kannte die Geschichte nicht, die Story, die Legende. Wie alt war die tätowierte Fresse hier? Mitte zwanzig? Der hatte vielleicht mal gehört, dass das hier früher ein Aufreißerschuppen war, so hatten sie das genannt. Dann war das alles unübersichtlicher geworden. Bis es sich aufgelöst und zerstreut hatte.
«In alle Winde», sagte Scheff und schwenkte seine leere Colaflasche: noch eine.
«Was», sagte Leon und schob sie ihm hin.
«Ich dachte, die hätten sich in alle Winde zerstreut. So hab ich mir das erklärt. Passiert, wenn man älter wird. Wirst du auch noch merken. Weißt du, Leon. Dass man sich aus den Augen verliert und so. Wenn der Wind bläst. Wind of change. Aber.» Scheff machte eine Kunstpause, auch, weil sein Mund colatrocken war, wogegen nur eins half, mehr Cola. «Aber die sind tot. Bäng. Mumifiziert. Na so was. Alle beide. Und Ecki haben sie nie gefunden. Von wegen, der ist in der Elbe.»
Leon sah ihn nachdenklich an, oder, vermutete Scheff, so wie Leon eben aussah, wenn er versuchte, nachzudenken und dabei vergaß, den Mund zuzumachen.
«Hast du mal so richtig auf die Fresse gekriegt?», fragte Scheff.
Leon sagte nichts.
«Ich schon», sagte Scheff. Mein ganzes Leben. Das fing in der Schule an. Von allen. Auch von denen, die mich gar nicht berührt haben. Nicht mal angeguckt. Und von den Häschen, klar. Immer auf die Fresse. In echt und metaphorisch, verstehst du. Aber das hört jetzt endlich auf. Ich hab jetzt wieder Oberwasser. Ich seh, was da abgeht. Und jetzt, mein lieber Freund, wird der Spieß umgedreht. Scheff schlägt zurück. Absolut.
Er räusperte sich, weil ihm einen Moment nicht klar war, ob er gesprochen oder gedacht hatte. Und weil Scheffler, den sie Scheff nannten, Fachmann darin war, die Bedrohung und die Opferbereitschaft in den Gesichtern der anderen zu lesen, merkte er die Veränderung im Gesicht von Leon. Irgendwie breiter, alarmiert, Leons Blick ging über Scheffs Schulter Richtung Tür.
Ist ja klar, dachte Scheff, da drehte man sich einmal weg von der Tür, um diesem unglaublich dummen Leon die Welt zu erklären, und dann kam da was von da. Langsam drehte Scheff sich um, denn man wollte ja nicht, dass wer auch immer da den Laden betreten hatte, merkte, wie interessant er war oder sie, vielleicht ein Häschen. Und ein bisschen Hoffnung spürte er auch in sich: Vielleicht war es Neunauge. Der war so was wie ihr Guru gewesen. Einer, den die anderen nie zu sehen bekommen hatten. Es hatte Jahre gedauert, bis er sich Scheff mal gezeigt hatte, und da waren Ecki und Frank schon verschwunden gewesen. Neunauge hatte hier plötzlich neben ihm gesessen und gesagt: Hey, ich bin Neunauge. Es war eine kurze Begegnung gewesen, Scheff hatte so viele Fragen nicht gestellt. Was ihm erst aufgefallen war, als Thorsten, dem er davon erzählte, ihm dafür auf den Hinterkopf haute, wie damals im Waldheim. Obwohl sie doch längst Männer waren.
«Ha!», kam es raus aus Scheff, so laut, dass er selbst erschrak, und er jagte seine Hände wieder an den Tresen, weil er sonst aufgesprungen wäre vor Begeisterung und vor Schreck. Er wusste es doch. Er wusste doch, dass er back on top war, Oberwasser, und dass der Spieß nur noch darauf wartete, umgedreht zu werden, und zwar von ihm. Von Neunauge und ihm. Alles passte zusammen, denn jetzt merkte er auch noch, dass er nicht mehr alleine war. Neunauge war da, und zusammen mit Neunauge würde er rausfinden, wer Thorsten und Fränkie auf dem Gewissen hatte und was wirklich mit Ecki passiert war.
«Meine sehr verehrten Damen und Herren», hörte Scheff sich rufen, «bin ich hier in einer verdammten Zeitmaschine oder was, gerade rede ich von Ecki, Thorsten und Fränkie, und dann kommst du, the one and only. Neunauge! Wie lange …»
Jahre, dachte er, bestimmt zwei Jahre.
Und wie weich und feucht von Dreck der Boden war, und die Kaugummis unter dem Hocker, graue Sterne vor grauem Firmament, Alter, schreib doch Gedichte, statt zu bluten.
Und war das sein Blut, oder von wem sonst?
Genau, von wem sonst.
Und was einem, dachte Scheffler, eben so durch den Kopf ging, wenn man richtig einen Schlag in die Fresse bekommen hatte, und zwar nicht als Metapher, sondern in echt, und wenn einem einer, den man zwei Jahre nicht gesehen hatte, mit der ruhigen Methodik dessen, dem das nicht in die Wiege gelegt war, sondern der das gewissenhaft hatte lernen müssen, wieder und wieder in die Seite und in den Magen trat, bis man ausfloss in einem kabbeligen Meer von Schmerz.
«Noch ’ne Cola, Scheff?», fragte Leon von ganz weit weg.
Scheffler, den sie Scheff nannten, drehte sich zur Seite und nahm kurz die Hände vom Kopf, um ihn in vorsichtiger, aber deutlicher Verneinung zur Seite und zurück zu drehen. Er hatte noch gar nicht ausgetrunken.
4. Kapitel
«Wo sind deine Sachen?», fragte Ahrens, sein Chef, bärtig-besorgt, doch unverbrüchlich jovial. «Läuft das alles?»
«Liegen schon im Konferenzraum», sagte Danowski gereizt, dabei mochte er Ahrens eigentlich mit seiner verblüffend langsamen Art, die doch immer zum Ziel führte, sorgfältig und abwägend: Erst mal sacken lassen. Was ein gutes Prinzip für die Arbeit in der Operativen Fallanalyse war, aber in jeder Hinsicht Danowskis Temperament widersprach: Er wollte die Dinge am liebsten loswerden, bevor sie Zeit hatten, einzusacken. Dann merkte er an seinen leeren Händen, durch die der warme Sommerwind pfiff, dass er die Akten, um die es eigentlich ging, auf dem Schreibtisch liegen gelassen hatte. Das ärgerte ihn zusätzlich.
«Ich bin auch noch mal zurückgegangen in die OFA, als es hieß, der Gaitner verspätet sich», sagte Ahrens, «aber meine Sachen nehm ich immer mit.» Wie zum Beweis schlackerte er ein bisschen mit dem Rucksack, der ihm an einem Riemen über der Schulter hing. «Sonst vermehren die sich am Ende. So läuft das doch.»
Danowski nickte gequält. Er war gereizt, weil er viel Energie darauf verwendete, sein Leben möglichst unkompliziert zu halten, aber jetzt verursachten seine Freunde Finzi und Jurkschat, dass dieses Leben sich wieder in eine einzige riesige Komplikation verwandelte. Er schwitzte, dabei waren es nur ein paar hundert Meter zum Haupthaus des Präsidiums, in den Fahrstuhl und zum Konferenzraum. Meta Jurkschat ging schweigend, zielstrebig, mit leicht hochgezogenen Schultern neben ihnen, und wenn Danowski zur Seite sah, wich sie seinem Blick aus.
Reg dich mal nicht auf, sagte er sich. Hat Meta was mit dem Tod ihres Exfreundes zu tun?
Nein, natürlich nicht.
Ist es nachvollziehbar, dass sie für sich behalten hat, den Toten zu kennen?
Nachvollziehbar schon. Aber völlig bescheuert.
Das war nicht die Frage.
Ja, nachvollziehbar.
Steht es zur Debatte, jetzt zu Behling zu gehen und dem borstigen Silberrücken zu sagen, er soll mal mit Meta reden, die weiß was über den Toten?
Nein, völlig absurde Vorstellung.
Also, ruhig atmen, nicht ärgern: Es geht erstens nicht darum, Meta bei der Vertuschung eines Kapitalverbrechens zu helfen, und zweitens gibt es keine Alternative.
Trotzdem. Allein der ganze Aufwand. Vorne den Fall analysieren und hinten Meta als Zeugin befragen, mit anderen Worten also: ermitteln. Und das auch noch unauffällig. Vom Risiko ganz abgesehen.
Muss ja nicht alles Spaß machen.
Nee, stimmt. Aber fürs Glückstagebuch wird’s auch nichts abwerfen.
Ahrens hielt ihnen die Tür auf, was ein geschickter Zug war, denn inzwischen waren sie diejenigen, die zu spät waren, alle anderen waren in der Nähe geblieben. Dadurch, dass er Danowski und Jurkschat erst durchgehen ließ, konnte Ahrens hinter ihm unbemerkt im Dunkel des Konferenzraums verschwinden. Jurkschat setzte sich zu Behlings Team, wo sie ihr einen Platz freigehalten hatten. Danowski blieb in der Tür stehen, die mit einem resignierten Seufzen ins Schloss fiel. Er brauchte einen Augenblick, um sich zu orientieren. Um den ovalen Tisch die Rücken seiner übrigen OFA-Kollegen, ein paar Leute, die er nicht gleich einordnen konnte, und unverkennbar auch Behling, dessen grauer Haarkranz im Beamerlicht leuchtete. Der große Gaitner arbeitete mit Multimedia. Neben Behling das breite Kreuz von Kienbaum, der müsste doch langsam wirklich mal austrainiert sein. Aber wo hatte Danowski noch mal gesessen?
Leider genau da, wo jetzt Martin Gaitner stand, das Arschloch aus München. Wie konnte man mit Anfang fünfzig so viel und so dichtes und so dunkles Haar haben, und – nicht zu vergessen – so lang, lässig bis auf den Kragen wie bei einem Lebenskünstler in einem Siebziger-Jahre-Film? Danowski hatte im Rahmen seiner Neuerfindung auch versucht, seine mittlerweile recht angegraute Matte ein bisschen in die Länge wachsen zu lassen, Deckhaar züchten, nannte das die Friseurin, aber er wirkte dadurch nur verwahrlost. Im Rückschein der Beamerleinwand sah Danowski die markante Nase und das außerordentlich gut dazu passende Kinn und den leicht ironischen Zug um den Gaitner-Mund. Fast hätte er den Arm ausgestreckt, um den Münchner Jackettrücken zu berühren, Danowski glaubte zu riechen, was für ein herrlicher Stoff das war, und nicht nur, wie die Herrenausstatter bei ihm immer tröstend sagten, «ein strapazierfähiges Material». Seine Mischgewebejacken waren das Einzige, was an Danowski strapazierfähig war. Gaitner ignorierte ihn: Der Fachmann war ganz auf sein fachmännisch an die Leinwand projiziertes Fachmannzeug konzentriert.
«So», sagte Gaitner, und schon an dieser einen Silbe hörte Danowski was entspannt lebensklug Süddeutsches, das ihn mit Neid und Abneigung erfüllte, dem Gefühlscocktail des kleineren Mannes. «Ich hab das hier mal fotografisch aufbereitet auf die Schnelle, dann haben wir das alle direkt vor Augen.» Gott, der suchte und fand Rs zum Rollen, wo fast gar keine waren.
Danowski lehnte sich an die Wand: weggegangen, Platz vergangen.
«Ich möcht Ihnen gern die Gelegenheit geben, weil wir noch nicht alle zusammengearbeitet haben, mich ein bisschen besser kennenzulernen, vom Prinzip her möcht ich mich kurz vorstellen», sagte Gaitner, und Danowski fragte sich, warum auf der Beamerleinwand drei Gegenstände zu sehen waren, die ihm alle bekannt vorkamen, die aber fremd wirkten, weil sie mit Legenummern gekennzeichnet waren wie Spuren oder Beweisstücke an einem Tatort. Ein Notizbuch, ein Kugelschreiber mit Wahlwerbung für einen Hamburger SPD-Abgeordneten und ein etwas zu kleines Sonnenbrillenetui, aus dem ein dunkelbraunes Bügelende schaute.
Danowski schluckte. Das waren seine Sachen. Das Zeug, das er hier auf dem Tisch liegengelassen hatte, genau da, wo Gaitner jetzt stand. Der die Gegenstände offenbar geordnet und schnell abfotografiert hatte, um sie an die Wand zu projizieren. Das war verblüffend. Und beunruhigend.
«So, in der Sache geht es mir immer erst mal darum, im Profiling zwei Prinzipien zu unterscheiden, von denen Sie sich am Anfang immer für eins entscheiden müssen. Das haben Sie so nicht gehört im Lehrgang, das ist ja work in progress immer, was wir machen, ich bin auch gerade erst dabei, das mal zu verschriftlichen. Also hören’s gut zu, können’s was lernen.»
Verblüffend. Allein die Dichte von Müncherismen, das rutschte dem doch nicht einfach so raus, das war doch gesteuert.
«Vom Prinzip her unterscheide ich immer gern zwischen der reduktiven und der additiven Analyse. Ist klar. Bei der einen nehmen’s was weg, bei der anderen tun’s was dazu. Nun ist das, was wir gelernt und gelehrt haben, im Grunde die reduktive Analyse: Wir schließen anhand von Spuren Dinge aus, die auf einen Täter zutreffen könnten. Hier sehen’s zum Beispiel die Sachen, die der Kollege auf dem Tisch liegeng’lassen hat. Ich schließe aus, dass das eine Frau ist, denn das ist eine Männersonnenbrille. Reduktive Methode. Die sagt uns auch: Er ist nicht blind, denn er hat eine Sonnenbrille, die er in geschlossenen Räumen ablegt. Und er ist kein Analphabet, denn er hat mit dem Stift offenbar in das Notizbuch geschrieben. Das ist unsere sicherste Methode, reduktiv. Aber mehr kriegen’s mit der Methode nicht raus: ein Mann, der gucken und schreiben kann. Aber jetzt zeig ich Ihnen einmal, was man mit der additiven Methode herausfinden kann. Ich weiß ja nicht, von wem des alles hier ist, darum können Sie das am besten für sich selbst überprüfen, ob des am Ende dann stimmt.»
Beunruhigend, denn wer wollte schon Gegenstand eines Persönlichkeitsprofils werden, vor allen Kollegen. Aber Danowski war erstarrt und guckte sich das alles an wie einen Scherz auf jemand anderes Kosten.
«So, bei der additiven Methode bleiben’s ganz nah am Plausibilitätskern, der gibt Ihnen Stabilität. Ich weiß erst mal über den Mann, dass er ungeduldig ist, denn als er gehört hat, der Vortragende verspätet sich, ist er aufgestanden und weggegangen. Er hätt ja bleiben können und a bisserl ratschen mit den Kollegen, aber das hat er nicht wollen. Also eher ein Einzelgänger. Dann fragt man sich, wo sind die fallrelevanten Unterlagen hier, die Aktenmappe vom Kollegen. Zwei Möglichkeiten. Er hat sie wieder mitgenommen, oder er hat sie vom Prinzip her gleich ganz vergessen. Ich tu mal die zweite Variante in den Topf: vergessen. Warum? Weil, draußen ist es sonnig, wenn er schon hier aufg’standen ist, wird er rausgegangen sein, und die Sonnenbrille hat er auch vergessen, also, er ist mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache.»
Danowski war drauf und dran, dem ganzen Analysespuk ein Ende zu machen, als er sah, dass Behling sich halb umgedreht hatte und ihm über die Schulter einen spöttischen Blick zuwarf. Danowski zögerte. Wenn er jetzt was sagte, wäre er doch wieder nur der Spielverderber.
«Trägt denn der Plausibilitätskern noch das, was ich zugetan hab?», fuhr Deutschlands bekanntester Profiler fort. «Schau’n mer mal, hier, der Kugelschreiber und das Notizbuch. Ich hab das nicht aufgeblättert, das ist ja nur eine kleine Veranschaulichung hier, ich mag nicht eindringen in die Privatsphäre von dem Kollegen, aber ich seh am Rand …»
Ein neues Bild aus dem Beamer, Detailaufnahme.
«… dass des Notizbuch nur am Anfang vollgeschrieben ist, das sehen’s hier an der Nutzbelastung der Seitenränder. Zugleich …»
Detailaufnahme des Umschlagrandes.
«… weist es vom Außenumschlag her starke Gebrauchsspuren auf. Also: viel herumgetragen, wenig reingeschrieben. Passt schon: Unser Mann ist entweder mit den Gedanken woanders oder ein bisschen nachlässig, oder er glaubt, er hat’s nicht so nötig, zum Beispiel, sich was aufzuschreiben, weil er eh alles weiß. Sehen’s, das mit dem nachlässig trifft den Plausibilitätskern: die Sonnenbrille passt nicht ins Etui, die ist ein bisserl zu groß, aber das war ihm egal, das Etui hatte er halt schon. Unser Mann ist auch nicht der Typ, der sagt, ich bin Polizist, ich muss viel schreiben, ich leg einen Wert auf erstklassiges Handwerkszeug, ich kauf mir einen schönen Kuli, nein, der hier vom Werbestand, Bundestagswahl 2013, der ist gut genug.»
Danowski machte den Analytiker-Job ja selbst inzwischen seit ein paar Jahren und kannte sich deshalb auch mit Persönlichkeitsprofilen aus, darum beeindruckte ihn das inhaltlich alles gar nicht, aber er spürte, dass er im Dunkeln rot wurde. Denn die Kollegen kicherten, als wäre das hier ein gelungener Partytrick.
«Aber wissen’s was, bei der additiven Methoden dürfen’s nie außer Acht lassen, dass alles seine zwei Seiten hat. Ich seh hier an drei Gegenständen einen Mann, der ungeduldig, eigenbrötlerisch, mit den Gedanken woanders und womöglich ein bisschen nachlässig ist. Jetzt kennen Sie den Kollegen ja besser als ich, Sie wissen ja, wer das ist. Und die andere Seite ist wichtig, das müssen’s bei der additiven Methode im Blick behalten, die Methode ist wie eine Linse, die Ihnen die Dinge von zwei Seiten zugleich zeigt. Also, ungeduldig, eigensinnig, nachlässig, das ist eine Lesart, die andere Seite davon ist: Das Ungeduldige können’s auch als stark priorisierend sehen, der Mann hat klare Vorstellungen davon, wie er seine Arbeitszeit nutzen möchte; auch das Eigensinnige, das heißt vielleicht, er möcht sich lieber allein fokussieren, als mit anderen zu ratschen, er ist also sehr konzentriert, und das Nachlässige, das ist schon auch so ein Hinweis auf eine Improvisationskunst, aber eben auch wieder das stark Priorisierende, das …»
«Nee, nee», sagte Knud Behling und winkte scherzhaft in Richtung Danowski, als wäre das hier ein Familientreffen, auf das keiner so recht Lust hatte, aber man machte das Beste draus, «das Erste stimmt schon, wenn’s um unseren Adam geht.»
Die meisten Kollegen grinsten auf diese warnende Art, die ihm sagte: Adam, du wirst doch wohl einen Spaß abkönnen. Ahrens, der als OFA-Chef Wert auf gemeinsames Grillen, also Loyalität legte, wiegte den Kopf und widersprach Richtung Behling: «Also, ich seh da eine gesunde Mischung, beide Seiten der Medaille, wenn man so will.» Dann lachte er und schaute dabei nach links und rechts, als wäre er nicht der Einzige.
Gaitner drehte sich langsam zu Danowski um. Wie in einer sorgfältig geplanten Dramaturgie wurde es gleichzeitig im Raum wieder heller und die Leinwand verblasste, als leuchtete Gaitner von innen.
«Ihre Sachen waren das», sagte er und hielt Danowski die Hand hin. «Gaitner.»
«Ja, war sehr interessant», sagte Danowski und ließ zu, dass das Arschloch aus München seine Hand, die Danowski ihm irgendwie gegeben hatte, festhielt, nachdem der Schüttelvorgang längst abgeschlossen war. «Danowski.»
«Leichenfundort Schule», sagte Gaitner und zog an Danowskis Hand. «Zwei Tote. Todesursache in beiden Fällen stumpfe Gewalt. Beide Leichen mumifiziert. Abstand der Taten etwa fünf Jahre. Wir kennen keine Verbindung zwischen den beiden Opfern. Ganz auf die Schnelle, was sagen Sie, was verbindet die Gegenwart einer Schule mit ihrer Vergangenheit?»
«Äh …» Danowskis Frau Leslie war Lehrerin, also, inzwischen Schulleiterin, darum fiel Danowski auf die Schnelle nur eine Sache ein: «Sanierungsrückstand.»
Gaitner lachte, so nach dem Motto: Kindermund tut Wahrheit kund.
«Ja, des mag schon sein, aber ich mein’s ganz ernst, auf unsere Fälle bezogen hier.»
«Wir wissen ja gar nicht, ob die beiden Funde zusammenhängen, also, die Tötungen …», sagte Danowski und merkte, dass er weiter an Boden verlor.
Gaitner zwinkerte ihm zu. Unglaublich, dachte Danowski. Als Nächstes zaubert er mir ein Markstück hinterm Ohr hervor und sagt, ich müsste mich da mal waschen, aber behalten darf ich’s dann schon, aber: Nicht alles auf einmal ausgeben!
«Das ist bis jetzt mal unsere Hypothese, liegt ja auch nahe, aber keine Angst, ich sehe, Sie sind ein Mann der Wissenschaft, ich hab hier noch ein gemeinsames Verletzungsmerkmal der beiden Leichen, das wir erst in München entdeckt haben mit der Spektralanalyse, ist ja nicht einfach bei der Mumifikation, schon die Tätowierungen sind nicht mehr gut zu erkennen, aber … dazu kommen wir gleich.» Er nickte Danowski zu, als dürfte dieser sich jetzt setzen.
«Sanierungsrückstand ist ein wichtiges Thema der Hamburger Schulen», sagte Danowski, «und Korruption im Baugewerbe ist immer wieder ein Hintergrund von Kapitalverbrechen. Da ist in den letzten Jahren viel Geld geflossen ins System, Hunderte von Millionen …»
Gaitner winkte ab, nachsichtig.
«Der zweite Leichenfund war am Gymnasium Klein-Flottbek», fuhr Danowski fort, jetzt erst recht, aber er fand selbst, dass er in einen unangenehmen Herr-Lehrer-ich-weiß-was!-Tonfall geraten war, mit dem er hier niemanden beeindrucken konnte. «Das ist eine Schule mit hohem Bildungsniveau, wohlhabendes Umfeld, kaum Schüler mit Migrationshintergrund. Im Moment müssen Schulen in wirtschaftlich bessergestellten Gegenden länger auf Sanierungen und Neubauten warten, aus politischen Gründen. Der erste Leichenfund im März war an der Gesamtschule an der Pulvermühle, in Tonndorf. Gemischtes Einkommensgefüge der Eltern, viele Schüler, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist. Als die Schule umgebaut werden sollte, wurde die Leiche im Keller gefunden. Das unterschiedliche soziale Umfeld der Schulen und der unterschiedliche Sanierungsstand …» Danowski brach ab. Er musste anerkennen, dass er den Faden verloren hatte.
«Was verbindet die Gegenwart von Schulen mit ihrer Vergangenheit?», wiederholte Gaitner seine Frage. Und Kienbaum von der Mordbereitschaft, ausgerechnet Hauptkommissar Kienbaum, der weder an der Gesichtsfarbe noch am IQ leicht von seiner Lederjacke zu unterscheiden war, antwortete in einem Tonfall, als helfe er Danowski aus der Patsche: «Schulen sind neben dem familiären Umfeld hauptsächlicher Ereignisraum für Traumata im Kinder- und Jugendalter. Also, aus kriminalistischer Sicht: traumatische Ereignisse aus der Vergangenheit, die Täter und Opfer miteinander verbinden und die zu einer kriminellen Entladung in der Gegenwart führen, über die Tat.»
«Und das nennt man wie?», fragte Gaitner. «Traumatische Ereignisse an der Schule?»
«Mobbing», sagte Behling ernst, der Senior am langen Ende des späten Nachmittags seiner Laufbahn bei der Hamburger Polizei. Wahrscheinlich hatte er mal eine Schulung dazu besuchen müssen, da hatte er zumindest den Tonfall gelernt.
«Mobbing», sagte Gaitner und nickte ernst in die Runde. Allerdings sprach er es Mopping aus.
«Ist gut und schön», sagte Behling. «Schon wichtig, dass wir hier das, äh, psychosoziale Spannungsfeld und so weiter, in dem sich das alles abspielt, dass wir das im Auge behalten. Muss aber doch vor allem dran erinnern, Anliegen aus dem Präsidialbüro, dass sich seit dem zweiten Leichenfund langsam bisschen Panik breitmacht. Alle Zeit der Welt haben wir jetzt auch nicht. Schulbehörde sagt, dass Hunderte von Eltern ihre Lütten bis zu den Ferien gar nicht mehr in die Schule lassen wollen. Also, zwei, drei Dutzend werden’s demnach schon gewesen sein.»
Gaitner dimmte wieder das Licht und nickte erst Behling zu und dann Richtung Leinwand, als wäre dort die Antwort auf dessen Bedenken. Es erschienen, nebeneinander projiziert, zwei Nahaufnahmen brauner Mumienhaut, durchzogen von Trocknungsfurchen. Über der linken Aufnahme stand Frank Jablonski, über der rechten Thorsten Stahmer. Jurkschats Exfreund. Dann begann eine Animation, die die Hautdetails in ein Schema verwandelte, um 180 Grad drehte und auf der Rückseite beider Hautstellen runde, fast spiralförmige Einstichstellen zeigte.
«Die Nackenpartie von Opfer 1 und Opfer 2», sagte Gaitner. «Bissspuren mit so geringen Einzeldurchmessern sind in der Augenscheinuntersuchung der Rechtsmedizin nicht unbedingt zu erkennen, vor allem, wenn wir wie bei beiden Leichen an den entscheidenden Stellen einen richtig schönen Pilzrasen auf der Haut haben. Aber uns hat eine Tätowierung von Opfer 1 interessiert, für die wir eh ans Mikroskop mussten. Und dabei haben wir das hier entdeckt. Jemand eine Ahnung, was das für Bissspuren sind?»
Danowski ertappte sich dabei, dass er selbst es gern gewusst hätte. Einfach, um etwas sagen zu können. Es war unglaublich, wie Gaitner den Raum im Griff hatte.
«Petromyzon marinus», sagte Gaitner. «Neunauge. Das ist das Rundmaul eines Meeresneunauges.»
«Ein Fisch», nickte Behling maritim.
«Ein kieferloses Wirbeltier, um genau zu sein», korrigierte Gaitner alpin, «schaut ein bisschen aus wie ein Aal, bis auf die neun Kiemenöffnungen am Rand und eben das Rundmaul mit den Hakenzähnen. Jedenfalls hat uns jemand einen Gefallen getan. Der Täter hat seine Opfer gekennzeichnet. Denn dass sie beide im Meer geschwommen und an der gleichen Stelle von diesem Tier gebissen worden sind …»
«Unwahrscheinlich», nickte Kienbaum.
Mobbing mit kieferlosen Wirbeltieren, dachte Danowski. Na toll. Das klang haltlos, uferlos.
«Was für eine Tätowierung haben Sie denn gefunden bei Opfer 1?», fragte er.
Gaitner nickte, als müsste er anerkennen, dass Danowski nun endlich bei der Sache war.
«Ex silvis», sagte Gaitner und zeigte das entsprechende Bild, die Umrisse der Tinte nachträglich digital deutlicher gemacht, die Schrift altdeutsch, aber eher in Runen als in Fraktur.
«Aus den Wäldern», sagte Jurkschat, die jetzt, wo sie es aussprach, tatsächlich aussah, als wäre sie als Schülerin gut in Latein gewesen. Sie war blass. Gaitner nickte interessiert in ihre Richtung.
Na wartet, dachte Danowski. Irgendwas werde ich schon auch noch wissen.
5. Kapitel
Das Gute war, dass ich Gaitner keine reingeschlagen habe. Cholerisch bin ich jedenfalls nicht.
Ich hab mit Finzi geplaudert.
Finzi hat gesagt, dass wir Freunde sind.
Danowski seufzte. Liebes Tagebuch. So was konnte man doch nicht hinschreiben. Er war doch ein erwachsener Mann.
Finzi hat gesagt, dass wir Freunde sind.