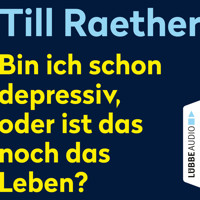9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Die Geschichte eines wunderbaren Sommers, der zwischen dem Scheitern von Beziehungen und einer latenten Aufbruchstimmung hin- und herpendelt.
Frühsommer 1986: Achim und Barbara, beide um die 30, ziehen aus der westdeutschen Provinz nach West-Berlin. Dort lockt Achim nicht nur eine feste Stelle im Labor der Bundesanstalt für Materialprüfung, er hofft auf ein aufregendes Leben. Immerhin hat hier Bowie mal gewohnt. Doch statt des großen Aufbruchs erleben die beiden in Zehlendorf Stillstand, spießige Enge und die Angst vor der radioaktiven Strahlung aus Tschernobyl. Und dann beginnt Achim eine Affäre mit der älteren Nachbarin, die aus Ost-Berlin stammt.
»Treue Seelen« ist die Geschichte eines wunderbaren Sommers, der zwischen dem Scheitern von Beziehungen und einer latenten Aufbruchstimmung hin- und herpendelt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Ähnliche
Zum Buch
Frühsommer 1986: Achim und Barbara, um die 30, sind nach West-Berlin gezogen. In die Großstadt, weg aus der Provinz. Weil es dort eine Stelle gibt für ihn im Labor der Bundesanstalt für Materialprüfung. Weil man ein anderer Mensch sein könnte, da, wo Bowie mal gewohnt hat. Doch statt eines neuen Lebens finden die beiden Stillstand, spießige Enge und Tschernobyl-Angst.
Während Barbara an Trennung denkt, verliebt Achim sich in die zehn Jahre ältere Nachbarin Marion, die enttäuscht von ihrem Bundesgrenzschutz-Ehemann Volker ist. Marion stammt aus Ost-Berlin, sie ist als Teenager kurz vor dem Mauerbau in den Westen abgehauen. Mit ihr fährt Achim heimlich in den Osten, wo sie Marions Schwester Sybille wiedersehen. Mit den besten Absichten mischt Achim sich in die dramatische Lebensgeschichte der beiden Schwestern. Und bringt alle in Gefahr – als er die Idee hat, für Sybilles illegale Umweltgruppe einen Geigerzähler über die Grenze zu schmuggeln.
Ein atmosphärisch dichter Roman über die verdrängte Geschichte einer ganzen Generation. Und eine Liebesgeschichte, die zu einem West-Ost-Drama wird.
»Raether versteht es, eine komplexe Geschichte klug zu komponieren.«
Hamburger Abendblatt
Zum Autor
TILL RAETHER, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Journalist und Autor in Hamburg, unter anderem für »Brigitte«, »Brigitte Woman«, »ZEITonline« und das »SZ-Magazin«. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von »Brigitte«. Seine Kriminalromane über den hochsensiblen Kommissar Adam Danowski wurden von der Kritik gefeiert und mehrfach für Preise nominiert. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Till Raether
Treue Seelen
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalveröffentlichung 2021
btb Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2020 Till Raether.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.
Covergestaltung: semper smile
Covermotiv: semper smile, München Umschlagmotiv: © Illustration von semper smile, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-25403-2V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Diana aus Lankwitz
Kapitel 1
Das wäre ja noch schöner gewesen: Der Reaktorunfall hatte genug Opfer gefordert, da sollte ihr Sommerfest nicht auch noch dran glauben müssen.
Den Spruch brachte Lothar Kries in Umlauf, der bärtige Baustoff-Experte aus dem Hochparterre. Fast hätte die Hausgemeinschaft das Fest im Hof abgesagt, weil alles viel zu belastet war: der Quark fürs Tsatsiki und der Schmand für Frau Sudaschefskis berühmten Zwiebeldip, das Grünzeug für die Salate sowieso, und wer wusste denn, woher die Koteletts kamen, bevor sie bei Bolle in der Fleischtheke aufgetaucht waren. Und was, wenn es regnete kurz vorm Fest. Der Regen war das Schlimmste. Der Regen und das Essen. Und die Milch.
Lothar Kries hatte noch weiter ausgeholt, nachdem er gemerkt hatte, wie gut sein Spruch ankam: zweiunddreißig Tote allein bei der Kernschmelze, eine halbe Million Sowjets komplett verstrahlt, und keine Ahnung, was da noch alles an Spätfolgen auf einen zukommen würde. Und dann sollte zu allem Überfluss auch noch ihr Fest über den Jordan gehen? Nee, Herrschaften, so weit kam’s gerade noch. Und außerdem, sagte die alte Frau Selchow aus der Wohnung unter ihnen zu Achim im Treppenhaus, musste man die Feste doch feiern, wie sie fielen: »Ihnen als Rheinländer brauch ich das ja nicht zu erklären.« Achim hatte genickt, mit den Gedanken woanders, aber: Nach Feiern war ihm sehr zumute.
Mittags brachte er Barbara zum Flughafen Tegel, Pan-Am nach Köln-Bonn, von da mit dem Intercity drei Stationen nach Remagen, zu ihrer Familie. Mit dem Vater war was, da musste Barbara wohl mal nach dem Rechten sehen. Schade, weil sie dadurch das Fest im Hof verpasste, sagte Achim erleichtert. Oh ja, sehr schade, sagte Barbara leicht resigniert. Er wusste, dass sie nichts wusste. Oder dass sie nichts wissen wollte.
»Ich kann hier schlecht halten«, sagte er am Flugsteig in Tegel.
»Ja, um Gottes willen, ich husch da einfach schnell rein«, sagte Barbara. Sie trug ihre braune Kunstlederreisetasche über die leere Parkzone direkt neben dem Passat, bevor sie in der gelben Drehtür verschwand, das Nachgefühl ihres Abschiedskusses hart und schräg auf Achims Mund. Er rieb sich die Lippen und gab zu wenig Gas, sodass der Passat anfing zu stottern. Hinter ihm hupte höhnisch ein Taxi. Er musste das Bonner Kennzeichen loswerden.
Auf der Stadtautobahn kurbelte er das Fenster runter und hielt die linke Hand in den Fahrtwind, die Luft roch nach Abgasen, Lindenblüte und Zuckerwatte vom Deutsch-Amerikanischen-Freundschaftsfest, wobei, das Letzte bildete er sich ein. Wie Marion sich hinter der riesigen weißen Wattewolke am Stiel versteckt hatte, als die Nachbarn auf der Höhe der Autoscooter an ihnen vorbeigelaufen waren. Sie mussten vorsichtig sein, Marion und er. Den Rest des Ausflugs hielt sie sich die Zuckerwatte weiter vors Gesicht, und wenn er sie küssen wollte, musste er zuerst die Zunge ausstrecken, damit der fein gesponnene Zucker zwischen ihnen wegschmolz. Es war, nüchtern betrachtet, eine klebrige Angelegenheit. Aber Achim fand, dass er die Dinge lange genug nüchtern betrachtet hatte.
Auf der Avus holte er alles raus aus dem Passat, hundertdreißig, hundertvierzig, fast hätte er die Ausfahrt Hüttenweg verpasst, das Autoradio so laut, dass er seinen Blinker nicht hörte.
In der Wohnung in Zehlendorf machte er die Fenster zu und legte Peter Gabriel auf, laut, bis Frau Selchow an die Decke klopfte, gar nicht mal unfreundlich. Die Leute hier sahen die Dinge nicht so eng, die hatten auch mehr erlebt: Blockade, Mauerbau, die ganzen Krawalle wegen der besetzten Häuser, Anschläge auf Diskotheken, die hatten Wichtigeres im Kopf, die zerrissen sich nicht so das Maul darüber, was die anderen machten, also er.
Und Marion.
Achim fand, dass er hier freier atmete als früher in Bad Godesberg. Und heute besonders. Weil Barbara nicht da war.
Der Nachmittag rann ihm durch die Finger, aber gar nicht unangenehm, eher wie warmer Sand, wenn man am Meer lag. Er lief durch die Wohnung, hörte Musik und trank Batida Kirsch mit Eiswürfeln aus der kleinen, frostigen Aluminium-Schale mit Hebel, unter dem man sich die Finger klemmte. Er hatte genau die richtige Jeans, er hatte genau das richtige Hemd, dunkelblau mit weißen Punkten, und nach drei, vier Touren zum Kühlschrank hing es ihm genau richtig über die helle Hose, lässig, pluderig.
Als er sah, dass der Lothar von gegenüber und der Lothar aus dem Aufgang links schon dabei waren, die Bierbänke und die Tische aufzubauen, konnte er es kaum erwarten, die Treppe hinunterzukommen, ach, da ist ja unser Feuerteufel! Ob er dann gleich mal den Grill übernehmen könnte, so als Fachmann fürs Zündeln. Sie lachten, Achim auch. Ob er denn an die Überraschung gedacht hätte. Achim zeigte auf den braunen Karton, den er schon unter den Buffettisch geschoben hatte. Klar hatte er daran gedacht.
»Na ja, wenn die Dinger losgehen, kriegt unser Oberbulle die Krise«, sagte Lothar Kries, und Achim wusste, wen er meinte: Marions Mann Volker. Er sah kurz vom Grill auf und hoch zu ihrer Wohnung, als stünde Volker da am Fenster. An Volker dachte er nicht so gern.
Die Luft vor Marions Wohnung vibrierte in Schlieren, und Achim merkte, dass der Grill heiß wurde. Die Mücken kamen, das war ja alles Sumpf hier, niedriges Grundwasser, die Seen, der Teltow-Kanal, und immer drückte ihm einer eine Schultheiß-Knolle in die Hand, die ausgetretene Wiese zwischen den Birken füllte sich mit Nachbarinnen in Leinenkleidern und Puffärmeln und Nachbarn in ihren Lieblingshemden, alle glänzten ein bisschen mehr als sonst, die Lippen, das Haargel, die Stirnpartien – warm war es geworden. Und wenn er schon mal am Grill stand, ob er dann nicht gleich – hier, nimm mal die Steaks, alles sauber, aus Argentinien, und die Würste sind aus dem Tiefkühler, Vor-GAU-Ware, und nimmst du noch ein Schultheiß, Achim?
Das Hoffest lag in drei Farbschichten vor seinen Augen wie ein aufwendiger Cocktail: unten die Kinder in gelb-blond, dreckig, zerzaust und zufrieden, weil sie zum ersten Mal wieder länger rausdurften; darüber die nackten Oberarme, die insgesamt creme-orange-roten Kleider und Hemden der Erwachsenen, der Qualm vom Grill, durch den die rötlichen Glühbirnenketten schienen, die Familie Fiorini von Birke zu Birke gespannt hatte, und immer fiel ein Kind über die Kabeltrommel; und darüber als dritte Farbschicht der unwirklich dunkelblaue Himmel, dieses Atemholen der Nacht kurz vorm Sonnenuntergang. Die seltsamste Welt war die eigene Wohnung, wenn man während des Hoffestes kurz reinhuschte, um was zu holen, ein anderes Klima, eine andere Zeitzone, die Möbel schauten stumm zur Wand. Die Kinder beschwerten sich über Achims schwarzbraune Würste, er machte ihnen mehr Ketchup darauf. Die Kinder sagten, affengeil, heute Abend war das noch im Rahmen. Wann war Marion eigentlich aufgetaucht, und warum hatte er sie nicht gleich erkannt, die dunklen Haare ein bisschen zurückgelegt, das lachsfarbene Kleid mit weißen großen Knöpfen hinten und vorne, ihre jetzt schon frühsommerbraune Haut matt und glatt mit vielen, wie hingesprenkelten Muttermalen, die es ihm unmöglich machten, rechtzeitig wieder wegzugucken. Er würde den Anblick nie wieder vergessen.
Frau Selchow hatte sich ans Buffet gestellt, nahm ein Gürkchen und zeigte mit dem durchsichtigen Plastikspieß auf den Grillrost: »Vernachlässjen Sie ma Ihre Pflichten nicht, Herr Tschuly.« Achim nickte und wendete das Fleisch.
Frau Selchow sah sich auf dem Buffet um, das ein Campingtisch mit weißer Papiertischdecke und acht oder neun großen Tupperschalen war. »Was haben Sie eigentlich mitgebracht?«, fragte sie, aber nett, so, als würde sie gern mal probieren. Ihr Dackel hieß Afra und schaute hoffnungsvoll.
»Nichts fürs Buffet«, sagte Achim, legte das Fleisch an den Rand und neue, hellgrüne Steaks auf den Rost, mariniert, dass es zischte. »Aber eine Überraschung für später. Wenn’s dunkel ist.«
Frau Selchow bückte sich nach dem Karton, auf den er gezeigt hatte. Sie klappte die Deckellaschen auf und guckte rein, als würde sie eine Ware prüfen.
»Wo haben Sie die denn hier?«, fragte sie.
Aus meinem Labor in der Bundesanstalt für Materialprüfung natürlich, wollte Achim sagen, aber für einen Moment vergaß er, worüber sie gesprochen hatten. Er starrte zu Marion, weil ihr Mann Volker sich über sie beugte, von hinten, und ohne aufzusehen, reckte sie die Arme nach oben und drehte Volker den Kopf zu und küsste ihn, zerstreut, gewohnt, da bist du ja, die Hand in seinem Haar, nur kurz, aber tief, Volkers Haare waren hinten länger als vorne.
»Sie müssen ’n bisschen aufpassen«, sagte Frau Selchow zu ihm, leiser als eben.
Achim atmete aus. »Die Raketen sind alle geprüft«, sagte er.
»Ja, nee«, sagte Frau Selchow und nahm noch ein Gürkchen, weil ihr offenbar nichts behagte aus den Tupperschüsseln. »Das meine ich auch nicht.«
Kapitel 2
Den Karton mit dem Feuerwerk hatte Achim vor ein paar Wochen bekommen, als sein Leben noch völlig anders gewesen war, aber die Effektladung des Neuen hatte es schon in sich getragen. Der Tag war ihm deutlich in Erinnerung, weil er später, nach der Arbeit, Marion zum ersten Mal gesehen hatte, auf dem Dachboden.
Achim sah noch vor sich, wie die Kollegen und er gegen Mittag in der Bundesanstalt für Materialprüfung die erste Rakete zum Abschuss vorbereitet hatten. Dr. Sonnenburg ließ endlich die Zündvorrichtung in Ruhe, dann fragte er die Laborantin, laut, damit sie es durch die Ohrstöpsel hören konnte: »Sie haben den Zeitnehmer im Griff, Frau Dobrowolski?«
Die Laborantin stieß Achim verschwörerisch in die Seite, dabei kannten sie einander erst ein paar Tage. Aber Sonja Dobrowolski war Mitte zwanzig und damit näher an Achim als am undefinierbaren Alter des Chefs, irgendwas über fünfzig. Sie hielt mit theatralischem Zittern die flache Hand über die Adox Laborstoppuhr, ihre Fingernägel für eine Technikerin eigentlich zu lang, neontürkis. Die Laborstoppuhr stand allein auf einem kleinen Rolltisch, der wie alles in der hellgrauen Halle verloren wirkte. Für einen Moment hatte Achim Mitgefühl mit dem Tisch. Er neigte dazu, unbelebte Dinge trösten zu wollen, und hielt sein Klemmbrett ein bisschen fester.
»Chef, der Zeitnehmer ist vollumfänglisch unter Kontrolle«, verkündete Sonja Dobrowolski mit bebender Stimme, als wäre sie ergriffen von der historischen Bedeutung des bevorstehenden Moments. Der erste Raketentest für Achim Tschuly, den neuen stellvertretenden Laborleiter. Sie stieß Achim noch einmal mit knochigem Ellbogen in die Seite. Dr. Sonnenburg hielt inne, blickte über die Kittelschulter und seufzte. Dann nickte er Achim entschuldigend zu, wobei der wippende gelbe Schutzhelm nach DIN 397 seine an sich subtile Kopfbewegung überdeutlich machte: Was sollen wir mit dieser kindischen Person anfangen.
Achim lächelte unverbindlich und ließ seine lauwarmen Handflächen am kalten weißen Stoff des Kittels entlanggleiten, die Taschen zugebügelt von Wäschestärke. In der alten Firma in Alfter-Witterschlick und insbesondere in der Abschusshalle im Industriegebiet Kottenforst hatten sie Blaumann getragen, und Helm und Schutzbrille nur, wenn der TÜV sich ankündigte. In Wessiland, wie Dobrowolski gesagt hatte, für die das ganze Bundesgebiet eins war, weit weg, fremd und öde. Sie war da nur durchgefahren auf dem Weg nach Dänemark, erzählte sie. Sah auch nicht anders aus als Lübars.
»Dann walten Sie mal Ihres Amtes, Fräulein Dobrowolski. Und bitte keine Sperenzien mehr.«
Weil das Testprotokoll für pyrotechnische Fluggeräte in der Bundesanstalt für Materialprüfung zu Beginn einer Chargen-Versuchsreihe die Einzählphase von zehn abwärts vorsah, entstand auch ohne Sonja Dobrowolskis Zutun ein Effekt, den Achim Tschuly etwas lächerlich fand. Drei Fachleute in weißen Kitteln, die im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand hinter einer Silvesterrakete standen, als wäre das hier Cape Kennedy 1969 und nicht der Süden von West-Berlin siebzehn Jahre später. Die Raketenspitze war aus orangefarbenem Plastik, ihr Korpus schwarz mit einem Prüfetikett, das die Laborantin von Hand beschriftet hatte, Kringel über den Is.
»Zehn.« Sonja Dobrowolski gab ihrer Stimme den Hauch eines amerikanischen Akzents, ganz dicht oberhalb der Wahrnehmungsschwelle.
»Neun.« Oder hatte sie jetzt wirklich einfach »Nein« gesagt?
»Akt.« Achim lächelte halb. Anfangs hatte er bei allem, was er neu erlebte, gleich daran gedacht, wie er das abends Barbara erzählen würde. Jetzt merkte er, dass er damit aufgehört hatte.
»Sziebän.« Im Gegenteil, der Gedanke an Barbara in der nicht einmal halb eingeräumten Wohnung machte ihn beklommen. Alles, was noch zu tun war, türmte sich vor ihm auf. All die Baumarkt- und Möbelhaus-Besuche, die Hausmeister-Anrufe, die Handwerker-Verhandlungen, all die Entscheidungen, die Kompromisse, die unüberschaubaren gemeinsamen Jahre, mit denen sie doch gerade erst anfingen, und das sollte doch was Schönes werden, mit Kindern, irgendwann.
»Sex.« Na ja, Dr. Sonnenburg konnte den Vorgang jetzt schlecht wieder abbrechen, man wollte ja auch langsam in die Kantine. Aber seinem Rücken war anzusehen, dass ihm gar nicht passte, was die Laborantin jetzt wieder abzog.
»Fumf.« Mehr als eine Sekunde dachte Achim Tschuly nun also doch noch an das Bett, das sie in flachen Paketen im orangefarbenen Passat in Ruhleben geholt hatten. Da machen wir uns einen schönen Abend, wenn wir das aufgebaut haben, hatte Barbara gesagt, Punkt Punkt Punkt. Und eigentlich müsste dieser schöne Abend jetzt endlich mal kommen. Was war mit ihnen los, dass sie es schafften, einander in der so gut wie leeren Wohnung so hartnäckig aus dem Weg zu gehen.
»Fear.« Vielleicht einfach die Umstellung. Er vermutete, dass keiner von ihnen sich traute zuzugeben, wie fremd sie sich hier fühlten, und dass der Umzug vielleicht ein Fehler gewesen war. Andererseits, fand Achim: Ein Fehler, den man nicht gleich korrigierte, war dann eigentlich keiner mehr, das waren dann einfach geänderte Rahmenbedingungen, mit denen man dann doch auch wieder klarkommen konnte.
»Derrai.« Samstags hatte Barbara in Bonn immer die Stellenanzeigen für ihn gelesen, sie blätterte darin wie in einem Katalog der Zukunft, ich schmöker da richtig drin, sagte sie, während sie auf dem Bauch auf dem Boden lag und in der Luft ihre Strumpfhosenfüße aneinanderrieb, bis der Raum sich mit Elektrizität zu füllen schien. Achim saß am Esstisch, durchs Fenster der Garten mit den verbrannten Baumstümpfen, dahinter der Blick auf die Godesburg. Der Generalanzeiger war voll von Stellen in West-Berlin, acht Prozent Berlin-Zulage, es wirkte ein wenig verzweifelt. »Hier«, sagte Barbara. »Die suchen einen Pyrotechniker in leitender Funktion. Bundesanstalt für Materialprüfung.« Ein Vierteljahr war das her.
»Zwei.« Jetzt wurde es langsam ernst, Sonja Dobrowolski riss sich von der Aussprache her wieder zusammen. Achim hatte die Schwarzpulvereinschlüsse unter seiner Fingerhaut betrachtet und vorsichtig zu bedenken gegeben: »Ich bin Verfahrenstechniker«, aber zugleich hatte sich was geöffnet in ihm. West-Berlin. Da hatte Bowie gewohnt. Und Christiane F. Da ging sonst keiner hin aus Bonn, das gefiel ihm. »Verbeamtung nach sechs Monaten«, sagte Barbara, über das Geräusch, mit dem sie die Anzeige ausriss. Es hatte ihn nicht gewundert, dass er die Stelle bekam.
»Eins.« Und nun kam kein Los oder Feuer oder Lift-Off mehr, auf eins drückte die Laborantin den Zeitnehmerknopf, und im selben Moment löste Dr. Sonnenburg die Zündvorrichtung aus, und im Haltearm wartete die Rakete das blaue Runterbrennen ihrer Lunte ab. Achim Tschuly besann sich wieder auf sein Klemmbrett. Kurz bevor der Treibsatz des Flugkörpers durch den Luntenfunken gezündet wurde, entstand für einen Atemzug Stille, bis Sonja Dobrowolski die Laborstoppuhr klackend anhielt, weil das Schwarzpulver zündete: fünf Sekunden, im Bereich der vorschriftsmäßigen drei bis acht, das konnte er schon mal abhaken.
Durch die Schräglage der Abschussvorrichtung hob die Rakete sich in keinen Himmel, sondern durchquerte die etwa zwanzig Meter lange Halle in einer Parabelbahn auf mittlerer Höhe. Dann blieb sie nach etwa zwei Sekunden im dafür aufgespannten grauen Kevlar-Netz hängen. Achim war es unangenehm, ihr dort beim hilflosen Kreischen und Pfeifen zuzusehen. Wie geräuschlos das beim Challenger Space Shuttle vonstattengegangen war: dieses Friedliche und Bodenlose der ausgreifenden weißen Raucharme nach der Explosion. Bis man die Schreie der Zuschauer hörte, hatte es wunderschön ausgesehen. Er wandte sich ab, sodass er die fahle grün-rote Effektladung nur in den Schutzbrillen des Laborleiters und der Laborantin reflektiert sah.
Was blieb, waren der feierliche Geruch nach Schwarzpulver und das hohle Klappern, als der erschöpfte Flugkörper vom Netz abrutschte und wie vorgesehen auf den Hallenboden fiel. Dr. Sonnenburg nickte ihm zu und sagte: »Willkommen im Team, Herr Tschuly.« Dann zog er sich die Schutzhandschuhe aus und legte die Brille auf den Labortisch. »Machen Sie die Charge noch zu Ende? Nur die Zündschnurbrenndauer? Ich …« Er schwenkte sein Laborleiterkinn Richtung Ausgang, merkte durch die Bewegung offenbar, dass er den Schutzhelm noch trug, und nahm ihn ab.
»Klar, Chef«, sagte die Laborantin. »Wir haben das hier im Griff.«
»Ich muss zur Laborleitersitzung. Wegen des Reaktorunglücks. Welche Maßnahmen wir hier behördenseitig … Ich halte Sie auf dem Laufenden.« Damit meinte er Achim.
»Na, dann essen Sie ma vorher lieber noch’n Happen«, sagte die Laborantin.
Als Dr. Sonnenburg weg war, sank Achim ein wenig das Herz. Nicht, dass er sich auf die Kantine gefreut hätte, das eiskalte Kompott, die weißen Plastikeimer, auf denen »Braune Soße« stand; der Kantinenpächter stapelte sie unübersehbar, trotzig. Aber bei der Aussicht, die Brenndauer von weiteren fast vier Dutzend gleichartigen Feuerwerksraketenzündschnüren zu messen, überkam ihn ein Gefühl von Sinnlosigkeit, das er von den aufgerissenen Möbelpaketen im Schlafzimmer kannte.
Sonja Dobrowolski schob ihm den Karton voller von ihr beschrifteter Raketen mit dem Turnschuhfuß rüber, ein Knirschen auf dem Hallenboden. »Vielleicht machen wa noch zwei, drei Stichproben, und den Rest nehmen Se einfach mit«, sagte sie. »Für wenn Se mal richtig was zu feiern haben.«
Kapitel 3
Barbara stand am Fenster wie so eine Hausfrau: Wann kommt mein Mann von der Arbeit. Dabei waren sie nicht mal verheiratet, und wer verlobte sich noch. Ihre Eltern hätte das vielleicht gefreut, die fanden Achim gut, vor allem seine bevorstehende Verbeamtung. Aber Barbara war innerlich eingestellt auf Weltuntergang. Ja, wer verlobte sich noch, zumal, wenn gar nicht weit entfernt die Atomkraftwerke explodierten oder schmolzen. Die technischen Details interessierten sie nicht, sie hatte Soziologie studiert und Achim auf der Ersti-Fete in Bonn kennengelernt. Wie schlaksig er getanzt hatte, »Living Next Door To Alice«, zehn Jahre war das her, das wollte damals schon keiner mehr hören. Als es spät wurde und der Typ am Plattenspieler die guten Sachen rausholte, tanzten sie als Einzige weiter. Sie hielt irgendwann Achims Arme fest, die er so schlackernd von sich warf zu »Psycho Killer« von den Talking Heads, und dann legte sie sich seine Arme erst auf und schließlich um die Schultern. Kurz vor dem Soz-Diplom hatte sie mit Romanistik angefangen, was ihre Eltern nicht verstanden, Achim vielleicht auch nicht, aber ermutigt hatte er sie.
Von der Küche aus sah sie das schlecht gemähte Rasenviereck, um das ihr Mietshaus sein Hufeisen bildete, die Seite zur Straße offen. In der Mitte ein Rhododendron mit Hunderten kleiner Knospenfäuste, Anfang Mai. Der Hausmeister hatte ihn genau in den Kreuzpunkt zweier Trampelpfade gepflanzt, die diagonal über die Wiese führten. Die Nachbarn liefen immer noch quer über die Wiese, und die Kinder dribbelten ihren Fußball um den Rhododendron und brüllten einander die Spielernamen aus dem WM-Kader zu. Alle wollten Litti sein, denn der kam von um die Ecke, Hertha Zehlendorf, Ernst-Reuter-Stadion, Onkel-Tom-Straße, das erzählten einem die Nachbarn hier sofort. Barbara schwirrte der Kopf von uninteressanten Informationen, wenn sie draußen jemanden getroffen hatte. An jeder Wegecke Koniferenbüsche, blickdichte, aber etwas zu nahe liegende Verstecke bei Doppeltes E und Mikrone, wie die Kinder hier Verstecken nannten. Fünf Birken, an jeder der drei Ecken eine, nur rechts von ihr zwei.
Barbara war allergisch gegen Birkenpollen. Morgens hätte sie am liebsten ihre Nase abgerissen. Im Laufe des Tages fingen die Tabletten an zu wirken und machten sie müde auf eine Weise, die sich endgültig anfühlte. Also tat Barbara tagsüber nichts, bis sie am Ende hektisch ein bisschen in der Wohnung räumte, kurz bevor Achim von der neuen Arbeit kam. Heute hatte sie gekocht, diese Schmetterlingsnudeln mit einer hellen Kräutersoße, die es neu beim Aldi Ecke Mühlenstraße gab. Die Soße hatte einen seltsam elektrischen Geschmack, den sie unwiderstehlich fand. Dieses Pulver war definitiv noch vor dem Reaktorunglück aus irgendeiner Fabrik gekommen, da musste sie sich keine Gedanken über die Becquerel und das Cäsium machen. Seit zehn Tagen standen die Werte jeden Tag in der Zeitung, und schon kam es ihr vor, als müsste das so sein, von nun an für immer. Wenn sie das Soßenpulver aus dem silbernen Plastikbeutel in die warme H-Milch rieseln ließ, wirkte es unangreifbar und rein, Pasta Alfredo. Nur die H-Milch widerstrebte ihr immer noch zutiefst, sie kam aus einer Familie, in der frisch gekauft wurde.
Sobald Achim um die Ecke kam, zündete sie mit einem Streichholz das Gas an und schob den Wassertopf darüber. In Bad Godesberg hatten sie schon Cerankochfelder gehabt. West-Berlin kam ihr vor, wie sie sich die Zeit nach dem Krieg vorstellte. Die amerikanischen Panzer, die zweimal die Woche hundert Meter entfernt von einer Kaserne zur anderen über den Teltower Damm rollten, das Bellen der Wachhunde von der Mauer am Buschgraben, Gasherd. Sie sah, wie Achim die Stufe hinter dem niedrigen Eingangstor mit einem großen Satz nahm. Manchmal verglich sie ihn für sich mit einem Collie, vielleicht, weil sie eine Zeit lang so einen Hund gern gehabt hätte, mit allem, was dazugehörte: die zwei, drei Kinder, das Häuschen am Stadtrand und mit Sicherheit ein gutes Gefühl. Zehlendorf: Das hatte sich für sie angehört wie der Anfang genau davon, aber nun wohnten sie in diesem Hufeisenhaus mit vier Aufgängen und zwanzig Wohnungen, nur für Beamte und Bundesangestellte, die Miete bezuschusst, die Leute waren doch sehr gesetzt. Und ein gutes Gefühl hatte sie auch nicht dabei.
Achim hatte diesen Bewegungsdrang, dieses körperliche Bedürfnis, in die Welt zu springen wie der Hund aus dem Kombi-Heck. Und er hatte früher den Kopf so schräg gehalten, wenn er ihr zuhörte, wie sie über französische Romane des neunzehnten Jahrhunderts sprach, den Mund fast offen vor Gebanntheit. Manchmal ertappte sie ihn dabei, wie er draußen regelrecht herumrannte, weil er so schnell wie möglich an einem schönen, vielversprechenden Ort sein wollte. Es fing an mit zügigem Ausschreiten und wurde zu einem Laufen, nahe am Sprinten. Zum anderen Ende des Parks oder über den Garagenhof die kleine Steintreppe auf diesen seltsamen Wäscheplatz hinter ihrem neuen Wohnhaus oder einmal um die Krumme Lanke, wo Riesenwelse schwammen, die sich nach Sonnenuntergang die Schoßhunde der späten Spaziergänger schnappten, und auf dem Grund lag ein abgestürztes Flugzeug aus den letzten Kriegstagen.
Früher hatte sie Mühe gehabt, hinterherzukommen, heute nicht mehr so viel Interesse. Erst recht nicht, seitdem die Wolke aus der Ukraine quasi über ihnen stand. Es war erstaunlich, wie schnell man sich an Formulierungen wie »radioaktiver Regen« gewöhnte, also daran, Angst zu haben vor ihnen. Barbara hielt es nicht aus mit der radioaktiven Wolke. Die Schuhe blieben vor der Wohnungstür, in Plastiktüten, die Nachbarn schüttelten den Kopf. Alles, was sie und Achim draußen angehabt hatten, musste gleich in die Maschine. Achim war ständig auf dem Dachboden, um Wäsche aufzuhängen. Sie war froh, dass er das übernahm. Da oben blitzte der Himmel durch die Dachschindeln.
Und dann wieder diese Scheu, die Achim überfiel, wenn er die Liegewiese, das Restaurant oder eine Gruppe Menschen erreicht hatte: Sie sah, dass er manchmal nicht mehr wusste, was als Nächstes zu tun war, wie damals nach der Erstsemesterfete, als sie nackt nebeneinander in ihrem Bett gelegen hatten, der Wandteppich kratzig an ihrer nackten Hüfte, und Achim hatte die Hand sanft zwischen ihre Beine gelegt, als wollte er sie bedecken, den Kopf schräg: Und nun?
Die Küche war direkt neben der Wohnungstür, aber für einen Moment tat Barbara, als bemerkte sie nicht, wie Achim nach Hause kam. Er hängte seine Windjacke an den Garderobenständer, und aus dem Augenwinkel sah sie ihn zögern: Die musste jetzt eigentlich in die Wäsche, sie hatte ihm extra eine zweite, fast identische gekauft, Hettlage. Oder merkte er, dass die Wohnung unbewohnbar wurde, sobald er sie betrat? Solange er bei der Arbeit war, kam sie einigermaßen zurecht in dieser halb fertigen Welt, sie navigierte zwischen offenen Umzugskisten und geschlossenen Möbelkartons, und die Matratze, die auf dem Boden lag wie auf den Fotos in der Mitte von »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, war ihr bequem und Bett genug, um stundenlang darauf zu liegen und an die Magisterarbeit zu denken.
Sobald Achim kam, ging die Wohnung nicht mehr. Viereinhalb Zimmer, fast hundert Quadratmeter, Balkon zum Hof. Die Wohnung in der Größe hatten sie vom Bundesliegenschaftsamt nur bekommen, weil Barbara der Frau am Telefon erzählt hatte, sie sei schwanger. Hatte sie es selbst geglaubt? Kaum. Berlin hatte sie sich bedeutend vorgestellt, aber jetzt schien es ihr ausgeschlossen, dass in dieser Wohnung etwas Bedeutendes würde geschehen können.
Einmal waren sie im Linientreu gewesen, aber die Leute waren ganz anders als in Bonn. Also, man kannte sie nicht. Und dann die Bombe im La Belle, seitdem mochte sie gar nicht mehr daran denken. Das gibt sich wieder, dachte sie. So kannte sie sich gar nicht. Muttersätze. La Belle, das war vier oder fünf Wochen her, eine Ewigkeit, als wäre sie schon zu lange hier. Drei Tote, aber schlimmer fand sie die Zahl der Verletzten: über zweihundert. Waren das nicht einfach alle, die da gewesen waren an diesem Abend? Friedenau, nicht gerade um die Ecke, aber die gleiche Welt wie ihre.
Einmal waren sie ins Loft im Metropol gegangen, Schöneberg. Kreuzberg wollten sie sich für später aufheben. Im Loft spielte eine australische Band, deren Namen Barbara sich nicht merken konnte, aber als die Leute auf die Bühne kamen, merkte sie, dass sie die doch vor anderthalb Jahren erst in Köln gesehen hatten. Na klar, sagte Achim und wippte so gegen die Musik. Na klar, als wäre das was Tolles.
Die drei Tornados in der UFA-Fabrik, irgendwas im Schwuz, SO36. Sie verstand schon auf den Plakaten kaum ein Wort. Die vier Cellisten der Berliner Philharmoniker spielten Beatles, ausverkauft, Zusatzkonzert, da war sie fast froh, nur noch zu Hause zu bleiben.
»Na, du?«, sagte Achim und verharrte auf der Schwelle zur Küche, Grenze zwischen dem schönen Schachbrettmuster der Küchenfliesen und der hellbraunen Auslegware auf dem quietschenden Flurfußboden, bei »Wand & Boden« hatte das mehr nach einem kräftigen Beige ausgesehen.
»Na, selber du«, sagte sie und rührte ein bisschen im Topf, weil Achim sie so lange anguckte. Manchmal dachte sie, dass eine lange Beziehung in erster Linie darin bestand, die Frage »Wie war dein Tag?« zu vermeiden.
»Wie war dein Tag?«, fragte Achim, aber so, als würde er sich dabei innerlich in der Wohnung umgucken, wo sich nichts getan hatte. Er streichelte von hinten ihre Unterarme, als müssten sie gemeinsam diese Kräutersoße rühren. Seine Hände waren warm. Plötzlich bekam sie Lust, heute noch mal rauszugehen, vielleicht endlich nach Kreuzberg, wo was los war, das ging immer hin und her bei ihr. Dann fiel ihr ein, dass es regnen sollte, radioaktiv. »Bist du gut vorangekommen? Warst du in der Bibliothek?«
»Ich musste hier noch ein paar Sachen nachlesen«, sagte sie auf beide Fragen zugleich. Immerhin lagen die Bücher neben der Matratze.
»Heute Abend bauen wir mal das Bett auf«, sagte Achim und fing an, auf diese zerstreute Weise den Tisch zu decken, die sie wahnsinnig machte: flache Teller, Messer und Gabel, dann bemerkte er seinen Irrtum, es gab ja Nudeln, also die Teller tief, für alles ging er zweimal. Einen Moment überlegte sie, den hellbeigen Emaille-Topf mit der weißen Soße an die Wand zu schmeißen. All ihre glänzenden Gutachten hatte sie aus Bonn an die FU geschickt, Institut für Romanistik, die hervorragende Prognose für ihre Magisterarbeit, die Empfehlung ihres Professors, daraus sofort eine Diss zu machen, sein Bedauern, dass sie nun nach Berlin übersiedelte, aber wie wärmstens er sie empfahl für die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin. Als sie sich endlich ein Herz fasste und noch von Bad Godesberg aus am Romanistik-Institut der FU anrief, sagten sie: Ach, Dumas und das Rachemotiv als Inversion des christlichen Ideals, das klang doch alles sehr historistisch. Und dann boten sie ihr die Stelle im Sekretariat des Dekans an, Mutterschaftsvertretung, zum kommenden Semester. Die Magisterarbeit könnte sie ja bis dahin … Also, wenn sie noch wollte. Und sich jemand fände, aber man müsste mal schauen. Oder parallel.
Die Soße wollte sie nicht aufwischen oder Achim dabei zusehen, wie er es versuchte, darum stellte sie den Topf betont behutsam auf den Korkuntersetzer. Achim saß schon und fummelte an der Papiertüte mit dem Reibekäse, aber Barbara merkte, dass sie noch zu hart und zu starr war, um sich zu setzen, sie brauchte ein paar Atemzüge. When love breaks down. Ob sie das Fenster aufmachen könnte, wo sie noch stünde, fragte Achim. Wegen der Soße Gute Idee. Die Frühlingsluft war warm und grün und stach ihr vertraut in der Nase, und mit jedem flatternden Atemzug wünschte Barbara sich weiter weg. Sie sah, dass es angefangen hatte zu regnen, in schneller werdenden, schweren Tropfen. Gegenüber ging die Haustür auf, die Mutter der Zwillinge kam heraus mit einem orangefarbenen Wäschekorb und duckte sich in den Regen. Frau Sebulke. Marion Sebulke. All die neuen Namen. Nach ein paar Schritten warf sie die Doktor-Scholl-Sandalen von den Füßen, um schneller rennen zu können, ihr kurzes dunkelbraunes Haar schwarz vom Regen, bevor sie auf die Idee kam, sich den Wäschekorb wie eine Haube über den Kopf zu halten.
Barbara merkte, dass die Mutter sie beruhigte, an deren Anblick konnte sie sich festhalten und orientieren wie an einer einfach gezeichneten Wegskizze in die Zukunft: Die war zehn, fünfzehn Jahre älter, arbeitete im amerikanischen Soldaten-Supermarkt an der Truman Plaza, wo außer den Angestellten keine Deutschen reindurften, und sie hatte die Kinder und den rechteckigen Mann mit dem ganz leicht angedeuteten Vokuhila, Bundesgrenzschutz, der bewachte das Schloss Bellevue, wo der Bundespräsident, den ihre Eltern hassten, nie war. Man musste nur ein bisschen unkomplizierter sein, dann konnte einem auch der Regen nichts anhaben. Unkompliziert, so, wie sie sich diese Nachbarin vorstellte, wenn Barbara sie nachmittags mit ihren Kindern hinterm Haus sah. Dort schob die Nachbarin die Sperrholzplatte, die zwei Väter zum Schutz vor Tschernobyl über die Sandkiste gelegt hatten, mit nackten Oberarmen allein beiseite. Der Regen war jetzt ein Wolkenbruch. Die Mutter von gegenüber verschwand unter ihrem orangefarbenen Panzer Richtung Wäscheplatz. Barbara wäre nie auf die Idee gekommen, dort im Freien jetzt überhaupt noch Wäsche aufzuhängen, statt auf dem sicheren Dachboden. Klar, draußen trocknete die Wäsche schneller, und sie roch besser, nach Sonne und Wiese. Aber den Mut hätte sie nicht gehabt. Sie fragte sich, wie viel Cäsium und Becquerel die Nachbarin wohl trotzdem schon abbekommen hatte, und die Wäsche erst.
»Kommst du?«, fragte Achim.
Kapitel 4
Achim hatte es gut gemeint und damit sich und die Laborantin um ihr Mittagessen gebracht. Und nicht nur das. Wie so oft, wenn er es gut meinte, war etwas Schwieriges, Unangenehmes daraus entstanden. Wie damals, als er mit zehn fassungslos im Oswalt-Kolle-Buch seiner Eltern gelesen hatte und ihm klar geworden war, dass seine Eltern »zärtliche Bereitschaft« brauchten, um doch noch das »kleine Geschwisterchen« zu machen, von dem die Oma nicht aufhörte zu reden. Und für diese »zärtliche Bereitschaft« brauchte es »intime Stunden zu zweit, in denen die Partner sich einander öffnen können«, und Achim hatte sich ein blütenartiges Aufklappen seiner verschlossenen Mutter vorgestellt.
Dass dieser ungewöhnliche Vorgang nur denkbar wurde, wenn er nicht in der Nähe war, leuchtete Achim ein. Also ging er zum Spielen in den Schuppen der Pörschmanns, wo es nach Rasenmäherbenzin duftete, damit seine Eltern diese »intimen Stunden« haben konnten. Er nahm extra eine Uhr mit, denn es war ja von Stunden die Rede. Nach zwanzig Minuten fing er an zu kokeln. Dann brannte der Schuppen der Pörschmanns in einer einzigen, erstaunlich dunkelorangefarbenen Flamme, der schwarze Qualm vom Stapel der neuen hellblauen Plastikgartenstühle war dicht und undurchdringlich wie etwas ganz Neues in der Welt. Unser Feuerteufel. Die Explosion des Rasenmähers wie eine Nachbemerkung, da rannte Achim schon.
Später, als eine Anekdote daraus geworden war, erzählte sein Vater, Achim habe aus den Hosenbeinen gequalmt, als er reingekommen sei und die Mutter vom Bügeln aufgeschaut habe, der Himmel durchs Fenster schwarz vom neuen Plastik der Pörschmanns, »du konntest ja die Godesburg nicht mehr sehen«. Wie Achim geweint und sich erklärt hatte, war die Pointe, die auf jeder Familienfeier den größten Erfolg erzielte, weil sie mit Oswalt Kolle und »zärtlichen Stunden« zu tun hatte. Aber Achim hatte um den Rasenmäher geweint, von dem er sich abends immer verabschiedet hatte. Wie der da immer so allein stand im Schuppen, das Gesicht zur Wand. Mit den Pörschmanns hatten die Eltern den Rest des Jahres über Geld gestritten. Wie schwierig das geworden war, hatte Achim an Weihnachten unterm Baum gesehen, da war viel Platz geblieben.
Als die Laborantin und er also mit der Hälfte der Raketen fertig waren (Zündschnurbrenndauer im Durchschnitt 4,6 Sekunden, Modalwert 5 Sekunden), hatte er gesagt: »Das reicht jetzt bestimmt.« Und er fand, dass er damit alles richtig gemacht hatte: der Chargen-Prüfordnung Genüge getan, den Chef nicht hintergangen (denn bei geringer Abweichung von Modal- und Durchschnittswert durfte er als stellvertretender Laborleiter den Prüfvorgang verkürzen), und gleichzeitig, so hoffte er, hatte er der Laborantin gezeigt, dass er doch auch cool war, obwohl er sich nicht an ihren Stichprobenplan gehalten hatte. Aber sie schien ein bisschen enttäuscht von ihm: noch so ein pingeliger Typ. Sie schaute etwas traurig in die am Ende halb leere Kiste und sagte: »Wollen Se die echt nicht mitnehmen? Sonst müssen wa die entsorgen.« Mehr, um ihr einen Gefallen zu tun, sagte er, ach so, klar, gerne, und dann wusste er nicht, wohin mit der Kiste. Aber vor allem: Die Kantine war nun längst geschlossen, auch das vorschriftsmäßige Abfeuern von nur 24 Raketen dauerte weit über Mittag. Und als Dr. Sonnenburg endlich von seiner Sitzung kam, warf er einen Blick auf Achims Prüfunterlagen und nickte düster, was Achim interpretierte als: Ah ja, so einer ist der Herr Tschuly. Hält sich an die Vorschriften, aber nicht an die Anweisungen.
Den Rest des Nachmittags hatte Achim Hunger und das Gefühl, trotz bester Absichten missverstanden und nicht gemocht zu werden. Er hoffte auf Besserung zu Hause, aber Barbara war fahrig und abwesend und hatte grausame Tütensoßennudeln gemacht. Im Endeffekt war wohl selbst der Regen seine Schuld: Die radioaktive Wolke aus der Ukraine hing über der DDR, West-Berlin und dem nördlichen Teil Bayerns, und auch wenn Barbara ihm die Stellenanzeige rausgerissen hatte, waren sie doch seinetwegen hier und nicht im vergleichsweise unverstrahlten Bonn-Bad Godesberg.
In der DDR hatten die Katastrophe und die Wolke niemanden zu interessieren, das entnahm Achim mit fasziniertem Schaudern der Aktuellen Kamera, die er in Bonn nur vom Hörensagen gekannt hatte und die sie hier in gestochen scharfem Schwarzweiß empfingen. Das DDR-Fernsehen berichtete kaum über die Strahlenbelastung, nicht über die radioaktive Wolke, nicht über die verzweifelten Gegenmaßnahmen, den Sarkophag aus Beton, der alles unter sich begraben sollte. Sondern nur: Westmedien hätten eine Desinformations-Kampagne zur Diskreditierung der sowjetischen Technologie begonnen, mit dem Ziel, die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik und der sozialistischen Bruderstaaten zu verunsichern. Die Strahlenbelastung sei nicht der Rede wert: »Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau«, stand in schwarzen Buchstaben auf der grauen Wand der Aktuellen Kamera. Achim war fasziniert, plötzlich konnte man die Welt von zwei Seiten sehen.
Barbara lief durchs Bild und bat ihn, umzuschalten. Er kniete sich vors Gerät und tat ihr den Gefallen, Der Große Preis. Etwas an der Nähe zum gewölbten Antlitz von Wim Thoelke ließ ihn erstarren, die knisternde Oberfläche der Mattscheibe, das Gefühl, der Showmaster und Der Große Preis hätten doch eigentlich verschwinden müssen mit ihrem Umzug nach Berlin, alles hätte doch neu sein müssen, und nun war es immer noch da: dieses fleischige, arglose Gesicht mit der festgelegten Frisur, der heitere Beschwichtigungsbariton, aus dem Achim nur hörte, dass es kein Entkommen gab. Sie lebten in diesem Gesicht wie in einer Landschaft, egal, wo sie hinkamen.
Barbara und er hatten es vor fünf Jahren kaum zur Friedensdemo in Bonn geschafft, keine drei Kilometer von ihrer Wohnung in Bad Godesberg, der Bonner Hofgarten. Irgendwie ging’s ihr nicht so gut an dem Tag, aber er wollte unbedingt raus, und sie hatte geschrien, dass es ja wohl egal sei, ob da jetzt Hunderttausend oder Hunderttausendzwei hingingen, die Demo hatte schon angefangen, und die WDR-Reporter waren fassungslos angesichts der Teilnehmerzahlen. Ob Achim denken würde, dass sich alles immer nur um ihn drehte. Tatsächlich war es ihm nicht so sehr um den Frieden gegangen, sondern darum, nichts zu verpassen. Am Ende waren sie ein bisschen hinterhergedackelt, pro forma, nicht richtig dabei.
Mühsam stand er auf. Barbara saß auf dem neuen Sofa mit diesem irgendwie indianischen Muster in Grün, Orange, Lila und Gelb, als würde sie das Möbelstück gerade bei Ikea ausprobieren, kurz vorm Aufspringen, ach nee, lieber doch nicht.
»Ich geh mal Wäsche aufhängen«, sagte er, weil er sich nach der Einsamkeit des Dachbodens sehnte und weil ständig was in der Trommel war, kleinste Wäschemengen, wegen der Strahlen. Barbara nickte, als wäre er ihr zuvorgekommen. Dann lehnte sie sich zurück und schaute vage Richtung Thoelke.
Auf dem Dachboden war die warme Luft des Maitages gefangen. Der Regen bewegte sich mit einem Knattern und Huschen über die rostbraunen Dachpfannen, die nur dünn isoliert waren, viele Lücken, dunkle Spritzer auf den staubigen Holzdielen. Durch die wenigen schrägen Dachfenster fiel trübes Licht auf die durchhängenden Wäscheleinen, die im Zickzack von einem Stützbalken zum anderen liefen. Die unlackierten Dielen unter Achims Füßen waren warm durch die dünnen Sohlen der Hausschuhe, die Barbara aus Bonn mitgebracht hatte, man hätte die auch mal wegschmeißen können.
Er blieb stehen und atmete den Geruch von splitterigen Balken und feuchter Wäsche. Mit einer Spur Zigarettenrauch, vielleicht aus einer der Mansarden: kleine Zimmer unter den Dachschrägen zum Hof hin, zwei pro Aufgang, aber zu ihrer Wohnung gehörte keine. Er stellte den halb vollen Wäschekorb ab, weil er nicht mehr wusste, welchen Leinenbereich der Hausmeister ihnen zugewiesen hatte. Die Zigarettennote in der Luft erinnerte ihn an Familienfeste in seiner Kindheit, als alle beim Essen geraucht hatten, und beim Trinken dann noch mehr, HB. Hitlers Beste, sagte Onkel Reinhard jedes Mal.
Die Geografie des Dachbodens verwirrte ihn: die schrägen Balken, die dunklen Verschläge mit Kaninchendraht, von der Wäsche ganz zu schweigen. All die nachbarschaftlichen Unterhosen mit oder ohne Eingriff, Büstenhalter, Trainingshosen, Jeanshosen, Cordhosen, Karottenhosen, Hemden, Unterhemden und Socken. Spannlaken: Biber. »Das ist so eine gewisse Ordnung hier, dit hat sich so einjebürgert«, hatte der Hausmeister gesagt und auf Achims Leine gezeigt, aber welche.
Er ging geduckt um ein Spannlaken herum, das in letzter Reihe eng vor der Dachschräge hing. Das Laken reichte fast bis zum Boden und tropfte, was so gut wie schwarz aussah im hellen Staub. Hinter dem Laken saß eine nasse Frau und rauchte. Der Boden, das Dach und das Laken bildeten ein rechtwinkliges Dreieck, mit dem Laken als Ankathete zum Winkel Alpha, wenn das Dach die Hypotenuse war. Achim hatte das Gefühl, seinen Kopf in ein Zelt zu stecken wie unangemeldeter Besuch. Die Frau saß auf einem alten Koffer, beige mit braunen Ecken, als wollte sie abreisen. Sie war barfuß, die zweiten Zehen länger als die anderen, und sie trug ein Jeanskleid, das dunkelblau vom Regen war. Wenn das Kleid nicht gewesen wäre, hätte Achim vielleicht einen Wimpernschlag lang gedacht: ein Junge, ein Jugendlicher, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Kurze Haare, ungeschminkt, dieser Gesichtsausdruck: Ich bin erwischt worden, aber mir doch egal. Aber dann die Fältchen um die Augen, als wäre sie viel ohne Sonnenbrille draußen gewesen, und Linien links und rechts vom Mund, sie wirkte bestimmt streng, wenn sie einfach nach gar nichts aussehen wollte.
»Naha?«, sagte sie mehrsilbig, als würden sie einander hier häufiger treffen. Eine Nachbarin von gegenüber, mit Zwillingen im für Achim undefinierbaren Kinderalter zwischen Krabbeln und Teenager.
»Tut mir leid«, sagte er.
Sie aschte in die Ritze zwischen zwei Dielen. »Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ist ja Ihre Leine hier.« Sie nahm einen Zug. »Muss ich mir’n anderes Eckchen suchen.«
»Von mir aus nicht«, sagte Achim.
»Ich komm gern hierüber«, sagte sie, »einmal über den Dachboden. Bei uns drüben verpetzt mich die alte Bolm.«
»Bei wem?«, fragte Achim.
»Na ja, sie fragt meinen Mann, ob er keine Angst hat, dass ich das Haus abfackele.«
»Die Gefahr besteht natürlich.« Beinahe hätte er gesagt: Ich bin Pyrotechniker. Verfahrenstechniker in der Pyrotechnik. Ich bin vom Fach.
»Fangen Sie jetzt auch damit an?«
Achim zögerte einen Moment. Er hatte den Namen der Frau vergessen, aber ihrem Mann hatte er kurz die Hand geschüttelt, als sie gerade eingezogen waren. Ein Polizist mit hellen Augenbrauen und erstaunlich sanftem Händedruck, der ihm die ganze Zeit über die Schulter geguckt hatte, als würde hinter Achim was kommen. Doch: Frau Sebulke.
»Von mir aus können Sie das Haus ruhig abbrennen«, sagte Achim, verblüfft, was da aus seinem Mund kam. Oder weil er hoffte, dass es das war, war sie hören wollte?
Sie lächelte mit leicht übereinanderstehenden Schneidezähnen. »Kommen Sie doch rein«, sagte sie und hielt ihm die Schachtel hin, eine amerikanische Marke, die Achim nicht kannte, in Grün mit dünner weißer Schrift: Kools. Auf dem Koffer war so gut wie kein Platz, und Achim rauchte nicht.
»Ich muss noch …« Er machte eine komische Kinnbewegung Richtung Wäsche.
Sie nickte. »Marion. Danke für den Unterschlupf.« Er fand das Wort geheimnisvoll und persönlich, und er vermutete, dass er rot wurde: Unterschlupf. Jetzt hielt sie ihm die leere Hand hin, rund mit kräftigen Fingern, die Nägel kurz, die Knöchel faltig, Spülhände, dachte Achim, irre, was man an Schrott aus der Fernsehwerbung mit sich herumtrug, bis hierher, ins neue Leben. Sie baden gerade Ihre Hände drin. Marions Ehering war einfach, ein schmales, goldenes Band, wie Eltern es früher hatten, als sie unter zerbombten Häusern verschüttet wurden, aber guck mal, mein Achim, den Ring hab ich durch den Krieg gebracht, dein Vater war ja noch beim Russen.
»Achim«, sagte er. Ihr Händedruck war kurz und flüchtig, und in diesem Moment ahnte er: Tagelang würde er versuchen, von dieser kurzen Berührung zu zehren wie von einer köstlichen Speise, in winziger Portion auf viel zu großem Teller wie in einem Charlottenburger Restaurant, wo das Geschirr schwarz und rechteckig war und man Messer, Gabel, Löffel nur mühsam voneinander unterscheiden konnte.
Dann hängte er irgendwo die Faustvoll trauriger Wäsche auf, die er aus der Maschine gezogen hatte, um etwas zu tun zu haben. Der Regen hörte auf, und die Dielen knarrten, wenn Marion auf dem Koffer hinter dem Laken die Beine übereinanderschlug, dann ein Schieben und Knarren, als würde sie sich noch häuslicher einrichten. Achim überlegte, ob er bereit für seine erste Zigarette im Leben und für seinen nächsten Satz war. Und als er entschieden hatte, ja, und als er den Satz hatte, ging er zu ihrem Unterschlupf in einem Schlendern, das er selbst albern fand, aus dem er aber nicht mehr rauskam, weil er die zehn Schritte strecken wollte, aus Angst und Vorfreude zugleich.
Er schob ihr nasses Laken ein Stück beiseite. Der Koffer war nicht mehr da, zurückgestellt in einen Verschlag, die Zigaretten wieder versteckt, Marion fort.
Der Satz wäre gewesen: Sind Sie immer noch da?, so ganz beiläufig dahingesagt.
Sätze, die er verworfen hatte, lauteten:
Nehmen Sie doch ein altes Marmeladenglas mit Wasser für die Kippen.
Zelten Sie sonst auch gerne?
Sind Sie als Kind auch in große Pappkartons gekrochen, um sich zu verstecken?
Haben Sie noch andere Unterschlüpfe?
Wie ist es, eine Familie und zwei Kinder zu haben?
Wie ist es, seit Jahren mit dem gleichen Menschen in einer Wohnung zu leben?
Darf ich mich in Zukunft hier mit Ihnen verkriechen?
Wollen wir zusammen das Haus abbrennen und barfuß in den radioaktiven Regen rennen?
Das Bett bauten Achim und Barbara an diesem Abend wieder nicht auf.
Kapitel 5
Marion hatte ein paar Lieblingsorte, und sie achtete darauf, dass sie jeden Tag mindestens einen davon besuchte. Manchmal schaffte sie alle vier.
Der erste, mehr für den Sommer, waren die kleinen lehmigen Buchten an der Krummen Lanke, wo das Laub der Rotbuchen und Weiden bis aufs Wasser hing und wo man die Spaziergänger mit ihren Kötern auf den Wegen hörte, aber sie konnten einen nicht sehen. Der zweite war das Grab im Schönower Park, diese riesige Familiengruft des Parkstifters, dem das ganze Land hier vor hundert Jahren gehört hatte. Zu diesem Grab kletterte man über einen Zaun mit verzierten Spitzen, und zwischen Efeu und Ginster konnte man knutschen, wenn einem das wütende Gefummel im Heim zu viel wurde. An den Zaunspitzen hatte sich angeblich mal einer der großen Jungs beim Drüberklettern alles abgerissen, aber ob das stimmte. Damals hatte sie sich immer gefragt, was das überhaupt hieß: alles. Der dritte Ort war, wenn sie den Teltower Damm hinab ging Richtung Butter Beck und Woolworth, hundert Meter rechts vor dem S-Bahnhof, der sich wie ein alter rostiger Riegel quer über die Straße schob, ganz kurz vor dem Eiscafé Anneliese, in dem die gut versorgten Witwen mit ihren gelben Haaren saßen, aber nie sie mit den Kindern, weil der Apfelkuchen das Stück drei Mark kostete, und die Kugel Eis unglaubliche neunzig Pfennig. Kurz davor aber bog der Herbergerweg nach rechts, wo das Heim, in das sie mit fünfzehn gekommen war, hinter einer gerupften Kiefer stand, schmucklos und abgewohnt wie vor fünfundzwanzig Jahren. Damals war sie Jannowitzbrücke in die S-Bahn gestiegen ohne was in der Hand, beim Umsteigen nichts als Langeweile im Blick und Angst im Nacken, und erst in Zehlendorf wieder raus, so weit entfernt, wie es ging. Zehlendorf, das war so ein Name gewesen, den mal jemand gesagt hatte, Seelendorf, hatte sie verstanden. Und sie hatte nie darüber nachgedacht, dass man ihr mit fünfzehn nach dem Aussteigen im West-Sektor keine Arbeit und Wohnung geben würde, sondern ein Bett im Heim im Herbergerweg und einen Platz an der Beucke-Schule, von wo aus sie aufs Gymnasium nebenan schaute wie früher über die Mauer. Dieser Abzweig zum Herbergerweg war heute ein Lieblingsort, weil sie jedes Mal im Vorbeigehen dachte: Auch da bin ich rausgekommen. Scheiß auf euch alle.
Seelendorf: Erst als die Kinder in der vierten Klasse Heimatkunde hatten und sie versuchte, die viel zu oft von der Matrize abgezogenen Arbeitsblätter zu entziffern, helllila Schrift auf dunkelbeigefarbenem Hintergrund, verstand sie, warum sie damals womöglich Seelendorf gar nicht so missverstanden hatte. Wie das hier mal das slawische Cedelendorp gewesen war, und die Lokatoren, die über die Havel in die Sümpfe gekommen waren und die Slawen nicht verstanden, hatten gedacht, das bedeute Seelendorf, weil hier soundso viele Seelen wohnten, bizarr, als nennte man einen Ort Einwohnerstadt. Als sie Volker davon erzählte, in der Hoffnung, er würde sie mal verstehen, lachte er auf diese seltsam väterliche Art, die er sich über die Kinder hinaus angewöhnt hatte. Er sagte: »Weil wir hier alle so treue Seelen sind.«
Vielleicht wegen Volker dann ihre häufigen Besuche am vierten Lieblingsort, für jeden Tag und sonntags auch zweimal: hinter der Wäsche auf dem Speicher gegenüber, auf dem ollen Pappkoffer, den sie aus dem Verschlag von Frau Selchow holte, darin alte Kleider, schön weich. Wie sie ruhig wurde, wenn die Schärfe der Zigarette in sie fuhr, ganz friedlich, denn wenn man rauchte, fand man sich mit dem Tod ab, also erst recht mit dem Leben. Beim ersten Zug dachte sie: Ich muss über Volker nachdenken. Da mal eine klare Linie reinbringen. Wie das weitergehen soll. Ob wir so weitermachen können. Wie wir das mit den Kindern regeln würden. Wenn wir wirklich. Und wegen Geld. Ob es ihn überraschen würde. Oder ob er längst wusste, dass es ernst war, wenn sie sagte: Es geht nicht mehr. Und wie ernst er es meinte, wenn er sagte: Wenn du das machst, dann passiert was. Und glaub bloß nicht, ich lass dir die Kinder, Marion.
Jemand anders in ihrer Lage wäre vielleicht abgehauen: die Kinder ins Auto und dann ab durch die Mitte, vielleicht zurück zur Mutter, das hörte man ja oft. Aber sie war schon mal geflohen, und seitdem war ihre Mutter unerreichbar, Todesstreifen dazwischen.
Ab dem vierten, fünften Zug dachte sie nicht mehr an Volker, das Rauchen wurde sich selbst genug. Das war das Schöne daran: Es half einem, Pläne zu machen und sie dann nicht mehr so wichtig zu finden.
Sie blies den Rauch vom Laken weg Richtung Dachfenster. Normalerweise machte sie das Fenster auf, aber jetzt lief Regen darüber, Tropfenwettrennen. Den Regen nahm sie persönlich, sie konnte nicht anders. Der Regen sagte ihr, dass es kein Entrinnen gab. Du kannst dich mit fünfzehn in die S-Bahn setzen und nie wiederkommen, deine Mutter und deine Schwester zurücklassen und nie wieder mit ihnen reden, du kannst dich im hintersten Winkel von West-Berlin verkriechen und all deine Wege so legen, dass du nie die verfluchte Mauer sehen musst, du kannst bei den Amis im Supermarkt arbeiten und dich vor die Regale stellen, die Augen auf unscharf, und dir vorstellen, du wärst irgendwo in New Jersey oder Texas, aber es holt dich immer wieder ein.
Als das Atomkraftwerk havariert war, hatte sie die Nachrichten mit einer Mischung aus Entsetzen und Schadenfreude verfolgt: Die armen Leute – geschah ihnen recht. Mit ihrer Schrotttechnik und dieser Mischung aus Größenwahn und Duckmäuserei. Aber als es dann geheißen hatte, es gäbe eine ganze landgroße Wolke aus Radioaktivität, und diese Wolke triebe nach Westen, und der Regen, der auf die Spielplätze und die Futterweiden und die Wälder, die Pilze, die Rehe, die Beeren fiele, sähe genauso aus wie immer, aber er wäre verstrahlt – da schien ihr dieser Regen, als brächte er extra für sie, was sie hatte zurücklassen wollen. Volker brauchte sie damit nicht zu kommen, der verstand nichts davon. Der interessierte sich weder für die Vergangenheit, erst recht nicht ihre, noch für die Zukunft. Er hatte Ganzjahresreifen aufgezogen, jetzt, wo neue Sommerreifen fällig gewesen wären, und er hatte gesagt: Jetzt brauchen wir uns um gar nichts mehr zu kümmern, und so glücklich hatte sie ihn lange nicht gesehen. Ein Mann, der die Zeit besiegt hatte, mit Ganzjahresreifen.
Sie hörte, wie umständlich der Nachbar seine Wäsche aufhängte, in seinen dummen Pantoffeln. Das war der mit der Frau, die immer so grimmig guckte. Bildhübsch, hätte ihre Mutter gesagt, mit diesem bestimmten Tonfall, der damals bedeutet hatte: Die weiß gar nicht zu schätzen, wie gut sie aussieht. Wie schrecklich jung diese Menschen waren. Man wollte denen sagen: Passt bloß auf, ab jetzt kommt’s drauf an. Na ja, zehn Jahre jünger. Aber eben die entscheidenden.
Aber das mit dem Haus-Abbrennen, das hatte ihr gefallen. Wie erstaunt er dabei geguckt hatte, als er das gesagt hatte. Achim. So, als würde er sich damit auskennen, wie man Häuser abbrannte, aber eigentlich wollte er’s sich abgewöhnen.
Marion hielt ihre Zigarette zwischen zwei Fingern, runtergebrannt bis kurz vor den weißen Filter, und dann ließ sie einen Spuckefaden aus dem Mund wie früher im Herbergerweg, wenn sie sich vom Etagenbett runtergebeugt hatte zu Ingrid. Sie traf die Glut wie in Zeitlupe, dann schnippte sie die Kippe in den unerreichbaren Winkel zwischen Dach und Bodendielen. Als sie in ihrem eigenen Treppenhaus das Linoleum unter den nackten Füßen spürte, fiel ihr auf, dass sie sich nicht verabschiedet hatte.