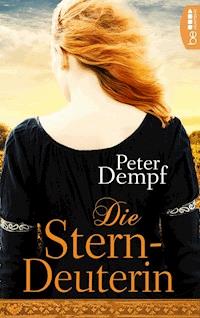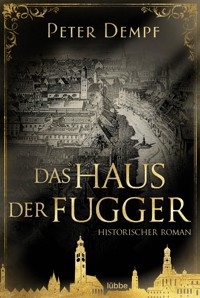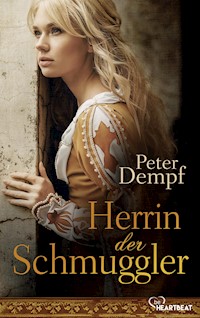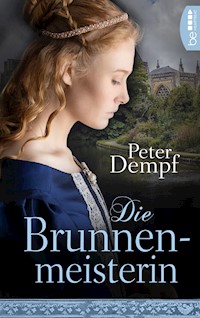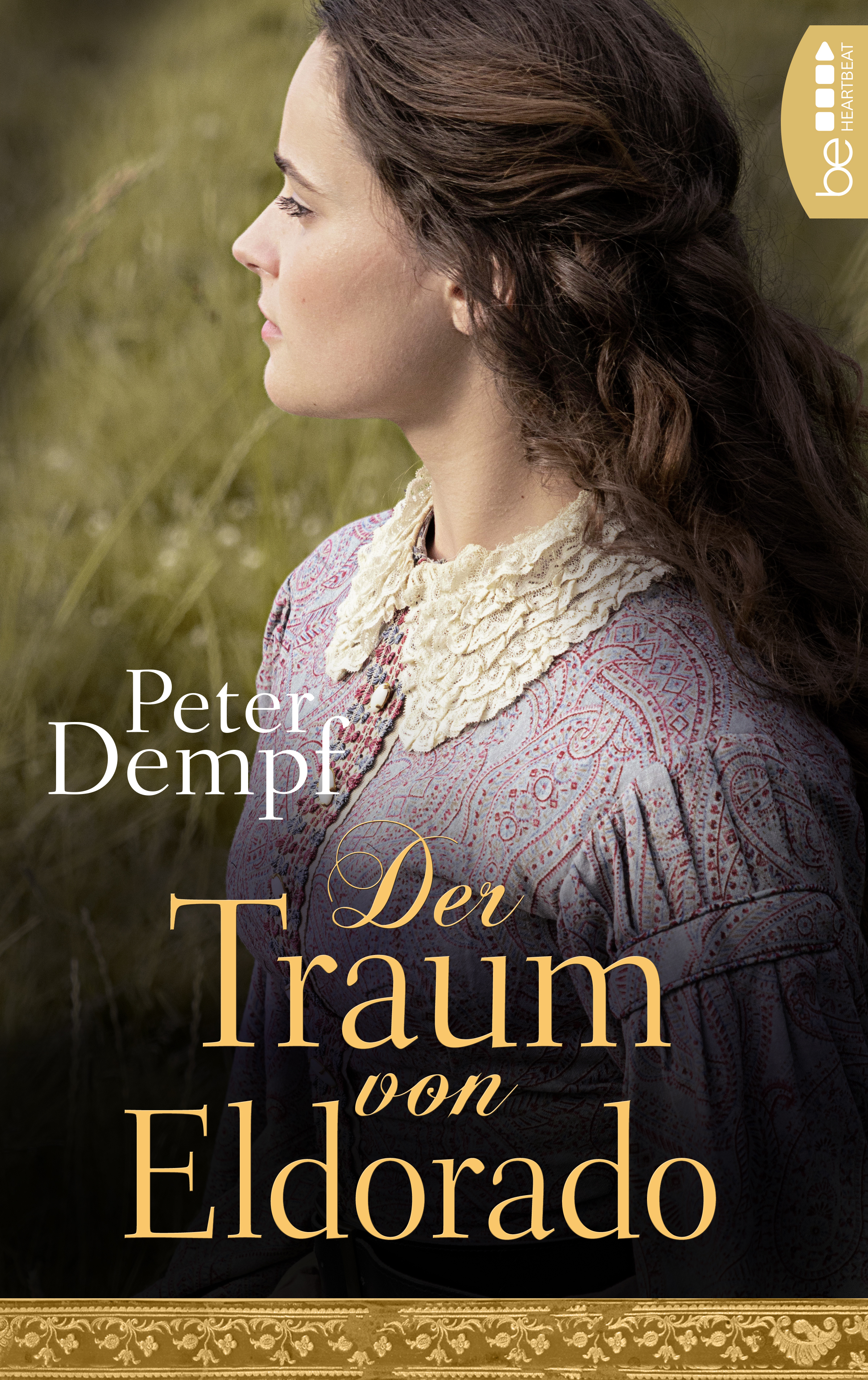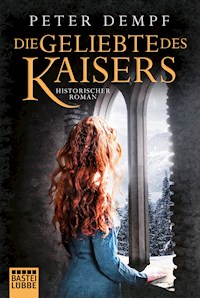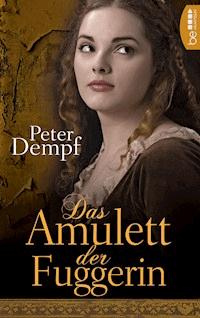6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Viele Legenden ranken sich um den »Garten der Lüste« von Hieronymus Bosch – gemalt zu einer Zeit, als die Heilige Inquisition das Europa des 16. Jahrhunderts in ihrem blutigen Griff fest umklammert hielt. Auch in der Werkstatt des berühmten Malers sind diese Auswirkungen zu spüren, wie der Malergeselle Petronius Oris leidvoll feststellen muss. Denn in s’-Hertogenbosch tobt ein gnadenloser Machtkampf zwischen der Inquisition und der berüchtigten Adamitensekte. Hunderte Jahre später muss der Restaurator Michael Keie das berühmte Gemälde nach einem Säureanschlag Unbekannter behandeln, bei der Restauration entdeckt er mysteriöse Symbole in tieferen Farbschichten. Seit diesem Fund umgarnt ihn Grit Vanderwerf, eine attraktive, aber auch undurchsichtige Kriminalpsychologin. Doch gilt ihr Interesse wirklich nur den Symbolen, wie Michael Keie vermutet? Auf zwei Zeitebenen erzählt Peter Dempf die faszinierende Entschlüsselung eines der bedeutendsten Kunstwerke der Kunstgeschichte, er verknüpft Wahrheit und Fiktion zu einem spannenden Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
Peter Dempf
Das Geheimnis des Hieronymus Bosch
Roman
Erstes Buch
Im Anfang war das Wort ...
I
Nervös trommelte Michael Keie mit den Fingern auf das Fensterbrett. Er wartete jetzt schon eine halbe Stunde auf seinen Mitarbeiter Antonio de Nebrija, der ihm eine sensationelle Entdeckung angekündigt hatte. Dass in Madrid die Uhren anders liefen, hatte Keie in den vergangenen zwei Wochen mehrfach erfahren müssen. Zwar genoss er es, zu den wenigen Spezialisten zu gehören, die für behutsame Bildrestaurierungen eingesetzt wurden, aber an diesem Nachmittag kam er mit seiner Arbeit kaum voran und war höchst unzufrieden.
Keie streckte sich und blickte durch das Fenster hinaus auf den Retiro. Ihn erstaunte das matte Grün des Parks noch immer, das langsam von der Sonne ausgelaugt wurde. Das Licht des Südens fraß die Farben.
Nach dem Telefonanruf in Berlin hatte er sich sofort ins Flugzeug gesetzt und war hierher geflogen. Schließlich wurde man nicht alle Tage zu einem der geheimnisvollsten und bedeutendsten Gemälde der Welt gerufen, zu Hieronymus Boschs ‚Garten der Lüste‘. Ein offenbar verrückter Geistlicher, so viel wusste Keie, hatte sich dem Triptychon bis auf wenige Schritte genähert, und ehe das Wachpersonal im Prado eingreifen konnte, war es ihm gelungen, aus einem kleinen Fläschchen einige Tropfen einer ätzenden Flüssigkeit auf das Bild zu spritzen. Glücklicherweise war der Schaden verhältnismäßig gering, und Keie war zuversichtlich, die Restaurierung in wenigen Wochen bewältigen zu können.
Vom Paseo del Prado wehte das Brausen des Feierabendverkehrs herüber. Der laue Wind, der durch das geöffnete Fenster herein strich, verschaffte ihm in der stickigen Luft des Büros über den Werkstätten des Prado nur wenig Erleichterung.
Endlich pochte es gegen die Tür. Bevor Keie reagieren konnte, wurde sie aufgerissen, und ein untersetzter Mann, blass unter seinem weißen Haarschopf und mit roten Flecken am Hals hinkte auf Keies Schreibtisch zu.
„Michael, kommen Sie. Ihre Bilder haben wirklich Unglaubliches offengelegt! Sehen Sie sich das einmal genau an!“
Er warf ihm zwei Abzüge auf den Schreibtisch. Die erste Aufnahme zeigte einen schwimmenden Schnabelfisch, so groß wie ein Hamster, der ein Buch in der Hand hielt und aufmerksam darin las. Keie beugte sich über den Ausdruck. Unregelmäßige helle Flecken waren darauf verteilt, Beschädigungen, verursacht durch die Säurespritzer. Über das Buch des Schnabelfisches war eine breite Bahn der ätzenden Chemikalie gelaufen.
„Und? Sehen Sie’s?“
Keie atmete tief ein.
„Nein, Antonio, ich fürchte, ich sehe nichts. No, lo siento. Nichts!“
Die eine Hand Antonio de Nebrijas begann im Haar zu wühlen, die andere fuhr über das Gesicht, ein ums andre Mal.
„Dass sie nichts erkennen, Michael. Sie sind blind. Sie wollen nichts sehen. Aber dort ist etwas. Es sieht aus ... wie eine ... eine Schrift. No comprendes? Dort hat jemand etwas geschrieben. Warum sonst ein Buch? Verstehen Sie?“
Keie unterdrückte seine Verärgerung. Schließlich war Antonio de Nebrija für ihn ein Glücksfall gewesen. Obwohl der Mann längst die Pensionsgrenze erreicht hatte, arbeitete er unermüdlich weiter und gehörte schon beinahe zum Inventar des Prado. Keiner kannte sich in den Werkstätten besser aus als der alte Kunsthistoriker, niemand wusste besser Bescheid über Farbtechniken, Malgründe und Firnisherstellung des 16. Jahrhunderts. Er war eine Fundgrube, dieser weißhaarige Kauz, mit einer untrüglichen Spürnase, wenn es um die Aufdeckung kniffliger Probleme und Hinweise von Bilderzuordnungen ging. Zwischen ihnen war schnell eine kollegiale Freundschaft entstanden und sie redeten sich, wie hier in Spanien üblich, mit Vornamen an.
„Moment, Antonio, ich werde mir das genauer ansehen.“
Keie zog eine Schreibtischschublade auf und holte sich eine Lupe heraus, die er über die Aufnahme legte. Tatsächlich konnte er auf den verwaschenen Konturen des Buches ein merkwürdiges Sammelsurium von Strichen erkennen, das aussah wie eine Schrift, das aber ebenso gut aus haarfeinen Rissen des Holzuntergrunds oder der Farbe, ein sogenanntes Krakelee, sein konnte. Schließlich war Boschs Triptychon beinahe fünfhundert Jahre alt.
„Und? Wird es deutlicher?“
Keie schüttelte den Kopf. Dann nahm er sich die zweite Aufnahme vor. Der halbe Kopf eines Eichelhähers, eine Distel mit blauem Blütenbusch und die Reste eines Schmetterlings waren darauf zu sehen. Auch auf diesem Ausschnitt verschwammen die Konturen wegen blasiger Aufwürfe und blinder Stellen. Die Säure hatte den Bildteil stärker beschädigt, aber auch hier nur den Firnis angegriffen. Mit viel Fantasie konnte er Augen erkennen, auch eine Nase. Man musste sich die verwaschenen Formen vielleicht in Ruhe betrachten, mit Hilfe der Lupe Konturen nachzeichnen, Linien ergänzen.
„Jetzt sagen Sie doch endlich etwas, Michael. Sie können doch nicht so blind sein.“
„Hören Sie, Antonio, das einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist, dass ich Vergrößerungen davon anfertige. Dann können wir gemeinsam nachprüfen, ob Ihre oder meine Augen sich getäuscht haben.“
„Ich täusche mich nicht, Michael.“
Antonio de Nebrija beugte sich über den Schreibtisch und fuhr mit dem Finger die angeblichen Konturen nach.
„Das hier sind Buchstaben. Und auf dem anderen Bild erkennt man ein Tier. Vielleicht einen Kauz, eine Eule oder etwas Ähnliches. Aber machen Sie die Vergrößerungen.“
Jetzt, wo er ihn mit der Nase darauf gestoßen wurde, begann Keie tatsächlich Formen in den Bildern zu erkennen. Ihm fuhr ein leichter Schauer über den Rücken. Vielleicht hatte der alte Fuchs doch den richtigen Riecher. Sollte er sich nicht irren, dann war das hier eine wissenschaftliche Sensation: Verborgene Zeichen auf einem der bedeutendsten Gemälde der Kunstgeschichte – und er war an ihrer Entdeckung beteiligt.
„Sie haben mich überzeugt, Antonio. Morgen werde ...“
„Morgen, mañana, mañana. Nein. Heute noch, Michael. Solche Dinge dürfen nicht aufgeschoben werden.“
Er hätte sich nie darauf einlassen sollen! De Nebrija zählte zu jenen Menschen, die solange keine Ruhe gaben, bis ein Problem angegangen und gelöst war, während er selbst lieber nichts übers Knie brach. Mit einem Seufzer der Ergebenheit wuchtete er sich aus dem Sessel.
„Die Negative liegen ...“
„... im Tresor. Solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, wollte die Polizei …“
„Antonio! Ich bitte Sie, unterbrechen Sie mich nicht und lassen Sie mich meine Arbeit tun. Sie wissen, dass ich Sie schätze. Sie wissen aber auch, dass ich Sie ...“
„... für eine Nervensäge halte!“, warf Nebrija ein und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Er grinste.
„Lachen Sie mich nicht aus. Ich mache die Vergrößerungen ja. Jetzt sofort. Weil ich weiß, dass Sie eine heilige Scheu vor aller Elektronik haben und nie einen Printer bedienen würden. Aber lassen Sie mich um Himmels willen allein. Ich bringe Ihnen die Vergrößerungen.“
Antonio de Nebrija setzte eine beleidigte Miene auf, wühlte mit einer Hand in seinem schlohweißen Haar und hinkte zur Tür. Mit einem schelmischen Blick auf Keie zurück tönte er noch: „Ich werde mich an eure deutsche Gemütlichkeit nie gewöhnen.“
Antonio de Nebrija sprach das Wort Gemütlichkeit ohne Umlaut aus und Keie konnte einen ironischen Ton heraushören. Der Alte hatte erreicht, was er wollte.
Keie verließ hinter de Nebrija sein Büro und löschte das Licht.
Als Keie aus dem Raum für die Drucker zurückkam, ging sein Atem schneller. Hastig durcheilte er die Gänge des Werkstattgebäudes. Es war ein kleines Labyrinth, in dem er sich bei seiner Ankunft mehrmals verlaufen hatte. Er hielt zwei Vergrößerungen in der Hand. Die Negative steckten in seiner Hemdtasche. Antonio de Nebrija würde einen Luftsprung machen, wenn er ihm die Aufnahmen zeigte. Er hatte recht behalten. Als Keie in den Gang einbog, der zu Nebrijas und seinem eigenen Büro führte, blieb er wie angewurzelt stehen.
Aus seinem Büro, das schräg gegenüber dem de Nebrijas lag, fiel ein schmaler Lichtstreifen auf den Gang hinaus. Sofort schrillten die Alarmglocken in seinem Kopf. Wer hatte sein Büro betreten und das Licht eingeschaltet? In den letzten Wochen verschwanden immer wieder Laptops und Drucker von den Schreibtischen. Er mahnte sich zur Vorsicht. Angestrengt überlegte er, was zu tun sei.
Er musste versuchen, den Kerl zu stellen, der womöglich sein Zimmer durchwühlte. Zuerst wollte er aber die hinderlichen Bilder loswerden und nachsehen, ob de Nebrijas noch da war. Vorsichtig schlich er sich zu dessen Zimmer und schlüpfte geräuschlos hinein. Das Büro war leer und Keie legte die Abzüge gut sichtbar auf dessen Schreibtisch. Dann trat er wieder auf den Gang und näherte sich der Tür zu seinem Büro. Durch den Spalt spähte er ins Innere, konnte aber niemanden entdecken.
Unwillkürlich griff er nach dem Schweizermesser in seiner Hose, dann drückte er gegen die Tür, die sich geräuschlos öffnete.
Am Bücherregal seitlich zum Eingang stand eine Frau. Schulterlange braune Haare, ein erdfarbenes Kleid, halbhohe Schuhe. Nur der grüne Gürtel stach farblich hervor. Sie blätterte in einem Folianten.
„Qué desea? Kann ich Ihnen helfen?“, warf Keie scharf in den Raum.
Die Frau klappte das Buch sofort zu und fuhr herum.
„Haben Sie mich erschreckt!“
Ihre Stimme klang vorwurfsvoll. Sie sprach ihn im ersten Augenblick der Überraschung deutsch an, mit einem holländischen Akzent.
„Wühlen Sie immer in fremden Zimmern herum? Wer hat Sie hereingelassen?“, fragte er auf deutsch.
Mit einem offenen Lächeln ging die Frau auf Keie zu und streckte ihm die Hand entgegen.
„Grit Vanderwerf! Psychologin und Psychotherapeutin. Ich wollte zu Herrn Dr. Michael Keie.“
Keie zögerte. Er mochte es nicht, wenn man seine Fragen ignorierte.
„Und was wollen Sie von Dr. Keie?“
„Ich behandle den Attentäter.“
Keie sah sich verstohlen um, während er den Raum betrat.
„Welchen Attentäter?“, hakte er nach.
„Der den ‚Garten der Lüste‘ zerstören wollte.“
Keie setzte sich auf seinen Stuhl und lehnte sich zurück.
„Ich bin Dr. Keie.“
Obwohl es sich bei seinem Gegenüber um eine attraktive Frau handelte, hielt ihn das kühle Grau ihrer Augen auf Distanz. Er konnte sich nur schwer überwinden, ein Gespräch zu beginnen.
„Darf ich mich setzen?“, fragte Grit Vanderwerf nach einer Weile des Schweigens und deutete auf den zweiten Stuhl vor dem Schreibtisch.
„Bitte! Was führt Sie hierher?“
„Ich behandle wie schon gesagt den Attentäter. Psychologisch.“
„Eine Niederländerin in Madrid?“
„Meine Mutter ist Spanierin, ich bin zum Studium hierher gekommen, und irgendwann habe ich bemerkt, dass mich eigentlich nichts mehr in den Norden zurückzieht. Nun arbeite ich seit Jahren an einem Großprojekt verschiedener europäischer Museen über Kunstattentäter. Und für die spanischen Behörden kümmere ich mich um die psychologische Betreuungen von Bilderschändern, fertige Gutachten an, entscheide über ihre Unterbringung und beurteile die Heilungschancen.“
Keie räusperte sich. Es war ihm plötzlich unangenehm, dass er Grit Vanderwerf so forsch angesprochen hatte.
„Aber wie kommen Sie in mein Büro?“
„Ein älterer Herr hat mir gezeigt ...“
In diesem Augenblick stürmte Antonio de Nebrija hinkend ins Zimmer.
„Phantastisch, mein Freund. Sehen Sie, ich hatte recht! Die Vergrößerungen sind hervorragend und lassen sich lesen wie die beste mittelalterliche Handschrift. Aber wollen Sie mich nicht vorstellen?“
Keie verzog säuerlich den Mund.
„Grit Vanderwerf, Psychologin. Sie betreut den Kerl, der den ‚Garten der Lüste‘ beschädigt hat.“
„Buenas tardes, Señora. Antonio de Nebrija.“
„Er ist das Faktotum in der Restauration“, nahm Keie das Gespräch wieder auf, froh darüber, einen Anfang gefunden zu haben. „Älter beinahe als das Gebäude hier – und ein unermüdlicher Tüftler. Erst heute hat er an Bildern, die wir von den Beschädigungen am ‚Garten der Lüste‘ gemacht haben ...“
Antonio de Nebrija fuhr herum und zwang Keie mit einem mürrischen Blick zum Schweigen. Erst jetzt erkannte Keie, dass Grit Vanderwerf aufmerksam lauschte. Als Keie sich unterbrach, nahm sie den Faden sofort auf.
„Für meine Arbeit wäre es wichtig, etwas über den Zustand des Bildes erfahren. Die Art der Beschädigungen lässt häufig Rückschlüsse auf die Art der Krankheit und die Motive des Täters zu.“
„Vielleicht sollten wir die Angelegenheit bei einer Tasse Kaffee bereden, Frau Vanderwerf“, schlug Keie vor. „Was halten Sie davon? Ich kann Ihnen dann etwas über meine Arbeit erzählen und Sie mir über die Ihre. In der Nähe ist ein nettes Café, das ich gern besuche. Es wäre mir ein besonderes Vergnügen.“
„Ich werde mich verabschieden“, sagte Antonio de Nebrija. „Die Arbeit ruft!“
Als er sich zu Keie umdrehte, hob er die Augenbrauen und schüttelte unmerklich den Kopf. Keie verstand nicht ganz, was er damit erreichen wollte, aber er beschloss, mit seinen Hinweisen auf das Bild vorsichtiger zu sein.
II
Die Hitze vor dem Gebäude war unerträglich. Der dunkle Asphalt glühte förmlich und nicht einmal der Schatten der Alleeplatanen konnte Linderung verschaffen. Keie schlenderte mit Grit Vanderwerf den Paseo de Recoletos bis zur Plaza de Colón hinauf. Auf den Schattenbänken der Parkanlage zwischen den Fahrspuren saßen die Menschen erschöpft im Schatten. Selbst die Luft um den grünen Pavillon des Café del Espejo mit seinen grünweißen Kachelrauten sirrte.
Bis auf den Bürgersteig hinaus fluteten die Tische und Stühle des Cafés. Überall saßen die Menschen unter riesigen grünweißen Sonnenschirmen.
„In den Pavillon oder auf die Terrasse?“
Als ein Pärchen von einem Zweiertisch aufstand, steuerte Keie sofort darauf zu und besetzte den Tisch unter dem grünweißen Sonnenschirm. Damit war die Frage von eben entschieden. Sie nahmen Platz und während der Ober am Nachbartisch abrechnete, nahm er gleichzeitig ihre Bestellung auf.
„Zwei Kaffee con leche! Und ein paar Tapas.“
Sie saßen nebeneinander und blickten hinauf zur Plaza de Colón, die vom Kolumbusstandbild auf der Säule überragt wurde.
„Sie wollten mir über ihre Arbeit berichten“, nahm Keie das Gespräch wieder auf.
Das Hupen und Anfahren auf der Hauptstraße und das Stimmengewirr der Leute um sie herum nötigte Grit Vanderwerf, sich zu Keie hinüber zu beugen. Sie sah ihn an. Ohne jedes Zögern sagte sie:
„Eine meiner Aufgaben ist es herauszufinden, welche Motive der Attentäter hatte und ob es Hintermänner gibt. Wir, das heißt mein Institut und die Polizei, glauben zwar, dass er ein Einzeltäter ist, brauchen aber Beweise.“
Keie versuchte, es sich auf seinem Metallstuhl bequem zu machen, doch dessen Lehne drückte ihm in den Rücken.
Der Ober brachte die beiden Milchkaffees und stellte einen Teller mit Tapas auf den Tisch.
„Und Sie, Dr. Keie? Ich habe wahre Wunderdinge von Ihrer Methode, Bilder zu analysieren, gelesen. Man hat Sie wohl als Zauberer in Sachen Kunst engagiert?“
„Die Infrarotreflektografie ist keine Zauberei“, sagte Keie belustigt. „Aber in Europa beherrschen nur wenige diese Technik und noch weniger können die Bilder auswerten. Da ich auch Restaurator bin, wurde ich wohl hierher gerufen. Schließlich ist der ‚Garten der Lüste‘ nicht irgendein Bild. Außerdem bin ich ungebunden. Familiär, meine ich. Da ist es leichter für einige Monate nach Madrid zu gehen.“
Grit rückte noch etwas näher. Der Lärm um sie herum schien zu verschwinden.
„Keine Frau? Keine Kinder?“
„Nein.“
Grit Vanderwerfs Blick schweifte hinüber zur Plaza de la Colón. Für einen Moment schien es Keie, als blicke sie in sich hinein. Aber gleich darauf hatte sie sich wieder in der Gewalt, richtete ihre Augen auf ihn und fragte unvermittelt:
„Haben Sie sich nicht schon gefragt, Dr. Keie, warum Menschen Bilder zerstören? Was treibt sie dazu, eine Säureflasche, ein Messer, Glasscherben oder andere Dinge in ein Museum zu schleppen und damit auf Gemälde loszugehen?“
„Ich kann es nur vermuten.“ Er nahm einen Schluck Kaffee. „Weil sie sich vom Bildinhalt bedroht fühlen, weil sie den Liebhabern solcher Gemälde Schmerz zufügen wollen oder Rachegedanken haben, warum auch immer. Weil sie Aufmerksamkeit für sich beanspruchen, etwas von der Aufmerksamkeit, die üblicherweise für das Bild, nicht aber für sie aufgewendet wird. Weil sie eine neurotische Störung haben und Bilder als lebendige Wesen betrachten. Habe ich etwas vergessen?“
Während seiner Ausführungen, die etwas im Lärm der Straße unterging, hatte auch Grit Vanderwerf an ihrer Kaffeetasse genippt.
„Sie haben recht, Dr. Keie!“
„Das freut mich. Meine laienhaften Kenntnisse der psychologischen Grundlagen von Gemäldeattentätern ...“
„Wissen Sie, beinahe alle Attentäter handeln im Auftrag. Einmal im Auftrag einer höheren Moral. Sie zerstören Anstößiges, Pornographisches. Oder sie handeln im Auftrag irgendeiner inneren Stimme, die ihnen befiehlt, ein Gemälde zu vernichten, oft genug grundlos, oder aber sie attackieren Bilder im Auftrag einer Organisation, die ganz bestimmte Ziele damit verfolgt: Wertsteigerung anderer Gemälde, Vernichtung unliebsamer Fälschungen oder Informationen über den Maler, über Modelle oder anderweitige biographische Hinweise. Wir hatten sogar einmal einen Museumsdirektor als Auftraggeber, der damit den Ankauf eines wertlosen Duplikats vertuschen und die Versicherungssumme dafür abkassieren wollte. Nur ein kleiner Prozentsatz der Täter ist wirklich geistig gestört.“
Grit Vanderwerf hatte ihre Stimme soweit gesenkt, dass sie eben noch das Rauschen der Straße übertönte. Sie unterbrach kurz, da sich hinter ihr eine Gruppe von Madrilenen lautstark vorüberschob, um einen Platz in der Mitte zu erobern.
„Die meisten Täter besitzen also Hintermänner. Ziel meiner Arbeit ist es, die geistig verwirrten Einzeltäter von denen, die einen Auftraggeber haben, zu trennen.“
Die Lehne drückte Keie in die Nieren. Unruhig rutschte er auf seinem Stuhl hin und her.
„Eine letzte Möglichkeit ist, dass die Auftraggeber das Bild deshalb beseitigen wollen, weil sie damit eine Information vernichten können. Eine wichtige Information.“
Sie sprach ohne jede Anteilnahme. Keie hatte das Gefühl, als würde die einen oft verwendeten häufig Vortrag abspulen und wäre mit ihren Gedanken nur halb bei der Sache.
„Die Vernichtung einer Information? Was verstehen Sie unter Information?“ Keie dachte sofort an die Entdeckung Antonio de Nebrijas, an die Zeichen, die er gelesen, an die Figur, deren Augen er selbst gesehen hatte.
„Botschaften“, ergänzte Grit Vanderwerf, „Ein Gemälde kann solche Botschaften selbst bildnerisch darstellen. Liebeshändel zum Beispiel. Oder aber man versteckt Hinweise in der Malerei oder bringt sie auf dem Rahmen, in der Grundierung unter. Der Fantasie sind hier keinerlei Grenzen gesetzt.“
„Das ist doch absurd.“
Keie beugte sich nach vorn, sein Rücken schmerzte. Grit Vanderwerf nahm einen Schluck Milchkaffee. Sie hielt Untertasse und Tasse noch in der Hand, als sie antwortete.
„Das ist häufiger, als Sie annehmen.“
„Sie glauben also, dass das Attentat auf den ‚Garten der Lüste‘ eine geplante, zielgerichtete Tat gewesen ist?“
„Ich behaupte nichts!“
„Dann wäre der Anschlag nicht derart dilettantisch ausgeführt worden. Ich bitte Sie!“ Keie hatte Feuer gefangen. Während er darüber nachdachte, musste er den Kopf schütteln.
„Inwiefern?“
Keie begann nun doch über seine Arbeit zu erzählen. Er berichtete davon, dass die Flüssigkeit das Bild nur an wenigen Stellen getroffen hatte.
„Hätte der Kerl es geschafft, die Säure weiter nach oben zu spritzen, wäre die Flüssigkeit das gesamte Bild hinuntergelaufen und hätte erheblich mehr zerstört. So wurde nur der Teich und eine lesende Figur darin beschädigt. Die Säure war zudem sehr verdünnt. Sie hat sich nicht einmal durch den Firnis gefressen, sondern nur an drei Stellen auf dem Bild darunter mattere Stellen hinterlassen. An denen sind allerdings Veränderungen ...“
In Grit Vanderwerfs Augen las Keie, dass er zu viel verraten hatte.
„Dann haben Sie auf dem Bild also tatsächlich etwas gefunden! Sie deuteten in ihrem Büro bereits etwas Derartiges an. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass diese Flüssigkeit nicht dazu da war, das Bild zu zerstören, sondern diese Information sichtbar zu machen?“
Keie hob die Augenbrauen.
„Ich verrate Ihnen noch etwas. Wussten Sie, dass der Attentäter ein Priester war? Mitglied der Kongregation der Dominikaner in Salamanca. Und dort Bibliothekar.“
Keie verschluckte sich am letzten Rest Kaffee aus seiner Tasse und musste husten.
„Ein Pfaffe? War ihm das Bild zu unmoralisch? Zuviel nackte Haut? Zuviel Sex und Pornographie?“
„Das hatte ich gehofft, von Ihnen zu erfahren. Aber einen Teil der Antwort haben Sie mir bereits gegeben.“
Keie fühlte, wie sie zögerte. Sie steuerte offenbar auf eine für sie wichtige Frage zu.
„Kann man die Beschädigungen sehen? Haben Sie womöglich Bilder davon gemacht?“
Keie fühlte sich in die Ecke gedrängt. Er wollte nicht lügen, wollte ihr aber auch nicht die ganze Wahrheit sagen. Antonio de Nebrijas Warnung stand ihm deutlich vor Augen. In seiner Branche musste man mit der Weitergabe von Entdeckungen vorsichtig sein, wenn man sie nicht im nächsten Kunsthistorischen Magazin von fremder Feder geschrieben, wiederfinden wollte.
„Wir können uns das Bild gemeinsam ansehen. Selbstverständlich.“
Grit Vanderwerf lächelte entspannt und trank einen kleinen Schluck ihres Milchkaffees. Keie bemerkte, wie zierlich ihre Hände auf der großen Porzellantasse wirkten. Während sie ihn über die Tasse hinweg anblickte, bekamen ihre Augen einen sanften Glanz.
„Ich brauche Ihre Hilfe, Dr. Keie!“, sagte sie leise. „Dieser Pater, er nennt sich Pater Baerle, ist bekannt. Ein Serientäter. Der ‚Garten der Lüste‘ ist sein viertes Bild in den letzten fünf Jahren. Er wurde aus der Kongregation ausgeschlossen, weil er Werke der Klosterbibliothek vernichtet hat, die Hinweise auf Frauen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit enthalten haben: Inquisitionsberichte, Dokumente, Briefe und vieles mehr.“
Ihr Gesicht bekam während der Aufzählung einen hellen Glanz. Er lauschte ihrer Stimme, deren lockendem Tonfall er sich kaum entziehen konnte.
„Ich habe nur ein Problem. Pater Baerle spricht nicht mit Frauen.“
Keie sah Grit Vanderwerf ungläubig an.
„Was kann ich dabei für Sie tun, Señora Vanderwerf? Es gibt doch bei der Polizei oder in Ihrem Institut sicher genügend Männer, die diesen Pater verhören könnten.“
„Sicher. Doch es ist noch keinem gelungen, etwas aus ihm herauszubekommen. Genau deshalb hat sich die Polizei auch an uns gewandt. Immer hat der verrückte alte Kerl gefordert, mit einem Kenner des Bildes, mit einem Spezialisten sprechen zu dürfen.“
Sie beugte sich vor, spielte mit der Kaffeetasse vor sich auf dem Tisch, drehte sie, als müsse sie ihren Gedanken erst die richtige Wendung geben. Ihr Gesicht näherte sich dabei dem Keies.
„Fachleute gibt es in Madrid zuhauf. Ich hatte erst gar nicht an Sie gedacht, doch jetzt weiß ich: Sie sind genau der Richtige. Sie machen als Restaurator seine Tat ungeschehen. Das muss ihn provozieren. Sie haben außerdem auf dem Bild möglicherweise etwas entdeckt. Das wird ihn neugierig machen. Außerdem sind Sie ein Mann. Mit Ihnen wird er reden. Dabei ist es egal, ob er sie beschimpft oder seine Tat sachlich reflektiert. Ich glaube, es ist für uns alle schon deshalb von großem Interesse, weil er bereits angedeutet hat, er sei während seiner Zeit als Bibliothekar in der Klosterbibliothek von Salamanca auf ein Manuskript gestoßen, das in Zusammenhang mit dem ‚Garten der Lüste‘ steht!“
Keie fühlte nur allzu deutlich, dass diese letzte Bemerkung der Köder gewesen war, ihn an die Angel zu nehmen. Er glaubte, mit dem letzten der Tapas auch den Haken zu fühlen, den er geschluckt hatte.
„Gut“, hörte er sich sagen. „Ich werde Ihnen helfen. Wann kann ich mit diesem Pater sprechen?“
„Wenn Sie wollen, sofort. Mit dem Taxi brauchen wir eine halbe Stunde, mit der Metro geht’s schneller.“
Statt einer Antwort winkte Keie den Ober herbei und zahlte.
„Ach ja, eine Winzigkeit noch, die ich Ihnen nicht verschweigen sollte. Pater Baerle behauptet, ich hätte ihn zu diesem Attentat angestiftet. Absurd. Die Projektion eines Verwirrten auf seinen Therapeuten. Aber ein weiterer Grund, jegliches Gespräch mit mir abzulehnen.“
Keie blinzelte in die Sonne. Sie erhoben sich und traten auf den Gehweg hinaus.
„Absurd!“, wiederholte er.
Grit Vanderwerf hakte sich bei ihm unter, als sie sich in Richtung Plaza de la Cibeles bewegten. Keie ließ es geschehen. Sie schlenderten über die breite Fußgängerzone des Parks, blieben am Wasserspiel vor dem Platz stehen und bewunderten das Rieseln der breiten Wasserfläche über das sorgfältig gelegte Steinbett und betraten die Metrostation Retiro.
III
Grit Vanderwerf führte ihn zu einem alten Kloster in einem der Außenbezirke. Der Putz bröckelte überall, und Farbe blätterte in aufgerissenen Blasen von den Wänden. Die vergitterten Fenster standen schwarz von der Tünche ab. Dahinter blinkten im Sonnenlicht alte, noch unregelmäßig geglättete Scheiben. Trotz der immer noch mächtigen Mauern wirkte das Gebäude unbenutzt. Nur eine Videokamera neben dem Eingang und ein neuen Schild mit der Aufschrift ‚Klausur‘, zeigte an, dass dem nicht so war.
„Sie arbeiten in einem Kloster?“
„Nein, das nicht“, antwortete Grit Vanderwerf. „Ich habe hier in dieser Station des Dritten Ordens einige Behandlungsräume und Belegzimmer für minderschwere Fälle. Die Polizei hat den Pater in unsere Obhut gegeben, da er unter Aufsicht keine Gefahr für die Öffentlichkeit ist. Pater Baerle ist hier sehr familiär untergebracht und wird bestens versorgt.“
Sie traten durch ein überdimensionales Portal ein. Grit Vanderwerf zeigte der Schwester an der Pforte ein offiziell aussehendes Papier, füllte ein Formular aus, ließ Keie unterschreiben und leitete ihn durch schier endlose Treppenhäuser und Gänge immer tiefer in das Klostergebäude hinein. Pflegerinnen in weißgrauer Ordenstracht begegneten ihnen in den Gängen, grüßten und huschten mit Essenswagen oder Arzneimittelverteilern an ihnen vorüber, bis Grit Vanderwerf und Keie das Ziel ihrer Wanderung erreicht hatten.
Eine Pflegerin im Habit des Dritten Ordens schloss ihnen auf. Sie betraten eine modern eingerichette Mönchszelle.
Keie sah eine schmächtige Gestalt, die sich, vom Besuch offenbar überrascht, von einer Liege erhob. Ganz in Schwarz gekleidet, stach der Pater vom Weiß des Raumes ab. Nur Gesicht und Hände schimmerten in der kalkigen Helle der Wände. Selbst das Haar glänzte in einem gelblichen Grau, als wäre es poliert.
„Pater Johannes Baerle“, stellte Grit Vanderwerf ihm die Person vor. „Dr. Michael Keie, Restaurator und Doktor der Kunstgeschichte, Spezialgebiet niederländische Malerei.“
Pater Baerle nickte und streckte dem Wissenschaftler seine Hand hin, die dieser zögernd ergriff. Sie fühlte sich trocken und kalt an.
„Endlich ein Mann!“
Keie lächelte mit geschlossenen Lippen.
„Setzen wir uns doch!“, forderte Grit Vanderwerf auf, und nahm sich einen Stuhl, der zusammengeklappt an der Zellenwand lehnte.
Mit einem Blick erfasste Keie die Zelle in ihrer Gänze. Der Raum war spartanisch eingerichtet. Neben der Pritsche stand ein kleiner Schreibtisch, auf dem Papier und einige kurze Bleistiftstummel lagen. Davor befand sich ein Anstaltshocker, weiß wie alles in dem Raum. Keie zog ihn heran und setzte sich. An der Wand rechts vom Fenster hing ein Regal, das außer einer Bibel nichts weiter enthielt. Ein Spind neben der Tür war geöffnet aber leer. Über allem, in gut drei Metern Höhe, brannte eine matte Leuchtstoffröhre ohne Glasabdeckung. Die Zelle war überheizt und roch auffällig nach Desinfektionsmitteln. Pater Baerle setzte sich auf die Kante seiner Liege, zog die Beine an den Körper und wartete darauf, angesprochen zu werden. Seine rotgeränderten Augen flatterten unruhig.
„Wie geht es Ihnen heute?“, brach Grit Vanderwerf das Schweigen.
„Gut, nachdem ich in diesem Gebäude endlich einen Mann sehe. Entschieden zu viele Frauen. Entschieden zu viele!“
„Werden Sie schlecht behandelt, Pater Baerle?“
„Wie man’s nimmt. Selbst mein Arzt ist eine Ärztin! Lassen Sie sich gerne von einer Männerhand betatschen, Señora Vanderwerf? Sehen Sie! Es ist gegen meine Würde. Mein Antrag auf ärztliche Behandlung durch einen Mann wurde abgelehnt!“
Pater Baerle zischelte bei jedem Wort, als stieße seine Zunge ständig zwischen die Zähne. Keie spürte, wie ihm eine Gänsehaut den Rücken hinaufkroch. Er schüttelte sich.
„Was macht er hier?“, übernahm der Pater jetzt das Gespräch und deutete mit einer Kopfbewegung auf Keie. „Soll er mich aushorchen?“
Grit Vanderwerf schüttelte den Kopf. Sie beugte sich zu Pater Baerle hinüber, versuchte mit ihrer Hand die seine zu greifen. Doch der Geistliche war schneller und zog seine Hand zurück.
„Er restauriert das von Ihnen beschädigte Bild! Außerdem wollten Sie doch einen männlichen Gesprächspartner!“
Mit einem Satz sprang Pater Baerle auf.
„Von mir beschädigt! Pah! Von mir beschädigt. Sie haben ja keine Ahnung. Aber das habe ich bereits hundertmal gesagt.“
Er senkte resigniert den Kopf und setzte sich wieder. Dann sah er Keie an.
„Hat es gewirkt? Sagen Sie mir, hat die Flüssigkeit gewirkt?“
Keie erschrak. Baerles Augen bekamen einen feuchten Glanz. So wurden in alten Filmen fanatische Wissenschaftler dargestellt, die die Grenze zum Wahnsinn überschritten hatten.
„Das Bild ist weitgehend unbeschädigt, wenn Sie das meinen, Pater. Nur die Firnisoberfläche wurde abgeätzt, mehr nicht. Allerdings hat das Mittel auf der darunter liegenden Farbfläche eine Reaktion ausgelöste, die wir noch nicht erklären können. Es wird einige Zeit dauern, bis wir sie verstanden haben. Der Firnis muss abgetragen und erneuert werden, aber das Gemälde musste ohnehin restauriert werden. Ansonsten ist es unbeschädigt. Ich habe es mit meiner neuen Methode untersucht, die Ihnen sicher nichts sagen wird.“
Mit geneigtem Kopf hörte der Pater die Erklärung Keies und schmunzelte. Dann, mit einem Augenaufschlag, fixierte er ihn und fragte leise, mit einem spöttischen Unterton:
„Glauben Sie, ich weiß nicht, wie man ein Bild nachhaltig zerstört? Sind Sie wirklich so blauäugig?“
Keie ging auf die Bemerkung nicht ein. Aber bevor er eine eigene Frage stellen konnte, hakte Baerle nach.
„Wo arbeiten Sie, Dr. Keie? In den alten Werkstätten hinter dem Museum in Richtung Retiro? Dieses graurote Gebäude?“
Etwas verwundert nickte Keie. Warum wollte er das wissen?
„Ist das jetzt wichtig?“, warf auch Grit Vanderwerf ein.
Keie konzentrierte sich auf seine Frage.
„Mich interessiert vielmehr, warum Sie es überhaupt getan haben?“
„Pater Baerle, vielleicht erzählen Sie Herrn Doktor Keie, was Sie mir nicht erzählen wollten.“
Pater Baerle stand wieder auf und näherte sich Keie. Er brachte sein Gesicht so nahe an das Keies und hauchte ihn an, bis Keie den Kopf zur Seite drehte. Plötzlich spürte er den heißen Atem des Paters an seinem Ohr.
„Helfen Sie mir. Bitte. Die bringen mich hier sonst um!“
Unvermittelt setzte sich Baerle wieder, fixierte Keie, bis der Pater plötzlich die Augen niederschlug und fragte: „Warum sollte ich ihm etwas erzählen?“ Baerle streckte sich und lachte über seinen Einfall. „Nichts soll er wissen.“
„Offenbar haben Ihre Zerstörungen etwas freigesetzt. Etwas Verborgenes ans Tageslicht geholt, Pater Baerle“, griff Grit Vanderwerf in das zähe Gespräch ein.
Der Pater fuhr herum, sein Gesichtsausdruck verzerrte sich.
„Was haben Sie gefunden? Erzählen Sie schon“, fuhr er Keie an.
Keie schwindelte es in der kahlen Helligkeit des Zimmers. Die roten Augen des Geistlichen bedrohten ihn regelrecht, schienen ihn zu umklammern. Nichts würde er verraten, nichts, weder dieser Frau noch dem verrückten Pater. Nein, er würde schweigen, nichts von dem preisgeben, was Antonio de Nebrija möglicherweise entdeckt hatte. Zu plötzlich interessierten sich zu viele für das Bild und seine Geheimnisse, die er selbst noch nicht recht verstanden hatte. Unruhig spielte er mit dem Messer in seiner Hosentasche, bis er bemerkte, wie Pater Baerle ihn interessiert beobachtete.
Eine Stille breitete sich aus, in der nur das Atmen der drei Menschen zu hören war. Durch das vergitterte Fenster drangen schwach Sonnenstrahlen in den Raum.
„Na gut, behalten Sie Ihr Geheimnis für sich, Señor Keie! Vielleicht sollte ich tatsächlich mit meiner Geschichte zuerst beginnen. Vertrauen gegen Vertrauen. Obwohl ich nicht weiß, ob ich hier in diesen Mauern ..., aber lassen wir das.“
Baerle sah zu Grit Vanderwerf hinüber, die sich aber nicht rührte. Er sprach jetzt langsam, mit einem harten Akzent. Keie hatte Mühe ihn zu verstehen. Er runzelte die Stirn und dachte einen Moment darüber nach, was der Geistliche gemeint haben könnte. Fühlte er sich wirklich bedroht? Natürlich wurde er seiner Freiheit beraubt und beobachtet, weil er eine Straftat begangen hatte. Keie kannte sich zu wenig aus in den Gepflogenheiten spanischer Psychiatrien oder Ordenskrankenhäusern. Doch die eindringliche Stimme des Paters verhinderte, dass er sich weiter damit beschäftigte.
„... zuständig für die Handschriftenabteilung in der Bibliothek von Salamanca und dort interessierte ich mich vor allem für inquisitorische Vorgänge der Vergangenheit. Meine Aufgabe war es sozusagen, die Rechtmäßigkeit bestimmter Urteile vom Standpunkt der Theologie aus zu überprüfen. Während der Recherchen bin ich auf eine Protokollnotiz gestoßen. Äußerst aufschlussreich. Allerdings etwas kurz. Es war darin die Rede von einem Manuskript. Ich habe jahrelang danach gesucht – und schließlich bin ich fündig geworden, in Unterlagen aus Köln. Alles noch ungeordnet, wahrlich ein babylonisches Durcheinander in verstaubten Kisten und Kästen. Leider unvollständig. Geschrieben wurden die Seiten um 1511 in den Verliesen der Heiligen Inquisition zu ‘s-Hertogenbosch, Brabant. Der Autor war ein Mann namens Petronius Oris, ein Künstlername wie in dieser Zeit üblich. Seine wahre Identität blieb im Dunkeln. Er hatte den Auftrag vom Inquisitor persönlich, seine Geschichte niederzulegen.
Ich habe sie gelesen ...“
IV
Die Gegend vor ‘s-Hertogenbosch wimmelte von Strauchdieben, Halsabschneidern und Wegelagerern, die ehrbaren Männern in den Stunden zwischen ausklingendem Tag und anbrechender Nacht auflauerte. Als Petronius Oris das Fuhrwerk auf sich zukommen sah, trat er aus dem niedrigen Jungholz hervor, um dem Fuhrknecht zu zeigen, dass er keine bösen Absichten hegte. Die Sonne ging eben unter, und in der heraufziehenden Dämmerung konnte Petronius erkennen, wie der Fuhrmann die Zügel fester fasste.
„So ist’s recht! Heraus und gezeigt, wenn Ihr es ehrlich meint und nicht niedergewalzt werden wollt!“, hörte er den Fuhrmann rufen. „Wenn kein Übel hinter Eurem Versteckspiel lauert, könnt Ihr mit auf den Wagen.“
Dabei ließ er die Peitsche knallen, so dass die Ochsen den Kopf hoben und sich stärker gegen das Joch lehnten. Aufmerksam kontrollierte er die umliegende Gegend, ob nicht doch menschlicher Abschaum hinter Buschwerk und Bäumen lauerte und der Wanderer nur ein Lockvogel war. Der Fuhrwerker kratzte sich mit den Fingernägeln das schorfige Kinn unter den Bartstoppeln, doch außer Petronius, dessen Kittel zwar durch Staub und Straße verdreckt war, aber nicht abgerissen wirkte, war weit und breit kein Mensch zu sehen. Ein kräftiger Zug an den Riemen der Ochsen ließ die Tiere hart am Junggehölz vorüberstreifen.
„Seid Ihr unterwegs nach Den Bosch? Wenn Ihr vor Torschluss in die Stadt wollt, müsst Ihr Euch sputen. Springt auf, wenn Ihr wollt!“
Lachend nahm Petronius seinen Sack vom Boden auf und warf ihn hinten auf den Wagen.
Dann erklomm er den Sitz neben dem Fuhrmann. Er wusste, dass der Kutscher ihn von oben bis unten musterte und dass er mit seinem verfilzten schwarzen Bart nicht eben vertrauenserweckend aussah. Der Blick des Fuhrwerkers blieb an Petronius‘ Schuhen haften,
halbhohe Stiefel aus feinem Kalbsleder, die ihm zeigen mussten, dass sein Fahrgast nicht unvermögend war.
„Ich will hoffen, die haben nicht vor ein paar Stunden noch an anderen Füßen gesteckt“, sagte er und spuckte kräftig aus. „Doch Ihr habt einen offenen Blick, ich will Euch trauen. Nun schnell noch den Namen. Ehrliche Christenmenschen kennen einander.“
„Petronius Oris. Maler aus Augsburg. Ebenfalls unterwegs nach Den Bosch. Ich suche Arbeit in der Werkstatt von Meister Hieronymus. Kennt Ihr ihn?“
„Ah, ein Pinselschwinger. Ich war schon immer neugierig darauf, wie diese Geschöpfe aussehen mögen.“
Dabei musterte der Fuhrmann Petronius Oris unverhohlen von der Seite, als wäre der eine Jahrmarktsattraktion. Der Fuhrmann ließ die Peitsche über die Hörner der Ochsen wegfahren und schnalzte mit der Zunge.
„Ich kann kaum einen Unterschied zu anderen menschlichen Wesen ausmachen, Meister Oris. Nase, Mund und Ohren tragt Ihr offenbar an denselben Stellen wie sonst jeder ehrliche Christ. Dann wird es mit dem Rest ebenfalls stimmen.“
Der Fuhrwerker lachte lauthals in den scheidenden Tag hinein, zog die Nase auf und spuckte geräuschvoll ins Buschwerk. Dabei reichte der Fuhrmann dem Maler seine Hand hinüber. Petronius schlug ein. Das pfiffige Gesicht mit den schelmischen Augen flößte Vertrauen ein.
„Seid mir und meinen Ochsen willkommen. Meinhard aus Aachen, kein lateinisches Geschnörkel dabei, kein Drumherum. Schlagt ein. Bis Den Bosch könnt Ihr mir Gesellschaft leisten. Und Euren Meister Hieronymus – nun, warum sollte ich ihn nicht kennen, wenn doch die halbe Welt von ihm spricht?“
„Ja? So könntet Ihr mich zu ihm bringen?“
„Wenn Ihr das wirklich wollt.“
„Ihr seid vorsichtig. Stimmt mit ihm etwas nicht?“
Wieder knallte der Fiesel über die Hörner der Ochsen weg, die sich ins Zeug legen mussten, da der Weg leicht anstieg und nach einer Seite hin abschüssig wurde. Petronius’ Blick schweifte über die Ebene vor ihnen, die nur mit einzelnen Baumgruppen, Gestrüpp und Unterholz bestanden war.
„Der Kathedralenbau Den Boschs müsste bald über den Hügel hin sichtbar werden, Fremder. Hoh! Ihr faulen Viecher! Zieht, ihr lahmen Fresssäcke, damit ihr euer Futter verdient. Hoh! Was den Maler betrifft. Die eine Hälfte der Welt verehrt ihn abgöttisch, andere Hälfte wünscht ihn zum Teufel.“
Mit beiden Händen hielt sich Petronius am Kutschbock fest, damit er bei der holprigen Fahrt nicht auf den Wegrain hinausgeschleudert wurde. Zwischen zwei Schlaglöchern tauchte die Kirche Sint Jan gegen den Horizont hin auf. Ihre Mauern ragten wie ein hohler Zahn in den Himmel, von Gerüsten eingeschlossen. Man war eben dabei, den Turm aufzuführen und, soviel zu sehen war, die Säulen des Mittelschiffs auf Gewölbehöhe zu treiben. Gleichzeitig mit diesem eigenartigen Anblick des halbfertigen Gotteshauses entdeckte Petronius drei Rauchsäulen, die sich neben dem Turmgerippe in den Himmel schoben.
„Warum gerade in die Hölle! Malt er zu schlecht?“
„Nein“, brummte der Fuhrwerker. „Das glaube ich nicht, wenn ich auch noch keines seiner Bilder richtig gesehen habe. Die Menschen stört, was er malt. Bestimmte Menschen. Seht, vor Euch. Die Hunde haben wieder gerissen.“
Mit ausgestreckter Hand deutete er auf die Rauchsäulen, die sich weiter oben weißlich auskräuselten und dann im dämmrigen Blau des Himmels verschwanden.
„Was ist das? Wen meint Ihr mit den Hunden, die gerissen hätten?“
„Wartet’s ab, Maler. Ihr werdet die neue Gastfreundlichkeit Den Boschs noch früh genug kennenlernen. Seid dankbar, wenn Ihr sie nicht zu fühlen bekommt.“
V
Das Quietschen der sich öffnenden Tür unterbrach die Erzählung des Paters. Plötzlich war alles wieder weiß, die Wände, die Möbel, das Gesicht Pater Baerles, der ihn anzugrinsen schien, und dennoch keine Miene verzog. Die Tür schlug zu.
Die Schwester, die sie hineingeleitet hatte, brachte auf einem weißen Emailletablett, dessen abgeschlagene Kanten das schwarze Metall darunter zeigten, drei Tassen Kaffee, der nach Keies Meinung ebenso nach Desinfektionsmittel roch wie das Zimmer. Nur langsam fasste sich Keie und bemerkte, dass er sich von der Erzählung des Paters hatte fortreißen lassen.
„Was ist das für eine Geschichte? Oder binden Sie uns einen Bären auf, um uns zu unterhalten?“
Pater Baerle bellte ihn regelrecht an und wurde noch eine Spur grauer.
„Glauben Sie doch, was Sie wollen.“
„Ich möchte Ihre Reputation nicht in Frage stellen, Pater Baerle, aber was genau wollen Sie uns erzählen? Das hat doch alles nichts mit dem Bild zu tun.“
Jetzt schloss Pater Baerle die Augen, lehnte sich langsam zurück, bis seine papierene Gesichtshaut beinahe mit der Wand zu verschmelzen schien. Die Schwester hatte das Tablett und die Papptassen auf den schmalen Tisch am Kopfende der Zelle gestellt und drängte sich jetzt wieder an Keie vorbei, dem ihre übertriebene Sauberkeit in der Nase kitzelte. Er musste zweimal heftig niesen.
„Es ist das Unglück dieser Zeit, dass die Menschen darin die Geduld verloren haben“, sagte Baerle.
Er stieß diesen Satz auf eine Weise hervor, dass selbst die Wärterin vergaß, Gesundheit zu rufen und stumm um Auslass klopfte. Sie zog die Tür leise hinter sich zu, als geöffnet wurde.
„Interessiert es Sie nicht, warum ich versucht habe, das Bild … angeblich … zu zerstören, Señor Keie?“
Baerle sah ihn erwartungsvoll an, und als keine Reaktion erfolgte, fuhr er einfach fort.
„Ich darf Ihnen etwas verraten, etwas, das mit meiner Geschichte, die ich Ihnen erzähle, eng verflochten ist. So eng, dass Sie sich darin verfangen könnten, mein lieber Wissenschaftler, wenn Sie nicht vorsichtig sind!“
Pater Baerle richtete sich auf, beugte sich vor und grinste Keie frech ins Gesicht.
„Wenn Sie wissen wollen, warum, wenn Sie es wirklich wissen wollen ...“, die letzten Worte schrie er in den Zellenraum hinein, dass es dröhnte, „... dann halten Sie Ihren Mund und hören Sie zu!“
Keie zog die Augenbrauen hoch. Drohte ihm der Pater oder wollte er ihn nur erschrecken? Besänftigt, als wäre der Gefühlsausbruch nicht geschehen, flüsterte Baerle:
„Wie bei einem Uhrwerk die Zahnräder ineinandergreifen, passt auch hier alles zusammen. Geduld.“
Er machte eine Pause und fixierte Keie mit einem wässrigen grauen Blick. Grit Vanderwerf, die sich bislang still verhalten hatte, schob beschwichtigend ihre Hand auf Keies Knie.
„Erzählen Sie doch weiter, Pater, bitte“, schmeichelte sie Baerle, dessen stumpfes Starren sofort einem angeregten Blick wich.
„Ihretwegen, Señora …“, grinste er und wedelte übertrieben höflich mit dem Arm. „Ihretwegen würde nicht ein Wort über meine Lippen kommen.“
An Keie gewandt meinte er: „Sie schulden mir etwas, Señor Keie, wenn ich mit der Geschichte zu Ende bin.“ Er deutete zur Tür und meinte damit ein unbestimmtes Draußen. „Wenn ich nicht gehorche, habe ich es zu büßen. Sie entziehen mir das Essen, lassen mich nicht schlafen. Dort oben, die Leuchtstoffröhre, nur sechzig Watt, aber sie brennt Tag und ...“
„Pater!“, unterbrach Grit Vanderwerf seine Anschuldigungen.
„... außerdem ist sie schuld daran, dass ich die Säure auf das Bild geschüttet habe. Sie wollte es! Sie! Sie! Sie!“
Die letzten Worte schrie Baerle erneut, während er mit ausgestrecktem Arm auf Grit Vanderwerf zeigte, bis er erschöpft in seiner Ecke zusammensackte. Keie sah Grit Vanderwerf an. Die zuckte nur mit den Schultern und nickte kurz.
„Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie von mir erfahren werden, was wir gefunden haben, Pater Baerle“, murmelte Keie.
Wieder ging seine Hand zum Taschenmesser, als würde es ihm Sicherheit gewähren. Sofort belebte sich die Miene des Paters und er setzte sich wieder auf.
„Sie versprechen es mir?“
Keie nickte und reichte ihm die Hand hin, die Pater Baerle aber zu übersehen schien. Er sammelte sich, beobachtete Keie. Baerle blickte in sich hinein und begann plötzlich mit einer tonlosen Stimme zu sprechen:
„Ich habe darum gebeten, meine Geschichte vor einem männlichen Zuhörer zu erzählen, einem Fachmann, der weiß, wovon ich rede.“
Dann verstummte er kurz, bevor er in einen eigenartigen Singsang verfiel, mit dem er die letzte Erzählung ebenfalls eingeleitet hatte. Wieder klang seine Stimme wie die eines Geschichtenerzählers, der die Stimmung der Vergangenheit heraufbeschwor und in die Köpfe seiner Zuhörer pflanzte.
„Was wissen wir, was wissen Sie über Bosch, Hieronymus Bosch, der eigentlich van Aken hieß, aus Aachen gebürtig, und sich erst nach seinem Wohnort Bosch nannte? Was? Nichts! Oder so gut wie nichts. Ein wohlanständiger Bürger in ‘s-Hertogenbosch, geachtetes Mitglied der Liebfrauenbruderschaft der Sint Jans Kerk, wie Dutzende, Hunderte anderer auch in dieser Zeit. Viel mehr wissen wir nicht. Einige Details aus seinem Wirtschaftsleben, Heirat, Grundstückskäufe, Festessen, Todeszeitpunkt. Eine geheimnisvolle Persönlichkeit, der es gelungen ist, trotz ihres Bekanntheitsgrades im Dunkeln der Geschichte zu bleiben. Ein Weniges davon konnte ich erhellen. Bosch war nämlich ein begehrter Lehrherr, zu dem aus aller Herren Länder die Begabten pilgerten, um in seiner Malschule ausgebildet zu werden. Bis von Augsburg kamen sie oder von Venedig, von Breslau und Nürnberg, Paris und Madrid. Ein Sammelsurium von Künstlern. Die besten Gesellen aus ganz Europa ...“
VI
Das Fuhrwerk holperte auf die Stadt zu, deren dunkle Mauern mit jeder Umdrehung der Räder höher zum Horizont aufrückten.
Nach den Sätzen des Fuhrmanns hielt Petronius Augen und Ohren auf, um keinen noch so kleinen Hinweis zu übersehen, der ihm die Antwort auf seine Frage bot.
Ihm fielen die abgeholzten und sauber ausgeklaubten Dickichte auf. Keine Äste, keine herabgefallenen Zweige, keine Zapfen oder Eicheln oder stacheligen Reste von Bucheckern waren zu sehen. Richtigen Wald hatte er schon seit der Eifel nicht mehr gesehen, allenfalls am Rhein entlang noch, aber seit er von Nijmegen aus abseits der Flüsse zu Fuß unterwegs war, standen nur noch kleine Baumgruppen beisammen. Die Holzräder klopften seinen Körper langsam weich. Aber es war besser, die wenigen Meilen zu fahren, als bei einbrechender Dämmerung zu Fuß zu gehen. Sie kamen den Rauchsäulen langsam näher, bis Petronius der Gestank verbrannten Fleischs in die Nase stieg.
„Scheiterhaufen!“, entfuhr es ihm.
„Ihr habt richtig gerochen. Die ‚domini canes‘, die Hunde des Herrn, mögen am liebsten Gebratenes.“
Der Fuhrmann beugte sich zu Petronius hinüber und flüsterte ihm ins Ohr. Dabei hielt er sich die Hand vor den Mund.
„Am Besten Ihr haltet mit Eurer Meinung zum Treiben der Dominikaner hinter dem Berg. Wer vorlaut ist, lebt nicht lange in dieser Stadt. Die Luft ist arg rauchig geworden in letzter Zeit. Stadtregiment und Inquisition liegen sich in den Haaren. Die ‚domini canes‘ wollen den Herren von der Stadtverwaltung an die Gurgel. “
Als das Fuhrwerk mit den Ochsen an den drei Scheiterhaufen vorüberzog, fiel gerade eine der langen Stangen in sich zusammen, an denen die Delinquenten aufgehängt worden waren, damit der Rauch sie nicht gleich erstickte. So wurde für die Opfer etwas vom Feuerhauch der Hölle fühlbar. Der Körper brach herab und schlug in den Haufen aus verkohltem Stroh und Holz, so dass er noch einmal aufloderte, als wolle das Feuer der Seele mit in den Himmel folgen.
„Noch einige Zeit und wir passieren das Stadttor. Kurz zum Geschäftlichen. Ich bringe Euch in die Stadt. Ihr seid mein Fuhrknecht, Fremder. Keine Widerrede, sonst übernachtet Ihr draußen oder verschwindet sofort in den Kerkerzellen der Dominikaner. Kein Wort. Tut, was ich Euch sage.“
Petronius nickte. Er beschloss für sich, solange nichts zu sagen, bis er hinter die Mauern gelangt war. Er kannte die Sorgen der Städte nur zu gut, die befürchteten, jeder Fremde schleppe Seuchen ein oder käme als Bettler. Gegen das Tor zu wurde der Verkehr stärker. Aus zwei anderen Richtungen erreichten ebenfalls Fuhrwerke mit finster blickenden Kutschern unter langen, grauen Regenplanen die Zugbrücke.
„Alles arme Schlucker“, deutete der Fuhrmann zu den Bränden hinüber. „Seit die Dominikaner versuchen, in der Stadt Fuß zu fassen, nimmt der Handel ab. Warenballen aus Eindhoven, Köln, Utrecht. Manche kommen aus England oder wurden in Riga geschnürt, andere enthalten Glas aus Venedig, feinste Muranoqualität. Das meiste aber ist für die Durchreise bestimmt, wird hier nicht einmal vom Wagen genommen. Den Fuhrleuten sitzt die Angst im Nacken, für die Dominikaner könnte das eine oder andere Teufelswerk sein, so dass sie es beschlagnahmen. Aber keiner von ihnen will außerhalb der Stadtmauern übernachten. Selbst die ‚domini canes‘ sind nicht so schlimm wie das Gelichter der Nacht vor den Mauern.“
Als sie sich dem Stadttor näherten, erschrak Petronius. Vor dem Tor waren, auf lange Stangen gespießt, mehrere Köpfe zu sehen, deren Knochen bereits sichtbar waren.
„Eine grauenvolle Angewohnheit, die man den Pfaffen nicht austreiben kann. Sie halten es für eine lehrreiche Lektion. – So, da wären wir.“
Der Karren rumpelte mit den Ochsen auf die Holzbohlen der Brücke, die einen schmalen Kanal überquerte. Ein Soldat der Torwache löste sich aus der schattigen Unterfahrt, trat auf sie zu und begrüßte den Aachener mit einem schiefen Grinsen.
„Na, Meinhard, schon wieder zurück? Schwere Fracht gehabt?“
Kräftig klopfte die Wache den Ochsen auf die Schenkel und schielte zum Fuhrmann hinauf. „Seit wann nimmst du Gäste mit?“
„Kein Gast“, knurrte Meinhard, „mein Fuhrknecht. Man wird gebrechlicher auf seine alten Tage. Da tut es gut, wenn zwei Hände mehr mit zupacken.“
„Gut, kannst passieren. Aber nächstens kommst du früher. Die Tore wären längst geschlossen, hätte ich dich nicht herzuckeln sehen.“
Meinhard trieb die Ochsen an, die auf dem glatten Holz kaum Halt fanden. Die Stichelei ließ er unbeantwortet, schließlich begehrten hinter ihm weitere vier Wagen letzten Einlass. Sie durchfuhren das Tor und tauchten in die winkeligen Straßen dahinter ein.
Sie wurden von gierigen Blicken verfolgt. Überall lungerten Bettler, die längs der Tore ihr Glück suchten und ihnen die Fäuste hinterherschüttelten, nachdem der Fuhrmann keine Münzen für sie übrig hatte. Aber auch die Händler der Buden beäugten die hereinrumpelnden Ochsenkarren argwöhnisch. Jede Ladung, die in den letzten Monaten hier gelöscht und umgestapelt wurde, veränderte die Preise, ließ die Kurse für Tuch, Glas und Wein fallen. Meinhard schien sich nicht um die gehässigen Blicke und geballten Fäuste zu kümmern.
„Ein freundliches Völkchen. Bei jeder ankommenden Fuhre haben sie Angst, dass man ihnen die Preise verdirbt. Ich werde in der Nähe des Marktes meinen Wagen abladen und die Ochsen im Süden unterstellen. Du kannst gehen, Fremder, wohin du willst, aber mach mir keinen Ärger. Der Lumpensack am Tor ist scheinheilig. Er weiß genau, wen ich in die Stadt mit hineinnehme und wen wieder mit heraus. Wenn du im Kerker landest, warum auch immer, sitze ich kurze Zeit danach neben dir. Das möchte ich nicht. Verstanden? So – und jetzt hau ab. Die Werkstatt deines Malers liegt am Markt, auf der Seite der Kathedrale. Sie ist nicht zu verfehlen. Ich muss mich um die Ochsen kümmern.“
Petronius hatte kaum zugehört, sondern aus den Augenwinkeln heraus einen Bettler beobachtet, die den Karren unablässig anstarrte und dabei Grimassen zog. In der Hand hielt er einen Stock mit einem aus einer Verwurzelung gebildeten auffälligen Knauf. Als der Bettler sich beobachtet fühlte, hob er gegen den Ochsenkarren die Faust und verschwand in einem Nebengässchen.
Dafür trat ein magerer Mönch neben den Wagen, gekleidet in das Schwarzweiß der Dominikaner, streckte die Hand zum Kutschbock hinauf und rief:
„Dem Herrgott zur Ehre und den Bedürftigen zum Lohn eine Spende.“
Meinhard knurrte Unverständliches, zog dann mit der Nase geräuschvoll auf und spuckte dem Mönch eine Mundvoll Rotz und Speichel in die Hand.
„Mit einem schönen Gruß an den Prior. Er hat die Teppiche der letzten Ladung noch nicht bezahlt. Wenn Geld fließt, reden wir weiter. Ansonsten entschuldigt, dass Ihr gerade Eure Hand in den Strahl meiner Spucke gehalten habt. Ich komme beichten. Morgen schon. Vergebt mir, Pater.“
Das Fuhrwerk zog an dem Dominikaner vorüber, der ihnen hasserfüllt nachblickte, die Hand immer noch erhoben.
Petronius konnte sich eines Grinsens nicht erwehren.
„Ihr habt das Herz auf dem rechten Fleck, Meinhard.“
„Denkt das nicht. Aber das scheinheilige Pfaffenvolk macht mich wütend. Wäre es so, wie Ihr sagt, hätte ich das eben gelassen. Ich würde eher sagen, ich bin lebensmüde.“
„Des Mönchs wegen?“
„Nein“, flüsterte der Fuhrwerker eigenartig rau und deutete mit dem Kopf ans Ende der Gasse. „Seinetwegen. Er ist hier der Blutteufel. Der Mordbrenner. Vor dem nehmt Euch in Acht.“
Petronius sah in die von Meinhard angedeutete Richtung. Ein schmaler, eher unscheinbarer Mann querte die Straße und blickte, bevor er die Hauptstraße verließ, kurz in ihre Richtung. Dann zuckte er mit den Schultern und tauchte in das Gewirr des Marktplatzes ein.
Petronius fragte sich, ob er die Szene von eben wohl beobachtet hatte.
„Pater Johannes von Baerle, der Inquisitor. Er ist der leibhaftige Tod!“
VII
„Was wollt Ihr hier, Fremder?“
Dicht hinter seinem Rücken schnarrte eine Stimme. Petronius fuhr herum. Vor ihm stand wieder der Bettler, der noch kurze Zeit zuvor die Faust gegen ihn geschüttelt hatte. Er lauerte geduckt auf eine Bewegung, seinen Stab mit dem gewundenen Knauf so in der Hand, dass er damit zustoßen konnte. Unter einer Lederkappe lag ein eigenartig geschrumpfter, schmaler Kopf, bedeckt von grauem Schorf, der wie feiner Schnee abschuppte. Ein sackartiger Kittel war um einen dürren und leicht nach vorn fallenden Körper gewunden, während die Beine in lumpigen Fetzen staken, die geschwollene rot und blau angelaufene Haut sehen ließen. Aus tief hinter den Brauen liegenden Augen stierte er ihn an.
„Wir lieben es nicht, wenn dahergelaufenes Pack sein Glück in unserer Stadt versucht! Ihr seid nicht willkommen! Habt Ihr verstanden?“
Dabei trat der Mann so nahe an ihn heran, dass Petronius der faulige Geruch seiner schlechten Zähne in die Nase stieg.
„Es gibt genug Stadtarme, die das Wenige zum Sterben nicht zusammenbetteln können. Damit wir uns verstehen, gebettelt wird nicht, auch wenn dich der Meinhard aus Aachen hinter die Stadtmauern gebracht hat. Hier reicht es nicht einmal für uns, und geteilt wird nicht!“
Petronius hatte den Fuhrmann erst kurz zuvor verlassen. Er war nach einem Händedruck vom Bock gesprungen und in die Gassen Den Boschs eingetaucht. Trotz der späten Stunde pulste das Leben in den Schluchten zwischen den Häusern: Kaufleute, Händler, Bettler, Fuhrwerker, Damen der besseren Gesellschaft und Huren, Mädchen, die ihre Kleider drehten, Windbeutel, die ihnen nachgafften. Petronius hatte sich sofort wohlgefühlt in dieser lichten Atmosphäre voller Pracht und Reichtum, voller friedfertiger Heiterkeit. Überall verspürte er die Offenheit des brabantischen Wesens, das ein fortdauerndes Lächeln auf die Lippen der Frauen schickte und den Männern einen geraden Blick bescherte. Mehrmals hatte er tief durchgeatmet auf den Marktplätzen der Stadt. Selbst die Luft trug den Geruch einer paradiesischen Freiheit.
Bis zur Kathedrale hatte er sich vorgearbeitet. Mächtig, schwer und hell hockte sie inmitten der Stadt. Dabei fehlten das Mittelschiff und die Bedachung. Die Säulen ragten unvollendet wie ein lückenhaftes Gebiss in den Himmel. Niemand hatte ihm bis dahin Auskünfte verweigert, bis er hinter sich diese knarrende Stimme vernommen hatte.
„Aber ...“, wollte er sich verteidigen, wurde jedoch rüde unterbrochen.
Aus den Augenwinkeln konnte er sechs oder sieben weitere Gesellen beobachten, alle in Lumpen wie der Kerl vor ihm, die rings einen Kreis um ihn schlossen.
„Verschwinde, Landfahrer“, zischte ihn der Bettler an, „bevor ich dir zeigen muss, wie wir Stadtrecht schützen.“
In diesem Augenblick schlug ihm der Duft von Weihrauch entgegen. Eine Prozession aus Dominikanern bog am Kopf der Gasse ein und bahnte sich mit Handglocken und Gesang einen Weg durch die Menge; hinter ihnen drein holperte ein Wagen den unbefestigten Weg entlang.
Überall spürte er plötzlich eine zurückhaltende, bedrückende Atmosphäre sich ausbreiten. Das Lächeln der Bürger verschwand von den Lippen. Die Menschen wandten sich ab, wechselten die Straßenseite, schlüpften in Nebengassen oder schlugen die Augen nieder.
Der Kreis um Petronius wurde in zwei Teile geteilt. Bis ganz an die Hausmauer mussten sie zurückweichen. Der Kerl in Lumpen wurde eng an Petronius gedrängt. Stille breitete sich aus, bis nur noch die Räder im schlammigen Kies der Straße mahlten und die Ketten an den Weihrauchfässern rhythmisch klingelten.
„Verzeiht, aber ich glaube, Ihr täuscht Euch in mir. Ich bin nicht ...“, flüsterte der Maler. Doch beim Anblick des Wagens hielt er inne. Oben auf den Brettern stand, an den Handgelenken festgebunden, eine junge Frau. Ihr Haar baumelte in strähnigen Zöpfen vom Kopf. Sie trug nur ein Untergewand, einen Fetzen, der nichts mehr verbarg. Überall sah man zerrissene Haut, offene Wunden, Verbrennungen, die eiterten oder mit Blut schwarz verkrustet waren. Ihre blutunterlaufenen Augen, die grünlich und blau schimmernden Blutergüsse an Armen und Beinen, die unnatürlich abstehenden Finger verrieten das Leiden der Folter. Ihr Gesicht schien nicht entstellt worden zu sein. Es strahlte eine beängstigende Ruhe und Zuversicht aus.
„Die Nummer vier heute. Sie sind unersättlich. Die Tochter des hiesigen Baders. Sie soll der Bruderschaft angehören, den Adamiten, und teuflische Unzucht mit ihnen getrieben haben. Aber das sind Gerüchte.“
Auf seinen Bettelstab gelehnt, kommentierte der Kerl den makabren Zug. Die Gesichter der Mönche blickten leer.
„Wer sind die Adamiten?“, murmelte Petronius, ohne die Frau aus den Augen zu lassen.
Der Bettler lachte unhörbar auf.
„Spinner im Namen des Herrn Jesu, sag ich dir. Oder Heilige. Oder Ketzer. Wer weiß das schon so genau? Jedenfalls fürchten die Päpstlichen sie wie die Pest, schlimmer vielleicht. Und rotten sie deshalb aus. Es ist außerdem einfach zu sagen, du bist Adamit, deshalb gehörst du auf den Scheiterhaufen. Wer kann schon das Gegenteil beweisen? Schon gar unter der Folter.“
Schwer zog der Bettler die Nase hoch und spuckte einem der Mönche, die vorübergingen, vor die Füße.
„Sie sollen Orgien feiern und dabei die Messe lesen. Ketzerisch, nicht. Aber leider hat mich noch nie jemand dazu eingeladen.“
Petronius riss sich von dem Anblick los und fasste den Bettler vor sich ins Auge. Zum Geruch von Weihrauch und verbranntem Fleisch gesellte sich der ranzige Gestank von Körperfett und Stallübernachtungen.
„Hört mir zu. Ich bin nicht in die Stadt gekommen um zu betteln. Ich suche das Zunfthaus der Maler und das Wohnhaus des Meisters Hieronymus.“
„Wie könnt Ihr in Anbetracht dieses Gesichts nur an Eure Haut denken, die es zu retten gilt?“
„Mit der Haut der Jungfrau dort auf dem Karren ist mir jedenfalls nicht mehr gedient. Ich benötige meine eigene. Sie passt mir besser!“
Die gesamte Straße starrte hinter dem Karren und den Weihrauch schwingenden Mönchen her, die in Richtung Stadttor verschwanden. Gesang und Rumpeln wurden schwächer.
„Noch einmal“, betonte der Maler und heitl jetzt den Arm des Bettlers fest. „Ich bin ein ehrbarer Maler auf der Suche nach einer Beschäftigung, und werde Euch nicht ins Handwerk pfuschen. Wenn Ihr mir ein Zimmer für diese Nacht zeigen könntet, wäre ich Euch dankbar.“
Dann ließ der Maler los, und der Bettler rieb sich den Arm.
Ein Wink mit dem Finger und die Gesichter der Umstehenden und auch das des Mannes vor ihm entspannten sich sichtlich.
„Das ändert die Lage. Verzeiht meine Aufdringlichkeit.“
„Nun“, gab Petronius zurück, „Ihr habt Euch Eurer Aufgabe entledigt. Eine Warnung an jeden Fremden, der die Stadt betritt, kann ich Euch nicht verdenken.“
„Ihr habt etwas gut, Fremder. Wenn Ihr die Straße hinaufgeht, zurück zum Stadttor, auf der rechten Seite. Das Gasthaus „Zum Adler“ steht Euch offen. Sagt, Ihr kommt vom Langen Zuider. Gehabt Euch!“
Als würde ihn der Boden verschlucken, tauchte der Bettler in der Menge unter. Petronius blieb allein. Als er hochsah, glaubte er noch am Ende der Gasse die Kutte eines Dominikaners in die Lücke zwischen zwei Häuser fliehen zu sehen.
VIII
Die ersten Laternen wurden angezündet. Petronius schlenderte zum Marktplatz, der dreieckig inmitten der Stadt lag. Neugierig umrundete der Maler den Platz, der sich langsam leerte, besah sich das Stadthuis, das von Macht und bestehendem Reichtum zeugte, schlenderte an den Buden der Kaufleute vorüber, von denen manche noch ihre Waren feilboten. Es roch nach Fisch und Brot, Gemüse, Käse und frischem Obst. Er tauchte ein in diese Welt der Wohlgerüche und der Betriebsamkeit und schlenderte dann wieder die Gasse hoch, um die Spelunke zu finden, die ihm der Bettler angewiesen hatte. Er folgte dem Klang der Musik. Harfenklänge wehten durch die Gasse und vermischten sich mit dem schmatzenden Wühlen der Stiefel im Morast. Dann stand der Maler vor einem Fachwerkbau mit schwarzen Balken und schwarzer Tür. Die Fenster wurden durch Läden verriegelt. Als er die Tür öffnete, trat ihm ein Hüne von Mann entgegen, der sich im niedrigen Durchgang zum Schankraum bücken musste.
„Wir haben geschlossen!“
Petronius hob erstaunt die Augenbrauen.
„Und die Musik hinter der Tür ist das Geflüster von Geistern?“
Die Miene des Riesen verfinsterte sich.
„Ich höre keine Musik.“
„Dann müssen meine Ohren klingen“, lachte Petronius etwas beklommen. Auf einen solch rüden Empfang war er nicht vorbereitet. Hatte der Bettler nicht gesagt, das Gasthaus stünde ihm offen? Hatte er ihn damit an der Nase herumführen wollen?
„Man sagte mir, ich fände hier eine Unterkunft für die Nacht.“
„Wer dieses Haus verlässt, ist entweder betrunken oder tot.“
Petronius wollte sich bereits umdrehen und wieder auf die Gasse hinaus, als ihn eine Pranke zurückhielt, die sich in seine Schulter grub.
„Sagte ich nicht tot oder betrunken?“
Mit einem Ruck drehte ihn der lange Kerl zu sich um. Petronius holte Luft.
„Ich hatte das nicht auf meine Person bezogen. Schließlich habe ich das Haus noch nicht ...“ Petronius hörte den Kerl knurren und die Hand heben. Schnell fügte er hinzu: „Außerdem schickt mich der Lange Zuider!“
Das Gesicht des langen Kerls hellte sich auf.
„Das ist etwas anderes. Freunde sind willkommen!“, brummte er schwerfällig und trat beiseite.
Freudig überrascht trat Petronius durch die niedre Tür, die der Hüne ihm aufhielt. Bierdunst stieg ihm in die Nase, ranziges Fett und beißender Männerschweiß. An schweren Holzbänken um speckige Tische herum saßen ein paar Dutzend Männer und einige wenige Frauen. Manche spielten Kanöffel, andere würfelten lautstark um die Wette. Krüge standen in hellen Lachen, Brot lag in Körben daneben. Inmitten des Raums hatte ein Harfner Platz genommen, an dessen Lippen die Menge hing. Seine schmalen Finger glitten spielerisch über die Saiten, schienen sie kaum zu berühren, und doch zupfte er mit jeder Bewegung einen Ton aus dem Instrument. Mit einer rauchigen Stimme sang er Verse, zu denen er klangvolle, wohlmeinende Akkorde suchte. Jede Zeile, die der Sänger vortrug, wurde mit lautem Jubel begrüßt:
„... Ein schädlich Ding ist um den Wein,
bei dem kann niemand weise sein,
wer Freud und Lust darin sich sucht.
Ein trunkner Mensch gar niemals ruht
und weiß kein Maß noch Unterscheid
Unkeuschheit kommt aus Trunkenheit!“
Petronius musste lächeln, die Stimmung in der Gaststube steckte an. Hier war man ausgelassen, freute sich an Gesang und Witz und trank dazu. Er suchte nach einem freien Platz und wurde alsbald an einen Tisch gewunken, an dem bereits der Bettler und zwei seiner Kumpane saßen und ausgelassen die Strophen beklatschten und mitgröhlten. Petronius setzte sich dazu, betrachtete den Sänger, der mit gerötetem Gesicht von der Narretei der Sorgen sang:
„... Zu viele Sorgen stehen nicht dafür,
sie machen manchen bleich und dürr:
der ist eyn Narr, der sorgt alltag,
was er doch nicht verändern mag.“
Das Johlen, Kreischen und Humpenschlagen wollten nicht mehr enden, sodass Petronius fürchtete, die eigentlichen Anspielungen nicht verstanden zu haben.
Ein Zwerg stand auf, gehüllt in einen Kaftan, der ihm weit über die Beine hinabhing. Sein Nachbar fasste den Kleinen und hob ihn auf den Tisch. Mit einer Stimme, die klang, als würde er in ein hohles Fass sprechen, grölte er:
„Kümmern wir uns um die wichtigen Dinge des Lebens und lassen die Arbeit denen, die glauben, nicht ohne sie auskommen zu können!“
Der Raum tobte. Im Rhythmus von Harfenklängen schlugen die Bierhumpen auf die Tische.
„Es freut mich, dass Ihr hergefunden habt. Ihr befindet Euch hier“, und der Bettler deutete in die Runde, „in bester Gesellschaft. Wir nennen es unser Paradies. Lauter Wunder unter den Augen des Herrn: sehende Blinde, humpelnde Lahme, beinlose Zweibeinige, Armlose mit zwei Daumen, mit einem Wort ein Sammelsurium an Heiligen und Seligen. Die Kirche hätte Jahrhunderte damit zu tun, alle ihre Geschichten aufzuschreiben und Kirchenfenster daraus zu schmelzen.“
Mit einer Geste, die weit ausholte und den Raum mit einschloss, winkte der Bettler einer der Bedienungen, die sich mit einem gefüllten Humpen näherte und ihn vor Petronius niedersetzte.
„Zum Wohlsein!“, begrüßte sie den Neuankömmling und hielt die Hand auf. „Bezahlt wird gleich, das ist hier so üblich!“