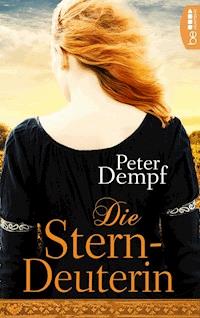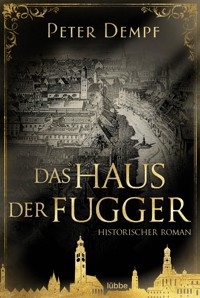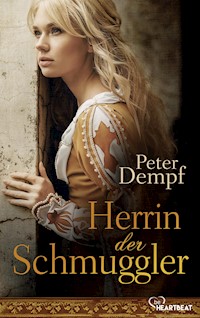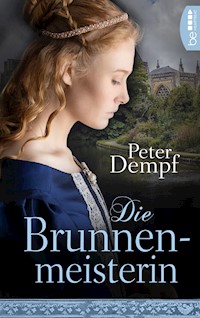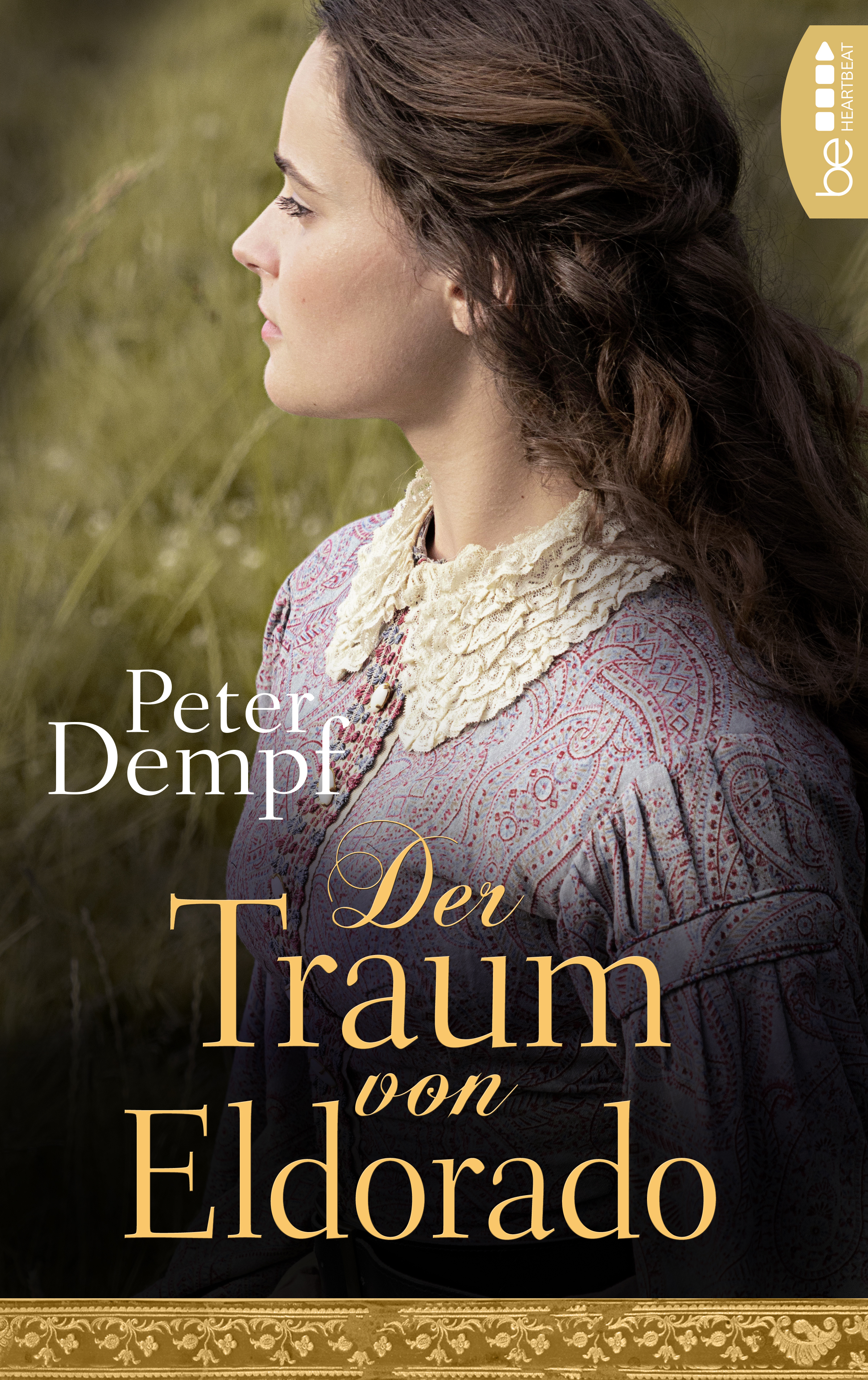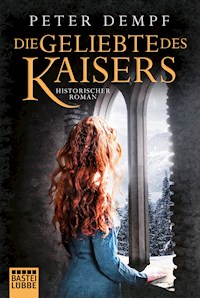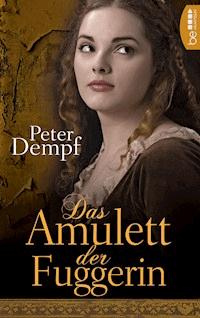6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio, kennt keine Grenzen, er ist durch und durch maßlos. Das einfache Volk liebt ihn für seine Bilder, für die ihm Bauern, Händler und Huren als Modelle dienen. Der Vatikan jedoch möchte den Künstler samt seinen »ketzerischen« Bildern beseitigen – und zwar so schnell wie möglich. Nach dem Tod einer Prostituierten gerät Caravaggio unter Mordverdacht und muss zusammen mit der jungen Malerin Nerina aus Rom fliehen. Stets auf den Fersen ist ihnen dabei ein gewaltiger Gegner aus Caravaggios Vergangenheit, vor dem es kein Entkommen gibt. Caravaggio sieht nur noch ein Mittel, mit dem er sich wehren kann: seine Gemälde …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 827
Ähnliche
Peter Dempf
Das Vermächtnis des Caravaggio
Historischer Roman
„Alles, was dir vor die Hände kommt,es zu tun mit deiner Kraft, das tu.“
Prediger Salomo
„Man muss über diese Welt so schreiben,dass das Herz erstarrt und die Haarezu Berge stehen.“
Boris Pasternak
I
„… so viel wiegt die Gunst des Volkes,das nicht mit den Augen urteilt,sondern mit den Ohren sieht.“Giovanni Baglione, 1625
1.
Leben und Tod waren auf dem Markt allgegenwärtig. Um die kleine Kirche Sant’Angelo in Pescheria, wenige Straßen nördlich der Tiberinsel, wurden kreisrunde Bastmatten die ganze Nacht hindurch mit Fackeln beleuchtet, sodass die darauf ausgelegten Fische und Krebse den Eindruck erweckten, als würden sie noch immer nach Luft schnappen und im Todeskampf zappeln.
Nerina lehnte sich gegen eine Säule und musterte die Menschen, die sich mitten in dieser ungewöhnlich warmen Februarnacht die besten Stücke aus dem Tiberfang suchten. Ihr zur Linken lehnte ein Mann gegen eines der hölzernen Fässer, in denen noch lebenden Tiere schwammen und gierig Luftblasen schluckten. Unverhohlen sah er sie an, doch als er gewahr wurde, dass sie ihn beobachtete, drehte er sich langsam weg, als wolle er dem günstigen Angebot eines der Fischer folgen. Nerina hätte ihn nicht beachtet, wenn ihr Gefühl sie nicht gewarnt hätte. Hatte sie den Mann heute nicht schon einmal vor Micheles Atelier bemerkt? Da sein Gesicht im Fackelschein aber nur unzureichend auszumachen war, konnte sie sich auch irren. An das zerzauste dunkle Haar mit der kreisrunden Glatze am Hinterkopf glaubte sie sich jedoch zu erinnern. Sie schüttelte den Kopf über ihre verqueren Gedanken.
Trotzdem beschloss Nerina, vorsichtig zu sein. Sie schlängelte sich wieder durch die Auslagen, vorbei an den Fischersfrauen, die lautstark ihre Waren anpriesen. Sie mochte diesen Geruch nach Feuchtigkeit und Leben, den Geruch der Fische nach dem langsam fließenden Wasser des Tibers. Sie mochte das Treiben, das mitten in der Nacht auf dem Markt herrschte, als würde dort das Herz der Stadt schlagen, fortwährend, in einem gleichmäßigen, starken Takt und Menschenleiber durch die Straßen und Gassen pumpen. Hier kaufte man den frischesten Fisch Roms, hier holte man sich, was zu Mittag oder zu Abend gegessen wurde. Hier traf sich, wen die Stadt übrig ließ, Huren und Bettler, Freier und Fremde, Nachtschwärmer und Frühaufsteher. Um das offene Feuer der Bratereien sammelte sich das Volk der Nacht, das sich tagsüber vor der Hitze in die dunklen Winkel der Stadt zurückzog, um hier mit einem Schluck Wein die letzte Mahlzeit des Tages oder das erste Frühstück zu sich zu nehmen.
Nerina ließ ihren Blick über das Gewühl schweifen. Quer über den Platz hin und in Richtung Corso und Porto di Ripetta schwankte eine Sänfte, die vermutlich einen Adligen beherbergte, der sich zu so früher Stunde nach Hause tragen ließ. Sie erkannte das herzogliche Wappen der Gonzaga auf den schwarz glänzenden Türverschlägen. Die Vorhänge waren zugezogen. Ein hagerer Begleiter in einer dunklen Livree mit langen schwarzen Haaren lief neben der Sänfte einher und fiel immer wieder in einen kurzen Trab, um Schritt zu halten. Er sprach in einem fort auf den Unbekannten in dem schwarzen Kasten ein. Nerina vermutete, dass es die Aufgabe des Mannes war, den Adligen, vielleicht auch den Kardinal, der sich hinter den Vorhängen verbarg, zu unterhalten. Sie musste schmunzeln. Der fortwährend ins Leere gestikulierende und vor sich hin brabbelnde Kerl wirkte gar zu lächerlich.
Fast hätte Nerina aufgeschrien, als sie plötzlich angesprochen wurde. Der Mann stand so, dass sie sein Gesicht gegen das Fackellicht nicht richtig erkennen konnte. Umrahmt wurde es ohnehin von einem starken Bart.
„Fisch, Signorina Nerina? Frisch aus dem Tiber. Mit Kopf!“
Erleichtert atmete Nerina auf, als sie die Stimme des Fischers Bernardo erkannte.
„Sì, Bernardo! Für zwei Personen. Nicht zu groß, damit der Kopf nicht beten muss!“
Bernardo lachte. Sie spielten auf den Marmortisch in der Nähe an, auf dem alle am Markt gekauften Fische gemessen werden mussten. Ragte der Fisch über die Marmorplatte hinaus, war der Kopf als Steuer an den Marktaufseher abzugeben. Jeder wusste, dass er in die Suppentöpfe des Vatikans wanderte und dem Heiligen Vater serviert wurde.
Sie deutete auf einen der Fische, dessen silbriger Rücken im Schein der Fackeln rötlich glänzte. Mit dem geschickten Hieb seines Hakens holte der Fischer ihn aus dem Wasser, legte ihn auf seine Theke und versetzte ihm einen Schlag auf den Kopf, bis er aufhörte zu zappeln.
„Geht bitte mit Eurem … Mann etwas sanfter um.“ Er grinste anzüglich, als er ihr den Fisch an den Kiemen reichte.
„Ich bin nicht verheiratet, Bernardo“, erwiderte Nerina die Spitze des Fischers, „aber ich bin eine gelehrige Schülerin.“
Nerina hielt ihm ihren Fischhalter aus Schilfgras hin und die Brasse wechselte den Besitzer. „Ist so ein Fisch nicht zu viel für Euch allein?“
Hinter der Säule kam der Fremde hervor und vertrat ihr den Weg. Er lachte dabei leise und in einem eigenartigen Tonfall, blickte ins Bassin und dann Nerina direkt in die Augen. Beinahe hätte sie über die Anrede ihren Fisch fallen lassen. Der Blick verursachte ihr Grauen, denn dort begegnete sie einer Kälte und Leere, die sie sonst nur in den toten Augen der Fische fand. Rasch senkte sie den Blick.
„Was geht Euch mein Fisch an?“
Nerina zitterten die Knie. Sie war sich jetzt sicher. Der Kerl verfolgte sie, und zwar seit sie Micheles Atelier verlassen hatte. Sie erinnerte sich an das Gesicht. Der Gedanke ließ ihren Bauch krampfen. Hitze schoss ihr in die Wangen. Was wollte er von ihr?
„Er reicht aus für zwei, bella donna. Gebt mir doch die Ehre …“
„Untersteht Euch, so mit mir zu reden, Fremder. Versucht Euch an Frauen, die das gewöhnt sind.“
Sie bemerkte, wie sich seine rechte Hand verkrampfte, und entdeckte am Daumen einen Ring. Rasch verbarg er die Hand und blitzte sie an.
„Der Versuch lässt die Gewohnheit entstehen!“
„Wagt es …!“, knurrte Nerina, bereit, mit der Fischtasche zuzuschlagen, wenn er sich ihr nähern sollte. Sie hasste diese gewohnheitsmäßigen Anreden der Freier und warf Bernardo einen bittenden Blick zu. Sofort trat der Fischer zwischen sie und den Fremden.
„Er muss gemessen werden!“, betonte Bernardo und verschränkte die Arme vor der Brust. Nerina stellte fest, dass Bernardo den Fremden um einen guten Kopf überragte. Sie packte ihre Fischtasche fester und ging hinüber zur Marmortheke, an der die Fische nach ihrer Länge geprüft wurden, und an der man auch die Innereien entfernte. Aus den Augenwinkeln heraus konnte sie noch erkennen, dass der Fremde ihr folgen wollte, Bernardo ihm jedoch den Weg vertrat.
Bei Michele gingen viele ungewöhnliche Gestalten ein und aus, aber noch nie war sie einem solchen Mann begegnet. Sie hätte schwören mögen, den Fremden noch nie zuvor gesehen zu haben. Und doch war ihr, als würden sie sich seit Wochen immer wieder begegnen. Die auffällige kreisrunde Glatze am Hinterkopf war ihr schon mehrmals aufgefallen. Er war ihr kein Fremder, das fühlte sie. Nerina versuchte seinen Dialekt einzuordnen, was ihr nicht recht gelang. Sie war sich aber sicher, dass es kein römischer war. So hart betonte hier in der Ewigen Stadt niemand die Wörter.
Warum lief er ihr nach, seit sie aus dem Haus getreten war?
Ein Schauer lief ihr die Arme entlang und kroch ihr bis an den Hals. Die ganze Situation blieb unheimlich, und sie dankte insgeheim dem Himmel, dass heute Bernardo statt seiner Frau den Stand betreute.
Vor der Marmorplatte hatte sich eine Schlange gebildet. Die Wartenden beschwerten sich lautstark über den Gesellen des Marktaufsehers, der jeden Fisch in die Länge strich, um ihn so über die Tafel hinaussehen zu lassen, und dann den Kopf ab der ersten Gräte abschnitt. Die Frau vor ihr zeterte lautstark und suchte Verstärkung, indem sie sich umdrehte und ihren geköpften Fisch herzeigte. Nerina selbst hatte keine Furcht vor der Messung, denn ihre Brasse war für solche Betrügerei entschieden zu klein.
Als sie an die Reihe kam, schlitzte der Geselle des Aufsehers mit einem scharfen Messer das Tier auf und entfernte die Innereien mit einer raschen Bewegung. Gedankenverloren folgte sie seinen Handgriffen und bemerkte erst spät, dass er ihr den Fisch bereits hinhielt und sie mit breitem Grinsen und einem begehrlichen Blick musterte. Rasch packte sie den Fisch in ihren Strohkorb. Mit schnellen Schritten eilte sie über den Platz, ohne sich noch einmal umzusehen, aber immer mit dem unbestimmten Gefühl, beobachtet zu werden. Jetzt verursachte ihr der Lärm Kopfschmerzen. Sie presste die Hände gegen die Schläfen, der Fischkorb schlug ihr gegen die Brust. Erst als sie den Fischmarkt in Richtung Marsfeld verließ, hielt sie inne, um zu verschnaufen.
Unwillkürlich suchte sie in der Menge. Sie wollte sich eben abwenden und zu Michele zurückgehen, als sie den Fremden entdeckte. Bei einer Dirne hatte er sich untergehakt, bei Lena, die oft für Michele Modell stand. Soeben stieß er ein weiteres Mädchen zurück, das sich an seinen anderen Arm gehängt hatte, sodass sie stolperte und in den Staub fiel. Lena lachte laut und zog den Fremden hinunter zum Tiberufer. Also hatte er doch nur eine Frau gesucht. Erleichtert sah sie den beiden nach, wie sie von der Dunkelheit verschluckt wurden. Das Mädchen hinter ihnen rappelte sich vom Boden auf, säuberte ihr Leinenkleid und schimpfte ihnen mit erhobener Faust nach.
Nerina nahm ihren Fischkorb fester und ging in Richtung Atelier davon.
2.
„Dieser Gestank, diese ewige Dunkelheit, diese Enge. Sogar mit seinem Sterben will uns dieser Aldobrandini quälen. Als hätte er nicht genug Unglück über den Stuhl Petri gebracht, als er sich dem Einfluss Spaniens beugte. Und wie sie um ihn herumschleichen, die Speichellecker von Kardinälen, dass einem übel wird. Dabei sieht und hört er nichts mehr. Mit offenen Augen stiert er an die Decke, röchelt nur noch und verbreitet einen pestilenzialischen Gestank.“
Scipione Borghese schwieg und beobachtete den Oheim, der seinen purpurnen Kardinalshut auf einen Ledersessel warf und jetzt barhäuptig im Zimmer auf und ab lief. Sein schwerer Körper schwankte dabei wie der einer gemästeten Gans. Schweiß rann ihm über die Tonsur den Nacken hinab, den er mit einem Tuch abwischte. Die Kinnfalte schlenkerte hin und her, als wäre sie ein Pendel, angetrieben durch die fortwährende Bewegung der Beine, und die Augen, die durch die aufgeschwemmten Backen zugedrückt wurden, wirkten, als würde er ständig zwinkern. All das gab ihm den Anschein eines etwas unbeholfenen Menschen, dessen Gutmütigkeit man durchaus ausnützen konnte. Scipione Borghese wusste, dass es anders war.
„Niemand kann sagen, ob er nun wirklich stirbt oder allen wieder eine Komödie vorspielt, bei der nur er selbst richtig lachen kann. Er ist eine Qual.“
„Ihr sprecht vom Papst, Oheim!“
Camillo Borghese fuhr herum.
„Dass ich nicht lache. Von Clemens dem Achten, dem Erfüllungsgehilfen des spanischen Königs, vom Arschkriecher der Habsburger spreche ich, der sich nicht zu schade war, sich mit dem französischen König zu verbünden, von diesem Niemand ohne Rückgrat und eigene Meinung, der die Christenheit an der Nase herumführt und die Gläubigen am liebsten alle in die Hölle schicken möchte.“
„Ihr versündigt Euch!“
Kardinal Camillo Borghese baute sich vor seinem Neffen auf und dieser konnte nicht anders, als die stattliche Gestalt in ihrer äußersten Erregung zu bewundern. Das Alter machte Camillo Borghese noch herrischer, als er schon war. Nur die etwas aufgedunsenen Züge und die hochrote, cholerische Gesichtsfarbe, die jetzt seine Blässe überfärbte, standen im Widerspruch dazu. Das Theater um den auf den Tod kranken Papst zehrte sichtlich an seinen Nerven.
„Ich habe Euch nicht nach Rom holen lassen, Scipione, um mir geistliche Plattheiten anhören zu müssen. Es ist die Wahrheit! Und ich werde etwas dagegen tun. Ich muss dafür Sorge tragen, dass kein Parteigänger der Spanier mehr den Heiligen Stuhl besteigt! Es muss ein Ende haben mit all den Sfondratos, Medicis, Aldobrandinis und Chigis.“
Scipione beobachtete seinen Oheim, der ans Fenster trat und einen Flügel aufriss. Kühle Luft strömte vom Tiber herüber. Er stellte sich in den Luftstrom und schloss die Augen. Mit leicht vibrierenden Nasenflügeln sog er den Geruch des Wassers ein.
„Ihr holt Euch den Tod, Oheim!“, meinte Scipione leise. Er wusste, dass man Camillo Borghese nicht ungestraft auf seinen ungesunden Lebenswandel ansprechen durfte. Es reizte ihn trotzdem.
„Was habt Ihr gesagt?“
Scipione Borghese räusperte sich. Sein Satz, der ihm einfach so herausgerutscht war, tat ihm jetzt leid. Leise wiederholte er:
„Ihr holt Euch den Tod, Oheim!“
Scipione erwartete eines jener Gewitter, die zum cholerischen Wesen seines Oheims gehörten. Aber Camillo Borghese drehte sich auf dem Absatz um und Scipione konnte sehen, dass sein Oheim übers ganze Gesicht strahlte und seine Augen über den Backenwülsten glänzten. Überrascht hob er eine Augenbraue.
„Ich wusste doch, dass ich eine Hilfe in Euch finden würde. Natürlich. Frische Luft wird ihn umbringen. Sein Lebtag hat er keinen Sack voll frischer Luft geatmet, diese spanische Hure. Ich werde die Fenster aufreißen, dass es die Purpurröcke hinausweht, Scipione.“
Zu Scipiones Erstaunen schnippte Camillo Borghese mit den Fingern und setzte sich auf den Stuhl, auf den er eben seinen Kardinalshut gelegt hatte.
„Damit wäre der erste Teil der Strategie abgehandelt. Jetzt lässt sich darauf aufbauen.“
Camillo Borghese streckte sich aus und blickte wie abwesend in sich hinein.
„Was meint Ihr mit Strategie, Oheim?“
„Scipione, mein Neffe, Ihr wisst, dass die spanische Fraktion die Kirche auf einen Weg führt, der gepflastert ist mit Tod und Verderben. Die Inquisition, die Herrschaft der Jesuiten, alles zielt auf Gewalt und Unterwerfung ab. Selbst die halbherzige Öffnung gegenüber Frankreich hat dem Vatikan kaum etwas genützt. Wir müssen etwas daran ändern – und der kritische Zustand des Papstes wäre die Gelegenheit. Ein Italiener muss auf den Stuhl Petri. Das nächste Konklave muss eine politische Wende bringen.“
Innerlich schmunzelte Scipione, weil sich sein Oheim so zurückhaltend zeigte. Er selbst ahnte, worauf die Argumentation hinauslaufen würde – in der italienischen Fraktion gärte und brodelte es und die Kardinäle fanden immer neue Parteigänger.
„Und an wen denkt Ihr, Oheim? Wer hat so viel Einfluss, den der spanischen Fraktion zu brechen? Wer kann das Konklave umstimmen? Wer kann die Stimmgelder an die Vertreter der Italiener zahlen?“
Camillo Borghese sah mit einem Blick auf Scipione, der diesem seltsam verschleiert anmutete, als säße sein Oheim bereits im weißen Gewand auf dem Stuhl Petri und segne von dort herab die Christenheit.
„An wen denkt Ihr, Scipione?“, lautete die Gegenfrage.
„Ich kann mir nur einen denken, der all die Eigenschaften in sich vereinigte und über die finanziellen Mittel verfügte.“
„Und? Sprecht! Wer könnte das sein?“
Scipione Borghese lächelte in sich hinein. Sein Oheim hielt sich an den Lehnen des Sessels fest, als müsse er eine Schwäche überwinden. Doch so schwach, wie sein Oheim tat, war er keineswegs. Zielstrebig und klar war seine Karriere verlaufen. Er galt als unbestechlich und tief gläubig, mit einer für die Verhältnisse tadellosen und würdigen Lebensführung, die nur wenige Schwachstellen aufwies. Zudem fühlte er sich seiner Familie gegenüber verpflichtet, vielleicht etwas stärker, als es den anderen Kardinälen lieb war.
„Ihr, Oheim, und niemand sonst. Wenn Kardinal Baronius Euch unterstützt.“
Kurze Zeit blieb es still zwischen ihnen. Scipione wollte nicht als Erster weitersprechen und wartete auf eine Reaktion seines Oheims. Die Erwähnung des mächtigsten Kirchenfürsten in Rom hatte seinen Oheim sichtlich getroffen. Plötzlich stand Camillo Borghese auf.
„Er wird es tun. Baronius ist ein gelehrter Mann. Er hat keinen Sinn für die Tiara. Und dann gilt es, diese Ketzer der spanischen Fraktion an den Pranger zu stellen.“
„Das wird schwierig werden, Oheim. Wie wollt Ihr das anstellen?“
„Dafür habe ich Euch kommen lassen. Es soll nicht Euer Schaden sein, wenn die Wahl auf mich fällt.“
„Warum gerade mich?“
„Oh, Ihr seid jung, intelligent – und ein Kunstfreund.“
Scipione Borghese musste lachen. Sein Oheim verstand sich aufs Pläneschmieden. Insgeheim hatte er geahnt, dass ein Hintergedanke dabei war, ihn nach Rom zu beordern, jetzt, um diese Zeit der spannungsvollen Erwartung des Hinscheidens eines der wirklich großen Päpste der Zeit.
„Wollt Ihr in der Stadt Ketzerstatuen aufstellen lassen, die alle Mitglieder der spanischen Fraktion bloßstellen? Oder wollt Ihr von Schauspielern spanische Autodafés veranstalten lassen, bei denen Kardinäle der spanischen Fraktion in Rauch aufgehen?“
Wieder wanderte Camillo Borghese durch den Raum, während Scipione neugierig eines der Deckengemälde betrachtete. Zeus zürnte dort einem der Titanen und schleuderte Blitze gegen die scheinbar Übermächtigen, die er schließlich doch besiegte.
Er erschrak, als sein Oheim unmittelbar vor ihm auftauchte und ihn von unten ansah. Sein Bauch berührte ihn leicht. Sein Oheim fasste ihn, Scipione Borghese, fest mit beiden Händen an den Armen.
„Eine gute Idee, wenn auch nicht durchführbar. Nein, Scipione, es muss so sein, dass das Volk aufbegehrt. Dass Unruhe entsteht, bei den Bürgern und Kardinälen. Dass man murrt und knurrt gegen den spanischen Popanz. Das lässt sich am leichtesten dort verwirklichen …“
„… wo sie am empfindlichsten zu treffen sind: bei ihrem Geldbeutel.“
„Richtig.“
„Aber ich verstehe noch nicht, wie Ihr das anstellen wollt. Es muss so heimlich geschehen, dass niemand auch nur den Hauch einer Ahnung besitzt, und es muss so spektakulär sein, dass es allen zu Gehör kommt.“
Camillo Borghese ließ los und ging zurück in den Raum.
„Eben das bereitet mir Kopfzerbrechen, Scipione. Ich will ein spektakuläres Ereignis, ohne dass mein Name dabei ins Spiel kommt. Niemand wird Euch verdächtigen, wenn Ihr als Sammler oder Auftraggeber auftretet.“
„Keine leichte Aufgabe!“
„Denkt darüber nach, Scipione. Ich muss zurück, die spanische Hure Ippolito Aldobrandini lässt die Zeiten notieren, welche die Kardinäle an seinem Bett gewacht haben. Ich bin schon zu lange weg. Dabei sollte man glauben, dass dieser wandelnde Totenschädel ohnehin nichts mehr wahrnimmt.“
Scipione half seinem Oheim noch, den Hut über die Tonsur zu stülpen, dann sah er ihm nach, wie er durch die übermannshohen Türflügel verschwand, als würde ihn der Wind hinauswehen.
3.
„Ich habe für Euer Anliegen Verständnis, aber ich kann augenblicklich nichts für Euch tun, werter Pater Leonardus.“ Scipione Borghese sah seinen Oheim noch vor sich, wie er zur Decke emporblickte, als würde ihm dieser Satz von dort oben eingeflüstert. „Leider! Die Umstände … ich hoffe, Ihr versteht … die Krankheit Clemens’ … das Kardinalskollegium … alle sind angespannt … niemand will voreilige Entscheidungen treffen. Vielleicht … wenn die Frage der Nachfolge entschieden ist … wenn das Konklave getagt hat …“
Bereits von Weitem hörte er den Pater kommen, langsam, enttäuscht. Er kannte die Art Mensch, die Pater Leonardus verkörperte. Sie war intelligent, skrupellos und machthungrig. Sie buckelte auf dem Land und fütterte besserwisserische und ungläubige Bauern mit einem Glauben, der mehr einem Karnevalstreiben als einer Andacht glich. Alle warteten sie auf den Zeitpunkt, an dem sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen konnten. Doch seinen Oheim plagten im Moment andere Sorgen, wie er durch die kleine Augenöffnung in der Tapetentür erspäht hatte.
Scipione Borghese hatte sich von seinem Lauschposten zurückgezogen und war auf den Gang hinausgetreten, auf dem er dem Pater unweigerlich begegnen musste. Dort wischte er sich jetzt über die Stirn und überlegte, während er auf den schleichenden Schritt des Paters lauschte. Gerade dieser Pater Leonardus erschien ihm der geeignete Mann für seine Pläne. Wenn der todkranke Heilige Vater starb und das Konklave einberufen wurde, mussten die Stimmen gekauft sein. Das Einzige, was diesen alten Fuchs Camillo Borghese, der seine Gerissenheit hinter einer frommen Larve verbarg, über die Bühne der Welt schleifte, war die Aussicht auf die Mitra des Heiligen Vaters. Dazu bedurfte es Vorarbeiten.
Vielleicht gelang ihm selbst so der Schritt zur Kardinalswürde.
Bereits von Weitem hörte er den Pater kommen.
„Oh, unser Prete Rosso!“, rief er ihm zu.
Offenbar überrascht blickte Pater Leonardus auf. „Wenn Ihr auf meine Haarpracht anspielt. Eine Laune der Natur, Gottes Natur.“
„Nehmt es mir nicht übel, aber die Dienerschaft im Haus hat Euch diesen Spitznamen sofort gegeben, als sie Euch das erste Mal sah. Ihr kommt von meinem Oheim?“
Der Hinweis hatte gefruchtet. Amüsiert beobachtete Scipione, wie Pater Leonardus sich ausrechnete, mit wem er sprach und ob der Neffe des Kardinals Camillo Borghese vor ihm stand. Vermutlich entdeckte er jetzt Gemeinsamkeiten, die Form der Ohren, die Nase, die Haltung der Hände.
Bevor Pater Leonardus seine Musterung abschließen und sich ein vorläufiges Urteil bilden konnte, hakte sich Scipione Borghese bei ihm unter. Sie stiegen eine Treppenwendel hinunter und traten auf den Innenhof hinaus. Ein Kolonnadenhof mit doppelten Säulen zu ebener Erde und der umlaufenden Galerie gab der Architektur einen leichten, aber strengen Charakter.
„Seid Ihr einen Schritt weitergekommen, Pater Leonardus? Habt Ihr die von Euch herbeigesehnte Pfründe erhalten?“
Jeder in Rom wusste, dass die Borghese eine Familie mit starkem Zusammenhalt und – trotz aller familiären Streitigkeiten – großem Gemeinsinn waren.
„Nein, leider nicht. Die Krankheit des Papstes macht die Kardinäle nervös. Sie scheuen vor jeder Entscheidung zurück.“
Scipione Borghese lachte, sodass es im Innenhof widerhallte und er im zweiten Stock kurz einen Kopf über der Brüstung erscheinen sah, der nach unten spähte. Der Kopf verschwand sofort wieder. Offensichtlich hatte sich der Pater für die Wahrheit entschieden. Möglicherweise sah er darin nur eine weitere Prüfung seiner Treue gegenüber der Familie Borghese. Ganz so eng knüpften die Bande der Familie nicht, vor allem dann nicht, wenn eigene Interessen eine Rolle spielten. Aber das musste der Pater ja nicht erfahren.
„Mein Oheim scheut im Augenblick alles, was ihn in ein schlechtes Licht rückt. Er kennt keine Freunde mehr, keine Verwandten, keine Günstlinge, nur noch Christen im Herrn.“ Plötzlich wurde Scipione Borghese wieder ernst. Er blieb kurz stehen und sah Pater Leonardus von der Seite her an.
„Er ist sich zu sicher.“
„Aber er wäre der rechte Mann.“
Scipione Borghese verabscheute diese Schmeicheleien, die dadurch zustande kamen, dass Pater Leonardus etwas wie Morgenluft schnupperte. Sicherlich rechnete dieser sich aus, dass Kardinal Camillo Borghese ein Mann war, der bislang jeden seiner Günstlinge versorgt hatte. Wenn er seinen Neffen mochte, dann hieß der nächste Kardinal Borghese möglicherweise Scipione.
Scipione Borghese hielt ihn immer noch untergehakt und drängte ihn langsam in eine Ecke des Kolonnadenhofes, die von der Galerie aus nicht eingesehen werden konnte. Dort trat er vor ihn und senkte die Stimme.
„Ihr seid ein Schmeichler, Pater Leonardus. Aber glaubt nicht, ich würde es nicht durchschauen. Ich weiß, was Ihr wollt, und ich weiß, warum Ihr es nicht bekommt.“
Scipione ließ seine Gesichtszüge von einem Augenblick zum anderen versteinern. Er veränderte seine Stimme. Alles Überhöfliche wich daraus und wurde durch einen Anspruch von Macht ersetzt. Seine Sätze schnitten wie Stahl.
„Aber, ich weiß nicht, was Ihr wollt!“, versuchte sich Pater Leonardus zu rechtfertigen, ein Blick des Borghese gebot ihm jedoch Schweigen.
„Wir werden einen Handel abschließen, Pater Leonardus. Ihr werdet davon profitieren – und ich auch.“
„Einen Handel? Welcher Art?“
„Liebt Ihr Bilder, Pater? Moderne Bilder?“
Pater Leonardus zuckte mit den Schultern.
„Ich vergöttere sie, mein Prete Rosso. Sie sind ein Geschenk des Herrn an seine unwürdigen Geschöpfe. Ein Stück des Paradieses, was sage ich, des Himmels! Vielleicht das einzige Geschenk, das nicht mit dem Bösen behaftet ist, das uns seit der Vertreibung aus dem Paradies anhaftet wie Leim.“
„Ich liebe sie auch.“ Die Stimme des Paters krächzte. „Die Gemälde in den Kirchen, die Darstellung der Heiligen und die des Lebensweges unseres Herrn“, beeilte sich Pater Leonardus zu sagen.
Insgeheim machte sich Scipione Borghese über Pater Leonardus lustig. Eine Rolle wollte er ihm zuweisen, die der Pater nicht durchschauen würde. Sollte er denken, was er wollte. Sollte er sich fragen, was sich wirklich hinter seinem Narrentum den Bildern gegenüber verbarg, das sich in seinem Gesicht spiegelte. Er verdrehte die Augen und senkte die Stimme ganz zu einem Flüstern herab.
„Blinder Tölpel“, murmelte der Borghese.
„Ich verstehe Euch nicht, Scipione Borghese!“
„Ihr werdet mich verstehen, Pater Leonardus. Bald werdet Ihr mich verstehen. Folgt mir.“
4.
Enrico hasste die Klingel seit dem Augenblick, als er sie zum ersten Mal gehört hatte. Er hasste den Umstand, dass er als Sekretär bei einem Adligen arbeitete, der bereits in seinen jungen Jahren offensichtlich unter Schlafmangel litt. Und er hasste die Tatsache, dass er wie ein Leibeigener diesem Gecken zur Verfügung zu stehen hatte, Tag und Nacht. Aber er liebte Rom – und deshalb war er seinem Schützling Ferdinando Gonzaga dorthin gefolgt, obwohl ihn dessen Vater seines scharfen Verstandes wegen nicht hatte gehen lassen wollen.
Wieder wurde am Klingelzug gerissen und Enrico sprang aus dem Bett, in das er sich noch angekleidet gelegt hatte. Als er den Vorhang zurückschlug, sah er, dass sich bereits graue Schleier am Horizont zeigten, aber die Sonne sich noch hinter dem Esquilin versteckt hielt. Morgen wie diesen kannte er zur Genüge aus der Zeit als Klosterschüler des Benediktinerkonvents in Mantua, wenn sie zur Matutin geweckt wurden und in die Kirche zum Gebet strömten, Klosterbrüder wie Schüler, müde, erschöpft und frierend.
Paolo, der Leibdiener Ferdinando Gonzagas klopfte und öffnete die Tür.
„Er ist eben nach Hause gekommen und wünscht Eure Begleitung!“, flüsterte er.
„Ich eile!“, sagte Enrico und rätselte darüber, wohin sein junger Herr zu dieser frühen Morgenstunde wollte, ohne zuvor geschlafen zu haben.
Er trat ans Fenster, um Luft zu holen. Die ersten Februartage waren außerordentlich mild gewesen, selbst die Nächte brachten die Kälte nicht zurück. Rasch fuhr sich Enrico durch die Haare und holte sich Tintenfass, Messer, Federn und Papier, verstaute alles in einem Köfferchen und eilte in den ersten Stock hinunter. Dort erwartete ihn Ferdinando Gonzaga mit tiefen Ringen unter den Augen, aber einem wachen Blick.
„Der Kardinal erwartet uns!“
„Mitten in der Nacht, Exzellenz?“
„Niemand in Rom schläft, während der Papst im Sterben liegt, Enrico.“
Durch ein Räuspern unterdrückte Enrico eine Bemerkung, die ihm beinahe unbedacht über die Lippen gerutscht wäre. Natürlich dachten die Würdenträger der katholischen Kirche im Augenblick an nichts anderes als an ihre Pfründen und Einnahmen und an den nächsten Papst, den Nachfolger auf dem Stuhl Petri, der im Konklave aus ihrer Mitte gewählt werden würde. Da musste man vorbauen, da musste man schmieren, da musste man die Lästermäuler stopfen.
Und für die Jungen, die Versorgungsfälle, wie er selbst insgeheim die übrig gebliebenen adeligen Söhne nannte, die vom väterlichen Erbe ausgeschlossen waren, bedeutete es eine Chance. Jetzt musste man an die Türen klopfen, Unterstützung zusagen, Geld spenden. Trotzdem wusste er nicht recht, für welche Mission sein Herr in Rom weilte. Für einen Kardinalshut war er mit seinen siebzehn Jahren zu jung und für eine politische Aufgabe zu unerfahren. Aber er würde es herausfinden, davon war Enrico überzeugt. Nur dass der Vater bereits enge Kontakte zu Kardinal Camillo Borghese geknüpft hatte, wusste er. Aber dieser Kardinal gehörte der falschen Fraktion an.
Enrico begleitete Ferdinando Gonzaga zur Sänfte hinunter, die in der Toreinfahrt wartete. Er ließ seinen Herrn einsteigen und schloss die Tür hinter ihm. Enrico selbst lief nebenher.
„Erzählt mir etwas über den Kardinal, Enrico. Was ist er für ein Mensch? Wie muss man ihn ködern?“
Enricos Stärke war sein Gedächtnis. Vor gut anderthalb Jahrzehnten wurde Padre Odilo, der Dorfgeistliche seines Heimatortes, deshalb auf ihn aufmerksam. Damals hatte er am Mittagstisch seiner Eltern, die den Padre zum Essen geladen hatten, den Geistlichen korrigiert und als Beweis Teile seiner Predigt auswendig wiederholt. Die Verwunderung bei Padre Odilo war groß gewesen. Von da an saß er, sehr zum Leidwesen seiner Eltern, häufiger bei ihnen am Tisch und unterrichtete ihn in Latein und Bibelkunde. Ferdinando Gonzagas Räuspern weckte ihn aus den Erinnerungen und gemahnte ihn an seine Aufgabe.
„Herr, ich weiß vermutlich weniger als Ihr. Kardinal Camillo Borghese ist nicht gerade einer der aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt, sofern uns Papst Clemens, Gott sei seiner Seele gnädig, verlassen muss. Es gibt aussichtsreichere Kandidaten wie die Kardinäle Baronius und Bellarmin, beide Vertreter der italienischen Fraktion, vor allem der Gelehrte Baronius, der allgemein großen Respekt im Kollegium genießt, oder aber de’ Medici, ein Vertreter der Spanier, oder gar Kardinal Joyeuse, der Führer der französischen Partei. Allesamt sicherere Kandidaten als der Borghese. Er ist dem Essen zugetan und fördert vor allem die, die ihm Gutes getan haben, ohne sie zu sehr zu unterstützen. Vorbehaltlos arbeitet er allerdings für die Familie Borghese. Er gilt als der Vergangenheit zugewandt, ganz im Gegensatz zu den übrigen Familienmitgliedern, wie beispielsweise Scipione. Die freien Städte bauen auf ihn, aber die spanische Fraktion ist noch stark, zu stark.“
Die Träger liefen los und Enrico musste sich beeilen, wenn er Schritt halten wollte. Er seufzte. Hinter den Chancen seines Lebens herzurennen, daran gewöhnte er sich nie. Aber er war nur der Sohn eines armen Buchbinders, und als solcher gewiss nicht dazu ausersehen, sich von Trägern durch den anbrechenden Morgen schleppen zu lassen. Trotzdem verspürte er an manchen Tagen einen Stich, wenn er das Oben und Unten, wenn er die Leichtigkeit sah, mit der Ferdinando Gonzaga durchs Leben ging und dies mit seinem eigenen Weg verglich.
Zwar wusste Enrico nicht, was der Herzog von Mantua, der Vater Ferdinandos, seinem Sohn auf den Weg gegeben hatte, aber er ahnte, dass es sich nicht nur um eine politische Mission handelte, sondern der Versorgung seines Schützlings dienen sollte. Dabei hatte dieser Ferdinando weiß Gott keinerlei Begabung, außer der des uneingeschränkten Müßiggangs und der Tatsache, dass er kaum Schlaf brauchte. Manchmal verzweifelte Enrico an der scheinbaren Interesselosigkeit Ferdinandos. Deshalb hatte er sich vorgenommen, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden, einen neuen Herrn zu finden und so schnell wie möglich seine Dienste bei diesem Gonzaga aufzukündigen.
„Jetzt erzählt doch, Enrico!“, tönte es aus dem Inneren der Sänfte.
Enrico rang nach Atem, fühlte sich unausgeschlafen und übermüdet. Unter lautem Keuchen begann er:
„Fangen wir bei Clemens VIII. an, Exzellenz. Der Papst gilt als geschickter Taktiker und Schlitzohr. Man munkelt, er soll das Kollegium der Kardinäle getäuscht haben. Sie glaubten, einen kranken Mann zu wählen, der nicht mehr lange zu leben habe. Doch sie mussten feststellen, dass der Florentiner Kardinal Ippolito Aldobrandini mit der Übernahme der Mitra plötzlich wunderbarerweise gesundete und als Clemens VIII. seine Amtsgeschäfte bis heute gewissenhaft erfüllt. Jedenfalls tat er das bis zu seiner Erkrankung. Zwar ist er ruhelos, reist beständig umher und wird immer wieder krank, aber sein vorbildlicher Ernst und seine Frömmigkeit verdienen uneingeschränktes Lob. Außerdem gilt er als einfühlsamer Politiker.“
Das erste Licht fiel in hellen Kaskaden in die Gasse, die sie eben durcheilten, und überzog die Wände der Häuser mit einem goldenen Schimmer.
„Was sabbert Ihr da, Enrico. Jeder weiß, dass Clemens VIII. eine noch nie da gewesene Günstlingswirtschaft betreibt, ohne je schamrot zu werden.“
„Aber es ist ihm gelungen, den Kirchenstaat zu erweitern und den Streit mit Frankreich beizulegen.“
„Auf Kosten des italienischen Adels und im Sinne der spanischen Fraktion unter Kardinal Madruzzo!“
Enrico wunderte sich, dass Ferdinando so genau Bescheid wusste, schließlich verbrachte er seine Vormittage mit Schlafen, die Nachmittage mit Vergnügungen und die Nächte mit den Tänzerinnen und Tänzern des Theaters. Viel Zeit, sich um Politik zu kümmern, blieb dabei nicht. Möglich, dass ihn sein Vater eingeweiht hatte.
„Ein erheblicher Teil der Kardinäle bezieht aus Spanien Pensionen. Aber das Schlitzohr auf dem Stuhl Petri hat es vermocht, den spanischen Einfluss zu brechen. Er holte sich den Beistand der Franzosen.“
„Nur, weil sich dieser Henry Quattre zum katholischen Glauben bekehren und taufen ließ.“
„Die Wiederaufnahme Heinrichs von Navarra in den Schoß der Mutter Kirche war von außerordentlicher Tragweite, Herr.“
Sie bogen vom Tiberufer aus in eine Seitenstraße ein und befanden sich plötzlich auf dem Fischmarkt. Enrico verschlug es beinahe den Atem. Es stank nach nassem Fisch, nach Schuppen und modrigem Tang. Hier pochte selbst in der Februarkälte das Herz Roms fiebrig wie im Dorf, aus dem er stammte.
„Clemens wollte nicht Kaplan des spanischen Herrscherhauses sein, und es ist ihm gelungen. Der Papst in Rom ist wieder sein eigener Herr.“ Enrico musste Luft holen, weil er glaubte, durch den Dunst auf dem Markt ersticken zu müssen, und ihn das ständige Rennen restlos erschöpfte. „Und jetzt ist er krank, Exzellenz, auf den Tod krank!“
„Er war immer auf den Tod krank.“
„Man munkelt, er liege im Sterben!“
„Man munkelte immer, dass er im Sterben läge.“
„Warum seid Ihr dann hier?“
Aus der Sänfte kam keine Antwort. Enrico sah sich kurz auf dem Markt um. Die Menschen, die sich hier zusammenfanden, ergaben ein buntes Bild, das ihm das Herz aufgehen ließ. Menschentrauben um Bratereien, Bastmatten mit handtellergroßen Krebsen, Holzbottiche voller Fisch. Hierher musste er noch einmal kommen, ohne diesen Laffen von Gonzaga, der nicht einen Blick darauf verwandte und vermutlich nur daran dachte, die besten Kontakte zu knüpfen. Bevor sie in Richtung Corso einbogen, traf sich Enricos Blick mit dem einer jungen Frau, die an einer der Säulen lehnte. Sie strahlte eine selbstverständliche Ruhe aus, und sie gefiel ihm sofort. Nur für einen kurzen Augenblick sahen sie sich an, dann musste sich Enrico beeilen, um der Sänfte hinterherzukommen.
5.
Ein Geräusch ließ Nerina aus ihrem Schlaf hochschrecken. Sie lauschte. Stimmen! Vom Fuß des Treppenhauses. Ihr Tonfall klang erregt und bedeutete nichts Gutes.
Schon graute der Tag und warf einen ersten Lichtstreifen durch die Fensteröffnung, der wie Nebel den Raum farblos ausleuchtete. Nerina musste sich erst vergewissern, wo sie sich befand. Der Stuhl, das Bett, die Staffelei, Bilder am Boden und an der Wand: Sie war in Micheles Atelier. Ihr war kalt an den Schultern, schnell zog sie die Decke höher. Ein Zittern durchlief sie. Wieder hatte sie auf der Liege geschlafen und fühlte sich wie gerädert. Nerina richtete sich halb auf und lauschte. An der unteren Eingangstür stritten sich offenbar mehrere Männer, versuchten aber ihre Stimmen zu dämpfen. Plötzlich schienen sie sich geeinigt zu haben und kamen die Treppe herauf. Die Stimmen wurden lauter. Sicherlich würden sie Donna Bruna, ihre Hauswirtin, wecken. Rasch erhob sie sich. Sie entdeckte ihr Kleid auf einer der Staffeleien und streifte es sich über. Das Leinen kratzte angenehm belebend auf der Haut. Keine fünfzehn Fuß entfernt schnarchte Michele am Tisch. Er war auf seinem Stuhl eingeschlafen und hatte eine Kopfseite in die Farbreste seiner Palette getaucht. Neben ihm stand eine leere Korbflasche.
Jetzt hatten die flüsternden Stimmen ihre Wohnungstür erreicht und hielten inne. Bis zum Hals klopfte Nerina das Herz. Wer wollte um diese Zeit zu ihnen?
„Michele, aufwachen. Ich glaube, es gibt Ärger.“
Michele murmelte im Schlaf, drehte jedoch nur den Kopf auf die andere Seite. Nerina gab ihm einen kräftigen Stoß in die Seite. Wie sie es satthatte, den Trunkenbold zu wecken.
„Gläubiger! Sie wollen eines deiner Bilder pfänden.“
Der Trick gelang immer. Dieser Malteufel konnte noch so tief in den seidenen Kissen des Weinrauschs liegen, die Angst davor, dass eines seiner Bilder in die unrechten Hände geriet, trieb ihn sofort auf. Doch diesmal war es zu spät. Michele sah Nerina an, und sie wusste, dass er noch nach Gegenwärtigkeit suchte, dass er sich hier in diesem Raum erst verankern musste, als bereits die Tür gegen die Wand flog, ein Gewirr an Stimmen und Menschen in den Raum flutete. Eine ganze Horde von Männern stürmte auf Michele zu, der schützend die Hände über den Kopf hielt.
„Ciao bella, ciao Nerina, ciao Michele!“, brüllte der vorderste Besucher, ein ungewaschener, nach ranzigem Öl riechender Fischer, der noch den Teil eines Netzes im Arm hielt. „Caravaggio, sieh her!“
Besorgt beobachtete Nerina, wie Michele die Hände vors Gesicht schlug und die Stirn auf den Tisch zurücksinken ließ. Die Geste war eindeutig. Auf seinem Gesicht erschien die Frage: Was habe ich nur verbrochen?
„Camillo, du weißt doch, dass er kein Geld hat“, versuchte Nerina Michele zu verteidigen.
„Er hat nie Geld.“ Der Fischer gebot den anderen mit einer Armbewegung Ruhe. „Aber ich komme nicht deswegen. Sieh her, Michele. Kennst du das?“
Nur langsam schien Michele aus seinem Rausch aufzutauchen. Nerina ging quer durch den Raum, nahm die Karaffe vom Waschtisch und goss sie Michele mit einem kräftigen Schwung über den Kopf. Der schüttelte sich wie ein Pudel.
„Madonna! Was soll das, Nerina?“, prustete er.
„Du sollst aufwachen“, betonte der Fischer, „und dir dies hier ansehen.“
Nerina trat hinter ihn und rieb Micheles nasse Haare mit einem Tuch trocken. Ein Geruch von Farbe, Fett und Wein stieg davon auf. Sie genoss es, ihm über den Kopf zu fahren.
Michele atmete schwer. Mit einer Handbewegung schob er sie von sich und strich sich das Haar aus der Stirn, während es in der Runde still wurde.
„Was ist das?“
„Was ist das? Was ist das?“, äffte ihn der Fischer nach. „Ein Tuch natürlich. Aus Seide.“
Das Tuch war zusammengerollt wie ein Seil, tropfnass und zerknittert, als hätte man es an einer Seite zusammengebunden.
„Und es gehört dir, Michele! Bernardo hat es gesagt. Gehört es dir?“
Er faltete das Tuch auseinander. Am unteren Ende kam ein Monogramm zum Vorschein, MMC.
„MMC heißt doch Michelangelo Merisi da Caravaggio“, mischte sich jetzt Bernardo ein. Nerina mochte den Bäcker vom Ende der Straße mit seinen teigigen Augen und der hohen Stimme. Gutmütig war er, etwas tollpatschig in seinen Höflichkeiten und immer fröhlich, aber sie hatten bei ihm Schulden, die allein eine ganze Leinwand gefüllt hätten. Irgendetwas stimmte nicht. Selbst sein Gesicht blieb so verschlossen und ernst wie die der anderen. Nerina hatte das Gefühl, als sei hier ein Verhör im Gange, als würden hier Inquisitoren nach Recht und Unrecht forschen. Ein Kribbeln zog sich ihren Bauch hinauf und schmerzte plötzlich im Nabel.
„Ja doch, ja doch!“ Michele rieb mit den Handflächen sein Gesicht. „Ich hatte es Lena gegeben. Als Dankeschön.“
„Wir haben es im Tiber gefunden, Michele.“
„Dann hat es ihr nicht gefallen. Auch recht. Gib her. Danke – und jetzt verschwindet. Ich muss schlafen.“
Der Fischer ließ seine Hand sinken, mit der er Michele das Seidentuch vor die Augen gehalten hatte. Michele griff ins Leere.
Sofort sprang Michele auf wie ein verwundetes Tier.
„Gib her!“, fauchte er heiser.
Nerina hielt ihn beschwichtigend am Arm fest, aber er riss sich los. Sie wusste, dass er es nicht liebte, wenn man ihn täuschte, wenn man Spiele mit ihm trieb. Mit einem Satz stand er vor dem Fischer und griff sich das Tuch. Sein ganzer Körper wirkte verkrampft, als müsse er sich beherrschen.
„Was willst du noch?“, mischte sich jetzt Nerina ein, die ahnte, dass es nicht nur um das Tuch ging. „Ihr wisst jetzt, wem es gehört. Das genügt doch.“
Es schmerzte sie, dass Michele dem Weibsstück für seine Arbeit als Modell wieder ein Tuch geschenkt hatte. Lena! Diese Advokatenhure, die ihn nur umgarnte, damit sie auf eines seiner Bilder kam. Michele war dumm genug, sich von ihr einwickeln und unter den Bettsack ziehen zu lassen. Nerina schnaubte durch die Nase, um ihre Missbilligung auszudrücken, aber sie wusste, dass ihre Eifersucht Michele nur belustigte. Er sah sie nicht einmal an, als er sich wieder setzte.
„No, bella. Es genügt nicht. Michele muss mitkommen. Wir haben nicht nur das Tuch gefunden. Leider, Nerina.“
Der Fischer sah Nerina mitleidig an, dann wandte er sich an Michele, der ihn offensichtlich nur halb verstand.
„Komm mit, Michele. Du musst es dir ansehen.“
Schwerfällig erhob sich der Maler. Nerina griff ihm unter die Arme. Sie fühlte seine weinselige Trägheit, die den Schritt unsicher machte. Dann stand er, allein, ohne Hilfe, verscheuchte sie.
„Kann es nicht noch bis Mittag warten?“
„No, Nerina. Bevor der Tag anbricht. Es sind nur wenige Schritte bis hinunter zum Tiber.“
Er sprach gedämpft und mit einer schwebenden Traurigkeit in der Stimme, die Nerina unsicher machte.
„Etwas Schlimmes? Ich hole nur schnell meine Schuhe.“ Nerina rannte zur Liege, schlüpfte hinter ihr abgetrenntes Schlafabteil am anderen Ende des Ateliers und in ihre Holzpantinen.
Camillo zuckte mit den Schultern und griff Michele am Arm. Als er ihn mit sich zog, schepperte Caravaggios Degen auf den Boden.
„Den brauchst du nicht!“, bestimmte Nerina, und Michele ließ ihn sich abnehmen. Sie wunderte sich, denn sonst achtete er peinlich genau darauf, bewaffnet zu sein, obwohl es Nichtadligen wie ihm verboten war, in der Stadt einen Degen zu tragen. Offenbar hatte er nicht die Kraft, sich zu wehren.
So schleppten sie den Trunkenen mehr die Treppen hinunter und auf die Straße, als dass er ging. Die Männer, Nerina zählte sieben, schritten stumm aus. Auf der Straße standen weitere – und bis sie zum Tiber hinunter gelangten, hatte sich ihre Zahl verdoppelt. Auf Michele wirkten die kühle Morgenluft und die Feuchtigkeit des Flusses offensichtlich belebend. Nerina beobachtete, wie er mit jedem Schritt sicherer auftrat und sich schließlich von Camillos Schulter löste und selbstständig ging.
Nerina war die ganze Prozession unheimlich. Wo sonst ein herzliches Hallo und Begrüßen einsetzte, wenn Michele auf die Straße trat, weil er mit allen im Viertel schon getrunken hatte und sich mit jedem unterhielt, blieben die Fischer und Fährleute heute stumm und auf den Wurzeln, Baumstämmen und Steinen sitzen. Sie trugen einen Ernst zur Schau, der Nerina vorsichtig werden ließ. Sie sorgte sich um Michele.
Noch lagen die Mauern der Häuser im Dämmerlicht. Von den Seilen, die über die Häuserschluchten gespannt worden waren, tropfte das Wasser der ersten Wäsche und verwandelte den Boden in eine feuchte und klebrige Masse. Aber es war nur der eigenartig satte Klang, mit dem die Morgenstunden in Rom alles bedachten. Ein Hauch von brackigem Wasser wehte durch die Gasse, die zum Tiber hinunter führte. Dann weitete sie sich zum Fluss hin. Die Männer gingen ans flache Ufer hinunter. Nerina konnte von hier aus den Ponte Fabricio, die Tiberbrücke erkennen, die zur Insel hinüber führte, und die ersten Boote mit ihren spitzen Latinersegeln ausmachen, die den Tiber aufwärts gerudert wurden, um an den tiefen Stellen vor der Insel zu fischen.
Unten am Ufer lagen drei Boote, deren Maststangen in den Himmel stachen, und um die eine weitere Gruppe von Männern stand. Eigenartig starr und verlegen wirkten sie mit ihren sparsamen Gesten.
„Camillo, sag endlich, was los ist. Warum weckt ihr Michele um diese Uhrzeit? Ihr wisst doch, dass er vor allem nachts arbeitet …“
Camillo unterbrach Nerina und deutete auf eine Stelle zwischen den Booten.
Nerina kniff die Augen zusammen. Zuerst konnte sie nichts erkennen, dann entdeckte sie etwas Dunkles zwischen den Männern. Es lag dort auf Steinen und Sand, als wäre es ans Ufer gezogen worden wie eines der Fischerboote oder die Netze, feucht, schwer und schwarz. Je näher sie kamen, desto schneller schlug Nerinas Herz. Langsam dämmerte ihr, was dort lag: ein Mensch.
Auch Michele schien wieder nüchtern. Er war Nerina einige Fuß voraus und stürzte die letzten Schritte auf die Person zu, die dort auf den Ufersteinen lag. Bevor Nerina ihn erreichte, kniete er nieder. Plötzlich fuhr er zu ihr herum und starrte sie mit vor Angst geweiteten Augen an.
Er öffnete den Mund zu einem Schrei, aber Nerina vernahm nur ein heiseres Krächzen, das ihr dennoch durch Mark und Bein fuhr.
„Lena!“
6.
„Man sollte ihn im Tiber ertränken und die Bilder hinterherwerfen. Sie beleidigen das Auge und den Glauben!“ Kardinal Camillo Borghese verschränkte die Arme und blickte abschätzig auf das Gemälde, vor dem sein Neffe stand. „Ich weiß nicht, warum Ihr das Geschmiere in Auftrag gegeben habt?“
Forsch musterte er die Runde, die sich versammelt hatte, und Scipione sah, dass er Zustimmung von ihm und dem jungen Gonzaga erwartete.
„Ihr werdet doch nicht auf Eure alten Tage zum Hasser der neuen Zeit, Oheim?“
Scipione Borghese versuchte, seiner Stimme so viel Schmerz zu verleihen, wie nötig war, um den Kardinal zu beruhigen, und so viel Aufsässigkeit und Überzeugung hineinzulegen, dass es seinen Oheim gleichzeitig quälen musste. Der verzog das Gesicht und drehte ihm den Rücken zu. Im Kerzenglanz schimmerten die grauen Haare unterhalb des Piloleums wie ein silberner Ring.
„Außerdem habe ich es nicht in Auftrag gegeben, sondern gekauft. Es schien mir … interessant zu sein.“
Kardinal Camillo Borghese blickte kurz zu seinem Neffen hinüber, aber Scipione Borghese wandte sich dem Gast zu, ohne die Antwort des Kardinals abzuwarten.
„Nun, mein lieber Ferdinando Gonzaga, werter Freund, seid Ihr ebenfalls der Ansicht meines Oheims? Euer Vater gilt als fleißiger Sammler mit ausgesuchtem Geschmack und offenem Herzen für die Moderne.“
Verlegen und offenbar in Erklärungsnot, trat Ferdinando Gonzaga von einem Fuß auf den anderen. Scipione Borghese tat der Junge leid, den er so in die Enge getrieben hatte. Er beobachtete, wie er Hilfe suchend zu seinem Sekretarius hinüberblickte, der scheinbar unbeteiligt auf das Gemälde blickte und sich dann das Deckengemälde des Raumes besah.
„Er wirft einen neuen Ton in die Arena der Kunst!“, stotterte Ferdinando Gonzaga seine Antwort heraus und Scipione Borghese musste die Augenbrauen heben. Sonderbar. Sein Urteil formulierte er zwar unsicher, aber treffend. Sollte in diesem blassen Jüngling tatsächlich der Kunstverstand des Vaters Vincenzo nisten oder hatte er sich dieses Urteil angelernt? Selbst sein Sekretarius schien erstaunt zu sein über diesen Satz, denn er musterte kurz seinen Herrn und hob eine Augenbraue.
„Ein Schmierfink, der die Heiligen beleidigt!“, knurrte Camillo Borghese.
„Im Augenblick immerhin einer der bestbezahlten!“, warf Scipione Borghese ein.
„Und einer der rauflustigsten. Der trinkfreudigsten. Der den Huren am meisten zugewandten! Die Liste könnte beliebig verlängert werden.“
„Sprecht Ihr von Caravaggio, Oheim, oder von den Kardinälen Seiner Heiligkeit?“
„Mit Euch kann man nicht über Kunst sprechen, Scipione! Sie sind ganz verrückt nach diesem Tier, diesem Unruhestifter, die Del Monte und Barberini und Chigi und dieser Bankier Seiner Heiligkeit, dieser Giustiniani. Als würde der Kleckser persönlich die Welt neu schaffen. Dabei sollte man ihm das Malen verbieten.“
Scipione Borghese musste lachen und aus den Augenwinkeln heraus beobachtete er, dass auch Ferdinando Gonzaga die Hand an den Mund führte, um ein Lächeln zu verbergen.
„Das hieße, sich an der Schöpfung vergreifen und sich zu versündigen.“
„Jeder Pinselstrich auf diesem Bild ist eine Sünde! Schaut ihn Euch doch an, diesen angeblichen heiligen Hieronymus. Ein magerer alter Mann, Arme und Brust faltig. Sieht so ein Heros der Kirche aus? Warum muss man ihn darstellen wie einen Bettler, der am Verhungern ist?“
Verärgert zog Camillo Borghese seinen Mantel enger und zog sich wortlos zurück. Scipione sah dem Oheim nach, blickte dann auf das Gemälde und wandte sich schließlich an Ferdinando Gonzaga.
„Er ist etwas nervös in letzter Zeit. Seine Heiligkeit kränkelt. Und er leidet mit.“
Scipione Borghese bemerkte, dass sein spöttischer Ton von Ferdinando mit einem unsicher scheinenden Lächeln erwidert wurde.
„Er hat immer gekränkelt!“
Neugierig musterte Scipione Borghese diesen Ferdinando Gonzaga, dessen äußere Hülle einen schwächlichen, den Lastern ergebenen Jüngling offenbarte. Täuschte er sich in seinem Gegenüber? War das alles nur Larve, hinter der sich ein intelligenter Kopf verbarg, oder war dieser Mantuaner Sprössling nur mit der Schläue eines gewöhnlichen Intriganten gesegnet?
„Es geht das Gerücht, dass er im Sterben liegt – und die“, Scipione Borghese stockte etwas, als wolle ihm das Wort nicht aus dem Mund, und fuhr dann doch fort, leiser, gedämpft, „Gespräche bezüglich seiner Nachfolge haben bereits begonnen. Es ist die Zeit der Freundschaften und persönlichen Bindungen, Gonzaga. Jedes beifällige Nicken könnte für die Zukunft nützlich sein. Die Familie der Aldobrandini hat lange genug regiert. Ihre Neffen und Enkel sind versorgt. Es wird Zeit für frisches Blut.“
„Verzeiht“, versuchte Ferdinando Gonzaga zu beschwichtigen und warf Enrico einen vielsagenden, Hilfe suchenden Blick zu, „aber es liegt vielleicht an meinem Alter, dass ich so forsch bin. Euer Oheim rechnet sich gegen die spanische Vormacht im Kollegium Möglichkeiten aus?“
„Möglichkeiten auch.“
„Das bedarf treuer Freunde.“
Scipione Borghese tat, als hätte er den letzten Satz überhört. Dieser Ferdinando gefiel ihm, obwohl er das Gefühl nicht loswurde, dass er sich vorsehen musste. Hinter diesen wie mit einigen wenigen Pinselstrichen hingewischten gefälligen Gesichtszügen verbarg sich ein scharfer Geist.
„Sagt, Ferdinando, wie gefällt Euch das Bild? Jetzt könnt Ihr offen sein, mein Oheim legt sich zu seinem Vormittagsschläfchen hin. Die Wachzeiten an Clemens’ Bett strengen ihn an.“
Ferdinando Gonzaga ging auf die Wendung im Gespräch ein. Er wanderte vor dem Bild auf und ab, und Scipione Borghese sah an seinem steifen Schritt und an seinen staksigen Bewegungen, dass er sich zurückhalten musste. Sicherlich war Ferdinando Gonzaga verärgert darüber, dass er seit Stunden mit seinem Sekretarius in einem der Vorzimmer hatte warten müssen, und jetzt wurde er zur Beurteilung eines Gemäldes aufgefordert, das ihm nicht zusagte. Er würde ihm auf die Sprünge helfen.
„Sagtet Ihr nicht, mein lieber Ferdinando, es werfe ein neues Licht in die Arena der Kunst? Das tut es. Was mein Oheim verabscheut, ist nichts anderes als der Ausdruck neuen Denkens. Künstler wie Cardi und Muziano haben den heiligen Hieronymus noch als kraftvollen Mann dargestellt. Ein Heiliger wie ein Herkules wurde daraus, mit Muskeln, als wolle er damit den Glauben in die Köpfe der Menschen prügeln.“
Mit einem Kopfnicken deutete der junge Gonzaga zum Bild hinüber.
„Aber dieser Caravaggio … er ist feiner, subtiler. Sein Hieronymus ist ein Asket, und man sieht es ihm an. Er verzichtet auf alles: Ehre, Ämter, Privilegien, Nahrung, Kleidung. Einzig das Geistige verbleibt ihm. In diese Spiritualität vertieft er sich. Gelehrsamkeit ist ihm wichtiger als irdisches Gut. So legt er den unerschütterlichen Grund seines Glaubens durch das Wort Christi.“
Scipione Borghese fühlte, wie er mit jedem Wort der Deutung des jungen Gonzaga tiefer in das Geheimnis des Gemäldes eintauchte, wie plötzlich ein Sog ausging von dessen Farben, von dessen Ton. So hatte auch er selbst das Gemälde verstanden.
„Weil er auf alles verzichtet, ist er frei!“, murmelte Ferdinando Gonzaga zuletzt, und Scipione Borghese sah erstaunt empor. Hatte der Jüngling diesen Satz eben selbst so formuliert oder war er ihm von seinem Sekretarius eingeflüstert worden, der direkt neben seinem Herrn stand? Er konnte diesen jungen Gonzaga so schlecht einschätzen. Sein Gesichtsausdruck erinnerte ihn immer noch an die blasierten Gesichter der Kater, die sich tagsüber im Kolosseum wärmten und faulenzten, die aber nachts unerbittlich auf Jagd ausgingen und ihre Reviere verteidigten.
„Und das fürchten sie alle, die Kardinäle der Kirche, insbesondere seit Clemens ernstlich erkrankt ist.“
„Selbst wenn ich es nicht sehe, leuchtet sein Licht in die Finsternis hinter meinen Augen. Wäre ein solcher Mann nicht geeignet, die Fraktion der italienischen Kardinäle hinter sich zu versammeln? Solche Bilder wirken wie Magnete, sie ziehen an oder stoßen ab.“
Ferdinando Gonzaga räusperte sich leicht, als er diese kurze Rede hinter sich gebracht hatte, als wäre sie zufällig, eigentlich unbeabsichtigt, seinem Mund entfallen.
Scipione Borghese hatte das Gefühl, als müsse er laut loslachen, unterdrückte es aber. Solche Sätze von einem siebzehnjährigen Knaben? Es konnte nicht schaden, die Ansichten des jungen Gonzaga zu erkunden, schließlich unterstützte der Vater die italienische Partei. Nicht ohne Hintergedanken schleppte er ihn bereits seit zwei Stunden durch die legendäre Kunstsammlung des Hauses.
„Ihr habt ein wundervolles Werk erworben, Herr!“
Ungläubig musterte Scipione Borghese den jungen Gonzaga.
„Wundervoll? Eine Provokation!“
Diesem Satz musste er etwas entgegenhalten, musste ihm entgegentreten, entschieden, schließlich sammelte er Caravaggio, hatte er dem Künstler aus bestimmten Gründen Aufträge erteilt. Stumpf, beinahe ausdruckslos blieben die Augen Ferdinando Gonzagas, während er selbst sich in Rage redete.
„… dieser heilige Hieronymus. Diese Ausgewogenheit in den Proportionen, dieser Lichteinfall, der den Schädel hervorhebt und nicht nur den Schädel des Heiligen, mein Freund, auch den Totenschädel auf der anderen Seite des Tisches. Versteht Ihr? Memento mori, gedenke des Todes im Leben, das ist üblich, aber dieser Caravaggio geht darüber hinaus und zeigt hier mit diesen Lichtreflexen und mit diesem Arm, dass Leben und Tod eins sind.“
Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete Scipione Borghese, dass Ferdinando Gonzaga nickte und ihm offenbar doch interessiert lauschte.
Konnte er ihm tatsächlich folgen? Steckte in diesem jungen Kopf tatsächlich etwas vom Verstand und Gespür seines Vaters?
Ahnte er, dass dieser Hieronymus, der am Tisch saß und die Bibel übersetzte, nicht als Gelehrter, nicht als Humanist, der einer philologischen Herausforderung nachging, sondern als ein von Gott Begnadeter, von Caravaggio als ein regelrecht Besessener interpretiert wurde.
„Betrachtet Euch nur das Licht. So neu, so vollkommen in seiner Ruhe. Überirdisch!“
„Ja!“, hörte Scipione den jungen Gonzaga flüstern. „Kosmisch!“
Scipione Borghese musste den Atem anhalten. Dieser Ferdinando Gonzaga spielte mit ihm und hielt ihn zum Narren. Und plötzlich wurde er doch verblüfft.
„Ein Wundertätiger ist er, dieser Caravaggio, selbst ein Heiliger. Der Heiligenschein des Hieronymus wird, wenn ich das richtig sehe, so eingesetzt, dass er damit eine Tiefenwirkung erzielt. Dann diese Bücher. Seht Ihr? Wie sie kreuz und quer durcheinander liegen, als wären sie wahllos übereinandergeworfen. Dabei gibt der Künstler dem Raum dadurch erst seine Tiefe, seine Gestalt. Hieronymus schwebt nicht mehr in einem imaginären Raum, sondern sitzt fest verankert im Hier und Jetzt. Er ist ein Heiliger unserer Zeit geworden, für unsere Zeit!“
Einige Augenblicke verharrte Scipione vor dem Werk, berührte mit der flachen Hand vorsichtig den Malgrund und dachte über das nach, was Ferdinando Gonzaga eben gesagt hatte. Recht hatte er, uneingeschränkt recht, dieser junge Geck. Konnte die eben geäußerte Idee wirklich im Kopf dieses Laffen entstanden sein? Vielleicht konnte er ihm tatsächlich nützen.
„Damit wird er ein Knecht der Gegenreformation“, dachte er sich. „Wer die Heiligen so ins Profane hinüberzieht, will sie entweder lächerlich machen oder aber die Toren damit fangen. Caravaggio hatte hier einfach einen der Bettler als Vorbild hergenommen, die täglich an der alten Tiberbrücke saßen und die Hand mit derselben Selbstverständlichkeit aufhielten, mit der dieser Heilige das Wissen um die Existenz Gottes erfasste.“
Scipione Borghese nahm Ferdinando Gonzaga am Arm und geleitete ihn einen Raum weiter. Im angrenzenden Zimmer, dessen marmorner Kamin angeheizt war, um die Kühle des Steinbodens und der Säulen zu mildern, war ein Tisch aufgestellt und gedeckt worden.
Er hieß Ferdinando Gonzaga am einen Tischende Platz nehmen und setzte sich ihm an der Stirnseite gegenüber. Welche Gedanken mochten sich hinter der Stirn des jungen Mannes verbergen? Ahnte er, dass Caravaggios Aufgabe tatsächlich darin bestand, die Kardinäle der italienischen Fraktion über ein gemeinsames Thema zu einigen?
7.
Nerina wusste sofort, dass sie nicht allein im Zimmer waren. Ein eigenartiger Geruch, der entfernt an Weihrauch erinnerte, warnte sie. Sie ließ die Tür offen, dirigierte Michele auf seine Liege und gewöhnte ihre Augen an die Dunkelheit im Raum. Michele war ihr jetzt keine Hilfe. Die letzte Wegstrecke hatte Nerina ihn beinahe allein geschleppt. Trotzdem rüttelte sie ihn und versuchte ihn aus seiner Lethargie zu wecken. Unruhig ließ sie die Augen über den Raum gleiten und versuchte sich an das Dämmerlicht zu gewöhnen, weil die Fensterläden noch geschlossen waren.
„Michele, es ist jemand hier!“
Vorsichtig drehte sie sich um ihre eigene Achse. Micheles Atelier war nicht so groß, als dass es viele Möglichkeiten gegeben hätte, sich zu verstecken, aber die Tatsache, dass sie aus dem Tageslicht kam, erschwerte die Suche. Kurz stieg in ihr die Angst ihrer Kindheit auf, wenn sie auf offenem Feld übernachtet und wilde Hunde, Füchse oder sonstiges Getier in den frühen Morgenstunden, an der Schwelle zwischen Nacht und Tag, hörbar an ihrem Reisewagen geschnuppert hatten und sie allein wach gelegen war und in die Dunkelheit gelauscht hatte.
Plötzlich schwang die Tür zurück und schlug gegen die Zarge. Für einen kurzen Augenblick wurde es vollständig finster im Zimmer.
„Michelangelo Merisi da Caravaggio?“
Rau klang die Stimme. Nerina klopfte das Herz bis in den Hals. Auch Michele erwachte jetzt aus seiner Betäubung und sah in die Richtung, aus der die Stimme kam. Nerina übernahm die Initiative.
„Sì, Signore. Michele Merisi, genannt Caravaggio, sitzt hier. Ich vertrete ihn. Warum versteckt Ihr Euch hinter der Tür?“
„Man hätte mich sonst für einen Eindringling halten können.“
„Ihr seid ein Eindringling!“
„Und Ihr habt ein geschliffenes Mundwerk.“ Aus dem Dämmerlicht hinter der Tür trat ein Mönch hervor, dessen Kapuze tief ins Gesicht ragte, sodass nichts außer einer dunklen Öffnung zu sehen war. „Die Diener des Herrn gelten gemeinhin nicht als Verbrecher.“
„Hört Euch auf den Straßen um und Ihr werdet Euch wundern. Das Volk spricht und denkt anders darüber. Was wollt Ihr? Michele kann niemanden empfangen, das seht Ihr ja! Er trauert.“
„Ich sehe, ich sehe. Aber ich habe trotzdem einen Auftrag für den großen Meister!“
Der Mönch im dunklen Habit der Karmeliter machte Nerina Angst. Sie trat dicht an Michele heran. Beschwichtigend legte er ihr seine Hand auf den Unterarm. Jetzt verfluchte sie den Umstand, dass sie ihm sein Schwert weggenommen hatte, weil sie fühlte, wie seine andere Hand die Seite nach der Waffe abtastete.
„Michele, ein Kunde. Er gibt ein Bild in Auftrag.“
Aufmerksam beobachtete Nerina die Bewegungen des Mönchs. Aus dem Ärmel seiner Kutte zog er eine Geldkatze und wog sie in der Hand. Die Münzen darin klangen satt.
„Vierhundert Scudi Silber, Messer Caravaggio. Die Hälfte jetzt, die andere Hälfte bei Ablieferung. Bei Gefallen können wir mit dem Preis heraufgehen.“
Noch bevor Michele antwortete, ergriff Nerina die Gelegenheit. Nichts konnten sie im Augenblick dringender gebrauchen als Geld, und der Münzklang besaß etwas Verlockendes.
„Er sagt zu. Michelangelo Merisi übernimmt den Auftrag.“
„Welchen Auftrag?“, murmelte Michele.
Er richtete sich auf, rieb sich die Augen und betrachtete zuerst Nerina, die ihre Hand der Geldkatze entgegenstreckte, dann den Mönch, der schwarz vor der schwarzen Tür stand.
„Malt ein Bild, das die Welt so noch nicht gesehen hat, Messer Caravaggio!“
Michele hustete anhaltend und Nerina klopfte ihm sanft den Rücken.
„Warum sollte ich Euch ein Bild malen? Ich habe Aufträge anderer ausgeschlagen, die tausend Scudi dafür gezahlt hätten.“
Die Stimme des Mönchs zwang Nerina zu genauem Hinhören. Leise war sie, verriet keinerlei Seelenregungen, als wäre sie auf alle Widrigkeiten im Unterhandeln mit Michele vorbereitet.
„Ich weiß. Der Fürst Doria klagt darüber, dass Ihr seine Loggia nicht ausgemalt habt. Für 6000 Scudi. Es war ein herber Schlag für den Fürsten. Ihr hättet zehn Jahre davon leben können.“
„Und als Freskant ein ganzes Jahr dafür buckeln müssen. Nein danke! Ich ziehe Leinwand und Staffelei vor. Sie sind freier, offener.“
„Aber“, der Mönch machte eine Pause, „ich will kein Fresko von Euch, Caravaggio, sondern ein Bild, Öl auf Leinwand. Eure Spezialität.“
„Ich bin nicht interessiert. Hebt Euch von meiner Türschwelle! Nerina! Du nimmst kein Geld an!“
Michele wandte sich ab. Nerina stand unschlüssig da und starrte auf den Beutel in der Hand des Mönchs.
„Aber Michele …“
„Zurück hab ich gesagt!“, fauchte Michele. „Soll er es selber fressen!“
Der Mönch regte sich nicht. Nerina hörte nur seinen gleichmäßigen Atem, als warte er geduldig wie ein Fischer darauf, dass Michele den Köder schnappte, den er ausgeworfen hatte.
„Ich verstehe Eure Erregung. Ihr trauert, Caravaggio?“, flüsterte er plötzlich. „Nehmt die Trauer mit ins Bild. Malt mir einen ‚Tod Mariä‘ für die Karmeliterkongregation!“
Schwerfällig erhob sich Michele und ging einen Schritt auf den Mönch zu, der zur Tür hin auswich. Dann drehte er sich abrupt um und starrte auf den Boden des Ateliers, als fände er dort seine Gedanken. Nerina fühlte, wie sein anfängliches Zögern und Ablehnen zu einem festen, klaren Entschluss gerann.
„Warum einen ‚Tod Mariä‘?“, fragte er und fuhr sich mit der Hand unsicher durchs Haar. Nerina sah, dass sie zitterte. Sein Blick wanderte unstet durch den Raum.
Der Mönch lachte leise. Sofort sträubten sich Nerina die Haare. Woher kannte sie dieses Lachen? Gleichzeitig wurde sie sich bewusst, dass Michele an der Angel hing.
„Ich dachte mir, dass Ihr danach fragen würdet, Caravaggio. Weil Ihr der Beste seid, weil Ihr die Trauer nicht nur kennt, sondern sie auch den Personen auf Eurem Bild mitgeben könnt. Kein anderer wäre dazu in der Lage. Wer Eure Gemälde betrachtet, den schaudert. Und dieser Schauder soll die Gläubigen überfallen, wenn sie Euer Bild sehen.“
„Ich male anders, als all die anderen Kleckser der Stadt. Ich halte nichts von den Gecken, die ihre Leinwände mit Unsinnigem vollschmieren, weil sie hoffen, damit ihrem Glauben zu dienen. Ich bin …“
„… der Meister der Contarelli-Kapelle, Messer Caravaggio. Ich weiß. Eben deshalb möchte ich Euch beauftragen. Neu soll es sein, Euer Bild, erschreckend neu und verstörend.“
Michele stand starr, den Blick wieder auf den Boden gerichtet, sodass Nerina beinahe glaubte, er sei eingeschlafen, aber plötzlich bewegte er sich mit geschmeidigen Bewegungen auf den Fremden zu, die nur von der Schnelligkeit des Mönchs übertroffen wurde. Michele griff nach der Kapuze, wollte sie ihm vom Kopf streifen, aber der Mönch hatte offensichtlich eine Attacke dieser Art erwartet und glitt im selben Augenblick durch die Tür. Er ließ den Beutel fallen, sodass die Münzen klirrend zu Boden fielen und durch das Atelier rollten. Auf leisen Sohlen schlich der Mönch den Aufgang hinab.
„Für die Kirche Santa Maria della Scala in Trastevere, Messer Caravaggio. Und lasst Euch nicht allzu lange Zeit“, rief der Mönch das Treppenhaus hinauf.
Michele stampfte mit dem Fuß auf und warf dem Flüchtigen ein deftiges Schimpfwort hinterher. Dann bückte er sich und begann die Münzen aufzusammeln, die noch über die Bohlen rollten.
„Nimmst du den Auftrag an, Michele?“
Nerina wagte nicht, ihm ins Gesicht zu sehen. Zu dicht lagen heute Schmerz und Glück beieinander. Zerrissen fühlte sie sich von den widerstreitenden Gefühlen, die Lenas Tod und der unerwartete Geldsegen in ihr ausgelöst hatten. Wie sehr mochte Michele darunter leiden?
„Wer war der Mönch? Doch sicher kein Karmeliter von Santa Maria della Scala. Für einen barfüßigen Karmeliter hat er nämlich zu viel geredet und zu viel Geld ausgegeben.“
Michele knurrte nur Unverständliches.
Nerina seufzte. „Es ist kein guter Tag, Michele.“