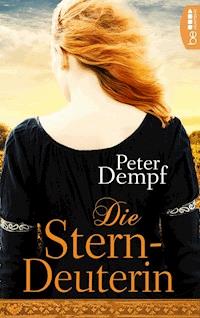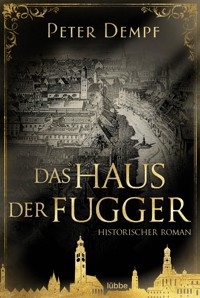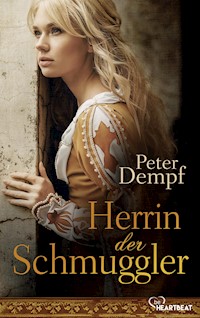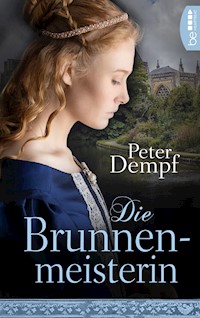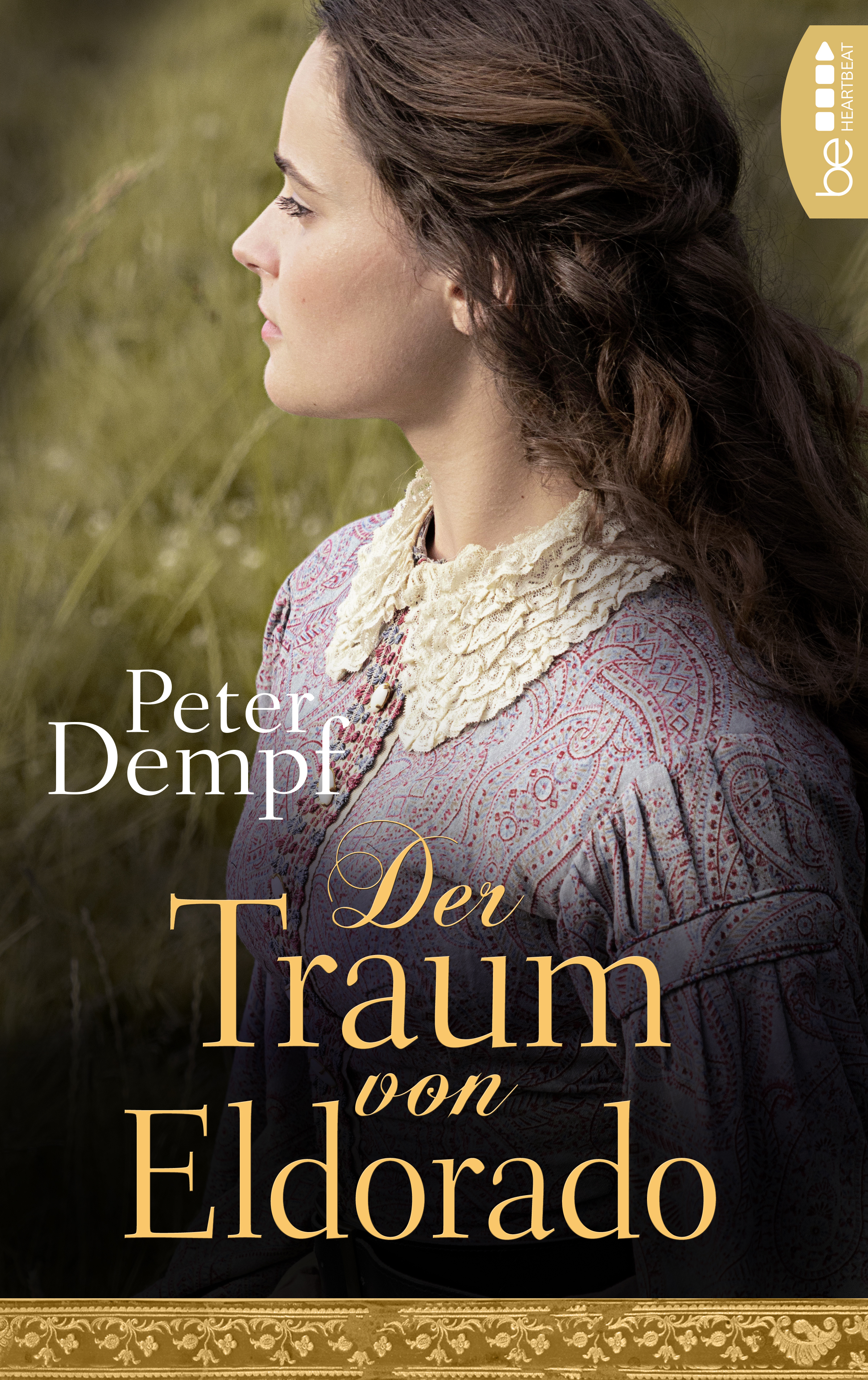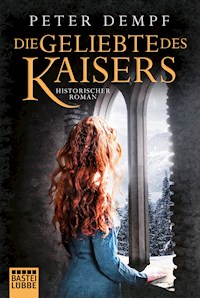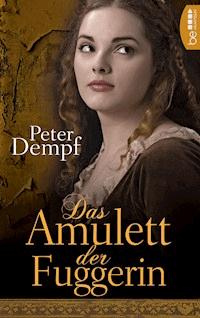6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Das Geheimnis von San Lorenzo
Venedig 1521. Die junge Isabella reist ins Kloster San Lorenzo. Hier soll sie ihre Tante treffen - doch diese ist tot, und sie ist keines natürlichen Todes gestorben! Isabella forscht nach und stößt auf eine Spur von kryptischen Zeichen in Bildern und Skulpturen. Welchen Schatz hütet das Kloster?
Diese Frage stellt sich auch Padre Antonio. Er wurde vom Papst entsandt, den Klöstern die Macht Roms zu zeigen. Und mit jedem Schritt, den der Inquisitor und das Mädchen der Lösung des Rätsels näher kommen, wächst die Gefahr. Denn San Lorenzo verbirgt ein Geheimnis, das tödlich ist für die Kirche - und für jeden, der davon weiß ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Prolog
Erster Teil - Der Schatten im Kreuzgang
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil - Die Schrift des Schweigens
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Dritter Teil - Die Verkündigung des Engels
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Vierter Teil - Der Brunnen der Delfine
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Epilog
Danksagung
Weitere Titel des Autors
Das Amulett der Fuggerin
Das Gold der Fugger
Der Teufelsvogel des Salomon Idler
Der Traum von Eldorado
Die Brunnenmeisterin
Die Geliebte des Kaisers
Die Sterndeuterin
Die Tochter des Klosterschmieds
Fürstin der Bettler
Herrin der Schmuggler
Mir ist so federleicht ums Herz
Über dieses Buch
Das Geheimnis von San Lorenzo
Venedig 1521. Die junge Isabella reist ins Kloster San Lorenzo. Hier soll sie ihre Tante treffen – doch diese ist tot, und sie ist keines natürlichen Todes gestorben! Isabella forscht nach und stößt auf eine Spur von kryptischen Zeichen in Bildern und Skulpturen. Welchen Schatz hütet das Kloster?
Diese Frage stellt sich auch Padre Antonio. Er wurde vom Papst entsandt, den Klöstern die Macht Roms zu zeigen. Und mit jedem Schritt, den der Inquisitor und das Mädchen der Lösung des Rätsels näher kommen, wächst die Gefahr. Denn San Lorenzo verbirgt ein Geheimnis, das tödlich ist für die Kirche – und für jeden, der davon weiß …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über den Autor
Peter Dempf geboren 1959 in Augsburg, studierte Germanistik, Sozialkunde und Geschichte für das Lehramt am Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine Mittelalter-Romane „Die Brunnenmeisterin“, „Herrin der Schmuggler“ und „Das Amulett der Fuggerin“ angesiedelt sind.
Homepage des Autors: http://www.peter-dempf.de/.
Peter Dempf
Die Botschaft der Novizin
Historischer Roman
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2008 by Peter Dempf und Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch AVA international GmbH, München
www.avainternational.de
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Peter Dempf und Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Master1305/shutterstock; © seanbear/shutterstock
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-8699-8
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
PROLOG
Frauen fühlen es, wenn sie beobachtet werden. Sie haben dafür eine Art sechsten Sinn. Das jedenfalls hatte ihre Mutter immer behauptet. Suor Francesca hob den Kopf. Was sie bislang nur für das Geplapper einer alten Frau gehalten hatte, wurde für sie jetzt zu einer unumstößlichen Wahrheit. Die Härchen am Haaransatz des Nackens kitzelten, und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Sie war nicht mehr allein. Irgendwo in der Dunkelheit stand jemand und beobachtete sie. Keinen Augenblick zweifelte sie daran. Mit einer raschen Bewegung drückte sie das Licht ihrer kleinen Öllampe aus. Sofort schlug die Schwärze der Nacht über ihr zusammen. Sie lauschte in die Dunkelheit hinein und hörte ein unterdrücktes Atmen, das hier im Kloster zu dieser Zeit nicht hätte sein dürfen. Ihr war, als hätte die Nachtschwärze die zweite Person näher an sie herangetragen, statt sie durch die tintene Finsternis von ihr zu trennen. Suor Francesca erhob sich. Ihr Habit raschelte, und das Geräusch klang in ihren Ohren, als würde es gegen die Nacht anschreien. Sie hätte stillhalten sollen, sich nicht rühren. Doch der nasse Saum ihrer Kutte tropfte vernehmlich. Jetzt hatte sie ihren Aufenthaltsort jedenfalls endgültig verraten und musste handeln.
Seit vierzig Jahren lebte sie hinter den Klostermauern von San Lorenzo. Jeder Gang, jede Abkürzung, sogar die beiden geheimen Türen, die hinter gewirkten Wandbehängen durch Zwischenmauern führten, waren Suor Francesca bekannt. Jeden noch so fernen Winkel in diesem Gemäuer würde sie mit geschlossenen Augen finden. Schon deshalb, weil sie in den Jahren ihres Eingesperrtseins alles über die Architektur des Klosters gelernt hatte. Selbst die Windrichtungen unterschied sie am Geruch. Die nördliche Wasserseite des Klosters roch anders als die südliche Inselseite. Der Schatten hinter ihr würde es demnach nicht allzu leicht haben, ihr zu folgen. Suor Francesca lächelte im Dunkeln. Angst verspürte sie nicht. Dennoch beunruhigten sie die Entwicklungen, die die Dinge nahmen. Seit sie den Schlüssel entdeckt hatte, schien sich die Dunkelheit wie eine Schlinge um sie zuzuziehen. Ihre Zelle wurde durchwühlt, ihr Gebetbuch fehlte, ein Schatten folgte ihr. Dabei hatte sie nur einer Vertrauten davon erzählt, und die verging vor Angst in der Nacht. Niemals würde sie durch die dunklen Flure hinter ihr herschleichen. Suor Francesca huschte durch den Innenhof des Kreuzgangs in Richtung Kanal und verschwand hinter einer der Türen, die zum Refektorium führten.
Womöglich bildete sie sich alles nur ein, war alles nur die überreizte Fantasie einer Nonne. Sie hielt kurz inne und lauschte. Hinter ihr hallten Schritte nach, bevor auch sie verstummten. Getäuscht hatte sie sich also nicht. Tatsächlich folgte ihr jemand. Suor Francesca atmete durch. Wer immer hinter ihr herschlich, er würde sich wundern.
Den Schlüssel, den sie noch in der Hand hielt, musste sie allerdings loswerden. Was auch geschehen mochte, bei ihr durfte er nicht gefunden werden. Suor Francesca schlüpfte hinter einen der bodenlangen Teppiche und öffnete die Pforte dahinter. Damit gelangte sie in einen kurzen Gang, der direkt in die Küche führte und hinter einem Topfregal endete. Geräuschlos schob sie dieses beiseite und stand in der Küche.
Dort roch es süßlich nach Blut und Fett. Hühner waren geschlachtet, gebrüht und gerupft worden. Zielsicher steuerte sie in der völligen Dunkelheit des Raumes den Ort an, den sie für den sichersten hielt. Keine drei Atemzüge brauchte sie, dann war der Schlüssel verborgen.
Nur ein Zufall oder das Wissen um sein Versteck würden ihn wieder zutage fördern. Suor Francesca huschte aus dem Raum und horchte sich um: keine Schritte, kein Atmen, kein Rascheln von Kleidungsstücken. Sie hatte ihren Verfolger abgeschüttelt. Zufrieden fuhr sie sich mit der Hand über das Gesicht. Es war verschwitzt. Die Nachstellung hatte sie stärker angestrengt, als sie sich zugestand.
Durch ein Fenster konnte sie auf den mondhell erleuchteten Turm der Kirche blicken. Bald würde die Glocke zur Messe läuten. Es lohnte sich nicht mehr, in ihre Zelle zurückzukehren. Beruhigt wartete sie in einer Nische des Gangs, bis die Turmuhren schlugen und sich die Schwestern auf den Weg in den Nonnenchor begeben würden.
Sie verharrte stumm und reglos wie eine Statue. Nur in ihrem Kopf arbeitete es. Wer mochte sie und ihre Aktivitäten entdeckt haben? Die Äbtissin des Klosters? Was Suor Francesca nicht glaubte. Da sie die Äbtissin an ihrem Gang erkannt hätte, konnte sie diese ausschließen. Suor Immacolata litt nämlich an einer schiefen Hüfte und humpelte. Die Fragen standen wie Drohungen in der Dunkelheit: Wer war die Person, die hinter ihr herschlich? Woher wusste sie von ihrer Entdeckung? Hatte man sie verraten?
Ihr einziger Trost war, dass sie rechtzeitig vorgesorgt hatte.
Die Glocke der Klosterkirche und der umliegenden Gotteshäuser rissen sie aus ihren Überlegungen. Ihre Schläge riefen zur Vigil, dem nächtlichen Stundengebet. Es musste also gegen zwei Uhr morgens sein. Alle Klosterkirchen der Stadt erwachten um diese Zeit zu einem gespenstischen Leben und weckten ihre Bewohner zum Dienst des Herrn. Bald würde ein vielstimmiger Choral gen Himmel steigen. Auch in San Lorenzo regte sich in den Zellen des Dormitoriums das Leben. Zuerst hörte Suor Francesca das Erwachen und Aufstehen der Schwestern wie anschwellendes Rauschen, dann wurden die Türen geöffnet. Licht brach in die Finsternis. Die Schwestern trugen anfänglich jede eine Kerze. Auch Suor Francesca holte einen Stumpen aus einer Tasche in ihrem Ärmel. Sie wartete, bis sich die Nonnen im Treppenabgang sammelten und zum Chor eilten, dann huschte sie aus ihrem Versteck und reihte sich, vom Abtritt her kommend, in die Prozession ein.
Alle Schwestern trugen ihr Licht vor sich her, die müden Mienen beleuchtet von den flackernden Kerzen. Als die Prozession kurz ins Stocken geriet, drehte Suor Francesca sich zu ihrer Nachbarin um und entzündete ihre Kerze an deren Flamme. Das fiel nicht weiter auf, da die zugigen Gänge die Lichter gerne löschten.
Während ihre Mitschwestern verschlafen zum Chor stolperten, spähte Suor Francesca aufmerksam umher. Doch sie konnte an keiner der Frauen Anzeichen eines nächtlichen Aufenthalts außerhalb der Zelle entdecken. Nur ihr eigener Chorrock zeigte den dunklen Ring ihres Aufenthalts im knietiefen Wasser.
Am Zugang zum Nonnenchor erwartete sie Suor Immacolata. Diese ließ die Nonnen an sich vorbei und betrat den Raum als Letzte. Nur zwei Gitter links und rechts des Altarbildes gaben den Blick in den Altarraum der Kirche frei. Suor Francesca konnte hören, wie der Hauspriester mit den Schellen die Lobgesänge einläutete, sehen konnte sie ihn nicht.
Suor Immacolata begann laut mit der Textstelle »Herr öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde«. Während sie inständig darum bat, dass der Herrgott ihren Mund über ihrem Geheimnis verschließen sollte, entriegelte Suor Ablata die metallenen Bügel der Neumenhandschrift des Klosters und schlug das Buch auf. Danach trat sie zurück in die Reihen der Frauen und intonierte den ersten Psalm zur Gebetseinladung.
Suor Francesca liebte die Hymnen, die Lobgesänge zur Vigil, wenn sich die hellen Stimmen der Frauen zu einem reinen Ton fanden und sammelten und hinausstrahlten in die Welt. Dahinein konnte sie ihre Kraft legen, und sie spürte ein wenig vom Atem Gottes durch sie hindurchströmen und in ihrem Innersten eine Saite anschlagen. Sie wusste, dass selbst zu dieser Zeit in der Kirche Menschen saßen und den betörenden Klängen lauschten, die den Kehlen der verborgenen Frauen entströmten. Der Chorgesang gehörte zum Opus Dei, zum Tagwerk der Schwestern an Gott, und war für Suor Francesca gleichzeitig eine Sünde, denn sie genoss die Melodien zum Lob des Herrn und der Mutter Kirche mit jeder Faser ihres Leibes.
Das Stundengebet hindurch blieb die Neumenhandschrift mit ihren großen bildgefüllten Initialen geöffnet. Mutter Ablata, die älteste Nonne im Kloster, blätterte um. Schlief sie ein, was öfters geschah, musste man sie wecken, denn einer Regel zufolge durfte niemand anderer außer der Äbtissin und Mutter Ablata die Handschrift berühren. Sie gehörte zu den kostbarsten Besitztümern des Hauses.
Suor Francesca ließ sich vom Gesang tragen. Nur zwischendurch, wenn der Priester vor dem Gitter seine Lesung nach den Psalmen abhielt, zählte sie die Schwestern. Fünfzig Frauen standen und knieten hier. Keine von ihnen fehlte heute.
Eine halbe Stunde später ließ das Zuklappen der Neumenhandschrift Suor Francesca aufschrecken und aus den Sphären des Klangs in das Dunkel des Nonnenchors zurückkehren. Die Schwestern um sie her begannen leise zu flüstern. Einige drückten sich an das Gitter, das den Chor abschloss, um hinaus in den Altarraum zu blicken.
»Habt Ihr gehört, Francesca? Man sagt, ein neuer Prediger habe heute Nacht gelesen. Er sei noch ganz jung!« Die Stimme neben ihr kicherte. »Sie schauen ihn sich gerade an.« Die Novizin neben ihr, Julia Contarini, ein Mädchen aus bestem venezianischem Hause, zupfte sie am Ärmel und zog sie zum Gitter. Doch draußen war nichts mehr zu sehen, die Lichter waren bereits gelöscht. Die Nonne spürte jedoch, dass dort vorn jemand stand und zu ihr hersah. »Francesca, Ihr seid ja ganz nass und schmutzig!«, zischte die Novizin empört. »Ganz schwarz! Seid Ihr durch den Kamin hinausgeritten und zur Vigil zurückgekommen? Oder übers Wasser gelaufen?« Wieder kicherte das Gör über seinen groben Scherz, doch Suor Francesca ließ sich nicht beirren.
»Hast du das nächtliche Stillschweigen vergessen?«, tadelte sie das Mädchen, das höchstens vierzehn Jahre zählte. Die Novizin senkte den Kopf. »Mea culpa!«, flüsterte sie und schlug sich mit der Faust gegen die Brust. Dann verschwand sie.
Suor Francesca wunderte sich über die Anzüglichkeiten der Novizin. Vor vierzig Jahren wäre sie niemals auf den Gedanken gekommen, eine der ehrwürdigen Mütter mit einer Hexe zu vergleichen. Doch diese überraschend blauäugige Contarini-Tochter zeigte vor nichts und niemandem Respekt und begehrte auf diese Weise gegen ihr Schicksal auf, das sie nach San Lorenzo verbannt hatte.
Während sie überlegte, welche Buße sie dem Mädchen auferlegen sollte, machte sie sich auf den Weg zu ihrer Zelle. Bereits nach wenigen Schritten wusste sie um die Strafe: Sie würde dem Mädchen das Tragen ihres Siegelrings verbieten und den goldenen Wappenring mit den drei schwarzen Streifen für eine Woche einziehen.
Dennoch hatte die Novizin recht. Sie musste ihre Kleidung waschen und vor allem eine trockene Kutte überziehen. Ihr nächtlicher Ausflug hatte seine Spuren hinterlassen. Doch dafür würde am Morgen Zeit genug bleiben. Anderes ging ihr im Kopf umher und verließ ihn nicht mehr. Welche der Nonnen konnte hinter ihr herspioniert haben? Oder waren Fremde eingedrungen? Erstaunt hätte es sie nicht, schließlich erhielten einige der Schwestern regelmäßig Besuch. Doch wie sollte ein Außenstehender von ihrer Entdeckung erfahren haben?
Vor ihrer Zelle blies sie die Kerze aus. Hinter der Tür brannte ein Licht, das der Ordensregel zufolge die ganze Nacht über zu leuchten hatte. Eine kleine Öffnung in der Zellentür sagte ihr, dass dies noch immer der Fall war. Als sie die Tür öffnete, erlosch das Licht, und Suor Francesca seufzte. Dieses Gebäude bestand aus einem einzigen Luftzug. Sie schloss die Tür hinter sich und griff nach Feuerstahl und Zunderschwämmchen. Wenn sie sich beeilte, konnte ein einziger Funke das Öl wieder entzünden.
Suor Francesca roch den Eindringling, bevor sie ihn sehen konnte.
»Wer ist da?«, hauchte sie in den schmalen Raum hinein. »Was wollt Ihr hier?«
Sie ging rückwärts, tastete nach der Tür. Doch die unbekannte Person war schneller. Sie glitt auf sie zu, als schwebe sie. Ein Stockhieb zischte an ihr vorbei und trieb sie in den Raum hinein.
»Bleib, Francesca, wir wollen uns unterhalten.« Die Stimme gehörte keinem Menschen. Sie besaß etwas Blechernes, klang melodisch und dennoch kalt. So hatte sie sich immer die Stimme des Herrn der Finsternis vorgestellt – und doch war sie ihr zutiefst vertraut.
»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Ihr habt hier nichts verloren. Was fällt Euch ein?«, versuchte sie sich zu verteidigen.
»Du hast ihn entdeckt? Du hast den Goldenen Weg entdeckt? Jede, die so lange in diesem Kloster haust wie du, weiß, was das bedeutet.«
Suor Francesca erschauerte. Die Nacht war so undurchdringlich, und die Stimme klang so monströs und bedrohlich, dass ihre Unterlippe unwillkürlich zu zittern begann. Woher wusste der Fremde vom Goldenen Weg?
Die Empörung über das Eindringen eines Mannes in ihr Allerheiligstes gab ihr den Mut zurück.
»Nichts weiß ich«, zischte sie. »Und jetzt raus aus dieser Zelle.«
Die Stimme des Eindringlings klang bedauernd und verbreitete dennoch eine eisige Kälte. »Das ist schade, denn dann weißt du nicht einmal, wofür du stirbst.« Die Stimme lachte so nahe an ihrem Ohr, dass es ihr unwillkürlich die Haare aufstellte. »Zuvor aber wirst du mir dein Geheimnis anvertrauen, Francesca.«
ERSTER TEIL DER SCHATTEN IM KREUZGANG
KAPITEL 1 Grau wischte der Morgen über den Himmel, als reinige er ihn vom Staub der Nacht. Die Gondel schaukelte aus dem schmalen Kanal des Bezirks San Polo hinaus und hinein in einen Wald aus Duckdalben, der sich die Reihen der Palazzi entlangzog wie Schilf. Die in die Stadt hineindrückende Flut nahm das Boot auf, und der Gondoliere hatte Mühe, dem schlanken Bootskörper die Richtung zu geben. Aus dem Rio delle Beccarie ging es hinaus auf den Canal Grande und auf die gegenüber liegende Seite. Kräftig krängte die Gondel, und nur die raschen, sicheren Ruderschläge ihres Führers verhinderten, dass sie umschlugen. Isabella und der Lehrling des Vaters mussten sich festhalten. Das Mädchen starrte düster auf die Einfahrt in den Rio San Giovanni, der sie zu ihrem Bestimmungsort führen würde.
»Mach kein so finsteres Gesicht, Kind. Isabella! Es wird nicht für ewig sein.«
»Ihr bleibt in Freiheit, Vater. Für Euch ist das keine Belastung.« Sie senkte den Kopf dabei und murmelte die Antwort in den Kragen ihres Mantels, den sie um sich geschlungen hatte. Noch bliesen die Seewinde am Morgen einen eisigen Atem in die Stadt, als müssten sie einen durch die nächtliche Freizügigkeit verdorbenen Ort lüften. Doch allein der Gedanke an ihre Zukunft ließ sie frösteln.
»Meine Schwester hat nach dir gerufen. Sie ist gebrechlich und benötigt jemanden, der ihr zur Hand geht. Das verstehst du doch? Außerdem wird es nicht für immer sein.«
Isabella Marosini betrachtete den Mann, der ihr gegenüber im Boot saß, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Ihr Vater bot eine stattliche Figur. Er führte eine gutgehende Offizin im Viertel San Polo; seine Druckerzeugnisse wurden in alle Welt verbreitet. Seine grauen Haare machten den Altersunterschied zwischen ihrem Vater und ihr offenkundig; Isabella war die Frucht einer dritten Ehe Giuseppe Marosinis, die dieser mit einer um viele Jahre jüngeren Frau eingegangen war. Tiefe Falten hatten sich links und rechts des Mundes eingegraben. Sie zeugten von einem Leiden, das ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Die rechte Seite schmerzte, und Giuseppe befürchtete, bald vor den ewigen Richter treten zu müssen. Da er diesen Jammer jedoch seit gut zehn Jahren in regelmäßigen Abständen der Tochter und seinem Sohn unterbreitete und sie so auf sein plötzliches Ableben vorbereitete, glaubte keines der Kinder mehr recht an dieses baldige Ereignis.
»Die Tante ist nicht gebrechlich. Sie ist erst Mitte fünfzig, aber sie bewegt sich wie ein junges Mädchen«, dachte Isabella. Sie getraute sich nicht laut und offen zu widersprechen, aus Angst vor Schlägen. Vater geriet außer sich vor Zorn, wenn eine einmal von ihm getroffene Entscheidung in Frage gestellt wurde. Seine Schwester hatte gerufen – und er folgte ihrem Wunsch. Isabella selbst hatte dabei nichts zu sagen. Vater schien sogar froh über diese Entscheidung zu sein, denn ihr Bruder Stefano hatte eben einen Meistertitel erworben, die Gesellenzeit beendet und würde wohl bald die Offizin des Vaters übernehmen. Endlich war die Nachfolge der Druckerei gesichert. Nur sie, Isabella, war keine Größe in diesem Handel. Sie verursachte Kosten, die mit dem Ruf der Offizin nicht Schritt halten konnten.
Missmutig trat sie gegen die Truhe, die Vater ihr ins Kloster mitgeben würde. Der Lehrling rutschte erschrocken zur Seite und brachte so den Kahn zum Schaukeln. Isabella störte sich nicht daran. Ihre Mitgift für eine Verehelichung betrug mindestens die Hälfte der Einlagen in die Druckerei. Weder der Vater noch der Bruder konnten und wollten dieses Handgeld für eine standesgemäße Hochzeit bezahlen. Da kam der Ruf der Tante gerade recht. Man brachte sie als Educanda, als Pensionatsschülerin, ins Kloster und ließ sie dort, bis sie zu alt für eine Heirat war. Schließlich würde ihr nichts anderes übrig bleiben, als die Profess zu nehmen und Nonne zu werden.
Als Isabella den Blick hob, schaukelte die Gondel bereits auf der Höhe des Klosters, eines auf das Wasser hinaus fensterlosen und düsteren Baus. Sie bogen nach Süden hin ab. Kurz blinkte die Sonne in den Kanal hinab und beschien ihr Gesicht, dann verschwand sie hinter dem Baukörper der Kirche, und eine kühle Frische ließ sie schaudern.
Sie fuhren auf eine Brücke mit drei Bögen zu, die sich über den Kanal spannte, den Ponte di San Lorenzo. Kurz sah Isabella auf. Mitten auf der Brücke stand, als erwarte er das berühmte Kreuzwunder, das sie in seine Arme führen würde, Marcello Tanti. Er trug einen schwarzen Mantel, der sich im Wind leicht bauschte, über einem weißen Rüschenhemd. Auf dem Kopf saß ein samtschwarzer Hut. So hatten sie sich vor nicht ganz zwei Monaten kennengelernt. Seinen rechten Handschuh hatte er abgestreift und winkte ihr mit der unbedeckten Hand. Unverwandt sah er zu ihr her. Vater saß mit dem Rücken zu ihm, sodass er ihn nicht sehen konnte. Isabella wagte nicht, den jungen Mann dort allzu lange zu mustern. Vor allem deshalb, weil der Lehrling neben ihr unverschämt zu grinsen begann und Vater Verdacht schöpfen konnte. Nicht einmal ein Zeichen durfte sie geben. Marcello war aus allen Wolken gefallen, als er von ihrem Bruder erfahren hatte, dass sie nach San Lorenzo gebracht werden würde. Vater hatte ihm verboten, sie zu verabschieden. Vermutlich hatte der alte Mann durch den Bruder von ihrer Verbindung zum jungen Tanti erfahren. Isabella senkte den Blick und starrte auf die Bilge im Boot. In ihr spiegelte sich ein Himmel, der keine Grenzen kannte und durch das Schwarz des Innenanstrichs grundlos erschien in seiner Tiefe.
Isabella biss sich auf die Lippen. Wenn sie selbst nicht am Schmerz der Trennung zugrunde gehen wollte, musste sie Marcello jetzt wehtun. Kurz sah sie hoch, blickte dem jungen Mann, der sich so sehr um sie bemüht hatte, in die Augen und schüttelte so langsam, dass es Vater nicht auffiel, den Kopf. Dann überließ sie sich ganz der Ankunft auf der Piazza.
Der Gondoliere brachte sie bis an den Anlegeplatz unterhalb der Brücke, ließ sie aussteigen und vertäute das Boot. Ihr Vater wies den Mann mit einem kurzen Befehl an, auf ihn zu warten, als er ihm half, die Wäschetruhe der Tochter auszuladen. Der Lehrling, der als Erster an Land gesprungen war, stand daneben und wusste nicht, wohin er greifen sollte, bis er mit einer Maulschelle von seinem Meister in die richtige Richtung gelenkt wurde und zupackte. Isabella tat der Kerl nicht leid. Er hatte sich die Ohrfeige wegen seines Grinsens verdient.
»Komm, Kind. Die Tante wartet.«
Giuseppe Marosini half Isabella aus dem Boot. Sie betrachtete die Hände ihres Vaters, als wollte sie sich noch nach Jahrzehnten daran erinnern können. Sie wirkten rau und waren von Schrunden überzogen. Die kräftigen Fingernägel gilbten bereits ein. Eine Altersfarbe, wie der Vater immer behauptete. Tatsächlich kam sie jedoch von den Tinkturen und Tuschen, von den Papieren und Bleilettern, mit denen der Vater tagtäglich zu tun hatte. Auch wenn er selbst längst nicht mehr Hand anlegte, die Verfärbungen hatten sich tief in die Haut eingegraben und würden nicht mehr verblassen.
Isabella lächelte bitter, als sie die Kirche mit ihrer achteckigen Kuppel vor sich aufragen sah, halb hinter anderen Gebäuden verborgen. Weit mächtiger und größer jedoch war der gewaltige, fast fensterlose Hauptbau des Klosters auf der anderen Seite des Platzes, als wolle er der Kirche ein Gegengewicht bieten. Zu zweit hatten Vater und der Lehrling die Truhe vor die Pforte geschleppt.
»San Lorenzo, eines der ältesten Frauenklöster in Venedig«, versuchte der Vater ihr das Gebäude zu erklären, obwohl sie das längst wusste. »Es wurde gegründet, da gab es die Stadt noch gar nicht.« Beinahe hätte Isabella laut hinzugefügt, deshalb nehmen sie auch Töchter aus mittlerem Hause auf. Die Mitgift nach einem Jahr als Educanda war nicht allzu hoch. Niedriger jedenfalls als die für San Zaccaria oder San Biagio e Cataldo.
»Es wirkt bedrohlich«, sagte sie leise und blickte die wuchtige Ziegelfassade der Kirche hinauf.
»Deiner Tante hat es dort gefallen. Sie ist gern in den Konvent eingetreten und hat sich wohl gefühlt. Sie freut sich auf dich.« Diesmal räusperte sich der alte Marosini, weil er seiner eigenen Lüge nicht glaubte. Jeder in der Familie wusste, wie sehr Vaters Schwester unter ihrem Schicksal gelitten hatte. Um die Druckerei erhalten zu können, war sie von Großvater Eugenio damals ins Kloster gesteckt worden. Gegen ihren Willen – und doch hatte sie sich dem Familienoberhaupt gebeugt. Selbst ein ehemaliger Verehrer aus reichem Hause war abgewiesen worden, weil man sich der Schande, keine Mitgift auszahlen zu können, nicht hatte aussetzen wollen. Außerdem war darüber gemunkelt worden, sie hätte ohnehin nur als Gespielin dieses Mannes geendet. Diesem Gerücht wollte man mit dem Klostereintritt einen zusätzlichen Riegel vorschieben.
Der Eingang zum Konvent lag im Sonnenlicht. Das dunkle Holz der Pforte glänzte. Die Meersalzkristalle, die der Wind an die Türen und Wände gesprüht hatte, glitzerten, als wären es Juwelen. Als ihr Vater den Löwenkopf aus Bronze in die Hand nahm und damit gegen die Tür schlug, staubten die feinen Kristalle und funkelten im Licht.
Eine unsichtbare Hand öffnete die Pforte.
Giuseppe Marosini zögerte, dann trugen der Lehrling und er zuerst Isabellas Truhe in den Vorraum und stellten sie dort ab. Danach kehrten sie vor die Pforte zurück. Dort wartete Isabella noch.
»Ich …«, begann ihr Vater unsicher und streckte ihr die Hand hin, doch Isabella wollte sich nicht verabschieden. Sie betrat den Vorraum, ohne sich nach ihrem Vater umzudrehen.
Die Tür schlug hinter ihr zu. Für eine kurze Zeit stand sie abgeschnitten von allem zwischen zwei Welten allein im Dunkeln, noch geblendet von der Sonne, bis sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Noch hatte sie die alte Welt nicht verlassen und ebenso die neue Welt nicht betreten. Hier, in dieser Zwischenwelt, hätte sie bleiben wollen, wenn es nicht ein derart trister Ort gewesen wäre: ein niedriger, kahler, sicher vor langer Zeit hell getünchter Raum, dessen Ecken von Spinnweben erobert worden waren.
Nur über dem Zugang prangten die farbigen Überreste eines Marienbildes. Es stellte die Verkündigung dar. Der Engel des Herrn kniete vor Maria. Die Muttergottes, überrascht vom Auftauchen des göttlichen Boten, erhob sich von einem Schreibpult, an dem sie gesessen hatte. Die abblätternde Farbe hatte aus dem gütigen Gesichtsausdruck der Gottesmutter eine verärgerte und gequälte Miene gemacht. Die Jungfrau bauschte ihren blauen Mantel auf, als wollte sie dem Engel den Blick auf ihr Pult verwehren. Sie hielt eine Schreibfeder in der Hand. Auf dem Pult lag der Schlüssel, der die Hausfrau auszeichnete. Zwischen dem Engel und Maria schlängelte sich ein Spruchband gen Himmel, dessen Inhalt kaum mehr zu lesen war, dessen erste Worte jedoch so gar nicht zum Bild passen wollten: »No… me tan…«, konnte sie lesen und wusste im ersten Moment nicht, wie sie ihn ergänzen sollte. Noli me tangere? Das passte allenfalls zur Geschichte des ungläubigen Thomas. Sie hätte einen anderen Spruch erwartet.
Doch ihr Aufenthalt in diesem Vorraum währte nicht lange. Ein Klacken beendete ihr Sinnieren und verkündete, dass ein Schloss entriegelt worden war. Die Tür vor ihr schwang auf, und eine Klosterschwester erschien. Ein mondrundes Gesicht sah ihr entgegen, gänzlich umrahmt von einem Schleier, der selbst das Kinn verdeckte. Dunkle, leicht vorgewölbte Augen musterten Isabella, und die vollen Lippen empfingen sie mit einem traurigen Lächeln, das sie sofort verunsicherte.
»Ich bin Suor Maria.« Eine Kopfbewegung lud Isabella ein weiterzugehen. Sofort war sie gezwungen, zu dem halb zerstörten Fresko hochzusehen. Maria als Verkünderin einer neuen Botschaft, die mit dem Eintritt ins Klosterleben in Einklang stand. Deshalb vielleicht auch dieser ungewöhnliche Spruch.
»Wo ist meine Tante? Wo ist Suor Francesca?«, löste sich eine Frage aus ihrem Mund.
Die Augen der Schwester weiteten sich, Tränen füllten das Weiß der Augenwinkel.
»Was … was ist denn? Was habt Ihr, Suor Maria?« Eine dunkle Vorahnung ließ Isabellas Stimme stocken. Sie musste schlucken, und ein säuerliches Gefühl wanderte langsam ihre Speiseröhre hinunter bis in den Bauch, um sich dort als Unbehagen breitzumachen.
»Es ist … nichts, Isabella Marosini. Es ist …« Plötzlich brachen Tränen aus den Augen der Nonne. Ihre Unterlippe zitterte und hinderte sie daran weiterzureden.
»Jetzt redet, Schwester!« Isabella wich keinen Fußbreit von der Stelle. Wenn sie jetzt gesagt hätte, sie wolle umkehren, dann hätte man die Tür zum Konvent hin geschlossen und die Außenpforte geöffnet, und sie wäre hinaus ins Sonnenlicht getreten.
»Es ist nichts …«, flüsterte die Schwester. Sie hatte sich wieder im Griff. »Folgt mir bitte. Suor Francesca …«, sie stockte, räusperte sich, dann fuhr sie fort, »Suor Francesca erwartet Euch bereits.«
KAPITEL 2 Padre Antonio schlug den Mantelkragen hoch und eilte an diesem unerfreulichen Morgen mit zügigem Schritt auf den Bischofspalast zu. Ihm war schlecht. Musste dieses Geschwür am Schaft Italiens, dieses Venedig, ausgerechnet mitten im Wasser liegen? Er hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, sich im Kloster San Giorgio Maggiore einzuquartieren. Beinahe eine geschlagene Stunde hatte der Gondoliere über das unruhige Wasser der offenen Lagune bis nach San Pietro di Castello gebraucht, und Antonio hatte davon jede einzelne Minute verflucht. Gott sei Dank hatte die Fastenzeit bereits begonnen und sein Magen war leer gewesen, ansonsten hätte er nicht nur einen elenden Anblick geboten, sondern sogar die Fische gefüttert. Er war geboren worden, festen Boden unter den Füßen zu spüren, nicht für diese schwankenden Särge, die sich über ein Element bewegten, das ihm eindeutig feindlich gesinnt war. Feucht, unruhig, abstoßend waren die drei Attribute, die er dieser Stadt geben konnte.
Dennoch war er ein Jäger – und sobald er mit zwei leichten Sprüngen die Treppe hinauf zum Portal sprang, witterte er seine Beute. Seine Sinne schärften sich. Der Campanile neben dem Gebäude war teuer mit weiß schimmerndem Marmor verkleidet, vermutlich istrischer Herkunft. Es ließ auf einen erlesenen Geschmack und eine gewisse Neigung zur Verschwendung schließen.
Padre Antonio wurde am Eingang von einem Mönch in brauner Kutte erwartet, der selbst bei diesen nasskalten Temperaturen barfuß ging. Sein unbestechlicher Blick erkannte sofort die gesäuberten Nägel und den gezupften Bart. Die bloßen Füße wirkten daneben wie eine trotzige Lüge.
»Padre Antonio?«, lautete die mehr gehauchte als gesprochene Frage des Benediktiners. Der Angesprochene nickte nur und wurde sofort ins Innere geführt. Er hatte diesmal kein Auge für die Fresken und Bilder, für die Teppiche und Wandbehänge, die den Palast ausschmückten und warm einkleideten. Er fror erbärmlich. Dieser Lagunennebel war ihm bis unter die Haut gekrochen und streckte immer noch seine kühle Hand in die Kleidung.
Als Nuntius des Papstes war er mit geheimem Auftrag zum Patriarchen von Venedig entsandt worden. Auch wenn der Patriarch in dieser Stadt eher eine untergeordnete Rolle spielte, da alle religiösen Feiern und Prozessionen vom Dogen angeführt wurden. Schon deshalb hatten die Herrscher dieses Lagunendorfes ihren Bischof in den Osten der Stadt verbannt. Weitab vom Palazzo Ducale, weitab von der eigentlichen Macht, dorthin, wo er jetzt im Frühjahr und später im Herbst den Stürmen und Unbilden des Meeres am stärksten ausgesetzt war. Selbst die Kriegswerft, das Arsenale, lag zwischen ihm und dem Zentrum Venedigs.
Padre Antonio wurde in einen Raum geführt, in dem ein Kaminfeuer vor sich hin glühte. Auch der Bischof schien zu frieren, denn er hatte es sich unter einer schweren Wolldecke bequem gemacht, die sogar seine Arme bedeckte.
Sein Blick erfasste sofort, dass dies eine reine Inszenierung war. Der Patriarch als alter Mann …
»Euer Eminenz?«, fragte Padre Antonio mit einer angedeuteten Verneigung.
Gerolamo Querine nickte gelassen, musterte ihn ausführlich und kramte dann aus dem Berg an Wolle seine Hand mit dem Ring hervor, damit der Besucher diesen küssen konnte. Padre Antonio beugte sich dem Spiel. Hieronymus Aleander hatte ihm tatsächlich etwas von einem ältlichen Mann mit Gicht und schlechten Zähnen erzählt, während vor ihm ein Kirchenfürst saß, der in der Blüte seiner Jahre stand. Vermutlich war der Bischof, an den sich der alte Bibliothekar noch erinnert hatte, längst verstorben und durch einen anderen ersetzt worden.
»Willkommen in der Lagunenstadt. Setzt Euch.« Querine deutete auf einen zweiten Sessel vor dem Kamin. Er betrachtete ihn neugierig von oben bis unten und verzog mürrisch die Mundwinkel. Vermutlich hatte er einen gesetzten und in die Jahre gekommenen Kardinal erwartet, keinen jungen Priester Mitte zwanzig. Padre Antonio setzte sich dennoch und schlug die Beine übereinander, was ihm erneut eine hochgezogene Augenbraue eintrug.
»Vielen Dank für die Begrüßung. Ich weiß, was Ihr sagen wollt, wenn ich vorab dieses Problem in den Mittelpunkt stellen dürfte. Doch der Heilige Stuhl wünschte eine junge Person, die – wie soll ich sagen – im Netz materieller Zuwendungen noch nicht allzu sehr verfangen ist, unabhängig von den familiären Zwistigkeiten der venezianischen Familien handeln kann und dem Heiligen Vater treu ergeben ist. Die Wahl Papst Clemens VII. fiel überraschend auf mich. Ich bin Absolvent der Universität Paris und Schüler des berühmten Hieronymus Aleander, habe in Bologna gelehrt und war stellvertretender Leiter der Vatikanischen Bibliotheken, berufen wiederum von Hieronymus Aleander, dem jetzigen Erzbischof von Brindisi und Nuntius am Hofe Frankreichs. Außerdem durfte ich – und ich denke, dass dies ausschlaggebend für diese Mission in Venedig war – den jetzigen Nuntius im Jahre 1521 nach Worms begleiten, wo mein Mentor in seiner Aschermittwochpredigt zu Recht gefordert hat, den Mönch Martinus Luther sofort und ohne Verhör mit dem Kirchenbann zu belegen.«
Padre Antonio lächelte verbindlich, lehnte sich zurück und versuchte möglichst neutral die Wirkung seiner Darstellung zu beobachten, die sich wie ein Frosthauch über die Stimmung im Raum gelegt hatte.
Der Patriarch schlug die Decke fester um seine Schultern, als friere ihn heftiger, dabei heizte der Kamin außerordentlich, sodass Padre Antonio bereits der Schweiß auf der Stirn stand. Alsdann blies er spöttisch durch die Nase.
»Ihr dient also einem Medici!«
»Dem Papst und Führer der Christenheit«, antwortete Padre Antonio ernst.
Der Patriarch nickte. »Ihr wisst, warum man Euch geschickt hat?«, begann der Bischof ohne Umschweife.
Natürlich wusste er, wozu er hier war. Die Venezianer hatten vor vier Jahren ein neues Amt eingerichtet, die Provveditori supra monasteri, ein Staatsamt mit besonderer Verantwortlichkeit für die Angelegenheiten vor allem der Nonnenklöster in Venedig. Klöster jeder Art unterstanden jedoch nicht dem Staat, sondern der Kirche – und damit dem Papst. Ein Grund mehr, sich die disziplinäre Aufsicht nicht aus der Hand nehmen zu lassen, den Venezianern ein wenig auf die Finger zu schauen und, wenn es nötig sein sollte, auch zu klopfen. Weil der derzeitige Patriarch dies mit zu wenig Strenge besorgte, schickte man ihn.
»Nein«, sagte der Pater dennoch kühl, »aber Euer Eminenz werden es mir erklären können.«
»Oh, ich dachte, Ihr würdet mir deuten, was Rom sich denkt.«
»Der Heilige Stuhl ergeht sich nicht gern in Rechtfertigungen.« Bedauernd hob Padre Antonio die Schultern. Zu leicht wollte er es dem Patriarchen nicht machen.
Querine zierte sich etwas, dann hob er den Blick. Etwas Lauerndes lag darin, und der Pater fragte sich, was der Bischof von ihm erwartete.
»Es gibt Klagen über den lockeren Umgang der Klöster mit dem Gelübde der Keuschheit und mit dem Gehorsam gegenüber der Observanz, Padre Antonio.«
Der Pater nickte, dann beugte er sich vor.
»So viel kann ich ergänzen, Eminenz: Man vernimmt bis nach Rom, dass Frauen sich der Fesseln der Klausur entledigen, sich Männer nehmen und nach dem neuen Ritus dieses Ketzers Luther heiraten.«
Der Bischof sah überrascht auf, und Padre Antonio registrierte eine unumwundene Verblüffung. Er hatte also anderes erwartet, dieser schauspielernde Patriarch.
»Es bestehen Befürchtungen«, fuhr er fort, »die Frauenklöster der Stadt könnten sich aufgrund ihrer Art des Umgangs mit der Berufung zur Keuschheit und dem Leben in der Klausur der Protestbewegung anschließen, die sich von Deutschland ausbreitet.«
Beinahe amüsiert unterbrach ihn Gerolamo Querine: »Oh ja, es herrschen Unzucht und Ungebärdigkeit unter den Frauen, die für unsere Mutter Kirche den Schleier genommen haben. Wir sind aufgerufen, die Unsitten, die sich unter den Nonnen verbreitet haben, aufzudecken und einzudämmen.« Er lächelte spöttisch. »Mit harter … äh … Hand …«
Dieses vorsichtige Abtasten langweilte Padre Antonio. Er würde einen Stachel setzen müssen. Einen schmerzhaften Dorn, der den Patriarchen aus seiner Decke holen würde.
»Man hat mich beauftragt, den Sumpf auszutrocknen, der sich in den Frauenkonventen gebildet hat, und für die Einhaltung der Regeln zu sorgen. Dafür müssen wir die Klöster besuchen! In Form einer Visitation.«
Der Patriarch, ein Mann in den Vierzigern, dessen straffe Züge von bester körperlicher Gesundheit berichteten, klatschte in die Hände. »Trinkt ein wenig Wein zum Aufwärmen. Esst einen Bissen. Fühlt Euch wohl.« Der barfüßige Mönch patschte herein, und Querine befahl Wein und Oliven und Schinken für ein bescheidenes Frühstück. »Wann wollt Ihr beginnen? Morgen? Übermorgen? Nächste Woche? Die Nonnen laufen uns ja nicht davon. In San Zaccaria, ganz hier in der Nähe? Oder in San Giorgio dei Greci im Bezirk San Marco? Wo wollt Ihr zuerst gegen diese Ketzerlehre das Kreuz des wahren Glaubens aufrichten?«
Padre Antonio wartete, bis aufgetragen war. Die Mimik des Patriarchen war wie eine Maske. Innerlich amüsierte sich der Pater. Er würde diese Maske schon zum Verrutschen bringen. Sie gaben einander Bescheid und ließen die Gläser klingen, dann erst gab er Antwort, das Glas in der Rechten.
»Wir sollten mit dem Frauenkloster San Lorenzo beginnen!«, sagte Padre Antonio und beobachtete dabei über den Glasrand hinweg die Reaktion des Patriarchen. Der hatte seinen Wein bereits an die Lippen geführt, verschluckte sich jetzt und musste mehrmals husten. Tatsächlich wurde ihm plötzlich zu warm, und die Decke fiel wie ein Schleier. Darunter kam der muskulöse Körper eines Mittvierzigers zum Vorschein, wie der Gesandte feststellte.
»Mit San Lorenzo? Warum nicht mit San Giovanni Laterano oder Spirito Santo?«, versuchte der Patriarch abzulenken, doch der Blick Padre Antonios ließ ihn verstummen.
Dies war die Auflage, die ihm sein Mentor Hieronymus Aleander mitgegeben hatte: Er müsse dem Patriarchen sagen, dass sie mit San Lorenzo beginnen sollten. Aleander hatte nicht gesagt, weshalb; er hatte nur angedeutet, dass sich in diesem Kloster Dinge täten, die bis über die Grenzen Venedigs hinaus Unruhe verbreiteten.
»Wir beginnen mit San Lorenzo. Zuvor solltet Ihr mir jedoch berichten, was es über dieses Kloster zu sagen gibt. Wir können das sicherlich bei unserer kleinen Mahlzeit besprechen, Euer Eminenz.«
Padre Antonio lächelte verbindlich und beobachtete den Bischof von Venedig aus dem Augenwinkel. Dann griff er zu und ließ sich das Essen trotz der Fastenzeit munden. Reisende mussten verköstigt werden – und er war ein Reisender. Nach seiner Schaukelreise in der Gondel hatte sich die Übelkeit verflogen und dem Hunger Platz gemacht.
Gerolamo Querine lehnte sich zurück. Er zog die Decke auf seinen Schoß, knäuelte sie zusammen und verbarg seine Hände darunter, was einen absurden Bauch aufwölbte. Verlegen räusperte sich der Patriarch mehrmals, dann erschienen die Hände wieder, und mit den Zeigefingern massierte er sich so lange die Nasenflügel links und rechts, bis Padre Antonio die Nerven verlor.
»Jetzt sprecht schon, sonst ist der Tag vorüber und Zeit zum Abendmahl.«
Wieder räusperte sich der Patriarch, dann hörte Padre Antonio ihn flüstern:
»Ich weiß nicht recht, was Ihr zu hören wünscht. San Lorenzo ist eines der ältesten Frauenklöster der Stadt. Gegründet im Jahre 854 nach der Geburt des Herrn. Es beherbergt vor allem Frauen aus venezianischen Adelsfamilien, doch auch wohlhabende Handwerker können ihre Töchter dort … dort … in den geistlichen Stand treten lassen«, begann er. »Allerdings geht von diesem Kloster der Ruf aus, recht großzügig im Umgang mit Gottes Geboten zu sein.«
Der Nuntius schob sich ungerührt zwei Oliven gleichzeitig in den Mund. Ein Zeichen der Maßlosigkeit, das er sofort bereute, als er sah, wie der Bischof seiner Gabel nachblickte. Tatsächlich hatte sich Padre Antonio bereits selbst ein erstes Bild von San Lorenzo gemacht. Deshalb hatte er letzte Nacht zur Vigil dort die Psalmen gelesen und einen Eindruck von dem Verhalten der Nonnen gewonnen, die in ihrem Chor geschnattert hatten wie die Gänse, statt ihrer Schweigepflicht nachzukommen. Aber war es dort wirklich schlimmer als in anderen Klöstern der Stadt?
»San Lorenzo ist eine gute Wahl!«, eröffnete er dem Patriarchen. »Das ehrwürdige Alter und das Ansehen des Klosters bieten eine gute Basis für die Observanz, die Missstände einen guten Hebel, um daran anzusetzen.«
»Dann beginnen wir eben mit San Lorenzo«, bestätigte dieser mit einem verkniffenen Zug um den Mund.
Padre Antonio war zufrieden und fuhr sich mit der rechten Hand durch sein dichtes schwarzes Haar. Sein Jagdinstinkt war geweckt. Er witterte Beute.
KAPITEL 3 Suor Maria bückte sich und hob die Truhe an einem der Griffe an. Isabella blieb nichts weiter übrig, als den zweiten Griff zu nehmen. Unhandlich war sie, jedoch nicht allzu schwer. Gemeinsam schleppten sie die Truhe ins Innere und stellten sie vor einer nachtdunklen Tür ab. Sie schien so alt zu sein wie das Kloster selbst und wies Risse und Schrunden auf, als wäre sie gealtert wie Haut.
Am Ende des Ganges stand eine Novizin, kenntlich an ihrem weißen Habit, und sah zu ihnen herüber. Sie lehnte gegen die Mauer und kaute unablässig auf ihrer Unterlippe herum. Unter ihren Augen wölbten sich dunkle Schatten, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Voller Neugier sah sie zu ihnen herüber.
Mit einem Wink der Hand verscheuchte Suor Maria die junge Frau, die sich nur widerwillig trollte.
Verlegen blickte Suor Maria Isabella an, als wolle sie sich für das Verhalten der Novizin entschuldigen, bevor sie klopfte. Dann trat sie ein. Zwei ehrwürdige Mütter saßen einander gegenüber im Raum an einem Tisch und begrüßten die Ankömmlinge. »Die Neue, Signora Artella!«, führte sie Isabella ein. Isabella horchte auf. Maria hatte »Signora« gesagt, nicht »Suor«. Vor ihr stand also eine Adlige aus bestem Hause, Artella Trevisan, wie sie von ihrer Tante wusste, die Priorin des Klosters und damit die Stellvertreterin der Äbtissin.
In den Gesichtern der beiden Frauen hatte die Zeit hinter Klostermauern, hatten Askese, Gebet und der Gram über die verlorene Freiheit tiefe Furchen hinterlassen und fallende Mundwinkel erzeugt. Isabella wunderte sich, dass sie von Suor Maria der Signora Trevisan und nicht der Äbtissin angekündigt worden war. Doch sie wusste aus Erzählungen, dass die Hierarchien in den Frauenklöstern eigenen Gesetzen folgten.
Mit einer Stimme, die aus einem Grab hätte stammen können, begann die andere, kleiner, schrumpliger als Signora Artella, zu sprechen. »Ich bin die Äbtissin des Klosters. Suor Immacolata.« Sie reckte das Kinn vor und musterte Isabella von oben bis unten. Dann verschränkte sie die Finger ineinander und fuhr fort. »Du bist Isabella Marosini, die eheliche Tochter Giuseppe Marosinis und seiner Ehefrau Anna?« Isabella nickte nur. »Getauft und gefirmt im wahren Glauben der heiligen Kirche?« Wieder nickte Isabella. »Du bist hier, um in den geistlichen Stand einzutreten!« Das war keine Frage, wie Isabella bemerkte, sondern eine Feststellung. »Die Truhe enthält deine cassa fürs erste Jahr? Sechzig Dukaten!« Jetzt schüttelte Isabella den Kopf.
»Die Dukaten fürs erste Jahr habe ich hier«, sagte sie und zog einen Beutel hervor, den sie in den Falten ihres Rockes verborgen hatte. Sie hielt ihn unschlüssig in der Hand. »Außerdem bin ich nur als Pensionatsschülerin angemeldet, als Educanda!«, betonte Isabella. Signora Artella, die bislang nur stumm dabeigestanden hatte, zitierte sie mit dem Wink des Zeigefingers zu sich her und hielt die Hand auf. Zögernd legte Isabella das Geld in die faltige Hand der ehrwürdigen Mutter.
Vater hatte ihr dieses Vorgehen angeraten, und der hatte wiederum von seiner Schwester erfahren, dass sie so ihre Truhe undurchsucht behalten und mit in ihre Zelle nehmen konnte.
»Vergiss deine Familie und das Haus deines Vaters. Leg die Welt ab, und nimm das neue Gewand der Stille und des Trostes. Es ist noch keine Einkleidung, sondern nur ein Zeichen der Demut. Du entsagst für die vorgeschriebene Zeit der Welt. Suor Maria. Die Schere.«
Jetzt kam der für Isabella schlimmste Teil. Nicht die Tatsache fürchtete sie, dass sie statt ihres weltlichen Kleides ein Habit tragen musste, nicht den Umstand, dass sie ihre Haare unter einem Tuch verbergen musste, sondern allein das Kürzen der Haare. Ihre langen dunklen Locken mussten fallen, wenn sie auch nicht wie eine Novizin geschoren würde. Allein der Gedanke daran ließ die Tränen schießen. Es war, als sprängen sie ihr geradezu in die Augen, obwohl sie als Educanda weder ein vorläufiges Gelübde noch eine Profess abzulegen hatte.
Suor Maria nestelte an ihrem Habit, und Isabella erkannte im Wasserschleier ihres verweinten Blicks, wie sie unter der Kutte eine Metallschere hervorzog und hinter sie trat. Als sie nach den ersten Strähnen griff, riss sich Isabella los.
»Nein!«, schrie sie unwillkürlich. »Nicht die Haare. Nicht die Locken!«
Doch Suor Maria hielt sie fest. Mit einem kräftigen Schnitt fielen die ersten schwarzen Haare. Als Isabella die dunklen Strähnen am Boden sah, begehrte alles in ihr auf, was sie bis dahin hinuntergeschluckt hatte, was sie um des Vaters willen zurückgehalten hatte.
»Niemals!«, schrie sie und riss sich los. Dann stürmte sie zur Tür, die sie mit einer bis dahin noch nie an sich wahrgenommenen Kraft aufriss, dass sie gegen die Wand krachte. Sie stürmte nach draußen, wollte wieder zurück in den Vorraum, stellte jedoch fest, dass der Zugang abgeschlossen war und die Tür keine Klinke besaß. Sofort drehte sie sich um und hastete den Gang entlang, der nach wenigen Metern auf einen Quergang traf, welchem sie rechter Hand folgte. Links und rechts gingen Türen ab, doch alle waren ohne Drücker zum Öffnen. Ihr war, als müsste sie endlos laufen. Links und rechts und rechts und links.
Urplötzlich stand die junge Frau vor ihr, die sie beim Eintreten bemerkt hatte, und versperrte ihr den Weg. Isabella wollte sie beiseiteschieben, doch die Kindfrau lächelte sie merkwürdig vertraut an und berührte ihre Hand nur sanft mit den Fingern.
Sie musste jünger sein als Isabella, denn ihr Gesicht wirkte zart und engelhaft. Die Augen blickten kindlich ernst. Sie legte den Finger auf die Lippen und deutete auf eine der Türen, ohne ein Wort zu sagen. Isabella sah den Türgriff undeutlich. Sie stürzte auf den Durchgang zu, drückte die Klinke und stand unversehens in einer Kapelle.
Durch den Tränenschleier hindurch, der alles vor ihren Augen verschwimmen ließ, erkannte sie einen schlichten Holzsarg, in dem eine Leiche aufgebahrt lag. Auf grobes Linnen gebettet ragte ein kleines Gesicht daraus hervor, spitz und mit halb geöffneten Augen.
Isabella musste sich mit dem Ärmel über ihre Augen wischen, bevor sie glaubte, was sie sah. Dabei gerieten ihr einzelne abgeschnittene Haare in die Augen, sodass sie das eine schließen musste, weil es noch schlimmer zu tränen begann.
»Tante?«, flüsterte sie und ging einen Schritt näher. Es konnte kein Zweifel bestehen. »Suor Francesca?« Sie hatte die Tante meist nur durch das Gitter des Besuchszimmers gesehen, doch sie kannte die Schwester des Vaters gut genug, um alle Zweifel zu zerstreuen. Das musste Suor Francesca sein. »Tante!«, wiederholte sie lauter, doch die Gestalt im Sarg rührte sich nicht. Die Hände der Leiche lagen nicht, wie sonst üblich, gekreuzt auf ihrem Bauch, sondern reckten sich noch in Leichenstarre halb aus dem Sargtrog. Isabella nahm eine Hand in die ihre und drückte sie sanft, doch die Kälte in diesen Fingern ließ sie aufschreien. Es war der Tod, den sie berührt hatte.
Als würden ihre Augen von einem Moment auf den anderen hin austrocknen, sah sie plötzlich den Leichnam klar und schonungslos vor sich. Sie sah eine blaue Zunge, sah Schmutz unter den Fingernägeln und auf der Kleidung, sah ihren angstvoll verzogenen Mund, als hätte die Verstorbene im Augenblick des Todes den Teufel persönlich erblickt, sah das Druckmal am Hals – und roch endlich auch den Leichnam. Er stank nach Urin und Fäkalien, was bedeutete, dass er noch nicht gewaschen worden war.
Isabella sah sich nach dem Mädchen um. Das war verschwunden, als wäre Isabella nur einer Erscheinung aufgesessen. Sie spürte noch immer die warme Berührung der Finger auf dem Handrücken.
»Hier seid Ihr, Isabella Marosini. Ihr dürft hier nicht sein. Kommt mit. Das ist kein Anblick!«
Suor Maria war hinter sie getreten.
»Das ist meine Tante. Meine Tante!«, wiederholte Isabella, fühlte sich jedoch im Moment so schwach, dass sie sich willenlos von diesem toten Körper wegführen ließ. Suor Maria schloss hinter ihr die Tür zur Kapelle und führte sie zurück in den Raum, in dem die Umkleidung stattfand.
Auf dem Weg dorthin trat Suor Maria vor Isabella hin und sah ihr ins Gesicht.
»Jetzt hört mir genau zu, Isabella Marosini. Ihr habt eben nichts gesehen. Versteht Ihr mich? Ihr habt nichts und niemanden gesehen und werdet folglich mit niemandem darüber reden! Versprecht es mir.«
Mechanisch nickte Isabella. Was sollte das? Sie wusste doch, was sie gesehen hatte. Warum sollte sie ihre Tante leugnen? Nervös sah sie sich um. Wo war das Mädchen, das sie in die Kapelle geleitet hatte?
Suor Maria schien ihre Gedanken zu erraten und drückte ihr das Handgelenk, sodass sie vor Schmerzen aufschrie. »Nichts habt Ihr gesehen, wenn Euch Euer Leben lieb ist!«, zischte sie. Dann zog sie Isabella hinter sich her.
Erst kurz vor dem Raum, in dem sich die Nonnen befanden, kam Isabella zu sich.
»Warum?«, fragte sie nur, doch Suor Maria legte einen Finger auf die Lippen und schüttelte den Kopf.
»Später!«, flüsterte die Nonne.
Der weißliche Riss in der Tür stammte von Isabellas Ungestüm. Es war eines der vielen Zeichen der Marter, mit dem dieses Türholz versehen worden war. Die beiden alten Nonnen saßen ungerührt am Tisch wie bei ihrer ersten Begegnung. Zu oft schon hatten sie solch einen Anfall erlebt, als dass dieser ihnen die Ruhe geraubt hätte.
Isabella bemerkte beim Eintreten einen kurzen Blick des Einverständnisses zwischen Suor Maria und den beiden Alten. Die junge Chornonne schloss kurz die Augen und bewegte den Kopf einmal hin und her.
Signora Artella lächelte sie wohlwollend an, als tadle sie das Verhalten eines kleinen, noch unverständigen Kindes, ohne es dafür ernsthaft zu bestrafen.
»Du wirst dich daran gewöhnen, Kind«, sagte sie sanft. »Es ist warm unter der Haube. Du wirst sehen, es ist bequemer so.«
Isabella biss die Lippen aufeinander. Sie wollte nicht verständig sein, wusste jedoch keinen Ausweg.
»Du wirst für deine Unbotmäßigkeit um Vergebung bitten und Buße tun!«, ergänzte die Äbtissin wie nebenbei. »Fahrt fort!« Der letzte Satz war an Suor Maria gerichtet, die bereits wieder eine Haarsträhne in der Hand hielt und mit dem Abschneiden der Locken fortfuhr. Jede Strähne, die zu Boden fiel, bereitete Isabella Schmerzen, sodass ihr die Tränen über die Wangen liefen und Gesicht und Halskragen benetzten. Als Schwester Maria fertig war, streifte sie ihr ein Schleiertuch über, und sie durfte sich in das weiße Gewand der Educanda kleiden.
»Du kannst gehen«, befahl die Äbtissin und schickte sie mit einer Handbewegung nach draußen.
»Suor Immacolata, darf ich eine Frage stellen?«, drängte Isabella, bevor sie nach draußen geleitet wurde. Die beiden Alten sahen sich an, dann nickte die Äbtissin. »Ich … meine Tante … wollte mich … sie hat gesagt, sie erwartet mich … Suor Francesca. Wo finde ich sie?«
Alarmiert wechselten die beiden Nonnen Blicke, dann räusperte sich die Äbtissin.
»Mein Kind. Wir müssen stark sein in unserem Glauben. Du wirst die Zelle deiner Tante beziehen. Wenn das erledigt ist, erwarte ich dich hier im Priorat. Zusammen mit Suor Maria. Sie wird dich durch das Gebäude führen. Bedenke, dass in diesen Mauern die Regel des Schweigens gilt. Nur was unbedingt gesprochen werden muss, darf in Redezimmern wie diesem besprochen werden. Geh jetzt!«
Isabella bewegte sich keinen Fußbreit von der Stelle.
»Was ist mit meiner Tante?« Die Schwester zerrte sie am Ärmel und wollte sie mit sich führen, aber Isabella widersetzte sich.
Signora Artella, die sich bereits wieder zur Äbtissin hinübergebeugt hatte, um mit ihr vertraulich zu sprechen, unterbrach sich und sah auf. Ihr Ton klang scharf. Nichts vom mütterlichen Verständnis für eine Verfehlung war geblieben. »Du wirst dich geißeln, Kind. Gehorsam ist unsere höchste Tugend. Nichts auf dieser Welt gibt es, das uns den Gehorsam verweigern lässt, es sei denn der Tod persönlich.«
Isabella war wieder den Tränen nahe. Doch diesmal gab sie dem Zerren der jungen Nonne nach. Die geleitete sie nach draußen und schloss hinter ihnen die Tür. Dann nahmen die beiden Frauen die Griffe der Truhe in die Hand, und Suor Maria führte sie den Gang entlang und sofort durch die nächste Tür nach links.
»Was ist mit Suor Francesca?«, platzte Isabella heraus. Doch Suor Maria legte die Hand an die Lippen und deutete nach oben. Zwischen Decke und Wand entdeckte Isabella kleine Schlitze. Suor Maria legte die Hand ans Ohr und zog die Augenbrauen hoch. Isabella verstand sofort. Das waren Horchgänge, die in andere Räume führten. Mit ihnen konnte überwacht werden, ob und was im Flur gesprochen wurde.
Für einen kurzen Moment wurde ihr ganz schwach in den Beinen, als sie begriff, wie sehr hinter diesen Mauern in ihr Leben eingegriffen wurde. Sie setzte die Truhe ab und holte zuerst einmal tief Luft. Dann stützte sie sich an der Wand ab. Der Schwindel, der sie kurz überfallen hatte, verschwand langsam.
Bald darauf tappten sie, die Truhe zwischen sich, stumm durch die Gänge. Nur einmal glaubte Isabella am Ende des Flurs die Gestalt der Novizin vorüberhuschen zu sehen; sie konnte sich jedoch ebenso gut geirrt haben.
Sie stiegen die Treppen ins nächste Stockwerk empor und hielten endlich vor einer Tür. Diese enthielt keinen Riegel, keinen Türgriff, sondern wurde nur einfach aufgestoßen. Isabella betrat nach Suor Maria einen Raum, der sich als länglicher Schlauch erwies. In einer Nische neben der Tür brannte eine kleine Öllampe. Ansonsten wurde die Zelle durch ein Fenster erhellt, das erst auf Kopfhöhe begann, sodass man nicht hinaussehen konnte. Ein Stuhl, ein Betschemel und eine Pritsche ergänzten das Mobiliar. In einem Winkel über dem Schemel hing ein Kreuz, darunter lag aufgeschlagen ein Gebetbuch. Der ganze Raum wirkte düster und bedrückend.
»Das Licht muss Tag und Nacht brennen«, flüsterte Suor Maria. »Das Fenster geht auf den Kreuzgang hinaus. Wenn du den Stuhl unter das Fenster stellst, kannst du nach draußen sehen.«
Eines wusste Isabella sofort, als sie diesen Raum betreten und ihre Truhe unter das Bettgestell geschoben hatte: Hier würde sie nicht bleiben!
»Meine Zelle ist übrigens direkt nebenan.« Die Nonne klopfte mit dem Knöchel gegen die Wand gegenüber dem Bett.
Isabella setzte sich auf die Pritsche. Die strohgefüllte Decke knisterte unter ihrem Gewicht, und das grobe Leinen biss ihr in die Haut. Maria ließ sich ihr gegenüber auf dem Schemel nieder. Erst jetzt bemerkte Isabella, dass sie keineswegs schlank war, sondern trotz ihrer Jugendlichkeit einen kräftigen Körper besaß. Vermutlich deshalb schmückten sie keinerlei Sorgenfalten, und ihr Teint wirkte straff und jugendlich.
»Hier hat Suor Francesca gehaust? Was ist mit ihr geschehen?« Auch sie flüsterte bereits.
Suor Maria beugte sich vor und bedeckte ihr Gesicht mit den Händen, als wolle sie nicht, dass Isabella darin lesen konnte. Doch Isabella sah sie nicken.
»Sie ist hier gestorben«, sagte Suor Maria. »Diese Nacht. Mein aufrichtiges Beileid.«
Isabella hatte es vermutet und sah jetzt auf ihre Hände, die sie im Schoß gefaltet hatte. Überrascht stellte sie fest, dass ihre Finger der rechten Hand schwarz waren, als hätte sie in Ruß gegriffen. Sie schaute umher, ob sie sich irgendwo die Hände waschen konnte, doch weder ein Stück Stoff noch Wasser oder Seifenlauge standen wie bei ihr zu Hause bereit. Woher nur dieser Schmutz kam? Es war eine Art fettiger, hartnäckiger Ruß, der sich nicht abreiben ließ, sondern abgeschrubbt werden musste.
»Wo kann ich mich waschen?«, fragte sie.
Suor Maria blickte auf und sah Isabella amüsiert an. Die zeigte ihre schmutzigen Finger vor. Die Nonne lachte.
»Du scheinst nicht nur den Geist des Widerstands von draußen mit hereingetragen zu haben, sondern auch den Ruß der Welt. Ich führe dich. Dann musst du ins Priorat.« Die Nonne senkte ihre Stimme. »Die Mutter Oberin wird dir vermutlich verheimlichen wollen, dass deine Tante diese Nacht verstorben ist. Glaub ihr kein Wort. Suor Francesca hat schrecklich ausgesehen, als sei ihr der Gottseibeiuns persönlich erschienen.«
Bevor Isabella noch das Wort an sie richten konnte, schlüpfte Suor Maria aus der Tür und auf den Gang hinaus.
»Woher wisst Ihr das?«, fragte sie in die Leere hinein.
KAPITEL 4 Die Äbtissin empfing sie in ihrem Amtszimmer.
Lange musste sie vor einem dunklen Schreibtisch stehen bleiben, bis die ehrwürdige Mutter einen Brief zu Ende gelesen hatte und sich ihr zuwandte. Jetzt, da die Priorin nicht mehr neben ihr saß, gelang ihr sogar ein Lächeln. Ihr Gesicht, von Runzeln durchzogen, wirkte dabei wie ein zu lange gelagerter Lederapfel. Doch Isabella hatte das Gefühl, die Ordensfrau wollte sie nicht täuschen und meinte es ehrlich.
Vom Kirchturm her erklang die Morgenglocke und läutete zur achten Stunde seit Mitternacht.
Das Priorat schüchterte ein. Ganz in dunklem Holz gehalten, drückten zwei schwere Dokumentenschränke in den Raum. Die Wucht des Schreibtischs, hinter dem die Äbtissin ein wenig verloren wirkte und beinahe verschwand, ließ empfindsame Gemüter zurückschrecken. Nur die schiere Größe des Raums hielt dagegen.
»Kind«, begann die Nonne und ließ Isabella stehen, obwohl vor dem üppigen Sekretär ein leerer Stuhl stand. »Du wirst deine Tante in der nächsten Zeit leider nicht sehen können. Wir Frauen im Dienst der Kirche werden immer wieder gebraucht. Wir sind Pflegerinnen des Körpers und oftmals auch der Seele. Auf Torcello, wo unser Orden mit San Giovanni Evangelista eine Niederlassung besitzt, wütet eben eine Krankheit – und Suor Francesca wurde dorthin geschickt, um zusammen mit vier weiteren Schwestern die Pflege zu übernehmen. Es wird also eine ganze Weile dauern, bis sie zurückkehrt. Sie hat dir hier diesen Brief geschrieben, damit du nicht allzu sehr beunruhigt bist über ihre Abwesenheit. Ich sollte ihn dir aushändigen.« Suor Immacolata schob ein gefaltetes Schreiben über den Tisch. Das Siegelwachs war erbrochen, das Papier geöffnet worden.
»Aber. Ihr habt ihn ja … gelesen!«, fuhr sie die Oberin an und verschloss dann mit der Hand den Mund, weil sie selbst bemerkte, wie unziemlich dies war.
»Es ist die Pflicht der Äbtissin, über alle Vorgänge im Kloster Bescheid zu wissen. Briefe, die ein- und ausgehen, werden von mir gelesen, wenn sie Verwandten zugedacht sind.«
Isabella blieb nichts weiter übrig, als sich dem zu beugen. Schließlich konnte sie sich nicht dagegen wehren. Was sie im Moment jedoch stärker beunruhigte, war die Tatsache, dass die Äbtissin sie belog. Mit eigenen Augen hatte Isabella ihre Tante in ihrem hölzernen Sarg liegen sehen. Gleichzeitig hämmerte immer wieder Suor Marias Warnung in ihrem Kopf: »Glaub ihr kein Wort!« Allerdings hätte sie zu gerne eine Erklärung für diesen Satz bekommen. Doch Suor Maria hatte sie hierher begleitet und dabei kein Wort mehr gesprochen. Jetzt wartete sie vor der Tür.
»Solange du nicht die zeitlichen Gelübde abgelegt hast, wirst du bei deinem weltlichen Namen genannt, Isabella«, fuhr die Äbtissin fort. »Du wirst von der Priorin, Suor Artella, in die Pflichten einer Dienerin des Herrn eingewiesen werden – zusammen mit der Novizin Julia Contarini. Um deine Hoffart zu mildern und die Gedanken an das Leben vor den Mauern dieses Klosters durch ein wenig Arbeit aus deinem Kopf zu verbannen, wirst du als Educanda bis zu deiner öffentlichen Einkleidung zwei Aufgaben übernehmen: Einmal benötigt Suor Maria in der Küche eine weitere Hand, und für die Sauberkeit im Chorraum und in den Gängen des Zellentrakts wirst du Suor Ilaria ersetzen, die ebenfalls nach Torcello gegangen ist. Suor Maria wird dich instruieren. Halte dich an die Regeln dieses Hauses, dann wirst du ein erfülltes Leben finden, Kind.«
Die Äbtissin senkte den Kopf und begann wieder in ihrem Brief zu lesen. Unschlüssig stand Isabella vor dem Schreibtisch und wartete auf weitere Anweisungen. Als Suor Immacolata jedoch keine Anstalten machte, sie anzusprechen, fühlte sie sich entlassen, knickste und wollte sich eben umdrehen, als die Äbtissin sie anfauchte. »Isabella!« Sie fuhr herum und blickte in ein Gesicht, aus dem alle Freundlichkeit gewichen war. »Wir stehen im Dienst einer höheren Aufgabe. Unbedingter Gehorsam ist keine Tugend, die man nachlässig übergehen kann, wenn man sich unbeobachtet fühlt. Gehorsam ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir die in uns gestellten Erwartungen erfüllen und die uns übertragene Aufgabe durch die Jahrhunderte tragen können.« Suor Immacolata hatte sich in Rage geredet. »Ich habe dich nicht entlassen, folglich hast du nicht das Recht, dich aus dem Zimmer zu begeben!«
»Entschuldigt!«, murmelte Isabella und knickste tief. Sie war so erschrocken über diesen Stimmungswandel der Äbtissin, dass sie sich verkrampfte und schief stand. So wartete sie, bis die Äbtissin einen langen Seufzer ausstieß und sie nach draußen winkte.
»Geh jetzt. Suor Artella wird dich holen lassen.«
Isabella lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür, als diese hinter ihr ins Schloss gefallen war. Vom Priorat aus hatte man einen Blick auf den Kirchturm von San Lorenzo, der Klosterkirche – und die Uhr, die ihren Stundenzeiger über das Zifferblatt schob, hatte sich kaum bewegt. Er stand noch immer auf acht Uhr. Obwohl sie selbst das Gefühl gehabt hatte, eine halbe Stunde vor der Äbtissin gestanden zu haben, konnten es kaum mehr als fünf Minuten gewesen sein.
Jetzt, aus der übermächtigen Bedrückung des Zimmers und Suor Immacolatas Stimmung herausgelöst, stieg die Frage wieder in ihrem Kopf nach oben: Warum hatte die Äbtissin sie belogen? In ihrer Hand raschelte das Papier. Der Brief der Tante. Sie würde ihn später lesen. Jetzt hatte sie anderes vor. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass Suor Maria fehlte. Hatte sie nicht warten sollen? In Isabella keimte sofort ein Gedanke: Sie musste noch einmal in die Kapelle.