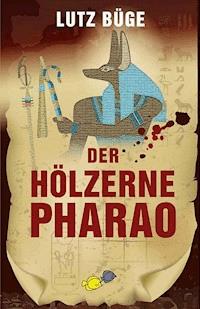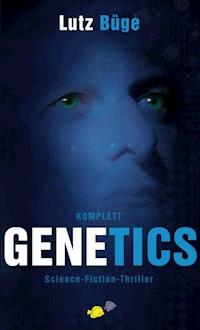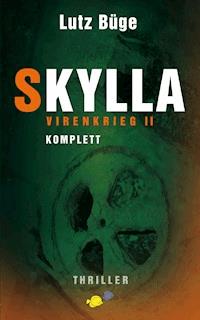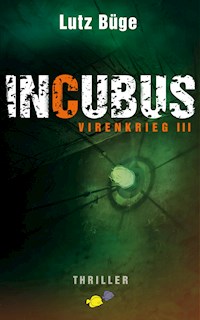
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ybersinn-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Virenkrieg
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Im Jahr 2024. Der Genetiker Jan Metzner bekommt es mit dem kniffligsten Fall seines Lebens zu tun: Er muss ein Mittel gegen eine mörderische Biowaffe finden. Derweil sind die USA im Wahlkampf, als die Wahrheit über das JFK-Attentat enthüllt wird. Hier entscheidet sich die Zukunft!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Ähnliche
Virenkrieg III
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
Inhaltsverzeichnis
Vorspann
Prolog 1
1. Kapitel: Leistungsträger
2. Kapitel: Hiroshima
3. Kapitel: Fünf Prozent
4. Kapitel: Bunkerkoller
5. Kapitel: Dreamland
6. Kapitel: Bienenstich
7. Kapitel: Verhaftet
8. Kapitel: Schlüsselerlebnis
9. Kapitel: Biozid
10. Kapitel: Wahltag
Epilog
Impressum
Projekt Enduring Freedom – Phase 1
Nahziel: Destabilisierung der USA
Ziel: Stabilität durch Machtübernahme
Operationsplan (Übersicht):
Stufe 4: Häufung von Krisenszenarien. Überreizung und Überforderung der Öffentlichkeit. Förderung der Gefühle: Hilflosigkeit, Ausgeliefertsein, Wut (FAD und IAD treffen Vorkehrungen; Details siehe Aktionspläne Anlage 2).
Stufe 5: Eskalierende Maßnahme. Bevorzugt: Ziel in den USA oder prominentes Ziel außerhalb, z.B. US-Botschaft in Berlin (Details siehe Aktionspläne Anlage 3). Vorbereitung eingeleitet. Heiße Phase nicht vor 2023.
Stufe 6: Druck verstärken, Regierungskrise via Online-Netzwerke forcieren. Unterstützung durch SCOUT Communications (Details siehe Anlage 3). Handlungsbereit, wenn Regierung handlungsunfähig, Bevölkerung wütend, keine Alternativen.
Übergang zu Projekt Free-Mind-Phase 3 (Eliminierung der US-Führungsschicht, Details siehe Konzeptpapier Projekt Free Mind) und zu Projekt Enduring Freedom – Phase 2
Auszug aus den SCOUT-Protokollen,April 2017
Prolog 1
13. Januar 2017
Amazonischer Urwald, Brasilien
8°28‘ Süd, 72°46‘ West
„Sind wir auf Sendung? Satellitenverbindung steht? Zentrale, hört ihr uns? Hallo Fletcher. Alles wie besprochen? Okay! Wir filmen den Abstieg, und ich rede einfach weiter und erzähle, was wir machen. Hier sind alle ziemlich aufgeregt. So was sieht man nicht jeden Tag. Pedro, Juan, sitzen eure Handschuhe? Helme? Atemmasken? Sauerstoff an? Das sind keine Hochsicherheitsanzüge, vergesst das nicht. Es kann losgehen. Denkt dran, Leute: Vorsicht da unten!
Fletcher, hörst du? Fürs Protokoll: Wir befinden uns unweit der Grenze zu Peru in Brasilien, im Quellgebiet des Juruá im dichten Regenwald. Luftfeuchtigkeit hundert Prozent, wir sind komplett durchgeschwitzt. Vor uns liegt etwas, was die Einheimischen Tezatipaca nennen. Wir sind vorgestern auf sie gestoßen. Ich dachte zuerst, ich höre Nahuatl, die alte Sprache der Azteken, aber wir sind weit von Mexiko entfernt. Die Azteken kannten einen Gott namens Tezcatlipoca, den Gott der Nacht. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, ich rede einfach nur weiter. Ist gut gegen Nervosität.
Die Einheimischen haben Respekt vor Tezatipaca, sogar Angst. Sie sind kaum mehr als hundert Leute, friedlich, sehr zurückhaltend. Sie hatten schon Kontakt mit der Zivilisation. Einer von ihnen, ein Bursche namens Idixco, hat in Quito gelebt und konnte halbwegs dolmetschen. Er sagte, seine Leute würden Tezatipaca meiden. Angeblich wohnt hier das Böse, das Ende, der Tod. Wenn wir so was hören, spitzen wir natürlich die Ohren. Fletcher, ihr wisst, was ich meine.
Vorhin sind wir an einer Art Gestell oder Geflecht aus Ästen und Blättern vorbeigekommen, das Idixcos Leute installiert haben, offenbar eine Art Altar. Ich nenne es mal so, aber wenn jemand von euch drüben in Arkansas das Ding lieber als ein Gerüst von krummen Ästen bezeichnen möchte, die mit Pflanzenfasern zusammengebunden wurden, widerspreche ich nicht. Idixco hat uns bis dorthin geführt, aber weiter wollte er nicht gehen. Als würde der Altar eine Grenze markieren. Idixco schien Angst zu haben. Wir sind dann ohne ihn weitergegangen.
Was hier vor uns liegt, ist ein riesiger, finsterer Kessel, ein Loch im Grund des Dschungels, vermutlich eine Grotte, deren Decke eingestürzt ist. Ich schätze den Durchmesser des Kessels hier oben auf hundert Meter. Schwer zu sagen. Alles zugewuchert. Hier ist ein steiler Abhang, eine Rampe, die wir gleich hinuntersteigen werden. Unten scheint sich die Grotte zu erweitern. Wir hören das Rauschen von Wasser, aber wir können nichts sehen. So weit reichen unsere Helmlampen nicht. Es ist stockdunkel da unten. Wie ihr seht, ist es schon hier oben gerade mal so hell wie in einer Vollmondnacht. Außerdem steigt aus der Grotte ein feiner Dampf auf. Jede Menge Insekten sind unterwegs, in der Luft und am Boden, aber wir haben uns gegen sie gewappnet.
Pedro beginnt jetzt mit dem Abstieg. Ich mache mich bereit und befestige die Kamera an meinen Schulterriemen. Sorry, wenn das Bild von nun an wackelt. Jetzt ist Juan an der Reihe. Ich hoffe, er hat die Seile ordentlich gesichert. Sie müssen das Gewicht von drei ausgewachsenen Männern aushalten, wir wollen schließlich nicht abrutschen oder stürzen. Es geht ziemlich tief runter, vielleicht fünfzig Meter diesen steilen Hang hinab. Also gut. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich brauche beide Hände für die Kletterei.
Pedro ist schon unten, er leuchtet herauf. Ich beeile mich. Verflucht dunkel hier. Keinerlei Sonnenlicht mehr, und die Helmlampen sind bei diesem Dunst auch nicht besonders hilfreich. Stickige Kaverne. Zum Glück tragen wir Atemmasken und bekommen Pressluft. Ich möchte nicht wissen, wie das hier unten riecht.
Der Untergrund fällt ab. Von dort unten steigt Dampf auf, wie von Thermalquellen. Verdammt, warum komme ich mir vor wie der erste Mensch, der hier nach dem Rechten schaut? Sonderbare Gegend. Seht euch diese Gewächse an! So was habe ich noch nie gesehen. Erinnert an Farne, oder? Aber total bleich. Kein Blattgrün. Klar, hier unten ist keine Photosynthese möglich. Wozu also Blattgrün? Schau dir das an! Dieser Farnwedel ist fast so groß wie ich. Ist das eine Pflanze? Der Corpus fühlt sich weich an, nachgiebig, irgendwie knorpelig. Ich versuche, etwas abzubrechen, aber das Zeug ist zäh. Ich könnte mein Messer nehmen, aber …
Juan ruft. Er hat was gefunden. Sorry, wenn ich etwas außer Atem bin. Bin gelaufen. Das sind Knochen, und zwar haufenweise. Ich … Sorry, Zentrale, Fletcher, musste erst mal zu Atem kommen. Die Pressluftversorgung kam wohl nicht hinterher. Bin wieder da. Ruhig, Juan! Das sind nur Tierknochen. Das hier zum Beispiel sieht aus wie der Beckenknochen einer Großkatze, wohl von einem Jaguar. Jede Menge Schädel, große und kleine, von verschiedenen Tieren, und das hier … Das hier ist eindeutig ein menschlicher Schädel. Warum kann ich ihn nicht aufheben? Fuck, was ist das? Als ob er mit dem Untergrund verwachsen wäre! Da sind überall weißliche Fäden zu erkennen, so etwas wie Wurzeln, nur dass sie aus dem Grund herauf wachsen. Sie halten die Knochen fest, und sie sind genauso elastisch wie die bleichen Gewächse. Was ist das hier?
Fletcher, hört ihr mich? Ich kriege leider gerade kein Signal von euch … Okay, ich rede einfach weiter. Also, Prinzip ‚Frage und Antwort‘. Welche Antworten habe ich auf Fragen, die sich gerade aufdrängen? Sorry, Arkansas, bin ein bisschen durch den Wind, was fast komisch ist angesichts der Windstille hier unten. Also, mir fällt im Moment nur eine einzige Frage ein, auf die ich eine Antwort hätte, und zwar: Wie kommen diese Knochen hierher? Es dürfte sich um Überreste von Lebewesen handeln, die in den Kessel gestürzt sind. Diese Fallhöhe steckt selbst eine Raubkatze nicht so einfach weg. Aber mir geben diese weißlichen Fäden zu denken, die an den Knochen haften. Das erinnert irgendwie an Epiphyten, an Parasiten. Oder an Pilzgewebe, an Hyphen. Wobei ich noch nie einen derart elastischen Pilz gesehen habe. Aber gut, denken wir das mal weiter. Die wesentlichen Teile von Pilzen wachsen unterirdisch. Was wir von ihnen essen, zum Beispiel Champignons, sind nur die Fruchtkörper, Teil eines größeren Ganzen. Hier fällt mir auf, dass überall dort weiße Fäden aus dem Boden wachsen, wo ein Tier abgestürzt ist. Vielleicht ist der Untergrund von Pilzgewebe durchwuchert? Sind diese sonderbaren Farne da hinten so was wie die Fruchtkörper dieses Pilzes, seine Sporenträger? Nur mal so als These. Zentrale? Fletcher? Hört ihr mich? Es sieht ganz so aus, als ob dieses sonderbare Geflecht die Überreste der toten Tiere verwertet hat. Vielleicht lebt es von den Nährstoffen, die aus dem Urwald herabstürzen, vom Fleisch toter Tiere, wie ein Aasfresser? Die Natur lässt bekanntlich nichts verkommen. Wir nehmen auf jeden Fall Proben von allem.
Juan macht mich gerade darauf aufmerksam, wie still es hier unten ist. Abgesehen vom Rauschen des Wassers irgendwo da hinten hört man nichts, keine Affen und keine Vögel. Juan hätte besser den Mund halten sollen. Habe ich nicht bemerkt. Klar, ich rede ja auch die ganze Zeit, aber jetzt beschleicht mich ein mulmiges Gefühl. Überall krabbeln Insekten herum, zum Beispiel diese Ameisen hier, die so lang und dick sind wie ein halber Zeigefinger. Und das hier ist mit Abstand der größte Tausendfüßler, den ich jemals gesehen habe. Arkansas, seht ihr ihn? Fletcher?
Pedro kommt zurück. Er war tiefer in der Grotte, da wo es noch dunkler ist, und hat sich erschreckt, als ihn etwas gestreift hat. Was sagst du, Pedro? Etwas hat ihn am Hals berührt. Eigentlich haben wir uns alle gründlich eingepackt, aber Pedro hat tatsächlich eine rötliche Strieme am Hals. Die Wunde ist nur oberflächlich und nicht länger als vier oder fünf Zentimeter. Hier, ich mache eine Nahaufnahme. Sieht ein bisschen aus wie ein Kratzer von einer Dorne. Pedro, wie fühlst du dich? Alles in Ordnung? Okay, Leute, dann lasst uns unsere Arbeit machen. Proben nehmen, von allem hier. Vom Boden, von den Farnen, den Knochen und diesen eigenartigen Wurzeln. Und dann schnell weg. Ich glaube, nach diesem Trip habe ich erst mal die Schnauze voll vom Dschungel. Dieser Kessel ist wirklich beklemmend. Macht die Becher voll, und dann nichts wie weg von hier.
Irgendetwas ist mit Pedro. Er ist kreideweiß und gibt sonderbare Laute von sich. Pedro, was ist los mit dir? Jetzt reißt er sich die Atemmaske vom Gesicht! Was soll der Mist? Pedro, du kennst doch die Regeln! Pass auf! Na klasse, jetzt hat er uns vor die Füße gekotzt. Das hab ich wirklich noch gebraucht. Was ist das – eine Vergiftung? Jedenfalls nicht einfach ein verdorbener Magen. Juan, Abstand halten! Pedro, bleib wo du bist! Scheiße, er kommt uns hinterher. Er scheint Angst zu haben. Er schwankt, presst die Hände auf den Bauch. Als ob er Schmerzen hat. Jetzt versucht er, etwas zu sagen, aber das einzige, was aus seinem Mund kommt, ist Kotze. Blutige Kotze! Verdammt, was ist das? Er bricht zusammen. Aber wir können doch nicht … Wir können nichts tun! Irgendetwas hat ihn erwischt. Er kotzt schon wieder, Blut mit irgendwelchen Fetzen drin. Es läuft ihm einfach so aus dem Mund.
Juan, los, weg von hier! Irgendetwas ist hier! Wir können Pedro nicht helfen. Was sagst du? Ich verstehe dich nicht! Nein, nicht die Atemmaske! Lass sie! Der Blödmann streift sie ab! Verdammt, mach doch, was du willst! Ihm ist wohl übel geworden, als er gesehen hat, wie Pedro sich übergeben hat. Jetzt kotzt er da hinten. Mir reicht’s! Ich will nur noch hier weg! Hier ist das Seil. Oben ist Sicherheit. Raus aus diesem verfluchten Loch, schnell! Was für eine Scheiße! Wie konnte ich mich nur auf diesen Job einlassen!
Juan steht unten am Seil und klammert sich daran fest, aber er wirkt unkoordiniert. Jetzt muss er sich noch mal übergeben, wie vorhin Pedro. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben etwas gefunden!
Gott sei Dank, geschafft! Dem Himmel sei Dank! Was für eine fürchterliche Gegend! Ich muss erst einmal was trinken. Mir ist übel von der Anstrengung. Beim Aufstieg bin ich einmal blöd mit der Atemmaske aufgeschlagen. Ich glaube, sie ist nicht mehr dicht, aber jetzt bin ja hier oben. Diese Aktion war wirklich reif für Olympia! Verflucht, was für eine Scheiße! Zentrale, wir brauchen hier ein Rettungsteam. Pedro und Juan sind im Kessel zurückgeblieben. Ich konnte nichts für sie tun. Keine Ahnung, auf was wir da gestoßen sind, aber ihr werdet es interessant finden, fürchte ich. Ich genehmige mir jetzt erst mal einen Schluck aus meiner Notreserve. Mir ist schlecht. Der Whisky wird mir guttun. Der räumt den Magen auf, der … Verflucht, jetzt habe ich das gute Zeug gleich wieder rausgek… Ich … Fletcher … Was ist das für ein Gerumpel in meinem … Au, verdammt, das tut … Zentrale … Hilfe …“
Prolog 2
24. Juni 2024, 5:30 Uhr Ortszeit
Flugzeugträger USS George W. H. Bush
Mittelmeer vor der libyschen Küste
Schwer und grau hingen dichte Wolken tief über der bleiernen See. Admiral Harold B. Lennon stand am Fenster des Towers und blickte auf das hell erleuchtete Flugfeld hinab, wo der Helikopter der SCO-Einheit auf den Startbefehl wartete. Der Einsatztrupp war bereits an Bord, soeben setzten sich die Rotoren in Bewegung. Die Deckmannschaft brachte sich in Sicherheit. Rotoren eines Helikopters dieses Typs konnten Turbulenzen von Orkanstärke auslösen.
„Verrückte Sache“, sagte Colonel Janet Baker, die Stellvertreterin des Admirals, als sie an Lennons Seite trat. Ihre hohe Stirn lag in Sorgenfalten. „Ich dachte, die Zeiten solcher Kommandoeinsätze wären vorbei. Hieß es nicht, die CIA sei an die Kette gelegt worden?“
Lennon zuckte mit den Schultern und strich mit den Fingern durch seinen buschigen Schnauzbart, den er nach jeder Mahlzeit kämmte, um ihn von Speiseresten zu säubern.
„Ich bin mir nicht sicher, ob unser … Freund wirklich von der CIA ist“, gab er knurrig zurück. „Ich blicke bei diesen Nachrichtendiensten nicht durch. Heutzutage braucht jeder Minister einen eigenen.“
Lennon versuchte, gleichgültige Miene zum Spiel der SCO zu machen, der Special Command Operations, aber tatsächlich missfiel ihm zutiefst, wie diese Leute seinen Flugzeugträger unter den Augen der Stammbesatzung missbrauchten. Dieser Einsatz roch nach Schweinerei.
„Red Wing-Patrouille meldet Feindkontakt“, sagte Lieutenant Henry Hodges, der am Funkleitstand die Meldungen der patrouillierenden Luftverbände sammelte. Ein Dutzend Funker und Fluglotsen arbeiteten ihm zu. Die George W. H. Bush befand sich im Blockade-Einsatz gegen Libyen und setzte mit ihren Jets die Flugverbotszone über dem Land durch.
„Luftabwehrraketen“, fügte Hodges hinzu. „Stellung des Feindes konnte ermittelt werden.“
„Geben Sie die Zielkoordinaten an die Yellowstone weiter. Sie soll zwei Tomahawks schicken und die Stellung des Feindes zerstören. Hatten wir Verluste?“
„Nein, Sir, alles in Ordnung.“
Die Tomahawks würden ein eindrucksvolles und zugleich nutzloses Feuerwerk veranstalten. Die Libyer waren extrem mobil. Vermutlich hatten sie die Stellung, aus der heraus sie vorhin die US-Jets beschossen hatten, noch in derselben Minute geräumt.
„Er kommt“, raunte Colonel Baker.
Agent Monty Harper betrat die Brücke der Bush durch den Haupteingang. Wie immer blieb er kurz stehen, als müsse er sich orientieren, doch tatsächlich ging es ihm vor allem darum, von allen Anwesenden registriert zu werden. Tatsächlich war es kaum möglich, ihn nicht zu bemerken. Er war zwei Meter groß, auffallend blass, schmal im Gesicht und zugleich breit in den Schultern wie ein Zehnkämpfer. Sein rotes Haar trug er an den Schläfen und hinten kurz und oben lang und gescheitelt. Er war irischer Abstammung. Seine grünen Augen blitzten gewohnt kühl. Er wirkte streng und unnahbar, trotz seiner Jugend; er war kaum 30 Jahre alt.
„Meine Männer sind startbereit“, sagte er, als er zum Admiral und dem Ersten Offizier trat, und deutete mit einer knappen Geste auf das Flugfeld hinab, wo die Rotoren des Helikopters erkennbar an Schwung gewonnen hatten.
Lennon suchte Harpers Gesicht nach Anzeichen von Mitleid oder auch nur Mitgefühl ab, doch er zeigte nicht die geringste Regung, nichts von dem, was er sich selbst vielleicht als Schwäche ausgelegt hätte.
„Sie wissen, dass Sie die Männer in diesem Hubschrauber in den Tod schicken?“, fragte der Admiral ein letztes Mal.
„Diese Diskussion ist heute so überflüssig wie gestern oder vorgestern“, gab Harper zurück.
„Keiner von ihnen wird zurückkehren“, fuhr Lennon dennoch fort. Er hatte diese Männer gesehen. Junge Kerle libyscher und marokkanischer Abstammung, die in aller Eile eine Spezialausbildung für Kommando-Operationen nach CIA-Muster durchlaufen hatten, die jedoch ohne jede praktische Erfahrung waren. Kanonenfutter! Sie waren chancenlos im libyschen Hinterland – was auch immer sie da zu suchen hatten.
„Sie müssen ziemlich verzweifelt sein, um so etwas wagen“, knurrte Lennon. „Natürlich war die Sache mit der Queen Mary 2 eine Riesenschlappe für die CIA, aber dass Sie deswegen nun alle Vorsicht fahren lassen und Menschenleben riskieren …“
„Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir einen Verdacht wegen Al-Isrā haben!“, entfuhr es dem Agenten. „Wir müssen endlich herausfinden, wo sich dieser verfluchte Stützpunkt genau befindet.“
Für einen Moment hatte er seine Maske gesenkt. Lennon lag wohl richtig mit seiner Vermutung, dass die CIA nervös war.
„Dieser Einsatz ist ein Blindschuss“, hakte Lennon nach. „Ich würde ihn am liebsten untersagen.“
„Zum Glück haben Sie darüber nicht zu entscheiden“, versetzte Harper.
„Sie hatten vierzig Jahre Zeit herauszufinden, wo Al-Isrā liegt“, gab Lennon zurück. „Die Gerüchte über diesen Stützpunkt sind uralt. Vierzig Jahre lang haben Sie es nicht geschafft, und jetzt versuchen Sie plötzlich, es übers Knie zu brechen? Weil Sie nach der Queen Mary-Schlappe einen Erfolg brauchen?“
„Hier wird nichts übers Knie gebrochen“, schnappte Harper zurück. „Meine Männer sind gut vorbereitet, und alle unsere Analysen deuten darauf hin, dass sich Al-Isrā …“
„Ihre Männer werden nicht zurückkehren!“, wiederholte der Admiral, während der Rotor des Helikopters unten auf dem Deck Startgeschwindigkeit erreichte. Lennon musterte das Gesicht des Agenten, dessen Lippen einen strengen Strich bildeten. Eiskalt lief es ihm den Rücken hinab, als er begriff, dass Harper die Männer bewusst in den Tod schickte auf die vage Hoffnung hin, endlich eine konkrete Information über den Standort von Al-Isrā zu erhalten – oder auch nur einen Hauch davon. Es war tatsächlich eine Verzweiflungsaktion.
„Geben Sie jetzt den Start frei!“, sagte Agent Harper. Es klang nicht wie eine Bitte.
Der Verteidigungsminister persönlich hatte Lennon in einem Vieraugengespräch über eine verschlüsselte Verbindung erst gestern klargemacht, dass er diesen Einsatz wünschte. Lennon hatte keine Wahl.
„Startfreigabe“, sagte er seufzend und nickte dem Deckoffizier zu.
Der zog das Mikrofon vor seinen Mund und sagte:
„SCO-L13, Sie haben Starterlaubnis. Viel Glück und auf baldiges Wiedersehen.“
Mit unbewegter Miene beobachtete Agent Harper, wie der Helikopter abhob und schwerfällig Höhe gewann, ehe er die Nase senkte und dann überraschend schnell Geschwindigkeit aufnehmend über das Flugfeld in die Nacht auf das Meer hinaus schwebte. In wenigen Minuten würde er in den Tarnmodus übergehen.
„Auf baldiges Wiedersehen“, wiederholte Colonel Baker an Lennons Seite.
Doch die zwanzig Männer an Bord waren schon so gut wie tot.
Incubus
Virenkrieg III
Thriller
Lutz Büge
www.ybersinn.de/news
1. Kapitel
Leistungsträger
28. Juni 2024
Al-Isrā, Stützpunkt der Islamischen Allianz
Jan Metzner war normalerweise schlagfertig und verfügte über eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, aber als Kommandant Sacharija Al-Maphrut ihm zuflüsterte:
„Du musst jetzt eine Rede halten!“, da brach ihm der Schweiß aus. Wie war er überhaupt aufs Podium neben den Kommandanten gelangt? Maria Francesca hatte ihn geschubst, erinnerte er sich. Jetzt stand er vor der versammelten Mannschaft in der Kantine von Al-Isrā, und die applaudierenden Menschen sahen mit erwartungsvollen Blicken zu ihm auf.
Soeben hatte der Kommandant in einer Rede seiner Bewunderung für Jans Arbeit Ausdruck verliehen.
„Wir beherrschen Skylla nun, die Biowaffe“, hatte Al-Maphrut gesagt, „ebenso wie unser Gegner sie beherrscht. Die ganze Welt hat das Ende von George W. Bush erlebt. Ich hoffe, die Botschaft ist angekommen, aber falls der Gegner weiterhin Skylla einsetzt, werden wir entschlossen dafür sorgen, dass er endlich begreift. Es gibt noch mehr Ziele beim Gegner, denen wir Gerechtigkeit widerfahren lassen können, Ziele wie Bush, der Tod über Millionen von Menschen gebracht hat. Dazu sind wir in der Lage dank der bahnbrechenden Arbeit eines Mannes, der erst seit wenigen Wochen bei uns ist: Dr. Metzner! Er hat das Werk von Professor Schwartz abgeschlossen und dafür gesorgt, dass Skylla nun praktisch wertlos für die Amerikaner ist. Das Gleichgewicht des Schreckens, von dem Professor Schwartz gern sprach, ist erreicht. Darum wollen wir heute feiern. Dr. Metzner, kommen Sie bitte zu mir aufs Podium! Es wird Zeit, dass wir offiziell machen, was bereits Praxis ist.“
Alle Menschen in der Kantine hatten Jan angesehen, während er dem Bewegungsimpuls gefolgt war, den Maria Francesca seinem Leib verpasst hatte, bis er hier oben stand.
„Im Namen der Islamischen Allianz“, sagte der Kommandant in feierlichem Tonfall, „ernenne ich Sie hiermit zum wissenschaftlichen Leiter von Al-Isrā.“
Ausgerechnet Maria Francesca rief nun über den Applaus hinweg:
„Eine Rede!“
Kommandant Al-Maphrut lächelte Jan an, erkannte dessen Verzweiflung und sagte beruhigend:
„Du bist unter Freunden.“
Das erinnerte Jan an etwas. Cincinnati. Studium. Freunde. Diskussionen. Ihm fiel etwas ein. Er wollte etwas sagen, aber der Laut, der über seine Lippen kam, erinnerte eher an ein Krächzen. Doch die Menschen hielten ihn für eine Bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit, und der Applaus verebbte.
„George W. Bush war ein Mensch!“, sagte Jan und staunte darüber, wie harmlos er klang. Gern hätte er seinen Worten mehr Nachdruck verliehen! Daher wiederholte er diesen Satz lauter werdend einmal und sogar ein zweites Mal, ehe er fortfuhr: „Wir hatten kein Recht, ihn umzubringen. Wir sind Mörder. Ich bin ein Mörder!“
Schlagartig herrschte schockierte Stille.
Jan schwitzte, aber er wusste, was er sagen wollte, und er war dem Kommandanten dankbar, dass er ihm die Gelegenheit verschafft hatte, dies vor der versammelten Mannschaft von Al-Isrā zu tun.
„Aber es war richtig!“, rief er. Bevor Applaus aufbranden konnte, hob er abwehrend beide Hände und fügte hinzu: „Und es war falsch. Es ist ein moralisches Dilemma, aus dem ich keinen Ausweg weiß. George W. Bush war ein Mensch, und wenn man an die Menschenrechte glaubt, so wie ich, dann war es Unrecht, ihn umzubringen, auch wenn er ein Verbrecher gewesen sein mag. Ich komme aus einer Familie, in der es viele Nationalsozialisten gab, die sich schuldig gemacht haben. Meine Eltern haben mich früh mit dem Elser-Dilemma bekannt gemacht. Georg Elser war ein deutscher Handwerker, der versuchte, Adolf Hitler zu ermorden. Sein Anschlag scheiterte. Aber darf man überhaupt versuchen, Diktatoren zu töten, um Schlimmes zu verhindern, obwohl auch Diktatoren und Kriegsverbrecher Menschen sind? Die eine Stimme, die idealistische, sagt: Nein, niemals, denn selbst so einer hat unveräußerliche Rechte. Die andere Stimme hingegen sagt: Unbedingt, denn vielleicht rettet man Millionen von Menschenleben. Das ist das Dilemma. Die Weltgeschichte wäre anders verlaufen, wenn Elser sein Ziel erreicht hätte. Jeder wird heute sagen: Leider ist er gescheitert. Auch ich. Bush war kein Diktator, doch auch er hat einen Krieg angezettelt, der Millionen Menschenleben gekostet hat. Wie sähe die Welt heute aus, wenn es den Irakkrieg nicht gegeben hätte? Bush heizte die Gewaltspirale an, er, der Oberbefehlshaber! Er war nie selbst in Gefahr, im Kugelhagel an der Front sein Leben aufs Spiel zu setzen. Typen wie er sind nie in dieser Gefahr.“
Jan holte tief Luft.
„Ich billige Bushs Tod nicht!“, sagte er dann mit fester Stimme. „Aber es ist gut und richtig, dass wir in Skylla ein Instrument in der Hand haben, um jenen zu drohen, die normalerweise nicht in Gefahr kommen, weil sie nur am Schreibtisch sitzen. Diese Entscheidungsträger müssen wissen, dass ihr Tun von nun an Konsequenzen haben kann, sogar für sie ganz persönlich. Egal an welchem Schreibtisch sie ihre Entscheidungen treffen – das Schlachtfeld befindet sich nicht mehr nur in einem fernen Land, sondern ihr Schreibtisch und sogar sie selbst sind Teil des Schlachtfelds! Jenes Exempel, das wir an Bush statuiert haben, mag ihnen diese Wahrheit unauslöschlich ins Bewusstsein brennen, so dass sie zur Vernunft kommen! Ich hoffe, dass wir Skylla niemals wieder einsetzen müssen. Und darum bin auch ich froh, dass wir Skylla haben.“
Es gab freundlichen, gebremsten Applaus. Dennoch hatte Jan nicht den Eindruck, als wären seine Worte angekommen. Wie konnte man den Tod eines Verbrechers wie Bush nicht gutheißen? Doch er fühlte sich wie befreit. Mit einigen Worten dankte er seinem Team und erinnerte an Michael Schwartz, seinen Freund aus besseren Tagen. Dann schüttelte er dankbar die Hand des Kommandanten, der ihn ablöste.
„Wir haben die Worte eines Philosophen gehört“, sagte Al-Maphrut. „Jedes Für kennt auch ein Wider. So schwierig kann die Welt für einen Deutschen sein. Statt sich eines Sieges zu freuen, äußert er Bedenken. Ich habe gehört, das soll bei den Deutschen so üblich sein. Ich dagegen sage: Freuen wir uns! Heute ist ein großer Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben. Ich bin sicher, dass es auch in Deutschland viele Menschen gibt, die heute sagen: Die Welt ist ein Stück besser und gerechter geworden, denn Bush ist tot. Erheben wir das Glas auf unseren Erfolg!“
„Musstest du unbedingt wieder versuchen, uns die Stimmung zu verderben?“, fragte Maria Francesca, die mit zwei Gläsern in der Hand im Publikum auf Jan wartete. Wenn sie zu diesen Worten nicht gegrinst hätte, wäre Jan nicht auf die Idee gekommen, dass sie nur scherzte. Ihm war nicht nach Scherzen zumute.
„Ja, das war mir wichtig“, antwortete er. „Nicht um euch die Stimmung zu verderben, sondern …“
„Aha, du und dein Konflikt! Der Chef hat schon recht mit dem, was er über die Deutschen sagt.“ Sie reichte ihm ein Glas und stieß sogleich an. „Cin cin!“
Dies war nicht der richtige Moment für diese Auseinandersetzung, zumal es Prosecco gab, guten sogar. Jan wunderte sich immer wieder, was die Islamische Allianz auf die Beine zu stellen vermochte, hier, im Herzen der Sahara. Prüfend blickte er sich um. Tatsächlich schienen alle zu trinken, obwohl ein knappes Drittel der Besatzung Muslime waren. Allerdings konnte er nicht erkennen, ob sich in manchen Gläsern nicht vielleicht etwas anderes befand als Prosecco. Er war hier bisher noch keinem Strenggläubigen begegnet. Wer die Islamische Allianz für eine Islamisten-Organisation hielt, war schlecht informiert. Immerhin zweifelte er nicht länger daran, dass die Allianz als Fernziel Frieden anstrebte, auch wenn sie sich unkonventioneller Methoden bediente – freundlich formuliert.
„Gute Rede, Dr. Metzner“, sagte Naïra, ein Mitglied seines engeren Teams. „Es tut gut, solche nachdenklichen Worte in all dem Getöse zu hören. Trotzdem kann ich Al-Maphrut verstehen. Wir sind den Amerikanern einfach viel zu lange hoffnungslos hinterhergehinkt. Auf ein solches Erfolgserlebnis haben wir lange gewartet.“
„Ich kann ihn ebenfalls verstehen“, gab Jan zurück. „Er befindet sich im Krieg.“
„Sie sich auch“, sagte Naïra. „Zwangsläufig!“
Jan kniff die Lippen zusammen.
„Das reicht jetzt“, schaltete sich Maria Francesca wieder ein. „Morgen und danach habt ihr alle Zeit der Welt für eure schlechte Laune, aber heute wird gefeiert. Die Band legt gleich los. Ich will tanzen!“
„Es gibt eine Band hier in Al-Isrā?“ Jan staunte. „Das wusste ich nicht.“
„Du weißt so einiges nicht“, sagte Maria Francesca und lachte. „Du hattest bisher ja kaum Gelegenheit, Al-Isrā richtig kennenzulernen.“
Die Band, die überwiegend aus Mitgliedern der Wachmannschaft bestand, spielte schwungvollen Pop mit Percussion und E-Gitarren ebenso wie orientalischen Dancefloor bis hin zu Rock’n-Roll-Nummern, die Jan und Maria Francesca in Schweiß ausbrechen ließen. Jans Stimmung besserte sich deutlich und erreichte einen vorläufigen Höhepunkt, als Maria Francesca ihre Arme um seinen Hals schlang, ihn küsste und in sein Ohr flüsterte:
„Lass uns gehen.“
Sie liebten sich in Jans Quartier, als wäre es zum ersten Mal. Doch dieser Nacht folgte ein Morgen, und Al-Isrā war wieder Jans Gefängnis. Allerdings kam es ihm mit Maria Francesca im Arm nicht mehr ganz so eng vor.
Als Jan das Blinken des Notebooks sah, das auf eine hereingekommene Nachricht aufmerksam machte, war er bereits wieder auf dem Boden der Wirklichkeit angekommen. Er stand auf, vorsichtig, um Maria Francesca nicht zu wecken, klappte das Notebook auf und rief die Nachricht ab.
„Einsatzbesprechung um neun Uhr. Anwesenheitspflicht für alle Führungskräfte. Konferenzraum Ebene 3.“
Al-Maphrut hatte Jan zum Laborleiter befördert.
Jan war jetzt Führungskraft.
Kaum drei Wochen in Al-Isrā!
Sicherheitshalber rief er in der Zentrale an und erfuhr, dass seine Teilnahme an dem Treffen tatsächlich erwünscht war.
„Sonst hätte man Ihnen diese Nachricht nicht geschickt“, wurde ihm beschieden.
Neun Uhr. Jan hatte noch Zeit für die Dusche und ein schnelles Frühstück in der Kantine. Für Maria Francesca hatte er keine Zeit. Er ließ sie schlafen.
***
Nie hatte Jan das verstörende Gefühl, neben sich selbst zu sitzen, stärker empfunden als in dem Moment, als er zwischen Professor Legrand und Dr. Latif am Konferenztisch auf der Führungsebene Platz nahm. So trat er für alle sichtbar offiziell die Nachfolge von Michael an, der vor ihm hier gesessen hatte. Die anderen Teilnehmer der Konferenz reichten ihm die Hand und gratulierten ihm. Sie nahmen ihn an.
Jan Metzner, Führungskraft der Islamischen Allianz – ein absurder Gedanke!
Legrand war als Chef des Hochsicherheitslabors hier und Dr. Latif als Leiter der Krankenstation.
„Freut mich, Sie wiederzusehen“, sagte Dr. Latif zur Begrüßung, doch sein Gesichtsausdruck strafte ihn Lügen: Er freute sich nicht für eine Sekunde. Die Begegnung war ihm vielmehr gleichgültig. Als Jan noch mit Skylla infiziert gewesen war, hatte Dr. Latif ihm wesentlich mehr Interesse entgegengebracht.
Im selben Tonfall gab Jan zurück:
„Ganz meinerseits. Lange nicht gesehen.“
Die meisten anderen Gesichter kannte Jan nur flüchtig vom Sehen. Zwei waren ihm unbekannt.
„Vielen Dank, dass Sie gekommen sind“, sagte der Kommandant. „Es gibt Neuigkeiten, die ich Ihnen nicht vorenthalten kann. Mit der Weitergabe bitte ich Sie jedoch zu warten. Das Folgende ist als Vorab-Information für Sie persönlich gedacht und muss in diesem Raum bleiben. Unser Geheimdienst ist in den Besitz von Informationen über eine Waffe gelangt, die von der US Air Force auf ihrem Stützpunkt in Aviano, Italien, stationiert wurde, eine Waffe vom Typ MOP. Massive Ordnance Penetrators sind bunkerbrechende Bomben. Hinter mir sehen Sie das Foto eines Prototyps. Die USA haben nach dem Irakkrieg starke bunkerbrechende Waffen entwickelt, da die irakischen Kommandostellen tief eingegraben und von dicken Betonwänden geschützt waren. Der MOP, der in Aviano stationiert wurde, gilt als Nonplusultra dieser Waffengattung. Unsere Analysten glauben, dass er gegen Al-Isrā eingesetzt werden soll. Die Amerikaner nennen ihn Incubus.“
Das Bild hinter ihm wechselte und zeigte nun einen US-Bomber. Jan saß stocksteif da vor Schreck.
„Incubus kann nur von Stratosphärenbombern des Typs Northrop-B2 abgeworfen werden“, fuhr Al-Maphrut fort. „Die B2 erreicht Höhen von mehr als 15 Kilometern. Incubus wiegt 14 Tonnen. Unseren Berechnungen zufolge hat eine mit Incubus beladene B2 eine Reichweite von knapp 4500 Kilometern, also 9000 Kilometer für Hin- und Rückflug ohne Betankung in der Luft. Al-Isrā liegt von Aviano aus also in Reichweite.“
Al-Maphrut verkündete diese Nachrichten in sachlichem Ton und mit einer Miene, die keine Rückschlüsse darauf zuließ, was in seinem Kopf wirklich vorging. Das Schweigen im Konferenzraum war zum Schneiden dick.
„13 der 14 Tonnen, die Incubus wiegt, sind Sprengstoff. Das Gehäuse besteht aus einem extrem harten Spezialstahl, der angeblich 40 Meter dicken Stahlbeton durchschlagen kann, bevor die Waffe explodiert. Diese ungeheure Penetrationsmacht gewinnt Incubus aus der Kombination seiner Masse mit der Fallhöhe. Wird er aus 15 Kilometern Höhe abgeworfen, trifft Incubus fast mit doppelter Schallgeschwindigkeit auf dem Boden auf. Unsere Modellrechnungen haben ergeben, dass Incubus in der Lage ist, sowohl die Felsschicht über Al-Isrā als auch unsere Panzerung zu durchschlagen. Wir müssen uns daher auf diesen Extremfall vorbereiten. Sie haben eine Frage, Najim?“
Najim Fahkri hatte die Hand gehoben:
„Vielleicht wären Sie noch darauf zu sprechen gekommen“, sagte der Leiter des Sicherheitsdienstes mit ruhiger Stimme, „aber ich bin neugierig. Ein Bombenabwurf aus solcher Höhe ist zwangsläufig ungenau, es sei denn, man hat eine Laserpeilung. Haben die Amerikaner uns anpeilen können?“
„Wir wissen es nicht!“, antwortete der Kommandant. „Richtig ist: Incubus kann mittels Laserpeilung punktgenau ins Ziel geführt werden, ganz wie Sie sagen. Vielleicht haben die Amerikaner darum kürzlich eine Erkundungsaktion versucht. Wir haben den Hubschrauber abgeschossen. Die Besatzung ist tot oder außer Gefecht.“
Al-Maphrut blickte gelassen in die Runde. Tatsächlich schienen ihn die Neuigkeiten, die er verkündete, nicht einen Moment zu beunruhigen.
„Wir haben keinen Grund, uns zu ängstigen“, sagte er gelassen, „auch wenn dies gewiss keine guten Neuigkeiten sind. Versuchen wir, die Lage realistisch einzuschätzen. Erstens: Die Amerikaner kennen unsere Position nicht. Zweitens: Für den zielgenauen Einsatz von Incubus bräuchten sie eine exakte Peilung, die sie aber nicht haben und auch nicht bekommen. Drittens: Es gibt von Incubus bisher nur zwei Exemplare. Diese Waffe ist teuer. Sie ist die schwerste konventionelle Bombe, die je gebaut wurde, und kostet pro Stück 22 Millionen Dollar. Bei solchen Summen denken selbst die Amerikaner zweimal nach. Viertens: Da die Amerikaner eine Flugverbotszone über Libyen errichtet haben, können wir uns hier in Al-Isrā nicht mehr so sicher fühlen wie bisher. Die US-Streitmacht hat freien Weg nach Al-Isrā.“
„Und unsere Luftabwehr?“, fragte Najim Fahkri.
„Ist keine Hilfe. Die B2 fliegt zu hoch und ist wegen ihrer Stealth-Eigenschaften für unser Radar kaum zu orten.“
„Also wird Al-Isrā evakuiert?“, fragte Dr. Latif, der auf dem Platz neben Jan unruhig geworden war. Jan hatte den Eindruck, der Arzt wäre am liebsten aufgesprungen und sofort geflüchtet.
„Natürlich nicht.“ Al-Maphrut hob beide Hände. „Es besteht kein Grund zur Panik. Wir werden informiert, wenn Incubus in Aviano startet, und haben dann genug Zeit für Maßnahmen. Sicherheitshalber werden wir die Evakuierung trainieren. Ich gehe aber davon aus, dass uns keine ernste Gefahr droht. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass ich die Lage nicht verharmlose, sondern sachlich einordne. Das Geheimnis um Al-Isrās Position konnte vierzig Jahre lang gehütet werden. Unsere Tarnung war immer unser bester Schutz. Daran hat sich nichts geändert. Eine exakte Laserpeilung ist schlicht unmöglich. Al-Isrā liegt 40 Meter tief unter einem Felsmassiv. Es gibt keinen zentralen Ein- und Ausgang, der angepeilt werden könnte, sondern zahlreiche Zugänge und Zufahrten, die teils kilometerweit voneinander entfernt sind. Selbst wenn die Amerikaner mit ihren Satelliten sämtliche Bewegungen aller Karawanen in der Sahara erfassen könnten, wäre es ihnen nicht möglich, unsere genaue Position zu errechnen, obwohl Al-Isrā durch solche Karawanen versorgt wird. Zudem wollen wir unsere IT-Spezialisten von der Abteilung Aynayya nicht vergessen. Sie sorgen dafür, dass die Amerikaner keine Daten bekommen, die zu Al-Isrā führen, auch nicht über ihre Satelliten. Einige der weltbesten Hacker arbeiten für Aynayya. Die Amerikaner bekommen von uns nur das zu sehen, was wir sie sehen lassen. Unterm Strich bedeutet dies, dass wir in Al-Isrā weiterhin annähernd so sicher sind, wie wir es immer waren.“
Er betonte das Wort „annähernd“ auf eine auffällig unauffällige Weise, die Jan leise kichern ließ. Zufällig blickte Al-Maphrut gerade herüber.
„Wenn es anders wäre, würde ich nicht so gelassen vor Ihnen stehen“, sagte er. „Dr. Metzner, Sie sind neu unter uns. Sie wissen noch nicht viel über Al-Isrā. Dieser Stützpunkt kann über Monate hinweg verriegelt betrieben werden. Unsere Energie gewinnen wir per Geothermie aus dem Erdinnern, unser Wasser beziehen wir aus dem Murzuk-Aquifer, einem fossilen Grundwasserspeicher, der auch unsere Abwärme aufnimmt. Unsere Abfälle werden fast komplett recycelt. Al-Isrā könnte für Generationen überdauern, wenn es nicht den einen Faktor gäbe, der unsere Abschottung zeitlich begrenzt: die Versorgung mit Lebensmitteln. Für eigene Plantagen oder Hydroponik-Anlagen ist Al-Isrā zu klein. Unsere derzeitigen Vorräte bestehen aus Konserven und Tiefgefrorenem und reichen für elf Monate. Armina, wie ist der Zustand des Maschinenparks?“
Die Angesprochene, der Jan noch nie begegnet war, erhob sich und stellte sich kurz vor:
„Armina Srarfi, ich wurde erst kürzlich nach Al-Isrā abkommandiert. Sayidi, die Maschinen sind im bestmöglichen Zustand. Es gibt ausreichend Ersatzteile. Al-Isrā kann jederzeit abgeriegelt werden.“
Jan hob die Hand, Al-Maphrut nickte ihm zu.
„Was passiert bei einem Volltreffer? Wenn das Hochsicherheitslabor beschädigt wird?“
„Das wäre das schlimmste Szenario“, antwortete Al-Maphrut. „Ein solcher direkter Treffer ist extrem unwahrscheinlich. Ich habe daher beschlossen, dieses Szenario zu vernachlässigen. Wir werden die Evakuierung proben, aber im Ernstfall werden wir verriegeln, sollte die Gefahr aus Aviano konkret werden. Dann werden alle Verbindungen zur Oberfläche gekappt.“
„Noch eine Frage!“, sagte Jan. „Ich dachte, der Gegner sei SCOUT.“
„Ja“, antwortete der Kommandant schlicht. „Und wie lautet Ihre Frage?“
Nachsichtiges Gelächter erhob sich.
Jetzt siezt er mich wieder!
„Wenn unser Gegner SCOUT ist, dann ist er nicht die USA“, sagte Jan. „SCOUT hat keine eigenen Luftstreitkräfte, ist aber anscheinend in der Lage, reguläres Militär der USA für seine Ziele einzuspannen. Oder wer sind diejenigen, die uns da angreifen werden?“
Das Gelächter verebbte, gespannte Blicke richteten sich auf den Kommandanten.
„Wenn wir das nur genau wüssten!“, antwortete Al-Maphrut. „Die Queen-Mary-Tribunale haben uns gezeigt, wie SCOUT andere für sich einspannt, sogar die CIA. SCOUT selbst ist eine Geheimorganisation, über die wir nur wenig wissen. General Al-Faris geht davon aus, dass es SCOUT gelungen ist, den amerikanischen Streitkräften Al-Isrā als lohnendes Ziel im Kampf gegen den Terror zu verkaufen, aber das ist nur eine Vermutung. Es ist immer wieder dasselbe in diesem Schattenkrieg mit SCOUT. Der Gegner vermeidet es, Präsenz zu zeigen, er spannt andere für sich ein. Ich habe allerdings gute Hoffnung, dass es ihm umgekehrt mit uns nicht viel anders ergeht. Genau darum wurde die Islamische Allianz gegründet: um SCOUT etwas entgegenzusetzen.“
Er kam nun hinter dem Rednerpult hervor.
„Habe ich Ihre Frage beantwortet?“
„Irgendwie schon, aber nicht zufriedenstellend“, sagte Jan, und alle lachten. Auch er selbst.
„Uns steht nun also die Bewährungsprobe bevor, für die Al-Isrā gebaut wurde“, sagte der Kommandant. „Nun beginnt das wohl wichtigste Projekt in der Geschichte dieses Stützpunkts: die Erforschung des Swat Valley Virus. Wir müssen unbedingt eine Antwort auf diese Biowaffe finden, um auch hier ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen. Das ist essenziell für den Fortbestand der Islamischen Allianz. Ich lege diese Aufgabe in Ihre Hände, Dr. Metzner, und versichere Ihnen, dass ich alles tun werde, um Sie zu unterstützen. Was Incubus betrifft: Im Alarmfall wird Code 137 durchgegeben. Sie alle sollen sich dann mit Ihrer Mannschaft schnellstmöglich auf den beiden untersten Etagen von Al-Isrā sammeln. Entsprechende Notfallpläne werden Ihnen im Lauf des Tages zugehen.“
Unten sitzen wir bei einem direkten Treffer in der Falle!
„Noch Fragen?“, fragte Al-Maphrut.
Baltimore
Phil Schwartz jr. sah immer noch den sterbenden George W. Bush vor seinem inneren Auge. Er träumte sogar davon! Sah so ein rasant verlaufender Herzinfarkt aus? So einer, wie auch Phils Vater ihn erlitten hatte, einer, bei dem große Blutgefäße einfach platzten, so dass man in Sekundenschnelle innerlich verblutete? Hatte sich Philipp Schwartz senior ebenfalls auf diese Weise an die Brust gegriffen, allerdings nicht vor laufenden Kameras, sondern in seinem Kanu auf dem Winooski River?
Phil zählte eins und eins zusammen. Von der Obduktion hatte er damals nur das Wichtigste mitbekommen: Die vom Herzen ausgehenden Gefäße seien aufgesprungen, als seien sie von Sprengstoff aufgerissen worden, hatte der Pathologe gesagt. Außerdem hatte er den Brief von Ruth Brennan. Sie hatte ihm geschrieben:
„Wenn Du wissen willst, wie Skylla wirkt, sieh Dir am 27. Juni die Nachrichten an.“
Sie hatte auch davon gesprochen, dass ihr nächster Auftrag in Dallas auf sie warte. Sie war die Attentäterin. Sie hatte die Biowaffe Skylla gegen den ehemaligen US-Präsidenten eingesetzt. Die Frau, mit der Phil vor kurzem eine leidenschaftliche Nacht verbracht hatte! Er war entsetzt – und zugleich stolz. Das hätte er natürlich niemals zugegeben, aber es stimmte, auch wenn es widerlich war, sich über den Tod eines Menschen zu freuen. Er verschloss diesen Gedanken tief in sich, obwohl er sicher war, dass er damit weder im Wohnheim noch in der Steuerungsgruppe der Wahlkampagne allein war. In gewisser Weise hatte Ruth für Gerechtigkeit gesorgt. Bush stand für alles, was Phil verabscheute. Religiöses Sendungsbewusstsein statt Ratio, Eigenmächtigkeit statt Absprachen, Gewalt statt Verhandlungen – Bush war die Mensch gewordene Anmaßung. Bush, der Leid über Millionen gebracht hatte, der Heerführer, ein gewählter Imperator – wie solche Männer starben, das lehrte schon das alte Rom.
Phil lehnte die Todesstrafe aus Überzeugung ab. Bush hingegen war ein Befürworter. Ironie der Geschichte: Nun hatte er sie selbst erlitten.
Ruth war nach ihrer gemeinsamen Nacht verschwunden, hatte aber Unterlagen zurückgelassen, nicht nur den Brief an Phil mit Informationen über Skylla:
„Dieses Virus ist die zweite Stufe eines Biowaffensystems. Es wirkt nur, wenn ihm die erste Stufe vorangegangen ist. Auf dem laminierten Blatt in Deiner Hand findest Du zwei Felder. Auf dem rechten sind Skylla-Viren einer milden Variante. Mit ihr hast Du Joey Calderon infiziert. Er ist künftig vor der rabiaten Skylla-Variante geschützt und damit für immer sicher vor dieser Biowaffe. Ich rate Dir, Dich ebenfalls mit dieser ‚Lebendimpfung‘ zu schützen. Dazu musst Du Dich zunächst mit der ersten Stufe des Biowaffensystems infizieren. Charybdis ist ein Bakterium. Es befindet sich auf dem linken der beiden Felder auf dem laminierten Blatt. Kratze die Folie über dem Feld weg, streiche mit einer feuchten Fingerkuppe über die freigelegte Fläche und lecke die Fingerkuppe ab. Du bekommst eine leichte Erkältung, die schnell abklingt. Fünf Tage später steckst Du Dich auf dieselbe Weise mit der Skylla-Variante auf dem zweiten laminierten Feld an. Dann musst Du Dich ein paar Tage schonen. Du wirst Fieber bekommen und vielleicht Schmerzen in der Brust haben. Ruhe in dieser Zeit viel, trinke isotonische Getränke und nimm Vitamine in doppelter Tagesdosis, vor allem Vitamin C, E und die Vitamine des B-Komplexes. Dann sollte die Infektion in drei bis vier Tagen überstanden sein, auch ohne ärztliche Hilfe.“
Phil kratzte unverzüglich die Folie über dem linken der beiden Felder ab und infizierte sich. Er vertraute Ruth. Wenn sie ihn hätte umbringen wollen, hatte sie mehr als genug Gelegenheit dazu gehabt.
Doch wie gern hätte er sie befragt!
Auch sein Vater musste zuvor mit Charybdis infiziert worden sein, bevor man Skylla auf ihn losgelassen hatte. Das bedeutete, dass jemand ihn vorab als potenzielles Ziel für die Biowaffe eingestuft haben musste. Als jemand, der vielleicht aus dem Weg geräumt werden musste. Dasselbe galt für Joey Calderon. Skylla – die leichte Variante – hatte bei ihm gewirkt. Phil hatte ihn unwissentlich angesteckt. Calderon musste also bereits mit Charybdis infiziert worden sein. Auch er war als Skylla-Ziel eingestuft worden. Doch von wem?
Phils Vater war ein angesehener Politiker gewesen, für viele ein Idol. Natürlich hatte er Gegner gehabt, etwa im Pentagon, dessen Verschleierungspraktiken er mehr als einmal öffentlich angeprangert hatte. Stammten jene, die Skylla auf ihn losgelassen hatten, aus dem Dunstkreis des Pentagon? Aus dem militärisch-industriellen Komplex? Aus den Sphären, in denen auch George W. Bush seine mit Allmachtsfantasien gespickte Bahn gezogen hatte? Was ging da im Hintergrund vor?
Unweigerlich musste Phil an die Queen-Mary-Tribunale denken. Dabei waren zwielichtige amerikanische Umtriebe aufgedeckt worden. Das Attentat auf Phils Vater passte zu diesen Intrigen. Phil hatte Probleme mit der Vorstellung, dass irgendwo im Hintergrund ein einzelner Mann seine Strippen zog und das Weltgeschehen manipulierte – jener ominöse Henry W. Osborne von SCOUT –, aber wenn nur ein Zehntel von dem stimmte, was da aufgebracht worden war, dann war diesem Osborne der Befehl zu einem Attentat auf einen der beliebtesten Politiker der USA ohne weiteres zuzutrauen. Das Attentat auf Bush hingegen passte besser zum Stil der Entführer der Queen Mary 2. Oder redete Phil sich etwas ein, weil er den Gedanken nicht ertragen hätte, dass er mit der Mörderin seines Vaters geschlafen hatte?
Nein, es verhielt sich anders. Ruth hatte den Zipfel eines schweren Lakens gelüftet, um ihm einen kurzen Blick auf ein Geheimnis zu gewähren. Sie hätte ihr Wissen über Skylla & Charybdis für sich behalten können, doch sie hatte es mit ihm geteilt. Es lag auf der Hand, dass irgendjemand im Hintergrund Biowaffen einsetzte, obwohl solche Waffen international geächtet waren. Diese Biowaffen-Technologie schien weit entwickelt zu sein, da es von ein- und demselben Erreger mehrere Varianten gab: eine, die fast auf der Stelle tötete, und eine abgeschwächte. Die erste hatte Phil in Dallas bei der USW-Convention am Werk gesehen, die andere hatte er auf Joey Calderon übertragen, um ihn, wie Ruth geschrieben hatte, vor der rabiaten Variante zu retten. Dass Calderon sicher vor Skylla war, erfüllte Phil mit Zuversicht, ja, fast mit Stolz, weil er daran mitgewirkt hatte, jenen Mächten im Hintergrund einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Ruths Ziele waren denen dieser Unbekannten also entgegengesetzt. Sie musste wirklich auf Phils Seite in einem Konflikt sein, in dem schon sein Vater gekämpft hatte und in dem die Mittel und Chancen ungleich verteilt waren. Die Gegenseite verfügte über eine funktionierende Infrastruktur und war fähig, heimlich tückische Biowaffen wie Skylla & Charybdis zu entwickeln. Sie brauchte Labors, Forscher, viel Geld, und das über Jahre hinweg. Die Waffen hingegen, die Phils Vater zu Gebote gestanden hatten, hießen vor allem Information, Aufklärung und Transparenz. Dies waren mächtige Waffen, wenn der Gegner die Öffentlichkeit fürchten musste, doch das Attentat auf Philipp Schwartz senior zeigte, dass dieser Gegner nicht zögerte zu handeln.
Michael musste mehr über diese Zusammenhänge gewusst haben, die Phil sich jetzt in seinem Zimmer im Wohnheim mühevoll zusammenreimte. Doch der ältere Bruder hatte ihn nicht einweihen wollen. Um Phil zu schützen, wie er behauptet hatte. Phil stockte der Atem, als er Ruths Zeilen las:
„Michael wollte der Islamischen Allianz das Virus bringen, um ein Gleichgewicht des Schreckens herzustellen und die Amerikaner davon abzubringen, Skylla einzusetzen. Es war eine rationale und kluge Entscheidung. Wir besitzen des Virus nun, und genau dies werden wir nun demonstrieren.“
Ruth gehörte also zur Islamischen Allianz. Und diese Islamische Allianz rettete Joey Calderon das Leben – mit Michaels und Phils Hilfe! So fügten sich die Dinge. Michael hatte dieses Wissen mit sich herumgetragen, ohne es zu teilen! Deswegen war er „in die Wälder gegangen“ und nie zurückgekehrt! Er lebte also noch? Wie würde sich seine Mutter freuen, diese Nachricht zu hören …
Nein, das durfte Phil ihr nie sagen. Sie würde sich Hoffnungen machen, Michael wiederzusehen, und sie würde dieses Geheimnis gewiss nicht für sich behalten.
Jetzt war Phil in derselben Situation, in der Michael damals ihm gegenüber gewesen war: Wissen bedeutete nicht Macht, sondern Lebensgefahr! Phil durfte dieses Wissen nicht weitergeben! Ruth hatte ihn zum Geheimnisträger gemacht.
Was waren dies nur für Zeiten! Vermeintliche islamistische Terroristen saßen über die Verbrechen der USA zu Gericht. Ein ehemaliger US-Präsident wurde vor den Augen der ganzen Welt Opfer eines Attentats mit einer Biowaffe, und ein angehender Präsident wurde von Muslimen vor einer solchen Attacke gerettet, ohne es zu merken. Phil sah aus dem Fenster hinauf in den Himmel über Baltimore, aus dem ihn noch vor kurzem Ruths grüne Augen angesehen hatten. Gut und Böse waren keine Kategorien, in denen er normalerweise dachte. Gerecht und ungerecht, aufrichtig und unaufrichtig, wahrhaftig und verlogen – nur entlang solcher Linien ließ sich die Welt verstehen.
Das alles hatte natürlich Konsequenzen für Calderons Wahlkampf – und für Phil, der Calderons Reden schrieb und half, der Kampagne Richtung und Rückgrat zu geben. Das Feuer, in dem sie standen, war viel heißer, als Phil geahnt hatte. Es ging nicht nur darum, gegen Positionen zu fechten und Argumente zu platzieren, sondern es ging um einen Wahlkampf, in dem die andere Seite ein Attentat als ernsthafte Option erwog! Was waren die unzähligen Morddrohungen und Hassmails, die Joey bekam, gegen diese Gefahr durch schweigende Unbekannte!
Wenn diese Unbekannten erfuhren, dass Skylla, ihre Geheimwaffe, bei Joey nicht mehr wirkte, griffen sie vielleicht zu anderen Mitteln. Joey Calderon wäre nicht der erste Kandidat, der auf dem Weg ins Präsidentenamt Opfer eines Attentats würde. Vermutlich war es am besten, die Unbekannten im Hintergrund in ihrem Unwissen zu belassen. Zumal Joey die Skylla-Infektion bewältigt zu haben schien.
„Es geht ihm besser“, sagte Nicole Harris, die Wahlkampfmanagerin, als er sie unter vier Augen nach einer Konferenz des Teams ansprach. „Er hat heute Nachmittag eine letzte Untersuchung, und das war es dann wohl.“
„Das ist eine gute Nachricht“, sagte Phil. „Dann wird er an der Veranstaltung des AEI teilnehmen?“
„Die wird wegen Bushs Tod sicher verschoben.“
Phil konnte zwei oder drei weitere Tage zur Vorbereitung gut gebrauchen. Wegen Ruth war er kaum noch zum Arbeiten fähig gewesen.
***
„Ich finde den Verlauf unserer Diskussion wenig überraschend“, sagte Joey Calderon auf dem Podium. „All das haben wir in den vergangenen zwanzig Jahren wieder und immer wieder gehört. So oft, dass viele in unserem Land solchen Aussagen allein deswegen zustimmen, weil etwas, das man so oft gehört hat, wohl irgendwie wahr sein muss.“
Er lächelte entspannt, aber Phil, der an der hinteren Wand des Saales stand und das Publikum überblickte, wusste, dass Joey Calderon unter den Verbalattacken von Nathan Connolly, einem Professor der Politikwissenschaft und Fellow des American Enterprise Institute, in die Defensive geraten war. Doch er kannte die Tricks, wie er aus dieser Falle wieder herauskam. Der Professor war kein starker Widersacher, obwohl er eine Koryphäe der Politikwissenschaft war. Es lag eine Art von vergiftetem Entgegenkommen darin, dass ausgerechnet Connolly ausgesucht worden war, mit Joey zu diskutieren. Man wusste beim AEI, dass der Kandidat an seinen Gegnern wuchs.
„Lassen Sie es mich folgendermaßen formulieren“, fuhr Calderon fort und blickte seinem Kontrahenten dabei direkt in die Augen. „Sie behaupten, Multikulti sei eine gescheiterte Idee. Ich frage mich zwar, woher sie diese Erkenntnis nehmen, denn tatsächlich wird multikulturelles Zusammenleben in weiten Teilen unseres Landes erfolgreich praktiziert. Ohio, dessen Gouverneur ich bin, ist ein gutes Beispiel dafür. Aber unterstellen wir mal, es sei so. Was ergibt sich daraus, dass Multikulti gescheitert ist? Was ist die Konsequenz, was ist die Alternative? Kommen wir dann nicht unweigerlich hin zu einer ‚Hier-wir-dort-die‘-Ideologie, indem wir statt der Gemeinsamkeiten die Unterschiede zwischen den Menschen betonen? Was bringt uns das? Das einzige, was dabei herauskommt, ist, dass wir irrationalen Ängsten den Aufstieg gestatten, den Ängsten vor dem Anderen, Fremden. Viele Menschen klammern sich schon heute an diese Ängste. Sie scheinen Halt zu geben, aber tatsächlich blockieren sie vor allem die Suche nach Lösungen. Angst ist ein schlechter Ratgeber! Angst vor dem Anderen führt dazu, dass Menschen wie Sie glauben, Vertreter einer Art Herrenmenschenkultur zu sein, die mehr wert ist als andere. Darum können Sie allen Ernstes fordern, dass sich Menschen aus anderen Kulturen, die mit uns leben wollen, unterordnen müssen. Ich halte das für anmaßend.“
„Herzlichen Dank für diesen Ausflug auf das Feld der Küchenpsychologie“, gab der Professor zurück und bekam dafür Beifall und Lacher. „Wir sollten nicht in Kategorien wie ‚Herrenmenschen‘ denken, Gouverneur. Das sind ideologische Kampfbegriffe, die darauf zielen, das Gegenüber zu diffamieren. Aber in der Tat glaube ich, dass Einwanderer sich den zentralen Werten unserer Gesellschaft unterordnen müssen. Sie können nicht beispielsweise für sich in Anspruch nehmen, ihren Islam bei uns frei zu leben, und gleichzeitig auf Christen spucken und sie als Ungläubige beschimpfen.“
„Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Dingen“, gab Joey zurück. „Erstens ist es völlig unnötig, von Einwanderern zu verlangen, dass sie sich den zentralen Werten unserer Gesellschaft unterordnen. Wegen dieser Werte kommen sie ja hierher. Sie werden diese Werte von sich aus ehren. Dabei müssen wir sie unterstützen. Unterordnung hatten sie dort, wo sie herkommen. Unsere Werte verlangen keine Unterordnung, sondern Toleranz und Respekt. Da hat mancher Einwanderer sicher noch Nachholbedarf – aber mancher Ansässige ebenfalls, der, wie Sie es getan haben, Professor, in schlichter Denkweise Unterordnung verlangt, als wären diese Menschen Bittsteller. Unterordnung worunter denn? Unter die Hegemonie einer weißen Führungselite, die schon im Umgang mit unseren afroamerikanischen Mitbürgern immer wieder zeigt, dass sie rassistisch ist? Haben Sie die neue Predigt von Referend Blake gehört? Christentum zuerst, Muslime raus …“
„Referend Blake spricht nicht für die Mehrheit in diesem Land.“
„Das ist richtig, er spricht nur für einen Teil der wiedererweckten Christen. Dies aber sehr laut.“
„Sie werden aber sicher nicht bestreiten, dass die Christen die älteren Rechte in diesem Land haben.“
Professor Connolly lächelte jovial. Phil war angespannt. In diese Falle durfte Joey nicht tappen.
„Die älteren Rechte in diesem Land haben zweifellos die Ureinwohner“, versetzte Joey, und Phil nickte zufrieden, „die Indianer. Sie wissen doch sicher, wie denen mitgespielt wurde? Manchmal täte es gut, sich in dieser Zeit des Zusammenpralls der Kulturen zu vergegenwärtigen, dass unsere gegenwärtige Situation keineswegs gottgegeben ist, sondern historisch gewachsen und mit Schuld beladen. Das würde vielleicht dazu führen, dass der eine oder andere Verfechter der gottgewollten amerikanischen Vorherrschaft etwas bescheidener aufträte.“
„Meinen Sie, Gouverneur“, schaltete sich William Perle ein, der Moderator des Streitgesprächs, „dass die USA in der Welt besser dastünden, wenn sie bescheidener aufträten?“
„Eine interessante Frage, William, und zwar vor allem, weil sie den Bogen schlägt vom täglichen Multikulti in unseren Städten und Gemeinden hin zur internationalen Politik. In dem Beharren auf der angeblichen Überlegenheit unserer Kultur – der Professor mag den Begriff ‚Herrenmenschenkultur‘ nicht, daher drücke ich es anders aus – liegt die Unterstellung der Minderwertigkeit anderer Kulturen. Es wird das Trennende betont, nicht das Gemeinsame, und das passiert täglich in unserem Land, es passiert aber auch täglich in unserer Außenpolitik. Ich glaube, dass diese Attitüde in den vergangenen Jahrzehnten nicht eben dazu beigetragen hat, die Welt sicherer zu machen. Im Gegenteil: Amerikanische Politik hat den Hass in der Welt angefacht. Wir empfinden andere Kulturen als bedrohlich, nicht als Bereicherung. Diese Haltung ist eines der größten Probleme amerikanischer Politik. Sie wurde unter anderem auch durch die Kommunikationspolitik dieses Hauses gefördert, dessen Gast ich heute Abend bin. Das AEI hat sich in dieser Hinsicht nicht mit Ruhm bekleckert.“
Phil grinste. Das hatte gesessen. Der Moderator war allerdings Profi, er verzog keine Miene.
Tatsächlich war das American Enterprise Institute seit mehr als fünfzig Jahre die tonangebende Denkfabrik der Konservativen. Sicher waren Positionen wie die, die Joey gerade vorgetragen hatte, auch früher schon in diesem Saal geäußert worden, denn man gab sich diskussionsfreudig, und dazu brauchte man Gegenpositionen. Aber gerne hörte man so etwas hier dennoch nicht. So spendeten auch nur wenige Zuschauer Applaus für Joeys Attacke. Die Atmosphäre war distanziert, der Kandidat hatte kaum Freunde hier, dafür aber vermutlich viele Gegner, die ihn hören wollten, um ihn besser einschätzen zu können. Unter den etwa 300 Menschen waren auch viele Journalisten. Vielleicht würden sie über die Rede berichten, die Joey vor der Diskussion gehalten hatte. Zum ersten Mal hatte er darin die Grundzüge dessen skizziert, was in der heißen Phase des Wahlkampfs als „Calderon-Doktrin“ in den Mittelpunkt der Botschaft gestellt werden sollte – ein Probelauf, der auf der Gettysburg-Rede aufbaute. Phil war nicht sicher, ob dieser Probelauf geglückt war. Die Rede war gut, doch das hiesige Publikum war nicht an den Stellen, die Phil dafür kalkuliert hatte, in Jubel ausgebrochen. Dieselbe Rede mochte vor Calderon-Anhängern eine völlig andere Wirkung entfalten. Genau darum war es richtig gewesen, diesen Probelauf ausgerechnet hier zu versuchen, auf gegnerischem Terrain. Phil hatte sich während des Vortrags einige Notizen gemacht und wusste, wo er noch feilen musste.
Vor Beginn der Veranstaltung hatte Phil einige seiner früheren Kommilitonen erblickt, die jetzt für Abgeordnete und Senatoren arbeiteten und als „Sonden“ unterwegs waren. Phil erkannte auch sechs Abgeordnete des Repräsentantenhauses, alle von der Demokratischen Partei. Außerdem war Senator Daniel Fullton aus Massachusetts gekommen – das einzige echte politische Schwergewicht außer Joey selbst heute Abend in diesem Saal. Fullton hatte schon oft dort oben auf dem Podium gesessen. Er unterstützte Joeys Kurs bei den Demokraten, unter denen es noch immer viele Zögerliche gab. Bis zum Nominierungsparteitag würde Joey einiges zu tun haben, die Partei auf seine Linie einzuschwören.
Von den Republikanern war niemand erschienen, aber Phil ging davon aus, dass auch Chris Kerry, der Kandidat der Gegenseite, Sonden im Publikum hatte.
„Sie meinen also, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn Amerika zu Kreuze kriecht?“, fragte Moderator Perle provozierend.
„Niemand wird zu Kreuze kriechen“, gab Joey zurück. „Wir werden selbstbewusst und aufrecht beginnen, eine neue internationale Friedensarchitektur zu schaffen, um die Welt sicherer zu machen. Wir werden gewiss die Gegensätze nicht aus den Augen verlieren, aber wir werden sie nicht länger in einer Weise betonen, die dazu angetan ist, die Gemeinsamkeiten zu verdecken, die es natürlich ebenfalls gibt.“
„Da haben wir ihn wieder, unseren allseits geschätzten John F. Kennedy“, sagte eine Stimme neben Phil in gedämpfter Lautstärke.
Phil zuckte zusammen. Er hatte in seiner Konzentration auf Joey Calderon nicht mitbekommen, dass sich ihm jemand genähert hatte.
„Cory! Du hier?“
„Was für eine Frage“, gab Cory Jackson zurück. „Ich wollte natürlich die Rede deines Brötchengebers hören. Nicht schlecht, aber auch nicht besonders originell. Dein Werk, oder? Aber immerzu diese JFK-Schiene! Kannst du den Leuten in deinem Team mal erklären, wie langweilig das ist? Wenn ich beim AEI etwas zu sagen hätte, dann hätte ich deinem Calderon einen etwas weniger langweiligen Gegner gegeben. Connolly ist … nun ja, ein wenig eingerostet.“
Es dauerte einige Sekunden, bis Phil begriff, was Cory ihm indirekt sagen wollte.
„Du arbeitest für Kerry?“
Sie hatten mehrere Semester gemeinsam studiert und waren sich in herzlicher Abneigung verbunden. Immerhin waren sie gemeinsam zu Auslandssemestern nach Paris gezogen. Cory hielt Phil für einen Privilegierten, dem die Früchte wegen seiner Herkunft von allein in den Mund flogen. Darum hatte er sich gern an Phil gehängt in der Hoffnung, dass seine Karriere Impulse bekam. Er stammte aus einer armen Familie aus dem Mittleren Westen und hatte hart fürs College gearbeitet.
„Du hattest schon immer eine rasche Auffassungsgabe“, gab Cory mit sanftem Spott zurück. „Ja, ich bin heute Abend hier, um mir deinen Herrn anzusehen, und da dachte ich, sag doch mal guten Tag beim lieben Phil ...“
„Wollen wir nachher was trinken gehen?“
„Lass uns auf Abstand achten. Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich mich auf unsere TV-Duelle freue. Ich hoffe, dass dein Herr noch lebt, wenn es so weit ist.“
Phil zuckte zusammen. Klang da eine Drohung mit?
Cory merkte selbst, dass er sich im Ton vergriffen hatte, und fügte eilig hinzu:
„Nicht dass ich das wünschen würde. Ich habe gelesen, dass Calderon täglich Morddrohungen bekommt. Er ist ein mutiger Mann, wenn er seinen Kurs trotzdem weiter fährt. Mutig und dumm.“
Phil kniff die Lippen zusammen. Cory versuchte ihn auszuhorchen?
„Dein Calderon polarisiert ganz schön“, fuhr Cory fort. „Wir werden einen echten Richtungswahlkampf haben. Das hat es lange nicht gegeben.“
„Ich glaube nicht, dass Kerry es mit Calderon so leicht haben wird wie du mit mir im Debattierclub“, gab Phil zurück und brachte sogar ein offenherziges Lächeln zustande. „Calderon ist ein exzellenter Redner, wenn er in der richtigen Stimmung ist.“
„Dann hoffe ich, dass er zur richtigen Zeit in dieser Stimmung ist“, versetzte Cory. „Einfach wird es nicht. Hast du die Nachricht schon gehört?“
„Welche Nachricht?“
Statt einer Antwort zeigte Cory ihm das Display seines Handys. Die Eilmeldung lautete:
„Ellen Parker als Kandidatin der Grünen für die Präsidentschaftswahl nominiert.“
Zum Glück war es dunkel im Saal, so dass Cory nicht sehen konnte, dass Phil erbleichte.
“Hammer-Nachricht, was?“, sagte Cory. „Parker sind drei bis vier Prozent zuzutrauen, die sie deinem Calderon wegnehmen wird. Wie anno 2000, als Ralph Nader Al Gore die entscheidenden Stimmen zum Sieg über George W. Bush weggeschnappt hat. Geschichte wiederholt sich eben manchmal doch.“
„Wir werden sehen“, gab Phil schmallippig zurück. „Entschuldige bitte. Ich muss telefonieren.“
„Das kann ich mir vorstellen. Wir sehen uns!“
Aufgeregt verließ Phil das Auditorium und wählte Nicoles Nummer. Sie schien seinen Anruf schon erwartet zu haben.
„Hatten wir Parker im Fokus?“, fragte er.
„Nicht wirklich“, antwortete Nicole.
„Eine Kandidatur zu einem derart späten Zeitpunkt?“
„Du bist nicht der Einzige, der da eine Intrige wittert“, gab Nicole zurück. „Randy meint, dass die Sache eingefädelt wurde, um Joey den Wahlsieg zu nehmen.“
Seattle
Gianfranco Demonti kam gewissermaßen direkt aus dem OP, wo ihm eine Kugel aus dem Oberschenkel entfernt worden war. Danach hatte man ihn für einen Tag zur Beobachtung im Krankenhaus behalten, natürlich unter strengster Bewachung, ehe er heute dem Seattle Police Department überstellt worden war. Nun saß er am Tisch im Verhörzimmer den Detectives Marc Johnson und Jeff Alford gegenüber. Er wirkte nicht im Geringsten verunsichert, sondern schien sich für den Herrn des Verfahrens zu halten.
„Harvey Walsh wurde mit Ihrer Waffe erschossen“, sagte Marc und deutete auf eine Mappe, die vor ihm auf dem Tisch lag. „Das ist das eindeutige Ergebnis der ballistischen Untersuchung. Am Abzug der Waffe finden sich Ihre Fingerabdrücke. Sie sind der letzte, der damit geschossen hat. Mr. Demonti, der Staat Washington wird Anklage gegen Sie erheben wegen des Mordes an Professor Harvey Walsh.“
Demonti zuckte mit den Schultern und sagte:
„Wenn Sie meinen …“
„Sie wollen dazu nichts sagen?“, fragte Marc.
„Was wünschen Sie denn zu hören?“
„Ein Geständnis wäre nicht schlecht“, gab Marc zurück. „Das wäre absolut in Ihrem Sinn, denn unsere Gerichte werten Geständnisse gern strafmindernd.“
„Sie haben immer noch nicht verstanden, was hier vor sich geht, oder?“, versetzte Demonti, weiterhin äußerlich ungerührt, aber ein leichtes Zittern seiner Stimme verriet, dass er emotional nicht ganz so unbeteiligt war, wie er zu sein vorgab.
„Was geht hier also vor? Erklären Sie es mir!“
„Nationale Sicherheit!“
„Es ist also im Sinn der nationalen Sicherheit“, hakte Marc sofort nach, „dass Sie einen Pathologen erschießen, der für die Polizeibehörden des Staates Washington täglich seinen Beitrag zur nationalen Sicherheit geleistet hat?“
Demonti schwieg.
„Es ist im Sinne der nationalen Sicherheit, dass Sie den Mord, den Sie begangen haben, einem unbeteiligten Studenten in die Schuhe schieben? Dass Sie die Leiche von Samuel McWeir aus dem Forensischen Institut entwenden, um sie schnellstmöglich einäschern zu lassen? Es war also wohl auch im Sinn der nationalen Sicherheit, dass Sie einen Seuchenalarm löschen, der zur Sicherheit der Bevölkerung ausgelöst wurde?“
Demonti zeigte mit keiner Regung, ob ihn Marcs Aufzählung beeindruckte.
„Was ist das für ein Krankheitserreger, dessen Auftauchen Sie mit Ihrer Aktion vertuschen wollten? Was hat McWeir damit zu tun? Warum hat Michael Schwartz ihn umgebracht, ein Mann, der seit fast zwei Jahren vermisst wird?“
Als der Name Michael Schwartz fiel, zuckte Demonti kaum merklich zusammen. Marc hatte den Eindruck, dicht dran zu sein an der Erklärung für das Durcheinander – denn auch wenn der Mord an Harvey Walsh als aufgeklärt gelten konnte, fehlte doch noch etwas Wichtiges: das Motiv. Allein mit nationaler Sicherheit war Marc nicht zufrieden. Es steckte mehr dahinter, Konkreteres.
„Ja, wir wissen von Michael Schwartz“, setzte er nach, „dem Sohn des Senators Philipp Schwartz.“